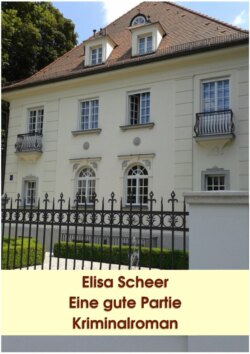Читать книгу Eine gute Partie - Elisa Scheer - Страница 3
Kapitel 1
ОглавлениеUnlustig schaute ich in meinen Kleiderschrank. Was sollte ich bloß anziehen? Ewige Frage aller Frauen, so sagte man – aber normalerweise hatte ich damit überhaupt keine Probleme, nur heute Abend.
Dieses dämliche Firmenfest! Wieso musste ich da überhaupt hin? Bloß weil Papa sich bei der Geschäftsleitung einschleimen wollte? Mama sollte sich besser schonen, Tobi würde sich sicher wieder vor den Jungsekretärinnen wichtigmachen und trotzdem zu nichts kommen, und ich vertat meine Zeit und tanzte notgedrungen mit dicklichen alten Kerlen, die mir erzählten, dass ihre Ehen schon lange nur noch auf dem Papier bestanden. Nur damit Papa den glücklichen und soliden Familienvater spielen konnte!
Papa und solide, da lachten ja die Hühner.
Wie wollte ich denn überhaupt auftreten? Alle meine Abendklamotten waren Verkleidungen. Ich konnte das brave Töchterchen spielen, die Freude ihrer Eltern, naiv und harmlos: das rosa-weiß geblümte Georgettekleid mit dem aufgebogenen doppelten Saum, das trotz der Spaghettiträger züchtig und mädchenhaft wirkte. Damit sah ich aus wie achtzehn; vielleicht lag es daran, dass das Kleid tatsächlich schon sechs Jahre alt war.
Hm... nein. Auf mädchenhaft stand ich heute Abend nicht so sehr. Außerdem war es dafür zu kalt. Das Graue? Ärmellos, Stehkragen, schillernde Rohseide, strenger Schnitt, der schmale Rock fast bis zur halben Wade. Dazu vielleicht eine Hornbrille mit Fensterglas? Die zielstrebige Studentin, die leicht unwirsch ihre Zeit auf der Weihnachtsparty von Pfeiffer, Gartengeräte für jeden Zweck, verplemperte, obwohl sie doch viel lieber ernsthafte Studien über die französischen Frühimpressionisten betrieben hätte. Keine schlechte Rolle, dazu gehörten ein leicht überhebliches Gesicht, die Vernissagen-Visage, kritische Kommentare und gezielte Unverschämtheiten, leicht verschleiert.
Oder die feministische Aktivistin? Die spielte ich selten, weil sie mir nicht so lag, ich hatte den theoretischen Jargon nicht besonders gut drauf. Aber das passende Outfit, handgewebtes violettes Leinen, solide Schuhe und eine Edelstahlbrosche in Form einer Schere! Mit diesem Schwanz-ab-Look käme ich heute leider nicht einmal bis zur Haustür, ohne dass Papa toben würde.
Nein, wenn ich schon mitging, musste ich dezenter subversiv sein. Anständiges Benehmen kam aber gar nicht in Frage, dann würde ich mich zu Tode langweilen. Ich musste etwas anstellen, aber was? Und in welcher Rolle?
Durch die weiß vergitterten Fenster meines Zimmers sah ich, dass es längst stockdunkel geworden war, es war sicher schon halb sechs. Und ich stand hier in der Unterwäsche herum! Cremefarben, immerhin passte das unter jedes Outfit. Wie wäre es mit der strengen jungen Adeligen? Dame von Welt, an nichts interessiert? Unangreifbar, körperlos, das lebende Benimmbuch? Und dann irgendeinen Eklat zünden? Für den Eklat hatte ich schon eine Idee, ich hatte eine Flasche extrascharfen russischen Wodka im Schrank. Wenn ich den in den unvermeidlichen Glühwein kippte, würde das Fest sich schnell entwickeln, wohin auch immer...
Lebendes Benimmbuch... das kleine Schwarze? Das kleine Schwarze war nie schlecht. Schmal geschnitten, fester Stoff, durch den sich nichts abzeichnete, diskreter V-Ausschnitt, mit winzigen grauen Perlen bestickt, Rocklänge bis knapp über dem Knie... Gut, dazu noch Strumpfhosen mit Seidenglanz und Wildlederpumps. Mit den Pumps überragte ich sicher die Mehrheit der eher kugelförmigen leitenden Angestellten, vielleicht würden sie sich dann nicht trauen, mich zum Tanzen aufzufordern.
Ich arbeitete mich vorsichtig in die Strumpfhose, zog mir das Kleid über den Kopf, bürstete mein überschulterlanges dunkelblondes Haar und steckte es zu einem strengen Nackenknoten fest. Nicht so lieblich wie Audrey Hepburn in Krieg und Frieden, aber auf jeden Fall etwas zwischen höherer Tochter und Zimtzicke.
Eine einreihige Perlenkette, bloß Zuchtperlen, etwas altmodisches Parfum. Keine Uhr, die Notwendigkeit, auf fremde, meist feiste und haarige Handgelenke gucken zu müssen, würde wieder einige Minuten totschlagen helfen.
Das schwarze Täschchen... Puderdose, Taschentuch (nie hatte ich diese albernen Stoffdinger mit Spitzenkante benutzt), Wodkafläschchen, Zigaretten und Zigarettenspitze – oder lieber nicht? Doch, warum nicht. Make-up? Nur dezente Grundierung, Puder, blassrosa Lippenstift, ein Hauch Wimperntusche. Perfekt. Ein irritierendes Detail wäre natürlich noch nett, etwa ein Nasenring oder ein großer Schönheitsfleck, aber das hätte ich mir früher überlegen müssen.
Weiße Handschuhe à la Grace Kelly? Nein, zu heftig. Und zu einem halblangen Kleid affig. Andererseits würde ich dann keine Fingerabdrücke auf der Wodkaflasche hinterlassen...
Achselzuckend wandte ich mich vom Spiegel ab und verließ mein Zimmer. Papa und Tobi warteten in der Eingangshalle, wie Papa und Mama unseren Flur mit den teuren, aber hässlichen Bauernschränken zu titulieren pflegten.
Papa im Smoking, Tobi auch. Tobi wurde fett, stellte ich fest, seine Hose saß verdammt stramm. Und der Kummerbund schillerte, war der etwa aus Pannesamt? Schauerlich! Außerdem hatte er zuviel Pomade verwendet und wieder dieses eklige Rasierwasser benutzt. Ich warf ihm naserümpfend einen Blick zu und hängte mir meinen Mantel um.
Papa holte Mama aus dem Schlafzimmer, wo sie wahrscheinlich genauso lange überlegt hatte wie ich, aber nicht, um eine möglichst amüsante Rolle zu spielen, sondern um einfach möglichst gut und vor allem jünger und gesund auszusehen. Sie war siebenundfünfzig und hatte ein angegriffenes Herz, aber an solchen Abenden wollte sie es noch einmal wissen.
Eigentlich traurig, dass Papa ihr dazu nichts Besseres bieten konnte als diese öden Firmenfeste!
Tobi musterte mich von der Seite, sagte aber nichts, bis ich ihn anfuhr: „Was ist?“
„Lahmarschig, das ist es!“
„Kann dir doch egal sein. Glaubst du, ich will so einen dicken, alten, verheirateten Kerl aufreißen?“
„Vielleicht gibt´s auch dünne, junge, unverheiratete?“
„Haha. Hab ich da noch nie gesehen. Selbst wenn, ich hab von Gartengeräten so die Schnauze voll, ich will keinen von dort.“
„Die haben einen neuen Chef.“
„Hach, wie aufregend“, höhnte ich.
„Könnte für Papa wichtig sein, dass du dich da kooperativ zeigst.“
„Vergiss es. Ich schleime für Papa bestimmt niemanden an, der soll seine Arbeit gefälligst selbst machen.“
„Das Gehalt reicht nicht.“
„Liegt das an mir? Ich verspiele nichts, im Gegenteil, ich jobbe noch nebenbei. Du bist das teure Kind, leg du dich doch zu dem neuen Chef ins Bett.“
Er packte mich am Arm, bis ich dicht vor ihm stand, und fauchte mich an: „Riskier nicht so eine große Klappe, Herzchen, du wirst schon noch tun, was Papa will!“
„Du säufst zu viel“, zischte ich zurück, „deine Nase ist schon ganz rot. Und für euch zwei tue ich bestimmt gar nichts.“
Sein Griff wurde noch fester, und ich überlegte, ob ich nachher einen schicken blauen Fleck am Arm haben würde. Keine schlechte Ergänzung meines Outfits – gepflegte höhere Tochter als Opfer häuslicher Gewalt? Familienabgründe in den feinen Straßen Leichings? Vielleicht würde ich Getuschel auslösen, das war fast besser als der Wodka im Glühwein.
Mama und Papa traten auf, und Tobias ließ mich los. Ich warf einen interessierten Blick auf meinen Arm – tatsächlich, eine deutliche Rötung. Ich verbarg sie hastig, indem ich in meinen Mantel schlüpfte, und machte Mama ein höfliches Kompliment zu ihrem weißen, bestickten Cocktailkleid, für das sie eigentlich etwas zu alt war.
In etwas verkniffenem Schweigen bestiegen wir Papas großen Mercedes, Tobi und ich wie immer auf dem Rücksitz. Ich zog wie immer sofort die Armlehne aus dem Polster, um die Grenze zu markieren.
Das Fest fand im Russischen Hof statt und war so organisiert wie in allen Jahren, seitdem Papa darauf bestand, mit seiner gesamten Familie teilzunehmen: kleine Tische, in der Mitte eine Tanzfläche, eine Zweimanncombo mit Akkordeon und Schlagzeug, die mehr schlecht als recht allgemein Bekanntes spielten und dazwischen peinliche Witzchen machten und die Gäste zum Mitklatschen und Refrainsingen aufforderten. An der Stirnseite ein Transparent, Pfeiffer Gartengeräte wünscht allen Mitarbeitern ein frohes Fest. Angenehm neutral, das hätte man notfalls auch für Ostern verwenden können. Das Transparent war an den Ecken schon ein bisschen ausgefranst, seit Jahren war es in Gebrauch.
Davor ein langer Tisch mit den üblichen Verdächtigen, Abgesandte des Vorstands der gesamten XP-Holding, in der neben Pfeiffer noch mindestens zehn weitere Firmen zusammengefasst waren. Der ominöse neue Chef war sicher der kleine Dicke, der sich die schwarzen Haare quer über die Glatze gelegt hatte und sein Smokingjackett nicht mehr zuknöpfen konnte.
Ehefrauen im besten Cocktailkleid, wenige lustlose Kinder um die zwanzig, die Damen aus dem Schreibpool in unterschiedlich stark aufgetakeltem Zustand, jüngere Sachbearbeiter mit Jagdfieber im Blick. Vor denen hatte ich wenig Angst, die kannte ich schon von den letzten Jahren, und da war ich bösartig genug gewesen.
Wozu schleifte Papa mich immer mit? Ich fiel ihm ja doch nur in den Rücken und benahm mich mit Freuden daneben. Vielleicht ging ich nur wegen Mama mit, die man nicht aufregen sollte, damit sie nicht keuchte und bläuliche Lippen bekam. Wegen Tobi tat ich es bestimmt nicht.
Papa fand den für uns reservierten Tisch, rückte uns Damen mit großer Geste die Stühle zurecht und bestellte eine Flasche Rotwein. Ich bat um Mineralwasser, fest entschlossen, heute die perfekte Zicke zu geben. Garantiert würde das ein furchtbarer Abend! Tobi steckte sich bereits eine Zigarette an, lehnte sich zurück und musterte die herumlaufenden Sekretärinnen und Sachbearbeiterinnen. Die hübschesten starrte er richtig widerlich an, als malte er sich ihre nackten Körper aus.
„Hast du Viagra eingeworfen?“, flüsterte ich ihm angeekelt zu. „Du sabberst ja schon, du Lustmolch.“
„Viagra hab ich nicht nötig. Weiß Gott nicht!“
„Gott wird das egal sein.“
„Nur kein Neid. Bloß weil du nie einen findest, der´s dir richtig besorgt, muss ich ja wohl nicht auf allen Spaß verzichten“, zischte er zurück.
„Streitet euch nicht, Kinder“, mahnte Mama milde und hielt eine Hand auf ihr Herz gepresst.
„Fühlst du dich nicht gut?“, fragte ich sofort alarmiert. Eigentlich waren solche Veranstaltungen nicht gut für sie, aber sie liebte es doch so, zu zeigen, dass sie noch jung und schön war. Schön war sie wirklich, sie hatte so feine Gesichtszüge und ungewöhnlich große, hellblaue Augen. Die Falten drumherum waren mit Ende fünfzig ja wohl keine Schande!
Leider hatten wir beide ihr Gesicht nicht geerbt, und ihre Augen auch nicht; Tobias und ich hatten beide Papas härtere Züge und seine normalgroßen, eher grünlichen Augen. Immerhin hatte ich nicht so feiste Bäckchen wie Tobi – er aß und trank eindeutig zuviel. Und er rauchte zuviel, das war schon die zweite! Der Qualm war sicher auch nichts für Mamas Kreislauf.
Mama wehrte matt, aber anmutig ab. „Lass nur, Kind, es geht mir gut. Ich habe mich doch so auf den heutigen Abend gefreut.“
„Warum eigentlich?“, fragte ich etwas bockig zurück, „Das ist doch immer das Gleiche, schlechter Wein, schlechte Musik, schräges Publikum.“
„Schräg?“ Papa setzte sich steif auf. „Was soll das heißen, Nathalie? Das sind meine geschätzten Kollegen und die Herren vom Aufsichtsrat der Holding, und irgendwo muss auch dieser neue Mann sein, der jetzt die Aktienmehrheit – der dahinten wahrscheinlich, der schwarzhaarige Kleine. Den kenne ich noch nicht. Das sind alles sehr korrekte Herren, also pass gefälligst auf, was du sagst! Du lebst nicht schlecht von der Firma Pfeiffer!"
Gar nicht wahr, dachte ich rebellisch, ich wohnte doch bloß noch zu Hause, aber ich verdiente mein Geld selbst und kümmerte mich obendrein um den Haushalt. Wenn ich auszöge, würde Papa gar nichts sparen.
Ich zog es aber vor, nicht zu antworten, weil sich sonst wieder ein endloser Streit entspinnen würde. Klar war der Abend langweilig, aber durch Papas Gezanke würde er auch nicht viel spannender. Eine der Mumien aus dem Aufsichtsrat erklärte das Fest für eröffnet, nachdem er eine mäßig komische, aber dankenswerterweise kurze Rede gehalten hatte.
Sobald sich die Massen am Buffet zu drängen begannen, stand ich auf und schlenderte durch die Räume, um sowohl dem plastikartigen Essen, das Papa wieder anschleppen würde, als auch den bald zu erwartenden dickbäuchigen und kahlköpfigen Tänzern zu entgehen. Fast eine Stunde lang saß ich in einem Vorraum auf einem kalten Marmorfensterbrett, halb von einem riesigen Ficus verdeckt, und hoffte, dass mich niemand nerven würde.
Schließlich rutschte ich doch, gründlich durchgekühlt, wieder vom Fensterbrett und kehrte in den Saal zurück. Ein, zwei Runden, dann konnte ich mich für längere Zeit aufs Klo zurückziehen... Die Menge tanzte. Den Schnee-Schneewalzer, -walzer tanzen wir... Ausgerechnet! Ich nahm mir ein Glas Wasser, sah mich verächtlich um und verzog mich in eine Nische, wo ich sehen, aber kaum gesehen werden konnte. Dort präparierte ich meine Zigarettenspitze, zündete die Zigarette an, verkniff mir den Husten und hielt die Spitze dann dekorativ in der Hand.
Grässliches Volk, wie immer. Papa redete eifrig auf Mama ein. Tobi tanzte mit einer Rothaarigen in einem silbernen Kleid. Ob sie wusste, wie dünn und entlarvend der Stoff war? Ich jedenfalls sah von hinten, dass sie darunter nur einen String trug, und dass das Gummi dieses Strings genau über ihrem Hintern mit einem Zierblümchen besetzt war, das sich sehr aufdringlich durch den Stretchstoff drückte. Wenig elegant, es sah fast etwas nuttig aus. Dann hätte sie ja zu Tobi gepasst, aber mir tat sie doch Leid, sicher hatte sie sich einfach nicht von hinten betrachtet. Tobi fummelte, und sie ließ es sich gefallen, wirkte aber nicht unbedingt glücklich.
Daneben der neue Obermotz mit den schwarzen quer gelegten Strähnen. Seine Tänzerin war einen guten Kopf größer als er und zog ein Gesicht, als könne sie nur beten, dass sie hier niemand von ihren Bekannten erwischte. Konnte ich gut verstehen... Und Papa würde sicher finden, die Höflichkeit gebiete es, mit diesem verschwitzten Zwerg zu tanzen! Höflichkeit! Um Papas Job zu retten? So toll war er als Geschäftsführer von Pfeiffer wohl auch nicht, wenn er das nötig hatte! Er war ohnehin bald reif für die Rente, wenn er sich auch absolut nicht so benahm.
Gelangweilt ließ ich meinen Blick weiter über die herumschiebende Menge schweifen. Alle uninteressant. Und die Zigarette schmeckte scheußlich. Immerhin war der Glühweintopf im Moment verlassen, also stellte ich mich so davor, dass ich ihn gegen die Leute abschirmte, praktizierte das Fläschchen aus der Tasche und leerte es hinein. Sollte hier wirklich jemand keinen Alkohol trinken dürfen, musste er von diesem Zeug ohnehin die Finger lassen, und die anderen würden sich umso schneller als die Idioten outen, die sie auch waren. Als die Flasche wieder sicher in meiner Tasche steckte, musterte ich noch einen Moment lang das Buffet, entschied mich schließlich für ein Scheibchen Baguette und knabberte, nun wieder mit dem Gesicht zum Publikum, daran herum.
Mein Blick fiel auf einen Mann, der mich beobachtete. Ich starrte zurück. Unhöflich, ja, aber ich hatte noch nie solche Augen gesehen. Auf die Distanz wirkten sie, als hätte er keine Iris, so hell waren sie. Vielleicht ein Blinder? Nein, er sah mich, das war klar. Nicht hässlich, vor allem im Vergleich zum sonstigen Angebot, groß, schlank, gut gekleidet. Das war an einem solchen Abend zwar nichts Weltbewegendes, aber sein Smoking saß wenigstens. Dunkelblonde Haare, wie meine, gut geschnitten. Kein Bart; warum manche Kerle es für nötig hielten, eine Bürste im Gesicht spazieren zu tragen, hatte ich noch nie verstanden. Um zu zeigen, dass sie es konnten? Dass sie über Testosteron verfügten? Das merkte man auch schon am schlechten Benehmen.
Ein kräftiges Kinn und eine vorspringende, schmale und lange Nase. Gut, in einer Schar Models wäre er untergegangen, aber für Pfeiffersche Verhältnisse war er ein Halbgott. Ich riss meinen Blick los, als ich merkte, wie unhöflich ich glotzte – aber er glotzte auch. Himmel, und jetzt setzte er sich auch noch in Bewegung! O nein, auch wenn er das relativ kleinste Übel im Saale war – den brauchte ich jetzt wirklich nicht!
Wohin? Ganz klar, vollkommen sicher war ich auf der Damentoilette. Ich sperrte mich in einer der Kabinen ein und sank auf den Deckel. Warum hatte ich ihn so angestarrt? Und warum er mich? Hätte ich den irgendwoher kennen müssen? Mir fiel nichts ein, aber dann kam mir eine eher unangenehme Erklärung: Er hatte gesehen, wie ich den Wodka in den Glühwein gekippt hatte, und wollte mich fragen, was der Blödsinn sollte.
Mist! Den ganzen Abend wollte ich hier auch nicht verbringen; das Klo war zwar gepflegt, aber es roch doch ein bisschen nach Urin und verdammt stark nach Haarspray – nach dem extrafeinen Nebel mit dem extra starken Halt, der vorzugsweise für graublau getönte Dauerwellen verwendet wurde. Und irgendjemand hatte sich gründlich mit einem stark vanillehaltigen Parfum eingesprüht – ein Duft wie in einer Puddingschüssel.
Nein, lange konnte ich hier nicht bleiben; ich wartete, bis eine der älteren Damen mit blau gesprayter Frisur aus einer Kabine kam, mir einen irritierten Blick zuwarf, sich die Hände wusch und die Toiletten verließ; durch die aufschwingende Tür sah ich den seltsamen Menschen mit den hellen, kalten Augen nicht mehr, also riskierte ich es und schlich in den Saal zurück. Hinter einigen strategisch platzierten Palmen gesellte ich mich zu drei jungen Frauen in paillettenbesetzten Cocktailkleidern, die sich über einen eher zudringlichen Tänzer ausließen. Ich hörte zu und freute mich, als ich merkte, dass es um Tobi ging, war aber zu faul, sie noch weiter anzufeuern. Schließlich schlenderte ich weiter und sah in einem wandgroßen Spiegel, wie prachtvoll der Bluterguss an meinem Arm aufgeblüht war. Tobi, das Schwein! Bei Gelegenheit würde ich ihm etwas antun, aber etwas Besseres, als bloß die Mädchen hier vor ihm zu warnen, schließlich outete er sich selbst schnell genug als Drecksack.
Ich zog mich wieder auf ein Fensterbrett zurück, nachdem ich mir noch ein Glas Wasser geholt hatte. Papa tanzte mit seiner Sekretärin, die mäßig begeistert dreinsah, Mama unterhielt sich mit einer Frau am Nachbartisch, Tobi versuchte vergeblich bei einer Blonden in extrem kurzem blauen Kleid zu landen und fasste ihr doch tatsächlich unter den Rock! Prompt trug ihm das eine Ohrfeige ein, die mich grinsen ließ.
„Warum sind Sie vorhin weggelaufen?“
Ich erschrak so, dass ich mir das Wasser über das Kleid kippte.
„Oh, das tut mir aber Leid – hoffentlich gibt das keine Flecken?“
„Nein, das war bloß Wasser, keine Sorge.“
Sollte ich mich jetzt vorstellen? Der war vielleicht etwas Höheres und Wichtiges, und ich bloß eine unfreiwillig anwesende Tochter. Oder der Herr zuerst? Und wenn ich jetzt was sagte, hörte sich das dann an, als sei ich irgendwie interessiert? Scheiß-Image, hier kannte mich doch eh keiner.
„Ich heiße Roth“, sagte ich also höflich. Er nickte, stellte sich selbst aber nicht vor.
„Wie gefällt es Ihnen?“
„Das dürfen Sie mich nicht fragen“, brummte ich, „ich bin absolut nicht aus freien Stücken hier.“
„Wie kann man jemanden dazu nötigen?“
„Mit der Drohung, dass es ansonsten zu Hause wochenlang Stunk gibt, ist das ganz einfach“, antwortete ich achselzuckend. „Aber immerhin ist es schon halb elf, und damit ist ein Ende absehbar.“
„Was finden Sie denn so furchtbar?“
Kurz schoss mir der alte Witz durch den Kopf, wo jemand den Gastgeber fragt, ob er die Party auch so langweilig findet. Das wäre natürlich das Gröbste, aber so etwas passierte wirklich nur in Die tausend ältesten Partywitze, einschlägig illustriert. Tobi hatte so etwas, und dem Gesicht seiner Partnerin zufolge quälte er sie gerade mit Kostproben. Witze erzählen konnte er auch nicht.
„Alles“, gestand ich, „die Musik, die Vorstellung, mit einem dieser Scheintoten Walzer neben dem Takt zu tanzen, ich mag keinen Glühwein, habe keinen Hunger und müsste dringend eine Arbeit über die frühen Werke Monets schreiben, anstatt hier herumzusitzen.“
„Glühwein mag ich auch nicht, aber er scheint großen Zuspruch zu finden. Übrigens kann ich Walzer im Takt tanzen. Wollen Sie´s riskieren?“
Ich seufzte und rutschte vom Fensterbrett. „Na gut. Dann muss ich nachher wenigstens nicht lügen, wenn Papa mich ins Kreuzverhör nimmt.“
Ergeben folgte ich ihm auf die Tanzfläche. Immerhin war das jetzt ein Straußwalzer – und er konnte es wirklich. „Sie studieren also Kunstgeschichte?“
„Ja.“
„Und was wollen Sie später damit machen? Ich meine, sind die Aussichten gut?“
„Miserabel“, bekannte ich, „aber irgendetwas werde ich schon finden, Auktionshaus, Galerie, Museum, Volkshochschule, Hauptsache, ich kann davon leben.“
Das Paar neben uns rempelte uns an; der Mann entschuldigte sich nuschelnd. „Oh- t-tut mir L-leid, m-muss der Glühwein s-sch-sein. S-supersüffig!“
Ich grinste in mich hinein, wenn ich auch nicht verstand, warum sich der Suffkopp eine so wortreiche Entschuldigung abgequält hatte, wo ihm das Sprechen doch schon so schwer fiel.
„Wo wären Sie jetzt lieber?“, fing mein Tanzpartner wieder an. Ich zuckte die Achseln. „Im Moment ist es auszuhalten. Prinzipiell? Zu Hause am Schreibtisch, oder auf einem schönen langen Nachtspaziergang...“
„Bei der Kälte?“
„Ich studiere zwar brotlose Künste, aber für einen Wintermantel hat es schon noch gereicht.“
„Wenn Sie noch studieren, werden ja wohl Ihre Eltern für den warmen Mantel gesorgt haben, oder?“
„Natürlich nicht. Ich wohne zwar notgedrungen noch bei meinen Eltern, aber ich jobbe natürlich nebenbei, um unabhängig zu sein. Sehe ich so verzogen aus?“
„Keineswegs.“ Er zog mich in eine schwungvolle Drehung, ich kam aus dem Takt und trat ihm auf den Fuß. „Macht doch nichts“, wehrte er ab, als ich mich entschuldigen wollte. „Wissen Sie was? Ich fand das Fest auch blöde, bis ich Sie gesehen habe. Man sollte es vielleicht anders gestalten.“
„Was würde Ihnen vorschweben?“ Den Gefallen, auf seinen ersten Satz einzugehen, würde ich ihm nicht tun! „Etwas Programm vielleicht, ein Motto... vielleicht Kostüme. Keinesfalls Glühwein, den scheinen noch mehr Leute nicht zu vertragen.“ Er wies mit dem Kinn auf einen der Tische, auf dem ein Paar gerade eine Art Ententanz zum Besten zu geben versuchte, nach den ersten Schritten aber herunterfiel und das Tischtuch samt allem, was darauf gestanden hatte, mit zu Boden riss. Das Geschepper unterbrach alle Gespräche und die Musik, da auch die unsägliche Zweimanncombo glotzte. Ich nutzte die Gelegenheit. „Ich glaube, ich muss mich ohnehin mal wieder bei meinen Eltern sehen lassen. Vielen Dank für den Tanz!“
Damit drängte ich mich durch die Menge, ohne mich noch einmal umzusehen. Mama saß alleine am Tisch und wirkte müde.
„Möchtest du nicht langsam nach Hause?“
Sie nickte. „Es tut mir Leid, wenn ich dich um dein Vergnügen bringe, aber fühle mich wirklich nicht besonders. Der Rauch... und der Lärm... Suchst du bitte Papa und entschuldigst uns?“
Also drängte ich mich weiter durch die Mengen, fand Papa, der viel zu eng mit einem recht minderjährig wirkenden Girlie tanzte, klopfte ihm auf die Schulter und schrie ihm ins Ohr: „Ich bringe Mama heim, wir nehmen uns ein Taxi, okay?“
„Muss das sein? Was das wieder kostet!“
„Das zahl doch sowieso ich, also jammere nicht rum. Ist das da nicht Unzucht mit Abhängigen?“
„Werd bloß nicht frech!“
Ich prustete durch die Nase und ging wieder. Bis ich Mamas und meinen Mantel ergattert, Mama in ihren Pelz geholfen, meinen Mantel umgehängt, unsere Taschen genommen, Mama nach draußen geleitet, ein Taxi herangewunken und Mama auf dem Rücksitz verstaut hatte, war es fast zwölf. Erleichtert sagte ich zum Fahrer: „Leiching, Zollhausweg“, und lehnte mich zurück. Wieder für ein Jahr geschafft! Und nächstes Jahr würde ich auf jeden Fall eine Ausrede haben... Notfalls eine Exkursion!
Ich half Mama noch beim Zubettgehen, küsste sie auf die Stirn und verzog mich in mein Zimmer. Was lag morgen an? Zwei Vorlesungen, ein Seminar, nachmittags eine Führung und am frühen Abend zwei Stunden Forschungsgruppe. Vor neun käme ich nicht nach Hause, ausgezeichnet!
Ich zog mich aus, hängte das Kleid sorgfältig auf, warf alles andere in die Schmutzwäsche, schlüpfte in meinen Pyjama und ging mich waschen und abschminken. Dass ich mit Tobi ein Bad teilen musste, war absolut furchtbar, man konnte wirklich nichts im Bad stehen lassen, ohne dass er es verbrauchte, ausgoss oder von der Konsole fegte, um Platz für seine Schönheitsmittelchen zu haben. Als ob die bei ihm noch was geholfen hätten!
Also hatte ich schon vor Längerem zum altbewährten Kulturbeutel gegriffen; sogar meine Handtücher hängte ich hinterher in meinem Zimmer auf, das ich stets sorgfältig abschloss. Und mein Rechner war mit einem nicht knackbaren Code gesichert, seitdem Tobi mal auf meine Kosten zu diversen Pornoseiten gesurft war und vergessen hatte, sie in der Favoritenliste wieder zu löschen. Zu allem zu blöde! Studierter Betriebswirt, schicke Praktika in schicken Firmen, aber nicht genug Raffinesse, dabei Beziehungen aufzubauen und so eine Stellung zu ergattern.
Also lag er unseren Eltern auf der Tasche. Mama pflegte nur zu seufzen, Papa fand, dass Tobi sich nicht wegwerfen sollte und deshalb ruhig auf das wirklich tolle Angebot warten könnte. Mein Vorschlag, er könnte doch wenigstens jobben, war verächtlich abgetan worden. Tobi bekam von Papa fünfzehnhundert Mark im Monat, als Taschengeld, außerdem Kost und Logis nebst Wäscheservice frei - und er finanzierte ihm sein Cabrio.
Ich fuhr mit dem Bus – außer, wenn ich den Wocheneinkauf machte, dann durfte ich Mamas Golf nehmen, bekam überhaupt kein Taschengeld und aß auf eigene Rechnung in der Nähe der Uni. Zum Dank wurde ich als frech und undankbar beschimpft und Tobi wurde mir als Vorbild hingestellt. Papa war wirklich unmöglich! Aber nächstes Jahr, wenn ich fertig war, dann war Schluss mit den Blödeljobs, dann wurde richtig gearbeitet, egal, was. Hauptsache, von acht bis fünf und so viel Geld, dass es für ein kleines Appartement reichte. Ich sparte schon wie verrückt, aber weder das Museum noch die Forschungsgruppe zahlten besonders gut. Und der eine Nachmittag an der Supermarktkasse – naja, ein Nachmittag brachte einfach nicht genug.
Der Typ heute war seltsam gewesen. Fragte mich da einfach aus, ohne sich vorzustellen. Gut, er konnte Walzer tanzen, aber das half einem im täglichen Leben auch nicht weiter. Sicher irgendein Sachbearbeiter, der im Smokingverleih Glück gehabt hatte! Immerhin hatte er einen Rest von Stil bewiesen und mich nicht angeödet, dass er mich wiedersehen oder anrufen wollte. Das hätte mir gerade noch gefehlt! Allerdings – diese komischen Augen hätte ich mir noch mal aus der Nähe ansehen wollen. Naja, zu spät, auch egal.
Außerdem hatte ich morgen ordentlich zu tun und sollte jetzt lieber schlafen.
Papa und Tobi kamen gegen halb vier Uhr morgens nach Hause und machten reichlich Krach dabei. Sicher hatten sie dem Glühwein nicht widerstehen können – und hoffentlich hatten sie morgen einen Granatenschädel! Mit diesem erhebenden Gedanken drehte ich mich noch einmal im Bett um.
Um sechs stand ich auf, sicher, dass ich das Bad für mich hatte, duschte genüsslich, zog mich so an, dass es den ganzen Tag passte – dunkelblaue Jeans, blassrosa Rollkragenpullover, blaues Tweedsakko, packte meinen Unikram ein, kontrollierte, ob mein Zimmer aufgeräumt und Tobi-sicher verschlossen war, und verließ das Haus gegen sieben Uhr. Zu früh für alles, aber ich sah nicht ein, dass ich auch noch das Frühstück vorbereiten sollte. Mama blieb morgens ohnehin im Bett, und die beiden Suffköppe sollten eben ein Weißbier trinken. Als ich an der Uni aus der U-Bahn stieg, kaufte ich mir am Backshop-Stand zwei Brezen. Das musste reichen! Wasser gab es in allen Unitoiletten, und einen Becher hatte ich dabei.
Um acht saß ich satt und zufrieden im Hörsaal und schrieb fleißig mit – Bauhausarchitektur, Dekoration und Malerei der Neuen Sachlichkeit, sehr interessant, und es wurden auch ziemlich anständige Kopien ausgeteilt. Nach zwei Stunden tat mir die Hand weh; ich packte ein und eilte ins kunstgeschichtliche Seminar, eine alte Villa am Anfang der Graf-Tassilo-Straße. Wieder zwei Stunden, Theoretische Grundlagen des Kubismus. Mein Referat hatte ich schon gehalten, unser Gruppenprojekt war auch schon erledigt, also genügte es, ein bisschen mitzudiskutieren, um in den Augen des Professors als „viel versprechend“ zu gelten, schließlich wollte ich bei ihm meinen Magister machen.
Zwischendurch schrieb ich mir mit Irina und Bea, meinen Gruppengefährtinnen, Zettelchen. Sie wollten hinterher Pizza essen gehen, aber ich hatte noch eine Vorlesung – Pieter Paul Rubens und seine Zeit. Und zu geizig für eine Pizza war ich auch!
Warum gar so eifrig?, stand auf dem nächsten Zettelchen. Ich will ja mal fertig werden, schrieb ich zurück, sobald der Professor wieder mit dem Kursschleimer in einer verbissenen Diskussion feststeckte. Nächste Woche Ratlos?
Gut, du Streberin, schrieb Irina zurück. Ich wollte den beiden nicht erzählen, wie es bei uns zu Hause aussah und warum ich dringend ausziehen wollte, sobald das Geld ausreichte. Immerhin schienen sie jetzt zufrieden zu sein.
Überhaupt erzählte ich nicht gerne von mir, wenn ich ehrlich war. Die einzige, die wusste, wie es bei uns manchmal zuging, war Esther, meine Freundin seit Schultagen – aber sie studierte, begabt wie sie war, in Cambridge. Musste sie nicht langsam fertig sein und zurückkommen? Ich sollte ihre Eltern vielleicht mal anrufen... Sobald ich die entsprechende Notiz an den Rand meiner Seminarnotizen gekritzelt hatte, passte ich wieder etwas auf und erweckte den gebotenen viel versprechenden Eindruck. Der Professor reagierte offensichtlich angetan, und ich beschloss, ihn gleich heute auf ein Magisterthema festzunageln – im achten Semester wurde es langsam auch Zeit, fand ich.
Während Irina und Bea bei einer Zigarette mit den wenigen vorzeigbaren männlichen Kunstgeschichtlern auf dem Gang standen und die üblichen Balzrituale vollführten, trug ich dem Professor mein Anliegen vor. Er nickte ernst und bat mich für nächsten Donnerstag in seine Sprechstunde, bis dahin sei ihm sicher etwas eingefallen. Jahrhundertwende sei doch mein Interessenschwerpunkt, nun, da gebe es ja Hunderte von Malern und Graphikern, deren Werk einmal grundlegend gesichtet und nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten bewertet und eingeordnet werden müsste, wahre Desiderate gebe es da, nur auf Anhieb falle ihm leider keins ein, aber unmittelbar vor den Weihnachtstagen sei das wohl auch nicht so dringend, nicht wahr, aber selbstverständlich werde er sich intensiv Gedanken machen und mir in der Sprechstunde sicher attraktive Angebote machen können.
Etwas atemlos hielt er inne, und ich betrachtete ihn milde erstaunt. Wieso so aufgeregt? Wäre ich dann seine erste Magisterkandidatin? So jung war er doch gar nicht mehr? Sonst redete er doch auch nicht so viel und so planlos? Ich notierte mir brav den Termin, wünschte ein frohes Fest (nichts war mir gleichgültiger als dieses bescheuerte Weihnachten) und gesellte mich, innerlich den Kopf schüttelnd, zu Irina und Bea.
„Was wollte er denn?“, fragte Bea. „Er nichts – oder wenn, dann hab ich´s nicht verstanden. Ich wollte ein Magisterthema.“
„Jetzt schon? Himmel, im achten Semester! Wann hast du eigentlich Spaß?“
„Spaß gönne ich mir, wenn ich hier fertig bin und auf eigenen Füßen stehe. Geht ihr jetzt Pizza essen? Viel Vergnügen und guten Appetit!“ Ich winkte ihnen freundlich und den ziegenbärtigen Clowns bei ihnen flüchtig zu und machte mich wieder auf den Weg ins Hautgebäude, Rubens rief.
Es war gar nicht so einfach, wach zu bleiben, wenn man zu wenig geschlafen hatte und ausgerechnet von zwölf bis zwei in einem verdunkelten Hörsaal unscharf eingestellte Dias betrachten sollte. Mühsam schrieb ich mit, ohne etwas zu sehen, und hoffte das Beste; dazwischen zwickte ich mich und lutschte ein uraltes Pfefferminz, das ich in meiner Blazertasche gefunden hatte, von Flusen umgeben. Um Viertel nach vier musste ich im Museum sein, um bis fünf eine Gruppe französischer Touristen zu führen; und von sechs bis acht hatte ich alles abzutippen und zu sortieren, was die Forschungsgruppe „Kunsterziehung in der frühen Kindheit“ in der letzten Woche wieder verbrochen hatte.
Lästig, aber das gab immerhin auch wieder Geld. Sobald es im Hörsaal wieder hell geworden war und sich die Leute um mich herum verstohlen die Augen rieben, packte ich zusammen. Erst einmal einen Depotauszug! Vielleicht hatte sich ja etwas positiv entwickelt... Und ich konnte mir wieder einen Pfandbrief leisten, zweihundert Mark hatte ich locker in der Tasche. Bargeld brauchte ich sowieso nicht mehr so viel, an Neujahr kam ja der Euro, und bevor man mühsam umtauschen musste…
Hinterher vielleicht eine Tüte Mandarinen... Und das Buch, das ich noch in der Unibibliothek abholen wollte. Oder ich konnte meine Vorlesungsnotizen durchgehen, solange ich mich noch erinnern konnte, was auf den Dias zu sehen gewesen war.
Ich kam gerade wieder aus der Bank, halb zufrieden, wegen des neuen Pfandbriefs, halb unzufrieden, weil mein Depot exakt da stand, wo es letzten Freitag auch gewesen war, als ich die Stimme hörte.
„So trifft man sich wieder!“
Überrascht blinzelte ich gegen die schwächliche Dezembersonne, die schon sehr tief stand. „Ach, Sie?“
„Ja, ich. Haben Sie Lust, mit mir Essen zu gehen?“
Ja, sonst noch was! „Nein, tut mir Leid, aber ich habe noch ziemlich viel zu tun und um vier wieder einen Termin.“
„Friseur? Kosmetikerin?“
„Blödsinn!“, fauchte ich, „einen Job. Im Kunstbau, eine Führung. Kosmetikerin! Sehe ich etwa aus, als würde ich für so etwas Zeit und Geld verplempern?“
Er musterte mich unverschämt genau. „Ehrlich gesagt, schon. Sehr gepflegt, Kompliment!“
„Ach, verstehen Sie etwas davon? Sind Sie – wie nennt man das gleich? Ach – Visagist? Oder Friseur?“ Unwillkürlich wedelte ich tuntig mit der Hand. Er lachte kurz auf. „Nein, wirklich nicht. Gut, ich nehme alles zurück. Was wollten Sie in Ihrer Mittagspause tun, anstatt sie mit mir zu vertrödeln?“
„Etwas essen, ein Buch abholen und meine Notizen durchsehen.“
„Und ich darf Ihnen dabei nicht Gesellschaft leisten?“
Jetzt staunte ich aber wirklich! Essen gehen, gut, das hätte ich noch verstanden – ich aß und er erzählte, was für ein toller Hecht er war. Das mochten solche Kerle, bestimmt! Aber zugucken, wie ich ein Buch durchsah und ab und zu abwesend brummte, ohne wirklich zuzuhören? Da stünde er ja gar nicht im Mittelpunkt! Ich sah ihn überlegend an – wirklich komische Augen! – und hörte mich zu meinem Erstaunen sagen: „Na gut. Aber spannend ist das nicht, ich warne Sie.“
„Macht nichts. Wohin zuerst?“
„Unibibliothek“, beschied ich ihn knapp und drehte mich auf dem Absatz um. Er folgte mir artig und holte schnell auf. „Was wollen Sie abholen?“
„Eine Untersuchung über Degas. Interessieren Sie sich für Malerei?“
„Ja, durchaus, allerdings verstehe ich nichts davon.“
„Was machen Sie denn beruflich?“ So war das ja nun nicht, dass er mich ausfragte und ich weiterhin nicht zurückfragte – Fakten auf den Tisch!
„Mehr Wirtschaft.“
Hätte ich mir denken können – Sachbearbeiter bei Pfeiffer, wetten? Für etwas Besseres war er noch nicht alt genug – höchstens vierzig, schätzte ich. Aber ich konnte ältere Leute nie gut schätzen – und ein Vierzigjähriger hatte schon den Führerschein gehabt, als ich noch zu klein für den Kindergarten gewesen war. Eine völlig andere Generation! Dabei fiel mir aber etwas ein: „Und heute machen Sie blau?“
„Wie kommen Sie denn darauf?“
„Na, Sie laufen hier am helllichten Tag an einem ganz normalen Freitag herum – auf dem Weg zum Arzt sind Sie offensichtlich nicht, oder?“
„Ich könnte Urlaub genommen haben“, schlug er vor. Ich betrachtete ihn sinnend. „Und dann laufen Sie immer so korrekt herum?“
Er trug einen exzellent geschnittenen dunkelgrauen Anzug, ein Hemd aus feinster Baumwolle, eine geschmackvolle Krawatte und auf Hochglanz polierte Schuhe, außerdem einen Trenchcoat, dessen Futter mir genug verriet – das Etikett musste ich gar nicht erst sehen. Entweder verdiente er mehr, als ich angenommen hatte, oder er steckte sein ganzes Gehalt in diese Chefetagen-Verkleidung. Sein Problem!
Er lachte wieder kurz und nicht wirklich erheitert. „Ich laufe wirklich gerne so herum. Aber ich hatte einen Termin hier in der Nähe. Nein, gucken Sie nicht so, nicht bei der Kosmetikerin! Okay, das habe ich verdient, ich gebe es zu.“
Er hob abwehrend die Hände und wäre beinahe über die ausgetretene Stufe vor der Unibibliothek gestolpert. Ich streckte reflexartig die Hand aus. „Vorsicht!“
„Geht schon, danke.“ War er wirklich zurückgezuckt? Das machte ihn mir ja direkt sympathisch – ich konnte die dauernde Anfasserei auch nicht leiden.
Ich holte mein Buch ab, wobei er neben mir stand und unauffällig auf meine Bibliothekskarte linste. Nur stand auf der Chipkarte nichts als N. Roth und eine zwölfstellige Nummer, die allerdings für Eingeweihte mein Geburtsdatum verriet; wenn man vorne und hinten drei Ziffern weg strich, blieb die Zahlenfolge 300977 übrig. Aber nur, wenn er hier studiert hatte, konnte er damit etwas anfangen. Sollte er doch Detektiv spielen, wenn er wollte!
Ich schob das Buch und meinen Ausweis in die Tasche.
„So, jetzt gibt es Mittagessen!“
Er trottete brav neben mir her. Nein, falsch, er trottete nicht. Er hatte einen energischen Gang, der gar nicht zu dieser unterwürfigen Rolle passte, die er heute übernommen hatte. Ob er auch so gerne spielte wie ich? Jeden Tag jemand anderes sein? Möglichst verdrängen, wie uninteressant man in Wirklichkeit war? Aber was war überhaupt noch die Wirklichkeit? Ich war heute jedenfalls als angehende Karrierefrau (vulgo: Streberin) unterwegs; auf die Arroganz der höheren Tochter hatte ich mangels geeignetem Opfer keine Lust. Bei dem zog das auch nicht, glaubte ich.
Bei dem! Hatte der eigentlich keinen Namen? „Wie heißen Sie eigentlich?“
„Freddy. Und Sie? Wofür steht das N?“
Großer Gott – Freddy? Ich überlegte, ob ich Junge, komm bald wieder summen sollte – aber den Witz kannte er sicher schon, wie Chrismas Jones im letzten James Bond.
„Nathalie.“
„Wird das irgendwie abgekürzt?“
„Wehe! Ich hasse Abkürzungen, und Natti ganz besonders. Einmal so einen Spruch, und Sie kriegen nichts von meinem Mittagessen ab.“
Ich kaufte am Obststand vier Mandarinen und daneben zwei Ganzkornsemmeln und lotste meinen Trabanten in die Unihalle zurück. Dort setzte ich mich feixend auf die Freitreppe zum ersten Stock und packte die Brotzeit aus. Er sah sich zweifelnd um, dann faltete er seinen Trenchcoat zusammen und setzte sich darauf. „Sehr frugal.“
„Vitamin C, Ballaststoffe und guter Geschmack. Was hätten Sie denn essen wollen?“ Er zuckte die Achseln und schälte sich eine Mandarine. „Scaloppine? Oder etwas Französisches?“
„Und dann den ganzen Nachmittag verpennen? Das wäre mir zu schwer gewesen.“
„Und außerdem essen Sie kein Fleisch, stimmt´s?“
„Probieren Sie Schubladen aus? Selten, aber ich bin keine Vegetarierin. Ich esse einfach nur, worauf ich Lust habe, und ich mag Mandarinen und diese Semmeln, da sind Walnüsse drin. Schmeckt total weihnachtlich.“
„Mögen Sie Weihnachten?“ Ich kramte meinen zweiten Becher aus der Tasche und schenkte Mineralwasser ein. „Nein. Nur die Gerüche und solche kleinen Erinnerungen. Der Familienkram, die Geschenke, die Werbung, das pseudofromme Getue – wirklich nicht. O, Scheiße!“
„Was ist denn?“
„Ich brauche noch Weihnachtsgeschenke. Jetzt ist es – ach, erst halb drei. Na, das geht schnell.“
„Weihnachtsgeschenke“, sagte er in einem Tonfall, als wüsste er gar nicht, was das war. „Für wen? Ihren Freund?“
„Lassen Sie das. Für meine Eltern und meinen Bruder. Aber da ich von denen wahrscheinlich gar nichts kriege, gebe ich mir auch nicht besonders viel Mühe. Whiskey für die Herren, der verbraucht sich wenigstens, und Mama kriegt ihr Lieblingsparfum, darüber freut sie sich wohl wirklich.“ Hatte meine Stimme etwas bitter geklungen? Seine Augen wirkten plötzlich schmaler.
„Warum kriegen Sie nichts?“ Ich zuckte die Achseln. „Wahrscheinlich sind alle zu beschäftigt dazu. Mir ist das egal.“
„Wirklich?“
„Ja, wirklich! Und, haben Sie schon alle Geschenke?“
„Sozusagen.“ Er starrte an mir vorbei ins Leere. „Nein, ich wüsste niemanden, dem ich etwas schenken könnte. Nur Leute, die Geld erwarten und es auch kriegen.“
Huch? Das passte aber jetzt nicht zu der Schublade, in die ich ihn gesteckt hatte. Oder meinte er einfach Trinkgelder? Ja, wahrscheinlich. Ich betrachtete ihn unauffällig, während er seine Semmel auseinanderbrach und verblüfft das bunt gescheckte Innere betrachtete. An den Schläfen wurde er schon etwas grau, vielleicht war er auch schon über vierzig. Ein Vaterersatz? Papa war als Vater ja wirklich ein Totalausfall!
Er verzehrte schweigend seine Semmel. „Schmeckt wirklich gut“, kommentierte er dann, sobald er sorgfältig die Brösel von seinem feinen Zwirn gewedelt hatte, und schälte die zweite Mandarine.
„Sie haben Recht, das ist wirklich eine interessante Mahlzeit gewesen. Jetzt fühle ich mich richtig fit. Was machen wir als Nächstes?“
„Wir? Sie kriegen aber auch den Hals nicht voll, was? Ich kaufe jetzt schnell diese Weihnachtsgeschenke, und dann muss ich sowieso ins Museum. Und hinterher Schreibarbeiten. Und dann fahre ich heim und bereite mich auf morgen vor. Wahnsinnig aufregend!“
„Eine Weile halte ich das schon noch aus. Also, Parfum und Whiskey, ja?“
Er folgte mir zum Supermarkt und in die Discountparfumerie, wo ich zu Mamas Femme eine Menge Pröbchen kassierte. Leider fast alle mit Herrenduft! Ich betrachtete mir draußen etwas betrübt die Ausbeute, sortierte die Gesichtscreme und die zwei Eau de Toilette aus und drückte Freddy den Rest in die Hand. „Hier, zum Ausprobieren!“
Er bedankte sich etwas verblüfft. „Öfter mal was Neues... Eigentlich war ich mit meinem Rasierwasser bis jetzt ganz zufrieden. Gefällt es Ihnen nicht?“
„Weiß ich nicht, mir ist nichts aufgefallen.“
„Dann schnuppern Sie doch mal!“ Ich warf ihm einen skeptischen Blick zu. „Danke, nicht notwendig. Sie können die Proben ja auch wegwerfen.“
„Ich denke nicht daran. Was steht jetzt gleich wieder auf dem Programm?“
„Museum. Kunstbau. Waren Sie da schon mal?“
„Ja... ich denke schon. Kann ich mir Ihre Führung anhören?“
„Wenn Sie nichts Besseres vorhaben?“ Ich verkniff mir ein Lächeln und ließ mich zum Museum geleiten. Freddy kaufte sich eine Karte, während ich in den hinteren Regionen verschwand, wo ich mir meine ID ans Revers heftete und noch einmal durchlas, was ich heute zu erklären hatte.
Dann trat ich wieder in die Halle, wo schon zwei Grüppchen versammelt hatten. Ich verhandelte kurz mit einer Reiseleiterin und trat dann zu ihrer Gruppe. Freddy stand bei der anderen und sah sich etwas ratlos um.
„Mesdames et Messieurs...“ Ich bat um Aufmerksamkeit und begann mit der Führung, wobei ich aus den Augenwinkeln bemerkte, wie Freddy hastig die Gruppe wechselte und sich dann offenbar sehr bemühte, meinem Vortrag zu folgen. Tja, ein Jahr Au pair in Paris, das half schon, vor allem, wenn man alle Kataloge der Pariser Museen auf Französisch besaß und so den ganzen Wortschatz draufhatte!
Eine Dreiviertelstunde lang erklärte und deutete ich, beantwortete Fragen und diskutierte mit einem älteren Herrn, der meine Aussagen akribisch anhand seines Reiseführers überprüfte, über die Provenienz eines Rokokogemäldes. Schließlich verabschiedete ich die Gruppe, kassierte ein nettes Trinkgeld, machte die Termine für die Woche nach Weihnachten mit der Sekretärin aus und sammelte den etwas benommenen Freddy in der Halle wieder ein.
„Na, alles klar?“
„Sicher. Eine sehr kompetente Führung. Nur, was den einen Watteau betrifft, da bin ich ja nicht ganz Ihrer Meinung.“
„Was?“ Ich starrte ihn verblüfft an, bis er lachte. „Reingefallen. Ich habe keine Ahnung, ob hier Watteau von Fragonard oder umgekehrt beeinflusst wurde. Aber Sie haben sich mit diesem älteren Herrn tapfer herumgeschlagen.“
„Ja, nicht? So einer ist immer dabei, das bin ich schon gewöhnt.“
„Machen Sie das schon lange?“
„Drei Jahre etwa. Das und meine anderen Jobs, damit komme ich ganz gut durch.“
„Und was machen Sie sonst so?“ Er hielt mir die Türe auf.
„Schreibarbeiten und kassieren, im Billigmarkt. Das ist anstrengender, aber es bringt am meisten. Oder brächte am meisten, wenn ich es nicht nur einen Nachmittag machen würde.“
„Warum tun Sie sich das an? Neben dem Studium – ist das nicht furchtbar anstrengend?“
„Man gewöhnt sich daran. Ich brauche das Geld, ich muss zu Hause etwas abgeben und möchte ab und zu auch entweder etwas anlegen oder mir etwas kaufen, zum Beispiel einen Wintermantel.“
Er lächelte etwas verloren. „Warum sind Ihre Eltern so hart?“
„Sind sie das? Ich meine, ich bin volljährig, warum sollte ich nicht selbst für mich sorgen? Gut, ich kann es noch nicht richtig, sonst würde ich ja nicht mehr dort wohnen, aber ich versuche es wenigstens.“
„Haben Sie Geschwister?“
„Einen Bruder“, gab ich ungern zu.
„Und der sorgt auch für sich?“
„Der findet keinen Job.“
„Was hat er für eine Ausbildung?“
„Er ist Diplombetriebswirt. Ich glaube, er sucht nicht gründlich genug. Ach, lassen wir das. Ich mache, was ich für richtig halte, und wenn Tobi das nicht tut, ist es sein Problem.“
„Sehr aufrecht.“
„Was? Wie meinen Sie das?“
„Ihre Haltung.“
Ich zuckte die Achseln. „Wenn Sie meinen. Ich fürchte nur, hier können Sie nicht mitkommen. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder.“
Ich hielt ihm die Hand hin; er drückte sie fest und sah auf mich herunter. „Da bin ich ganz sicher. Ich bitte Sie aber nicht um Ihre Telefonnummer, schließlich liebe ich die Herausforderung.“
Ich sah in seine Augen. Ganz hellgrau, wie der Himmel an einem trüben Tag. Und ziemlich lange, dunkle Wimpern, ungewöhnlich für einen Mann.
„Tja, dann – einen schönen Abend noch. Und frohes Fest und so...“
Damit verschwand ich im Kunsthistorischen Institut.
Zwei Stunden lang tippen, ablegen, Bänder sortieren, ein unordentliches Büro aufräumen. Zweimal die Woche, das waren immerhin hundertzwanzig Mark – schwarz -, dazu hundert Mark vom Billigmarkt und pro Führung netto etwa vierzig Mark, also in der Woche im Schnitt etwa hundertzwanzig. Dreihundertvierzig in der Woche, also gut vierzehnhundert im Monat, davon kassierte Papa vierhundert, zweihundert durfte ich ausgeben, achthundert legte ich an. Zum Ärger meiner Freundinnen aus der Projektgruppe und aus den anderen Kursen, die fanden, ich sollte mir öfter etwas gönnen und nicht so verbissen sparen. Die wohnten ja auch in schnuckeligen Appartements, die ihnen ihre Eltern finanzierten, in chaotischen WGs oder mit ihren Freunden richtig solide in bürgerlichen Dreizimmerwohnungen.
Und ich hockte immer noch in meinem Teeniezimmer in Leiching! So konnte das wirklich nicht weiter gehen, also sparte ich eben. Etwa achttausend Euro hatte ich schon (Bankanlagen wurden ja schon in Euro gerechnet), aber das reichte auch nur für acht Monate zum Leben. In einem Jahr aber, wenn ich mit dem Studium fertig wäre...
Ich schleifte meine Einkäufe in den Bus und fuhr nach Hause. Mama lag im Wohnzimmer auf dem Sofa und rief mit klagender Stimme nach mir. Ich kam zu ihr. „Fühlst du dich auch gut, Mama?“
„Danke, mein Kind... es geht schon. Etwas schwächlich, vielleicht. Ich bekomme so schlecht Luft... Und Papa und Tobi sind natürlich nicht da.“
Herumvögeln, dachte ich wütend und ordinär. Ich war sicher, dass Papa Mama dauernd betrog, und Tobi begrabschte ohnehin alles, was nicht schnell genug wegrannte. Und Mama ließen sie alleine hier liegen!
„Warum kommst du heute so spät?“, fragte Mama.
„Es ist neun. Früher komme ich freitags doch nie. Du weißt doch, dass ich arbeiten muss. Wenn Tobi schon nichts tut...“
„Ach, Tobi! Lass nur, Kind, eines Tages findet schon eine gute Stellung.“
„Ja, und bis dahin schenkt Papa ihm das Geld, das er mir jeden Monat abnimmt. Ganz fair finde ich das nicht. Soll ich dir helfen, ins Bett zu gehen?“
„Das schaffe ich schon noch alleine, Kind. Lauf du nur.“
„Bist du sicher?“
„Ja, mein Kind. Gute Nacht.“
Ich küsste sie auf die Wange und verzog mich in mein Zimmer. Dort packte ich die Weihnachtsgeschenke ein, alle in silberne Folie und schwarze Schleifen, versteckte sie im Schrank und fuhr meinen Rechner hoch. Freitagabend, Viertel nach neun, da lohnte es sich direkt noch...
Ich schrieb eine Stunde an dieser lästigen Seminararbeit über die Anfänge des Impressionismus, dann reichte es mir wieder; ich tippte noch schnell meine Mitschriften und wollte den Rechner eigentlich schon wieder ausschalten, aber dann verharrte meine Hand regungslos und nach einem unentschlossenen Moment rief ich ein neues Dokument auf, nannte es Erkenntnisse – F und tippte alles ein, was ich über Freddy nun wusste. Komischer Kerl, lief mir den ganzen Nachmittag nach und ließ sich von mir schikanieren – wenn ich bedachte, dass ich ihn zu gesundem Essen gezwungen und ihn der Folter einer Kunstführung in französischer Sprache ausgesetzt hatte, von dem Almosen der After-Shave-Proben ganz zu schweigen. War das wohl eine Frechheit gewesen? Egal, wahrscheinlich fand er mich ja doch nicht wieder, und sicher war es auch besser so. Viel wusste ich sowieso nicht:
1.) Komische, extrem helle Augen: hellgrau mit dunklen Wimpern
2.) Staffiert sich aus wie ein Aufsichtsratsvorsitzender, sogar in seiner Freizeit
3.) Macht was mit Wirtschaft
4.) Verschenkt nichts zu Weihnachten. Aus Prinzip? Oder kennt er niemanden?
5.) Findet, meine Eltern sollten mich finanzieren
Fand er das wirklich? Nein, das hatte er nicht gesagt. Ich löschte den letzten Punkt wieder und sicherte die Datei mit einem Extracode, obwohl Tobi sowieso zu dämlich war, um meinen Rechner zu knacken.
Das Wochenende nutzte ich, um die Seminararbeit fertig zu machen; ich druckte sie aus, band sie in ein hübsches Mäppchen und legte sie für den ersten Unitag nach den Weihnachtsferien parat. Außerdem sichtete ich wieder einmal meine Scheine fürs Examen, stellte erfreut fest, dass ich nun wirklich alles in der Tasche hatte, sogar in den Nebenfächern, Französischer Literatur und Medienwissenschaften (obwohl ich noch mehr zu kriegen hatte), räumte sie perfekt auf und warf allerlei anderen Kram weg. Außerdem wusch und bügelte ich sieben Maschinen voll für Mama und für mich – Papa und Tobi konnten sehen, wo sie blieben - , kaufte für die Weihnachtsfeiertage ein, bis die Türen von Mamas Golf kaum noch zugingen, schleppte den überflüssigen Christbaum nach Hause, assistierte Frau Sopeck am Samstagnachmittag beim Hausputz, als Papa und Tobi bei irgendeiner Weihnachtsfeier im Golfclub waren, und kam mir am Sonntagabend sehr tugendsam und ausgebeutet vor. Die zwei hatten wirklich gar nichts gemacht! Und Mama hatte auf dem Sofa gelegen – nein, dekorativ geruht – und beklagt, dass sie uns so gar keine Hilfe sein konnte. Sie hatte mich direkt etwas ungeduldig gemacht, denn es wäre ja wohl nicht nötig gewesen, immerzu im Weg zu sein und die ohnehin nicht gerade arbeitswütige Frau Sopeck dauernd durch Gespräche abzulenken. So machte ich dann schließlich das meiste alleine, bis ich entnervt Frau Sopeck in die Badezimmer jagte. Klos putzte ich nicht – irgendwo war die Grenze erreicht! Jedenfalls nicht die Klos von Leuten, die ich nicht leiden konnte.
Tobi und Papa waren, als sie am Samstagabend nach Hause kamen, mehr als nur angetrunken. Tobi war glänzender Laune, zog sich hastig mehr discomäßig um und ließ sich von irgendeiner Maus abholen. Konnte er nicht selbst fahren und sich betrunken um einen Chausseebaum wickeln? Abscheulicher Gedanke, aber ich wünschte ihn wirklich zur Hölle.
Papa strich murmelnd durchs Haus, trank noch etlichen Whiskey, telefonierte herum und saß schließlich übellaunig im Wohnzimmer, also verzog ich mich unauffällig in mein Zimmer und las in Geschichte der Malerei 1880-1920. Vielleicht stolperte ich ja über einen unbekannten, aber viel versprechenden Künstler, den ich Professor Werzl vorschlagen konnte?
Tobias kam erst am Sonntagmittag wieder heim, wies das Mittagessen (Minestrone und Kartoffelgratin, ich hatte mich redlich bemüht) mit allen Anzeichen des Ekels von sich und trug sein bleiches, aufgedunsenes Gesicht mit den rötlichen Augen in sein eigenes Zimmer.
Papa aß stumm, warf mir ab und zu kritische Blicke zu, bis ich ihn wütend anblitzte, und seufzte dann leise vor sich hin. Jetzt hätte ich fragen sollen, was ich denn für ihn tun könnte! Das kannte ich schon, das waren immer schauerliche Aufträge, entweder am Rande der Legalität, unangenehm oder/und zeitraubend. Ich stellte mich dumm, das war sicherer.
Mama aß wenig, lobte das Essen ohne große Überzeugung und schob ihre Portion auf dem Teller hin und her, als könnte sie nur durch Reibungsverluste verschwinden.
„Iss doch was, Mama“, mahnte ich, aber vergebens. Was war eigentlich los? Tobi war heute auch nicht ärger als sonst, also warum diese Krisengesichter? Hatte ich irgendwas angestellt? War jemand krank? Keiner sagte etwas, und ich hütete mich zu fragen, sondern begann, die Teller aufeinander zu stapeln.
Der Montag wurde noch viel anstrengender; vor Tau und Tag stand ich auf, ohne die anderen zu wecken, putzte das Wohnzimmer noch einmal flüchtig, schleifte den Baum hinein und rammte ihn in den Ständer (andere Leute machten aus der Baumschmückaktion sicher eine lustige Familienangelegenheit – glaubten meine Eltern jetzt eigentlich wieder ans Christkind?), schraubte ihn fest, gab ihm Wasser, arrangierte die Lichterkette, verteilte Kugeln, Engelchen und Lametta, räumte alle Schachteln wieder in den Keller, füllte diverse Schalen mit Weihnachtsgebäck (gekauft, irgendwo war Schluss), verteilte meine Geschenke unter dem Baum, stellte Kerzenleuchter, alte Rauschgoldengel und eine große Schüssel mit Apfel, Nuss und Mandelkern auf, schloss das Wohnzimmer ab und deckte im Esszimmer den Frühstückstisch. Dann schloss ich die gefüllte Kaffeemaschine an, duschte schnell, zog mich warm an und ging die traditionellen Croissants holen und die Baguettes, die ich bestellt hatte. In der Schlange vor dem Bäcker war ich von sehr unweihnachtlichen Gesichtern umgeben, die nur Müdigkeit, Überarbeitung und Unlust ausdrückten. Auf dem Rückweg holte ich noch einige vergessene Kleinigkeiten, wieder einmal auf eigene Rechnung – Papa gab Mama nur sehr wenig Haushaltsgeld, und sie verbrauchte davon noch einen hohen Anteil für ihre Medikamente, den ganzen rezeptfreien Kram, durch den sie sich besser fühlte.
Als ich nach Hause kam, schlief immer noch alles. Neun Uhr, nun, warum nicht? Ich setzte mich vor meinen Rechner und überlegte, welche Vorlesungen und Übungen ich zu erstklassigen Skripten für die Magisterprüfung ausarbeiten konnte. Erst gegen elf regte sich etwas; ich schaltete die Kaffeemaschine ein, stellte die Croissants, Butter und Marmelade hin und arbeitete weiter. Mit denen zu frühstücken, ging über meine Kräfte!
Überhaupt hatte ich von Weihnachten schon wieder richtig die Nase voll! Erst am frühen Nachmittag begrüßte ich die anderen, räumte die Reste des Frühstücks ab, fragte Mama nach ihrem Befinden und ignorierte Tobi, der schon wieder verkatert und verquollen wirkte. Papa las Zeitung und brummte vor sich hin. Für den frühen Abend musste ich nur noch einige Salate und Baguette vorbereiten, ansonsten hatte ich nichts mehr zu tun. Und glücklicherweise gingen wir am ersten Feiertag traditionell essen und begingen den zweiten nicht mehr besonders festlich.
Mama lächelte schmerzlich. „Es tut mir ja so leid, dass ich dir nicht mehr helfen kann, Kind, aber du weißt ja...“
„Ja, ich weiß. Aber den anderen fehlt doch eigentlich gar nichts?“
„Ich arbeite schließlich den ganzen Tag, da wirst du ja in Gottes Namen mal den Kaffee kochen können“, kam es hinter Papas Zeitung hervor, „außerdem habe ich weiß Gott andere Sorgen.“
Toll – und ich arbeitete wohl nichts? Und welche Sorgen hatte er wohl? Ich wusste, dass er bei Pfeiffer mehr als ordentlich verdiente, ich kostete praktisch nichts, Mama bezog immer noch ein ausreichendes Einkommen aus einer Familienstiftung, das sie zwar nicht in den Haushalt, aber wenigstens in ihre Klamotten und ihre Schönheitsmittelchen steckte, und dass Tobi so eine Drohne war, war schließlich Papas eigene Schuld – hätte er ihn eben nicht so verzogen! Tobi brummte nur: „Weiberkram. Ich bin heute Abend nicht da, ich geh auf eine coole Fete bei Theo.“
„Wer ist Theo?“, fragte Papa, während Mama losjammerte: „Aber Tobi, doch nicht an Weihnachten!“ Mama wurde ignoriert, nur ich legte ihr beruhigend eine Hand auf den Arm. „Theo hat die Schwarze Hexe in der Tiepolostraße direkt am Bahnhof. Ich sag dir, der Laden brummt. Da ist echt für alle Bedürfnisse gesorgt, Privatzimmer und was man so braucht.“
„Klingt wie eine Mischung aus Zockerhöhle und Puff“, kommentierte ich.
„Was weißt du denn schon, du lahme Kuh!“, blaffte Tobi.
„Kenn ich aus dem Fernsehen, und das reicht mir auch schon.“
„Ich hab jedenfalls nicht vor, mein Leben voller Langeweile zu verbringen, ich will es genießen, und das tue ich auch. Und heute fange ich damit an. Papa, fahr mal ein paar Hunnis rüber!“
Wütend sah ich zu, wie Papa nach kurzem Zögern fünfhundert Mark über den Tisch schob – für einen Abend? „Kann ich auch was haben?“, fragte ich versuchsweise. „Du? Warum denn? Du gehst doch nicht weg? Hast du überhaupt schon dein Kostgeld abgegeben?“
„Für Januar kriegst du es am Ersten, sonst kassierst du noch zweimal“, antwortete ich pampig. „Wieso zahle ich eigentlich Kostgeld und Tobi nicht?“
„Weil du längst aus dem Haus sein solltest, wenn du nicht so fad wärst“, antwortete Tobi und musterte mich verächtlich. „Wenn du ein richtiger Hase wärst, wärst du längst reich geschieden und hier raus. Ich bin hier der Erbe, der Kronprinz – und du bist bloß eine Last. Immer diese trübe Miene! Ich glaub, ich bring ein paar von meinen Kumpels mit, damit du mal richtig durchge-“
„Tobias!“ Mamas Stimme klang ungewohnt scharf. „Lass das Kind in Ruhe. Sie arbeitet wenigstens und kümmert sich um mich, und du lebst nur deinem Vergnügen. Wann findest du endlich eine Arbeit und entlastest deinen Vater? So jung bist du auch nicht mehr, immerhin fast dreißig. Sohn alleine ist auch kein Beruf, schließlich hat Papa ja keine Firma zu vererben.“
Ich staunte; so viel und so energisch hatte Mama nicht mehr gesprochen, seitdem Tobi beim ersten Anlauf durchs Abitur gefallen war, was niemanden außer ihm selbst erstaunt hatte. Andererseits – alle zehn Jahre ein Machtwort und sonst nichts? Viel Unterstützung war das auch nicht.
Ich kümmerte mich ums Abendessen, legte zur Bescherung die übliche uralte Platte auf, überreichte meine Geschenke und bekam von Papa zwanzig Mark aus der Hosentasche und von Mama ein wehes Lächeln. „Kind, du weißt ja, ich fühle mich zurzeit nicht gut genug, um in die Stadt zu gehen...“
„Schon gut, Mama.“
Hauptsache, Tobi war nicht da! Aber schäbig fand ich das schon. Sie hätte etwas bestellen können oder eine Freundin bitten, etwas zu besorgen, meinetwegen bloß irgendein kleines Parfum oder so. Aber gar nichts, nur diese Leidensmiene? Den Zwanzigmarkschein strich ich sorgfältig glatt, dann räumte ich die Küche auf und ging kommentarlos ins Bett. So satt hatte ich die bucklige Verwandtschaft noch nie gehabt! Den Morgen des ersten Feiertags verbrachte ich in meinem Ärger damit, alles Gerufe nach Frühstück zu ignorieren und stattdessen mein Fotoalbum durchzusehen. Lauter geheuchelte Idylle!
Ich riss Foto für Foto heraus, beschriftete sie sorgfältig auf der Rückseite und machte mich dann daran, Tobi und meinen Vater – und schließlich auch Mama – sorgfältig wegzuschneiden. Ich hatte keine Familie, basta, es genügte doch, wenn ich wusste, wie ich wann ausgesehen hatte! Irgendwo hatte ich noch ein ganz kleines Album in schwarzem Lack, aus dem ich mal für Mama etwas hatte basteln wollen. Wahrscheinlich hatte sie so desinteressiert gewirkt, dass ich es gelassen hatte.
Stück für Stück klebte ich die Fotoreste wieder ein und fegte die herumliegenden Schnipsel samt dem alten Album mit den aufgerissenen Seiten in eine Tüte. Kurz bevor der Gang zum Leichinger Hof angesagt war, kam ich aus meinem Zimmer. „Ich geh spazieren und esse woanders was. Schönen Tag noch!“ Mama guckte beleidigt, Papa schien zu überlegen, ob er sich aufplustern sollte, und ließ es dann; die Kasse in seinem Kopf hatte wahrscheinlich schon die gesparten vierzig Mark registriert, nachdem er ja schon Weihnachten so großzügig hatte sein müssen. Tobi schaute verächtlich, wahrscheinlich war ihm völlig unklar, wie man eine Gratismahlzeit ausschlagen konnte – für den Gegenwert bekam man in der Schwarzen Hexe oder im XY sicher schon einen Caipirinha!
Ich warf das alte Familienalbum in die Altpapiertonne und fuhr mit der U-Bahn in die Innenstadt, wo mir Massen von feiertäglich gekleideten Familien entgegenkamen. Den billigsten Hamburger gönnte ich mir als Festtagsessen, dann beguckte ich Schaufenster und studierte lange die Angebote der Immobilienabteilungen der Banken. Fast alles nur zum Kaufen, zu Summen, von denen ich nur träumen konnte. Mama würde mich auch nicht unterstützen, schließlich machte ich die ganze Arbeit. War ich eigentlich Aschenputtel? Warum ließ ich mir das bieten?
Zunehmend steigerte ich mich in Zorn auf Mama hinein, die ihre Krankheit nutzte, um alles auf mich abzuwälzen. Warum musste ich eine Familie zusammenhalten, an der mir eigentlich nichts lag? Ich mochte Papa und Tobi nicht, wenn sie nicht mit mir verwandt gewesen wären, hätte ich sie nie in meiner Umgebung geduldet. War ich denn bescheuert? Ich putzte, ich organisierte, ich zahlte noch dafür und ließ mich obendrein noch von Papa und Tobi beschimpfen? Und Mama raffte sich alle zehn Jahre zu einem strengen Wort auf und lag ansonsten dekorativ auf dem Sofa? Wie krank war sie eigentlich wirklich? Dr. Jellinek würde mir bestimmt keine Auskunft geben, auch nicht, wenn ich mich heuchlerisch erkundigte, wie man sie besser pflegen konnte. Den kannte ich schon, der war sauer, weil ich nie zu ihm ging. Nein, ich musste leider doch davon ausgehen, dass sie es wirklich am Herzen hatte, schließlich konnte sie diese Blässe ja kaum mit psychischen Mechanismen hervorzaubern, oder? Und ihr zu unterstellen, sie simuliere nur, war eigentlich ziemlich schäbig von mir!
Ich lief einige Stunden herum, haderte mit meinem Schicksal und schämte mich dann wieder für meine finsteren Gedanken, imaginierte einen Flugzeugabsturz für Tobi (auf dem Weg zum Ballermann oder nach Thailand, das alte Ferkel) und Betreutes Wohnen für Papa und Mama, mit strenger Taschengeldzuteilung für Papa und abendlichem Ausgehverbot. War ich gemein, eine richtige Rabentochter! Aber andererseits... war ich denn der Flocki? Immerhin, nur noch ein doofer Feiertag, dann könnte ich mich wieder in lange, befriedigende Arbeitstage flüchten!
Als ich nach Hause kam, saßen Papa und Mama vor dem Fernseher und Tobi setzte dem Geprassel und Gepruste zufolge gerade das Bad unter Wasser, um sich für die Piste aufzuhübschen. Ich servierte schnell ein kaltes Abendessen, kümmerte mich um die Wäsche, sprach kein Wort und wischte das Bad auf, sobald Tobi daraus verschwunden war. Seine nassen Handtücher warf ich ihm ins Zimmer, in dem es aussah wie nach einem Bombeneinschlag. Sein Problem – hoffentlich schimmelte der Teppich!
Am Donnerstag ging es mir schon wieder viel besser; ich besuchte Professor Werzl in der Sprechstunde und bekam ein Thema, einen eher unbekannten einheimischen Maler, der um 1900 beliebt, aber heute völlig vergessen war – zu Recht? Das sollte ich herausfinden. Einige Tipps, wo seine Gemälde hingen, folgten, dann war ich wieder entlassen und konnte an die Arbeit gehen. Abgabe im Oktober, Prüfung im Dezember, Highlife ab Januar - 2004 würde mein Jahr werden!
Ich absolvierte zwei Führungen im Kunstbau, eine auf Deutsch, eine auf Französisch, brachte mein Honorar zur Bank, bestellte einiges in der Unibibliothek, kopierte mir im Lesesaal Basisinformationen, kaufte mir einen neuen Block und eine neue Mappe und setzte mich in die Cafeteria, um bei einem Mineralwasser eine Gliederung zu entwerfen und die kopierten Artikel zu lesen.
Erst gegen neun Uhr abends kam ich nach Hause.
Den Freitag verbrachte ich ähnlich, nur war die Bibliothek der Kunsthistoriker dran, und um sieben traf ich mich mit Irina, Bea und einigen anderen im Ratlos in der Emilienstraße, um zu besprechen, was wir Silvester machen wollten.
„Wir könnten doch einfach hierher kommen“, schlug Tim vor und seine Bartflusen wackelten eifrig. „Könnt ihr nicht“, sagte Birgit und stellte Biere auf den Tisch, „wir sind ausgebucht bis zur Halskrause, sorry. Was zu essen?“
Ich verzichtete, so viel Geld hatte ich nicht mehr, weil ich das meiste heute auf die Bank getragen hatte. Keine Schlafmünzen für mich!
„Muss der krasse Weihnachtsbaum sein“, witzelte Beas Freund Peter, „der sieht aus wie ein riesiger Nikolaus.“ Birgit freute sich über das Kompliment, aber wo wollten wir nun feiern? Und wie?
„Machen wir´s bei mir“, schlug Tim vor. „Jeder bringt was mit, Salat oder so, ich kauf ein Tragerl Bier und ein paar Flaschen Sekt, Peter bringt Raketen mit, ich lade noch ein paar Kumpels ein und dann geht die Post ab.“
Tim hatte eine schäbige Altbauwohnung, aber recht nette Mitbewohner. Eigentlich waren sie alle in Ordnung. Nicht mein Geschmack, aber liebe Kerle. Irgendwie nur furchtbar jung. Worüber die sich aufregen konnten! Verfehlte Scores, tiefergelegte Wagen, Bierpreiserhöhungen... natürlich auch öde Seminare, verpatzte Scheine, Finanzkrisen und Liebeskummer.
Ich trank meine Schorle, rauchte eine Zigarette und hörte den Gesprächen zu, versprach, einen extrascharfen Reissalat mitzubringen, hörte mir den neuesten Streit zwischen Bea und Peter an – zum Skifahren nach Österreich oder in die französischen Alpen? Währungstechnisch war es ja mittlerweile egal, aber die Vor- und Nachteile wurden erbittert diskutiert.
„Und wie läuft es zu Hause?“, fragte Irina zwischendurch leise. Ich winkte ab. „Wie immer eben. Noch ein Jahr, dann bin ich fertig und ziehe aus.“
„Wenn du mit einem WG-Zimmer zufrieden bist, dann kannst du auch gleich ausziehen. Bei uns wird eins frei, nur vierhundert Mark – also, zweihundert Euro warm. Nicht groß, aber mit einem schönen Blick.“
„Ich weiß nicht. Lieb von dir, aber ich glaube, ich möchte am liebsten ganz alleine wohnen. So was wie WG, nur mit Unsympathen, hab ich jetzt auch, und ich muss mir erst den Mechanismus abgewöhnen, mir alle Arbeit aufhalsen zu lassen. Ich hätte gerne ein ganz kleines Appartement, das ich ganz für mich allein habe.“
„Hast du eigentlich keinen Freund?“, fragte Tim, der anscheinend gelauscht hatte. Ich schüttelte den Kopf. „Wann soll ich denn das noch machen? Ich bin wirklich ausgebucht. Außerdem treffe ich nie wirklich tolle Männer.“
„Suchst du denn?“, fragte Irina schlau und grinste. „Nein“, musste ich zugeben und lenkte das Gespräch auf weniger verfängliche Themen.
Einen Freund? überlegte ich auf dem Heimweg. Wirklich, wann denn? Der würde mich sicher auch nur für diverse Hilfsdienste einspannen und mir mein bisschen Geld abnehmen... naja, das war sicher ein Vorurteil, aber Liebe? Pure Einbildung. Wenn einer sagte Ich liebe dich, dann wollte er etwas, soviel hatte ich schon gelernt – mit mir ins Bett, meine Zustimmung zu irgendetwas, irgendeinen Hilfsdienst oder ein Darlehen. Warum auch nicht, so schön war ich wirklich nicht.
Und das bisschen Sex als Gegenangebot für die Ausbeutung? Wirklich nicht, so spannend war das nicht. Gut, meine Erfahrungen hielten sich in Grenzen, einer mit neunzehn, einmal, und einer mit einundzwanzig, einige Wochen lang. Aber gefallen hatte es mir nie. Sicher, da gab es ein diffuses Gefühl der Erregung, das sich viel versprechend anließ, aber es führte zu nichts, nur zu Peinlichkeiten, Blut und Schmerzen. Ich hatte bei Bernie nie verstanden, warum er hinterher immer so wohlig seufzte und so ausgepumpt neben mich gefallen war. Ich war weder erschöpft noch zufrieden – aber was er gefühlt hatte und ich nicht, das wusste ich natürlich nicht. Als braves Kind hatte ich jedes Mal versichert, es sei toll gewesen. Vielleicht war es ja auch toll, und ich wusste es nur nicht zu würdigen? Vielleicht war ich zu kritisch oder konnte mich nicht entspannen, so dass ich nur die Grimassen, das Grunzen, den Schweiß und das unangenehm schmerzhafte Gefühl registrierte und nicht die Macht der Leidenschaft, die Wogen der Lust, die einem aus jedem Liebesroman entgegenschwappten. Und zur Selbsthilfe greifen? Nein, das erschien mir wie ein Eingeständnis der Niederlage, lieber nahm ich Sex nicht weiter wichtig. War er ja auch nicht. Ich wollte lieber alleine bleiben, arbeiten, Geld verdienen – vielleicht später mal einen netten Mann finden und die Nächte über mich ergehen lassen, um ein, zwei Kinder zu haben. Hieß es nicht, dass die meisten Ehepaare nach wenigen Jahren ohnehin keinen Sex mehr hatten? Dann müsste ich ja bloß abwarten.
Ich dachte darüber nach, wie der Kerl geheißen hatte, mit dem ich beim ersten Mal, auf diesem Fest kurz nach dem Abitur, geschlafen hatte. Martin? Markus? Max? Irgendwas mit M.... Michael? Ich hatte ihn vorher nicht gekannt, aber er war niedlich, ich war ein bisschen betrunken und fand es peinlich, als Jungfrau Abitur gemacht zu haben, also wollte ich wenigstens nicht auch noch als Jungfrau au pair arbeiten.
Er (Michael? Nein, doch eher Max) war mir gerne behilflich gewesen, aber die Entdeckung, dass ich noch Jungfrau gewesen war, freute ihn nicht, offenbar war ihm das zu anstrengend. Ich verkniff mir jeden Protest, als es weh tat und enteilte hinterher so schnell wie möglich, bevor er sehen konnte, wie sehr ich blutete. Zwei Tage lang hatte ich danach kaum sitzen können.
Nichts, was einen danach süchtig machen konnte! Und dafür sollte ich meine Pläne opfern? Dafür einen Kerl umsorgen und ihn dann auch noch finanzieren? Musste nicht sein...
Um acht sollte es bei Tim losgehen. Ich rührte meinen Salat an – nicht einmal Tobi traute sich angesichts meiner grimmigen Miene, zu behaupten, ich hätte die Zutaten nicht aus eigener Tasche bezahlt – und bunkerte ihn in meinem Zimmer, bis ich fertig angezogen war. Viel Mühe gab ich mir nicht, Jeans, ausgeschnittenes T-Shirt (ich kannte den bullernden Kohlenofen bei Tim, da war es immer furchtbar heiß), Stiefel, Pferdeschwanz, etwas Lipgloss und Puder.
Tobi wollte auf die angesagte Fete des Jahres, Papa hatte ebenfalls etwas vor, und Mama fand, das Feuerwerk verursache ihr Beklemmungen. Nein, ich blieb heute nicht zu Hause, um ihr das Händchen zu halten! Ich riet ihr nur, früh ins Bett zu gehen, und verabschiedete mich. Bis alle Tropfen und Mittelchen richtig neben ihrem Bett und dem Sofa aufgebaut waren und sie gemütlich mit Wolldecke und Fernbedienung, den kleinen Snack nicht zu vergessen, installiert war, war es acht Uhr durch.
Als ich bei Tim ankam, war das Fest schon in vollem Gang. Ich stellte meinen Salat auf den umfunktionierten Schreibtisch, begrüßte den Gastgeber, Irina, Peter und Bea, die schon wieder über den Skiurlaub stritten, fragte nach, ob denn zur Zeit überhaupt irgendwo Schnee läge, was das Zauberwort Gletscher ins Spiel brachte, und suchte mir ein gemütliches Plätzchen, nachdem ich mir ein Bier genommen hatte. Etwas anderes gab es hier offenbar nicht, außer einer eher zweifelhaft aussehenden Bowle mit Dosenobst.
Ich trank das Bier, lauschte der Musik und den Gesprächen und überlegte schon wieder, ob ich hier nicht fehl am Platze war – alle anderen schienen sich glänzend zu amüsieren.
„So trifft man sich wieder“, hörte ich da eine Stimme und erschrak. Freddy? Hier? Der konnte diese Leute doch gar nicht kennen! Als ich nach oben schielte, stellte ich erleichtert fest, dass das absolut nicht Freddy war, sondern ein recht hübscher Kerl mit schwarzen Löckchen.
„Wieso wieder?“, fragte ich zurück.
„Sag bloß, du hast mich vergessen!“
„Ehrlich gesagt, ja. Wo sollen wir uns denn schon mal begegnet sein?“ Ich durchforstete wie rasend mein Gehirn, schließlich wollte ich ja nicht unhöflich sein, aber er war mir wirklich völlig unbekannt.
„Na, auf dem Grillfest bei Irina!“
„Grillfest? Im Sommer?“, fragte ich erleichtert zurück.
„Klar, Mensch, wann sonst?“ Egal, wenn er mich für dämlich hielt! „Ich habe Irina erst zum Wintersemester kennen gelernt. Das auf dem Grillfest war ich also nicht.“
„Schade. Du bist wirklich nicht Gabi?“
„Nein. Nathalie. Und du?“
„Benedict. Irina ist meine Cousine.“
Hübsch war er, unbestreitbar – zu den schwarzen Löckchen konnte er mit tiefblauen Augen, einer kühnen Nase, einem verlockend geschwungenen Mund und einem piratenmäßigen Dreitagebart aufwarten. Ich betrachtete ihn interessiert. „Ist das nicht anstrengend?“
„Was?“, fragte er irritiert zurück.
„Den Bart exakt auf diesem Level zu halten.“
„Das hat mich auch noch keine gefragt! Ja, furchtbar. Wenn ich zu faul bin, rasiere ich mich eben drei Tage vor einem Event, dann ist er wieder genau richtig. Und du, wie kriegst du diesen Honigton hin?“
„Du meinst die Haare?“ Ich befingerte meinen Pferdeschwanz. „Gar nicht, die sind einfach so verwaschen. Ich glaube auch nicht, dass sich dieser Ton gut verkaufen würde. So sehen die Leute schließlich von Natur aus aus.“
Benedict war Schauspieler (behauptete er jedenfalls), und nach einer angeregten Diskussion, ob auch männliche Darsteller nun nicht mehr umhin könnten, sich operativ verschönern zu lassen, wurde ich mit einem Vortrag über Schauspieltechniken, Actor´s Studio versus Stanislawski (oder war das das Gleiche?), Falckenberg, Juillard und Max Reinhardt erfreut. Als mein Blick offenbar leicht glasig wurde, unterbrach er sich. „Entschuldige, ich langweile dich sicher.“
„Nein, gar nicht“, wehrte ich höflich ab.
„Wir sollten lieber tanzen“, schlug er vor, und ich erhob mich sofort. Noch eine Schauspielschule, und ich wäre zusammengebrochen!
Uralte Heuler, Born to Be Wild, When I Was Young.... Das tat mal wieder richtig gut, und dieser Benedict war eigentlich ganz nett. Etwas einseitig in seinen Interessen vielleicht, aber zum Tanzen reichte es.
Die Musik wechselte zu langsamen Rhythmen, und Benedict zog mich vorsichtig an sich. Zwei, drei Schleicher, recht angenehm. Er zog mich etwas enger an sich. Gutes Aftershave... Wozu eigentlich Aftershave, wenn er sich gar nicht rasiert hatte? Seine Wange lag an meiner und kratzte ein bisschen. Nicht unangenehm. Auch die warme Hand auf meinem Rücken war recht wohltuend – aber mehr auch nicht. Wir tanzten schweigend.
„Du gefällst mir“, murmelte er mir in einer Pause zwischen zwei schluchzenden Gitarrenklängen ins Ohr und küsste mich auf die Wange. Der Druck seiner Hand verstärkte sich, als sie langsam tiefer wanderte und meinen Hintern zu streicheln begann. „Nein“, murmelte ich und die Hand wanderte wieder zurück, aber der Druck verringerte sich nicht. Beim nächsten Stück hob er mit einer Hand mein Kinn und küsste mich leicht auf den Mund. Dann sah er mich prüfend an. Ich starrte zurück. Konnte er das nicht lassen? Ich tanzte gerne, aber auf Knutschen hatte ich jetzt keine besondere Lust, nicht mit jemandem, über den ich gar nichts wusste, außer dass er von Schauspielunterricht besessen war. Ich war doch keine siebzehn mehr!
„Magst du das nicht?“
„Nicht besonders. Tanzen wir lieber.“
Er fügte sich, aber ich spürte, dass ich ihm die Stimmung verdorben hatte. Nach dem Lied bedankte er sich artig, aber kühl und ließ mich stehen. Ich schlenderte herum, flachste ein bisschen mit Tim und Bea über die windschiefen Regale, die sicher bald von der Wand rauschen würden, und beobachtete, wie Benedict ein neues Opfer anpeilte. Ob er es wieder mit der Grillparty-Gabi-Nummer versuchen würde? Und wie lange würde sie diese Falckenberg-Geschichten aushalten?
In der Küche saßen einige Hartgesottene und spielten Skat; das Bad war von jemandem blockiert, der sich – den Geräuschen nach, die durch die Tür drangen – schon jetzt mit Bowle bis in Augenhöhe abgefüllt hatte und den Jahreswechsel sicher nicht mehr bei Bewusstsein erleben würde.
Und in Tims Schlafzimmer lagen zwei, die sich doch recht schnell recht nahe gekommen waren. Na, viel Vergnügen! Ich schloss leise die Tür und traf im Gang auf Irina. „Du hast doch vorhin mit Ben getanzt, nicht?“
„Ja, hab ich. Warum?“
„Warum baggert er jetzt Karin an?“
„Vielleicht, weil ich keine rechte Lust hatte. Lass ihn doch.“
Sie zog mich auf ein durchgesessenes Sofa in einer Ecke hinter einer eingestaubten und halb verdorrten Palme. „Was ist eigentlich mit dir los?“
„Nichts, wieso? Was soll denn mit mir los sein?“
„Ben ist doch wirklich ein schnuckeliger Kerl. Gut, sein Schauspielwahn nervt ein bisschen, aber dass er dir gar nicht gefällt? Worauf wartest du eigentlich?“
„Auf nichts. Was willst du denn? Ich hab mit ihm geredet – eigentlich hat nur er geredet -, getanzt und hab mir sogar einen Kuss gefallen lassen. Aber auf mehr hab ich keinen Bock, nicht in diesem Tempo. Sei doch froh, dass er anderweitig so gut ankommt!“
„Ach, der ist leicht an die Frau zu bringen, er ist ja wirklich dekorativ. Aber warum wolltest du ihn nicht? Bloß, weil du ihn noch nicht so gut kennst? Warum bist du so wählerisch?“
„Warum nicht? Ich hab keine Angst, dass ich am Ende keinen abkriege.“
„Echt nicht? Dein Selbstbewusstsein möchte ich haben, mir macht das schon Angst.“
„Nein, du verstehst mich nicht. Ich bin auch nicht sicher, ob ich am Ende einen habe, aber es macht mir keine Angst. Ich glaube, ich will gar keinen.“
„Echt nicht? Jede will doch einen.“
„Ich nicht. Für mich ist das nichts, glaube ich.“
„Wieso nicht?“
Tja, wieso nicht? Warum schnitt ich überhaupt so private Themen an? Was sollte ich denn jetzt sagen? Weil ich Sex langweilig und unangenehm finde und nicht weiß, was man mit einem Mann sonst anfangen soll? Kaum, das konnte ich doch nicht erzählen! „Weiß ich auch nicht.“
„Stehst du auf Frauen?“
„Nein!“, kreischte ich auf und mäßigte mich wieder, als mich überraschte Blicke trafen. Ich überlegte. „Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Kann man nicht einfach auf gar nichts stehen?“
„Nein, kann man nicht“, behauptete Irina. „Jeder Mensch braucht Liebe.“
„Liebe... Du meinst Sex?“
„Nein. Sex auch, aber Liebe ist doch mehr, findest du nicht?“
Ich zuckte die Achseln. „Was ist Liebe? Begehren? Zuneigung? Argumentationshilfe? Einbildung? Hauptmotiv der Seifenopern? Wann liebt man jemanden? Wenn man von ihm abhängig ist? Ich bin gerne unabhängig. Ach, Irina, amüsier dich mit Peter und ärgere dich nicht mit mir herum, das lohnt sich nicht.“
„Unsinn. Du bist so eine Liebe, und eines Tages findest auch du einen Kerl, der dir klarmacht, wie viel Unsinn du eben geredet hast.“
„Vielleicht.“ Ich hatte auf das Thema schon wieder keine Lust mehr. „Aber dein guter Ben ist es leider nicht.“
„Macht nichts, der ist schon wieder versorgt.“
Irina stand auf und zog Peter auf die Tanzfläche. Eine Frau ließ sich neben mich aufs Sofa fallen, stellte sich als Heidi vor und verwickelte mich in ein Gespräch darüber, ob man Romane im Original oder in der Übersetzung lesen sollte. Wir verglichen die schönsten Stilblüten bekannter Übersetzer (offenbar hatten wir beide Dieter E. Zimmer gelesen) und waren uns schnell wundervoll einig – oder lag das am zweiten Bierchen?
Tim klatschte in die Hände. „Leute, fünf vor zwölf! Jeder nimmt sich Sekt! Und dann ab auf die Straße!“ Lachend und rufend trabten wir die knarzenden Holztreppen herunter und schauten zu, wie drei ganz wichtige Männer die Raketen in leeren Sektflaschen deponierten und dann Feuerzeug bei Fuß dastanden, während wir im Chor rückwärts zählten – der dröhnend laute Fernseher aus der Erdgeschosswohnung gab den Takt vor. Bei Null umarmte jeder jeden, wie üblich, und die Raketen wurden der Reihe nach gezündet. Zischend fuhren sie in den klaren Nachthimmel und explodierten in goldenen, grünen und purpurroten Sternen.
„Los, zum Geldautomaten! Und dann wieder nachtanken!“, rief Tim und ließ die leeren Flaschen mitten auf der Straße stehen. Irina und ich sahen uns an und räumten sie an den Straßenrand. Männer! Sie machten doch nichts als Unordnung!
Ich sah den anderen nach, wie sie um die Ecke rannten, und fand, da ich meine Tasche und meinen Mantel mit hinunter genommen hatte, könnte ich mich jetzt auch auf Französisch verdrücken. Das merkten die doch gar nicht mehr, und nach Mitternacht zogen diese Feste sich bloß endlos hin. Lieber lief ich zu Fuß nach Leiching, dann wurde der Kopf wieder klar.
Ein langer Weg, aber ich merkte es kaum. Hatte Irina Recht? Hatte ich Unsinn geredet? Warum war ich so misstrauisch? Irgendwie verkorkst vielleicht?
Nein, das war sicher übertrieben. Oder doch nicht? Woher konnte das kommen? Ich hatte Max – Max? Michael? Nein, Max – und Bernie nie als so traumatisch empfunden. Blöd, peinlich, unangenehm, ja – aber doch nicht schlimmer, als ein Gedicht vor der ganzen Klasse aufsagen zu müssen oder beim Referathalten im Seminar bei einem dicken Hund erwischt zu werden! Sex war kein Schock gewesen, nur eine gewisse Enttäuschung – und die altbekannte Frage, warum die Romane ein derartiges Gewese darum machten.
Hatte es daran gelegen, dass ich beide nicht besonders gut kannte? Dass sie mir als Menschen eigentlich egal waren? Aber da waren sie doch nicht die einzigen, oder? Waren mir nicht eigentlich alle Menschen ziemlich egal? Wenn hatte ich wirklich gern?
Diese Frage gab mir Stoff zum Nachdenken bis zur Leichinger Straße, die erst jenseits des nun ganz verlassenen Stadtrings anfing. Auf der Kreuzung blinkten die Ampeln gelb und unbeachtet, auf den Bürgersteigen lagen die himbeerroten Pappröhrchen, die von den Raketen übrig geblieben waren, in den Papierkörben und auch daneben steckten leere Sektflaschen, aber die feiernden Menschen hatten sich längst wieder ins Warme verzogen und feierten weiter.
Zurück zum Thema!, rief ich mich zur Ordnung und schritt energisch die Leichinger Straße entlang. Wenn hatte ich wirklich gerne? Mama? Manchmal schon, aber häufiger war das reines Pflichtbewusstsein. Sie war eben kränklich, und einer musste sich ja um sie kümmern. Papa? Wirklich nicht! Warum auch, er mochte mich doch auch nicht. Warum, wusste ich nicht – weil ich ihn verachtete? Weil er lieber einen zweiten Sohn gehabt hätte? Weil ich wusste, was er für ein erbärmlicher Wicht war? Ziemlich wirr, meine Gedanken – auch für ein Uhr morgens.
Tobi? Den konnte ich nicht leiden, und das war mir auch überhaupt nicht peinlich. Das beruhte ja auch auf Gegenseitigkeit; ich fand ihn gewöhnlich, egoistisch, machohaft und ganz allgemein widerlich. Was er von mir hielt, darüber wollte ich lieber nicht länger nachdenken.
Irina? Sie war nett, wirklich. Aber wenn sie morgen anrufen würde und sagen, das nächste Semester gedächte sie in Berlin oder Sydney oder wo auch immer zu verbringen – ich würde sie kaum vermissen. Bea auch nicht. Wer blieb da noch? Esther würde ich zwar gerne mal wieder sehen, aber ich brauchte sie auch nicht. Ich brauchte überhaupt niemanden. Und Männer schon gar nicht. Diesen Freddy, der mich bei stumpfsinnigen Verrichtungen begleitete, alles kommentierte und sie dann brav wegschicken ließ? Recht angenehm im Umgang, der Mann, so fügsam. Aber was sollte mir das? Nein, den würde ich auch nicht vermissen.
War ich eigentlich innerlich tot? Hing ich denn nicht wenigstens an meinem Studium, an der Kunst? Nein, auch nicht. Es freute mich, wenn ich Erfolg hatte, aber wenn ich nach dem Examen statt eines Jobs in der Kunstszene (Auktionshaus wäre nicht schlecht) nur irgendeine Schreibtischarbeit, vielleicht in der Straßenbauverwaltung oder so, bekäme, wäre mir das auch Recht, solange ich davon leben konnte.
Vielleicht liebte ich nur das Geld... Gesetzt den Fall, mein Depot bräche über Nacht zusammen: Wäre ich fix und fertig? Ja, musste ich zugeben, aber nur, weil ich dann erst später ausziehen konnte. Für eine eigene, egal wie winzige oder wie schäbige Wohnung hätte ich jeden Cent ausgegeben. Also liebte ich nur meine Selbständigkeit? So sah es wohl aus...
Mein ganzes Leben lang friedlich und alleine in einer kleinen, hässlichen Wohnung? Egal, das stellte ich mir richtig geruhsam vor. Von acht bis fünf arbeiten, dann eine Kleinigkeit zum Essen besorgen, meine Wohnung pflegen, gemütlich ein, zwei Stunden lesen, spazieren gehen, vielleicht ab und zu ins Kino (ohne jemanden, der dazwischen quatschte), einmal im Jahr ein neues Kleidungsstück, Tobi nie wieder sehen müssen... Schöne Vorstellung! Woher konnte ich noch Geld kriegen?
Schmuck besaß ich, ja, aber den konnte ich nicht einfach verkaufen. Zum Teil gehörte er der Familie (immer von der ältesten Tochter zu tragen), zum Teil hatte Mama mir früher mal Kleinigkeiten geschenkt. Sollte ich ausziehen, würde ich ihn natürlich zurücklassen. Was besaß ich sonst noch? Einen Stapel Lieblingsbücher, recht wenige, weil ich meist die Städtische Bibliothek frequentierte, einen Koffer voller Kleidung – und die achttausend Euro. Wenig für vierundzwanzig Jahre! Gut, noch eine Mappe voller Scheine und einen drei Jahre alten Rechner. Außerdem hatte ich Abitur, sprach fließend Französisch und konnte Auto fahren – auf mich hatte die Welt gewartet!
Die Welt brauchte mich nicht. Toller Gedanke. Immerhin, da vorne war der Zollhausweg, allmählich wurde mir ganz schön kalt. Niemand brauchte mich. Wer würde mich vermissen, wenn ich plötzlich verschwand? Wenn mich zum Beispiel jetzt jemand in ein Auto zerren würde und ich auf Nimmerwiedersehen im Orient...? Blödsinn, die standen bestimmt nicht auf Frauen wie mich.
Aber vermissen würde mich keiner. Der zittrige Professor nicht, der offenbar eine Heidenangst hatte, dass mir sein Themenvorschlag nicht gefiel, Irina und Bea nicht, Esther würde es gar nicht merken, Tobi fände, mir sei Recht geschehen und außerdem wollte er ohnehin alles erben, Mama müsste eben die Arbeit selbst machen. Unsinn, sie würde ihr eigenes Geld nehmen und jemanden engagieren. Und Papa? Papa wäre froh.
Eine reichlich deprimierende Bilanz, stellte ich fest und schloss das Gartentor auf. Es quietschte leise, ich musste es morgen mal ölen. Bis auf Mamas roten Golf war die Auffahrt leer.
Ich schlich mich ins Haus, sperrte ab, ließ die Kette aber hängen und tappte in mein Zimmer, wo ich mich lautlos auszog, mich flüchtig abschminkte und wusch und schließlich ins Bett fiel. Was für ein deprimierendes Jahr tat sich vor mir auf! Öder konnte es nun wirklich nicht mehr werden.
Den Neujahrsvormittag verbrachte ich auf die gewohnte Weise – ich richtete ein Frühstück, das keiner einnahm, ich auch nicht, wusch und bügelte, räumte das Haus ein bisschen auf und setzte mich schließlich an meinen Schreibtisch. Gute Vorsätze!
Was sollte ich mir denn vornehmen? Mein Geld zu verdoppeln und den Magister zu bestehen, das reichte ja wohl. Wenn ich mich wahnsinnig beeilte, konnte ich dann schon im März abgeben? Drei statt der offiziellen sechs Monate Zeit? Das wurde eng... Oder mehr jobben? Zwei Nachmittage im Billigmarkt? Wann denn noch? Oder sollte ich alles absagen, mir einen Dauerbürojob suchen und ansonsten möglichst schnell den Magister machen?
Was würde eigentlich passieren, wenn ich einfach kein Kostgeld mehr zahlte? Dann würde Papa mich rausschmeißen, höchstwahrscheinlich. Oder doch ein WG-Zimmer? Sollte ich Irina fragen? Zweihundert Euro... dann blieben mir - hm, umrechnen… fünfhundert zum Leben, das musste doch reichen? Krankenversicherung, Handy für den Notfall, etwas zu essen... ich aß ja wirklich billig und wenig. Wenn es gar nicht mehr anders ging - ich hatte wirklich keine Lust auf ein Leben nach den Regeln anderer, das kannte ich schließlich schon. Andererseits war ich abgehärtet, es konnte eigentlich kaum noch schlimmer werden.
Als Papa draußen herumrumorte, ließ ich Vorsätze Vorsätze sein, es kam ja eh nichts dabei heraus. Er verschwand in seinem Arbeitszimmer (pompös, in dunkler Eiche, ganz der Vorstandsvorsitzende, zu dem er es nie gebracht hatte). Ich wollte ihn gerade, voller Neujahrsmilde und töchterlicher Ergebenheit, fragen, ob ich ihm einen Kaffee bringen sollte, als ich merkte, dass er telefonierte. Ich lauschte, nur mäßig beschämt.
„Nein. Ich brauche mehr Zeit. Etwa einen Monat, oder zwei.“
„Ich versuche es doch! Eine derartige Summe...“
„Sind Sie wahnsinnig? Dann kriegen Sie gar nichts.“
„Hören Sie auf, mir zu drohen. In zwei Monaten, sicher. Gut, machen wir den ersten März fest.“
Er legte auf und ich hob schon die Hand, um an die angelehnte Tür zu klopfen, als er wieder den Hörer abnahm und hastig eine Nummer eintippte. Auswendig, wie mir schien. Ich ließ die Hand wieder sinken und horchte weiter.
„Ich habe über Ihren Vorschlag nachgedacht.“
„Ja, ich weiß zwar nicht, warum, aber ich rede mit ihr.“
„Nein, das muss man diplomatisch machen...“
Papa und diplomatisch? Da lachten ja die Hühner!
„Wenn diese Notlage nicht wäre... Ja, gut, ich versuche es.“
„Aber sagen Sie mir eins: Warum?“
„Nein, da haben Sie wohl Recht, ich verstehe es wirklich nicht. Aber ich bin Ihnen für Ihr Angebot wirklich dankbar. Nur, von mir alleine hängt das nicht ab, das wissen Sie. Wollen Sie nicht selbst...?“
„Ja, das stimmt natürlich, das habe ich nicht bedacht. Ich rufe Sie wieder an.“ Hm, das klang nach Schulden und dem Versuch, von irgendjemandem Geld zu pumpen. Mit wem wollte er reden? Mit Mama, dass sie ihr Erbe flüssig machte? Sie würde blau anlaufen! Und dann wäre sie finanziell ganz von ihm abhängig, dann könnte sie ja verhungern! Und ich würde im Leben nicht so viel verdienen, dass es für sie auch reichte...
Dieser unzuverlässige Sack, hatte er mal wieder gespielt? Ein Vermögen verzockt und mit heißen Miezen durchgebracht? Der kriegte keinen Kaffee! Ich nahm mir meinen Mantel und verließ das Haus – ein Spaziergang würde meine Laune sicher wieder bessern.
Ich trabte den Zollhausweg entlang, passierte das neue Stadtteilmuseum im alten Zollhaus und bog in die Puellstraße ein. An der vom Blitz getroffenen Eiche vor dem ersten Haus lehnte jemand und löste sich bei meinem Näherkommen vom Baumstamm.