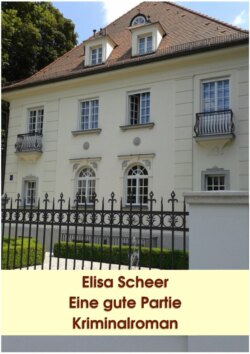Читать книгу Eine gute Partie - Elisa Scheer - Страница 4
Kapitel 2
Оглавление„So sieht man sich wieder.“ Der Satz verfolgte mich offenbar, aber es war tatsächlich Freddy. „Hallo“, meinte ich eher lustlos, „ein gutes neues Jahr und so.“
„Sie sind schlecht gelaunt?“
„Ach, es geht schon. Ein bisschen Neujahrsblues.“
„Wollen Sie spazieren gehen?“
Schlaue Frage – was sollte ich in der extrem unspannenden Gegend an einem Feiertagsmittag sonst machen? „Ja“, antwortete ich mürrisch.
„Darf ich Sie begleiten?“
„Meinetwegen. Aber ich bin keine charmante Gesellschaft, Sie sind gewarnt.“
„Das bin ich auch nicht, machen Sie sich keine Gedanken.“
„Wohnen Sie hier in der Gegend oder ist das ein Zufall?“
„Ein Zufall ist es nicht direkt.“ Blöder Geheimniskrämer. Ich fragte nicht nach, den Gefallen würde ich ihm nicht tun!
„Und warum sind Sie keine charmante Gesellschaft?“
Tat der eigentlich noch etwas anderes als mich auszufragen? Und warum antwortete ich ihm so bereitwillig? Jetzt wieder! „Neujahrsfrust, denke ich. Das habe ich eben doch schon gesagt, oder? Sie wissen schon, gute Vorsätze, aber welche? Ist das Leben zufrieden stellend oder nicht?“
„O ja, ich weiß. Dann haben wir heute wohl die gleichen finsteren Gedanken gewälzt.“
„Sie auch?“
„Natürlich. Wer ist schon mit seinem Leben zufrieden? Aber ich bin immerhin fest entschlossen, das zu ändern.“
„Inwiefern?“
„Ungelegte Eier. Das erzähle ich Ihnen vielleicht später einmal.“
Bitte, dann eben nicht!
„Was macht Ihre Familie?“
„Wahrscheinlich ärgern sie sich gerade, weil ich kein Mittagessen gekocht habe“, murmelte ich voll finsterer Zufriedenheit.
„Drei erwachsene Menschen können sich nicht selbst etwas kochen?“
„Ich glaube nicht. Meine Mutter hat Herzprobleme.“
Er nickte langsam, als sei ihm das schon bekannt. „Mein Vater sieht nicht ein, dass er kochen soll, und mein Bruder findet, für niedrige Arbeiten sind Weiber da.“
„Und deshalb spielen Sie Cinderella?“
„Tu ich nicht.“
„Ach nein?“ Er sah mich von der Seite an und lächelte. Etwas spöttisch, aber es stand ihm ganz gut, er sah weniger streng aus.
„Nein! Cinderella war eine dumme Pute, die wartete, dass eine Fee ihr einen Prinzen verschafft, für den sie dann wahrscheinlich genau die gleiche Arbeit machen musste.“
„Und war das so schlimm?“
„Wenigstens sehe ich nicht, wo da die Verbesserung ist. Klar, die Märchen sollten ja wohl Wohlverhalten lehren, wer brav ist und jeden Ärger widerspruchslos schluckt, kriegt am Ende einen Prinzen. Mir ist die Goldmarie lieber.“
„Goldmarie... ja, Frau Holle, nicht? Aber die ist doch auch häuslich und fleißig?“
„Ja, aber sie verdient sich dadurch Geld. Und am Ende wäre ich an ihrer Stelle nicht zur bösen Stiefmutter zurückgekehrt, sondern hätte mir ein kleines Häuschen gekauft und glücklich für mich gelebt.“
„Das wäre Ihr Traum?“
„Ja“, seufzte ich. „Aber erst muss ich mit meinem Studium fertig werden, dieses Jahr. Dann kommt das Leben. Ich hab lange nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich mich für eine andere Art Leben nicht eigne.“
„Keine Liebe?“
„Nicht schon wieder! Daran glaube ich nicht.“
„Hm. Eigentlich haben Sie Recht, aber Sie klingen so bitter, das finde ich doch schade. Wie alt sind Sie?“
„Vierundzwanzig. Und Sie?“
„Älter. Viel älter.“
„Wie drückt sich das in Zahlen aus?“, hakte ich ungeduldig nach.
„Warum wollen Sie das wissen?“
„Warum machen Sie einen auf geheimnisvoll? Sie fragen mich selbst aus und revanchieren sich nicht. Arbeiten Sie für eine Werbeagentur und wollen meine Zielgruppenzugehörigkeit ermitteln? Ach, lassen Sie, ich will´s gar nicht mehr wissen.“
„Sind Sie jetzt böse?“
„Geht so. Aber ich beantworte keine Fragen mehr. Das Spiel ist mir zu einseitig.“
„Gut, ich versuche, nicht mehr zu fragen. Ich wollte nur wissen, warum Sie so trübsinnig wirken.“
„Ich bin nicht trübsinnig!“, fauchte ich.
„Wenn Sie kein Mittagessen gekocht haben, könnten wir doch etwas essen gehen“, schlug er vor, ohne sich zu entschuldigen, dass er mir Trübsinn unterstellt hatte. „Ich habe keinen Hunger“, entgegnete ich patzig. „Und außerdem muss ich wieder zurück nach Hause.“
„Schade. Ich unterhalte mich gerne mit Ihnen.“
„Ernsthaft? Warum das denn?“
Er zuckte elegant die Achseln. „Warum nicht?“
„So spannend bin ich nicht. Nur Cinderella.“
Er zog die Augenbrauen hoch. „Nur?“
„Ja, nur. Außerdem bin ich ja nicht gerade wahnsinnig charmant, oder? Sie haben mich eben in einem ungünstigen Moment erwischt.“
Warum entschuldigte ich mich jetzt auch noch? War es denn mein Problem, wenn er mich in finsterer Stimmung erwischte und mir dann nicht von der Pelle ging? War ich trotzdem verpflichtet, zuvorkommend zu sein?
„Ich mag charmante Frauen nicht“, antwortete er kühl, „Charme ist doch meistens eher verlogen.“
„Wirklich? Auch, wenn jemand einfach nett und lustig ist? Ich kenne schon Leute, deren Charme echt ist. Das glaube ich wenigstens.“
„Vielleicht. Das ist wohl eine Frage der persönlichen Erfahrungen.“
Sollte ich jetzt nachfragen? Um mir ein neues Ausweichmanöver einzufangen? Wozu denn! Er verabschiedete sich an der Ecke Puellstraße von mir mit einem förmlichen Händedruck. Die Hand war warm und trocken, der Griff fest und energisch. Angenehm. „Wir werden uns sicher wiedersehen. Oder fühlen Sie sich belästigt?“
Ich schüttelte verblüfft den Kopf. „Nein, wieso denn?“ Er sah auf mich herunter, obwohl ich doch wirklich nicht klein war. „Dann ist es ja gut.“
Zu Hause wurde ich von einem wütenden Tobi empfangen. „Wieso ist das Essen nicht fertig?“
„Weil ich nicht die Köchin bin! Mach dir ein Brot oder koch dir selber was!“
Ich schubste ihn beiseite, rannte in mein Zimmer und schloss mich ein. Er hämmerte noch etwas an die Tür, dann gab er es offenbar auf. Solange ich nicht aufs Klo musste, hatte ich meine Ruhe.
Ich blieb stur in meinem Zimmer, bis ich hörte, dass Tobi mit aufheulendem Motor wegfuhr, dann wagte ich mich wieder heraus. Das Haus war still. In der Küche fand ich Mama, die sich hilflos umsah und leicht schwankte.
„Komm, ich mach dir einen Tee“, seufzte ich. „Fühlst du dich schwach?“
„Ja, ein bisschen. Das ist wohl der Hunger.“ Das wurde von einem vorwurfsvollen Blick begleitet. „Mama, wenn du solchen Hunger hast, warum machst du dir dann nicht ein Brot oder isst ein Stück Stollen?“
„Ich hätte lieber etwas Warmes gehabt, aber wenn dir das zu viel Mühe macht...“ Ihre Stimme erstarb.
„Früher hast du immer gesagt, wenn man noch wählerisch ist, hat mein keinen Hunger, sondern bloß Appetit, weißt du noch? Also, was möchtest du?“
„Eine frische Tomatencremesuppe. Tomaten hast du doch gekauft, oder?“
Also kochte ich frische Tomatencremesuppe, mit meinem Schicksal hadernd. Als ich endlich damit fertig war, aß Mama zwei Löffel und murmelte dann, um diese Zeit sei ihr Appetit immer so schlecht... Ich war direkt froh, als Papa alles aufaß, ein sattes Grunzen von sich gab, alles stehen ließ und wieder im Arbeitszimmer verschwand, wo er wieder aufgeregt telefonierte.
Dass ich am zweiten Januar mehrere Führungen und eine Sitzung der Forschungsgruppe hatte, kam mir sehr entgegen – ich konnte meine Familie nicht mehr sehen. Zwischendurch verkaufte ich allen Schmuck, der nicht von der Familie oder von meinen Eltern stammte, für einen lächerlichen Preis bei einem Gold-An-und-Verkaufsschuppen und trug den Erlös auf die Bank. Immerhin verdiente ich in der letzten Ferienwoche ziemlich gut und fand eine Menge Material für meine Magisterarbeit. Außerdem achtete ich nun strenger darauf, keinen Cent für den Haushalt auszulegen: Wenn ich schon für das Privileg, Aschenputtel zu sein, zahlen musste, dann würde ich doch nicht noch mehr Geld investieren!
Irina musterte mich in den ersten Unitagen nach den Weihnachtsferien immerzu mitleidig von der Seite, bis ich mich darüber zu ärgern begann, dass wir in diesem Semester einen derartig ähnlichen Stundenplan hatten. So hatten wir uns ja auch kennen gelernt: Als wir uns zum dritten Mal in der dritten Vorlesung begegneten, mussten wir beide lachen und verglichen dann unsere Stundenpläne. Von ähnlichen Interessen war es dann nicht mehr weit zu gemeinsamen Gesprächsthemen, und die unbeschwerte Irina mit den schwarzen Haarstoppeln und der knallblauen Strähne war wirklich eine angenehme Freundin. Nur dieses Mitleid! Hielt sie mich für psychisch gestört? Für liebesunfähig? Vielleicht war ich das, na und? Jedenfalls wollte ich nicht darüber reden und auch nichts daran ändern.
Ihre Versuche, das Thema anzuschneiden, blockte ich tagelang erfolgreich ab, aber am Freitag in der Cafeteria, wo sie sich zwei Paar Weißwürste genehmigte und ich an einer Breze herumkaute, die garantiert nicht von heute war, entkam ich ihr nicht mehr so leicht.
„Du siehst total unglücklich aus. Was ist denn los?“ Ich brach eine der Brezennasen ab und schob sie in den Mund. „Nichts. Mir geht´s wie immer. Viel Arbeit, wenig Geld, lästige Familie. Meine Mutter ist krank.“
„Das ist aber doch ein Dauerzustand, oder? Ist es schlimmer geworden?“
„Keine Ahnung. Sie sagt ja nichts. Vielleicht ist sie so tapfer. Oder sie will sich als kränker hinstellen als sie wirklich ist - nein, vergiss es, das ist ein gemeiner Gedanke.“
„Warum? Mir scheint ohnehin, dass sie dich ausbeuten.“
„Nur im Vergleich zu Tobi. Aber der ist der Kronprinz. Und sehr viel energischer, wenn es darum geht, mehr zu kriegen und weniger zu tun. Ach, egal.“
„Wieso ist das egal?“ Irinas schwarze Augen musterten mich streng und das Weißwurststück auf ihrer Gabel, mit der sie auf mich zeigte, zitterte empört.
„Weil mich das eigentlich nicht mehr interessiert. Tobi ist mir gleichgültig, ich mag ihn nicht mal – meinen eigenen Bruder. Findest du das mies?“
„Kein bisschen. Warum ist man verpflichtet, jemanden zu mögen, nur weil er zum Teil die gleichen Gene hat? Ich kenne mindestens zehn Verwandte, die ich nicht ausstehen kann, darunter meine älteste Schwester. Die anderen sind okay, aber die – unerträglich. Und nachdem, was du über deinen Bruder erzählt hast... Kannst du nicht rauskriegen, wie krank deine Mutter wirklich ist?“
Ich schüttelte wieder den Kopf. „Mir sagt der Arzt nichts. Ich hab ihn mal gefragt, weil ich dachte, eine Kur... Er ist richtig giftig geworden und hat gefragt, wo die Welt hinkommt, wenn die Kinder hinter den Eltern herspionieren. Er hätte früher alles über mich meinen Eltern weiter getratscht! Seitdem ich achtzehn bin, war ich nicht mehr dort, und das nimmt er mir übel. Ich glaube auch nicht, dass er ein guter Arzt ist, aber das kann ich vielleicht nicht beurteilen.“
„Willst du das Zimmer nicht doch haben? Du richtest dich doch zugrunde, wenn du dort bleibst!“ Die dunklen Augen waren voller Mitleid. „Und essen tust du wohl gar nichts mehr, oder?“
Ich hielt, wie um mich zu verteidigen, den Rest der Breze hoch. „Tu ich doch! Nein, ich kann dort noch nicht weg. Es ist wegen Mama, sonst kümmert sich doch keiner so recht um sie, und vielleicht bin ich ja doch ein Trost, wenn Papa und Tobi sie schon ignorieren.“
„Und wenn du einen richtigen Job hast? Dann überlässt du sie ihrem Schicksal?“ Jetzt hatte sie den Finger auf die wunde Stelle gelegt. „Vielleicht weiß ich bis dahin, wie man ihr helfen kann – oder ob man ihr überhaupt helfen muss. Jetzt jedenfalls kann ich noch nicht weg, obwohl ich sowieso die meiste Zeit nicht da bin. Ach, Irina, ich weiß selbst, dass das alles furchtbar unlogisch ist!“
„Kein Wunder, du willst ihr helfen, traust ihr aber nicht so ganz, und die anderen schikanieren dich. Da wäre ich wohl auch etwas konfus. Vielleicht muss ein Prinz auf einem weißen Ross kommen und dich da wegheiraten.“
„Wie bei Aschenputtel?“ Ich musste lachen. „Das hat mir doch schon mal jemand vorgeschlagen… Vom Regen in die Traufe, was? Nein, das ist keine Lösung. Schau, ich brauche sicher noch ein Jahr, bis ich mit der Uni ganz fertig bin, und bis dahin sehe ich sicher klarer.“
„Und wenn du mich brauchst, weißt du hoffentlich, wo du mich findest, ja?“
Ich nickte dankbar. „Ja. Keine Sorge, ich belästige dich bestimmt.“
„Soll ich dich mal besuchen kommen? Nur kurz? Dann könnte ich einen Blick auf die Mischpoke werfen. Außenstehende sehen manchmal klarer, heißt es.“
„Das wäre vielleicht nicht schlecht“, antwortete ich langsam, „aber das kann ich dir kaum zumuten. Tobi ist wirklich – naja, also...“
„Er wird mich begrabschen und ich trete ihm mit Schmackes in die Eier? Es wird mir ein Vergnügen sein!“ Ich verschluckte mich vor Lachen an dem letzten Stück Breze.
Wir setzten das am Ende der zweiten Uniwoche tatsächlich in die Tat um; ich brachte Irina mit, als ich gegen sechs, mit Einkäufen beladen, nach Hause kam. Sie hatte versprochen, sich über rein gar nichts zu wundern oder zu empören. Wir wuchteten die Einkaufstüten in die Küche und packten gerade aus, als Mama plötzlich in der Küchentür stand.
„Du hast Besuch, Kind?“ Besuch klang aus ihrem Munde irgendwie unfein, als hätte ich unser Haus entehrt oder so. Tatsächlich hatte ich seit über zehn Jahren niemanden mehr mitgebracht.
„Ja, das ist Irina Suchow, wir wollen zusammen an einem Referat arbeiten.“
„Schön, schön, Kind.“ Sie reichte Irina die Hand, die den schlaffen Händedruck sichtlich ängstlich erwiderte.
„Kannst du mir einen Tee machen? Ich fühle mich heute gar nicht so recht... Aber natürlich möchte ich dir keine Last sein...“
„Leg dich nur hin, ich bring dir deinen Tee gleich. Magst du heute Abend Scholle, Reis und Gemüse?“
„Ja, vielleicht eine ganz kleine Portion. Aber wenn ihr arbeiten wollt...“
Die ersterbende Stimme reizte mich, und ich zwang mich, begütigend zu sprechen, während ich den Wasserkocher einschaltete und die Teekanne anwärmte. Irina räumte stetig die Tüten aus und faltete sie dann zusammen, wohl aus lauter Verlegenheit. Mama seufzte auf und verließ langsam die Küche. Hastig verräumten wir die Einkäufe, für die Mama mir immerhin achtzig Euro schuldete (das mit dem Vorherkassieren klappte nicht so recht), ich brachte Mama den Tee und wir deckten den Tisch für das Abendessen.
Wir hatten gerade mal für ein kurzes Gespräch in meinem Zimmer Zeit, wo Irina sich wunderte, wie wenig ich besaß, dann war es Zeit, den Reis aufzusetzen und das Gemüse vorzubereiten.
Papa telefonierte laut und gereizt im Arbeitszimmer, und als ich gerade die Schollen in der Pfanne wendete und Irina den Brokkoli in eine vorgewärmte Schüssel füllte, knallte die Haustür zu, ein Schlüsselbund flog krachend auf die halbantike Bauernkommode, und Tobi rief etwas Unverständliches.
Wir servierten und riefen alle zu Tisch.
Papa war schlecht gelaunt, er warf Irina, als ich sie korrekt vorstellte, nur einen mürrischen Blick zu, als überlegte er, wie viel sie ihm wegessen würde. Tobi musterte sie anerkennend, wobei sein Blick länger auf ihrem hübschen Busen verweilte, der unter dem Norwegerpulli kaum sichtbar war – aber einer wie Tobi wusste, wo er suchen musste.
„Und du bist tatsächlich eine Freundin von Natti?“
„Ja, warum denn nicht?“ Sie sah ihn ruhig an.
Er zuckte die Achseln und bediente sich großzügig aus allen Schüsseln. „Wieso denn Fisch? Ich möchte mal ein anständiges Steak! Hast du einen Freund, Schätzchen?“
„Ich heiße Irina, nicht Schätzchen. Ja, habe ich.“
„Kaum zu glauben.“ Tobi funktionierte perfekt – wenn man ihn vorführen wollte, war er tatsächlich noch dämlicher als sonst. „Warum kaum zu glauben?“
„Eine richtige Frau – und ist mit unserer faden Urschel befreundet? Wahrscheinlich macht die kleine Streberin dir die Hausaufgaben, während du dich amüsierst, stimmt´s?“
„Kaum. Dem entnehme ich, dass Sie -“ sie betonte das Sie so, dass man merkte, wie ungern sie sich ungefragt duzen ließ – „kein Streber sind?“
„Da vermutest du richtig, Schätzchen. Ich weiß die schönen Dinge des Lebens zu genießen. Und du auch, glaube ich.“
„Was hatten Sie für einen Examensschnitt?“
„Geht dich einen Scheiß an, Schätzchen. Wie hast du´s am liebsten? Von vorne? Von hinten?“
„Geht dich einen Scheiß an, Schätzchen“, flötete Irina zurück. Tobi wurde dunkelrot und lachte dann verächtlich. „Noch so eine frigide Streberin! Dein armer Freund! Na, wahrscheinlich hast du ihn dir eh nur ausgedacht, um dich vor mir interessant zu machen.“
„Ach ja? Warum sollte mir daran liegen, vor Ihnen interessant zu wirken?“
„Spiel nicht die Spröde, Schätzchen, ich hab schon verstanden.“
Irina lachte schallend los und hielt sich im letzten Moment die Serviette vor den Mund, um nicht ihr Essen über den Tisch zu sprühen. Mama guckte geschmerzt, Papa musterte Irina angewidert.
„Einbildung ist auch ´ne Bildung, was?“, prustete Irina, als sie wieder Luft bekam. „Nathalie, du hattest Recht, er ist zum Schießen!“
Tobi wurde bleich vor Wut, Papa räusperte sich mahnend. „Junge Frau, Sie sind Gast in diesem Haus. Es gehört sich nicht, die Gastgeber zu beleidigen.“
„Es gehört sich auch nicht, einen Gast wie eine Nutte zu behandeln!“, fauchte Irina zurück. „Der Charme Ihres sauberen Sohnes gipfelt wohl darin, am Ende mit einem Zehneuroschein zu wedeln?“
Papa senkte den Kopf und aß weiter. Ich schob das Reishäufchen, das das Einzige war, was ich in den Schüsseln noch vorgefunden hatte, auf meinem Teller herum und schämte mich für meine Familie. Dass Irina das lustig fand? Und Mama sagte mal wieder gar nichts. Doch, jetzt seufzte sie. „Kind, es tut mir wirklich Leid, aber dieser Fisch ist mir zu fett. Kannst du mir etwas Leichteres machen, ein Omelett vielleicht?"
Ich nickte ergeben. Dabei hatte ich die Schollen extra fettarm gebraten! Irina folgte mir in die Küche, wo ich ein Omelett aus einem Ei und einem zusätzlichen Eiweiß aufschlug und in die Pfanne goss.
„Dass du über Tobi lachen kannst?“, wunderte ich mich dabei.
„Lachen? Ich wollte ihn doch nur ärgern. Ich finde ihn – mit Verlaub – zum Kotzen. Und wie er über dich redet!“
„Er ist ein ordinärer Schleimbatzen. Sorry, aber zu meinem Bruder fallen mir nur grobe Ausdrücke ein. Pass auf, ich bringe nur Mama ihr Omelett und räume den Tisch ab, dann verschwinden wir in meinem Zimmer.“
Tobi war verschwunden, seine Stoffserviette hatte er in die Schüssel mit dem Brokkoliwasser geworfen. Ich fischte sie heraus und hängte sie über seine Stuhllehne, wo das grünliche Ding trocknen konnte. Mama nahm das Omelett mit schmerzlichem Lächeln entgegen. Papa warf mir einen halb finsteren, halb verlegenen Blick zu und verschwand im Arbeitszimmer.
Während Mama aß, räumte ich den Tisch ab.
„Meinst du, deiner Freundin gefällt es bei uns?“, fragte Mama schließlich mit schwankender Stimme. „Warum sollte es? So, wie Tobi sich benommen hat?“, antwortete ich zornig und warf das Besteck klirrend in die leere Reisschüssel.
„Du musst ihn verstehen“, bat Mama, „es nagt an ihm, dass er keine Arbeit findet.“
„Ach ja? Warum sucht er sich keine? Glaubt er, die Chefs klingeln hier und betteln auf Knien, dass er mit seinem miesen Examen bei ihnen eine leitende Position annimmt?“
„Das ist nicht so einfach“, antwortete Mama schwach und presste sich die Hand auf die Brust. Von dem Omelett hatte sie gerade mal zwei Bissen genommen, stellte ich betrübt fest, als sie unsicher aufstand und das Sofa ansteuerte.
Eigentlich hatten mir kräftige Worte über Versager im Allgemeinen und Tobi im Besonderen auf der Zunge gelegen, aber Mamas Anblick erschreckte mich. „Brauchst du deine Tropfen, Mama?“
„Ja, bitte, Kind. Zwanzig Stück in einem Glas Wasser, nicht zu kalt, du weißt ja.“
Ich eilte um ein lauwarmes Glas Wasser, zählte die Tropfen ab, reichte sie ihr, breitete die Decke über ihr aus und räumte den Tisch fertig ab. Irina hatte schon die Spülmaschine gefüllt. „Das ist mir jetzt aber peinlich – für Küchendienste bist du doch nicht gekommen!“, protestierte ich schwächlich.
„Oh doch! Wenn ich wissen will, wie du hier lebst, muss ich doch in deine Rolle schlüpfen. Hat sie das Omelett auch nicht gegessen?“
Ich wies den fast vollen Teller vor. „Komisch.“
„Warum? Sie isst wirklich fast nichts mehr. Mir macht das schon Sorgen.“
„Komisch ist, dass sie doch eigentlich eine ganz normale Figur hat, nicht? Wenn sie immer so isst wie heute – eine Gabel Reis, zwei Löffelchen Omelett, müsste sie bis aufs Skelett abgemagert sein, aber sie sieht total normalgewichtig aus. Du bist viel dünner. Hast du überhaupt was gegessen?“
„Bisschen Reis, es war ja alles weg.“
„Warum schnappt deine Mutter dir den Fisch weg, wenn sie ihn dann doch nicht mag? Und warum lässt dein Vater deinen Bruder herumpöbeln und regt sich dann über meine Manieren auf? Hier stimmt was nicht, finde ich.“
„Was soll nicht stimmen? Sie mögen mich eben nicht. Und ich mag sie auch nicht!“, stellte ich finster fest, knallte die Tür der Spülmaschine zu und schaltete sie ein.
„Und trotzdem lebst du hier? Pass auf, wenn ich mit den anderen rede, können wir mit der Miete sicher noch auf hundertfünfzig heruntergehen. Komm, nur drei Mädels, das wird total lustig, Suzanne ist auch eine ganz Nette.“
„Danke, aber ich brauche keine Almosen. Ihr müsst mir nicht die Miete leihen.“
„Entschuldige, ich wollte dich nicht kränken, aber ich dachte – Mensch, Nathalie, hier kannst du doch nicht bleiben!“
„Doch, ich kann. Und ich muss. Wenn sie mich mal rauswerfen, dann ist das was anderes.“
„Dich rauswerfen? Die werden den Teufel tun, dann müssten sie ja selbst ihre Ärsche hochkriegen!“
„Irina!“
„Ist doch wahr!“, murrte sie und wischte die Arbeitsplatte ab. Tobi schaute in die Küche. „Ich will ´nen Kaffee.“
„Dann koch dir einen“, blaffte ich ihn an. Für Mama, ja – aber für ihn?
„Na, Schätzchen? Und diese Gewitterziege soll deine Freundin sein? Was machst du heute Abend?“
„Meinen Freund treffen. Soll er seine Motorradkumpels mal bei dir vorbeischicken?“, fragte Irina freundlich. „Moto- nö, lass mal. Du verstehst ja auch keinen Spaß, was? Was ist jetzt mit dem Kaffee?“
Ich löschte das Licht und verließ mit Irina die Küche. „Weiß ich doch nicht.“
In meinem Zimmer fing sie wieder an, mir zuzusetzen. „Das ist doch kein Leben! Die beuten dich aus und schikanieren dich – lass dir doch nicht alles gefallen!“
„Keine Sorge – irgendwann komm ich schon hier raus.“
Schließlich gab sie es auf, wir gingen im Leichinger Hof noch etwas trinken und ich brachte sie zum Bus. Als ich dem Bus nachsah, wie er um die Ecke verschwand, kam ich mir sehr stiefkindartig vor – da fuhr sie hin, in ein freundliches und lustiges Zuhause, direkt im Univiertel!
Ich war ja auch das Stiefkind, jedenfalls wurde ich so behandelt. Kurz gab ich mich einem pubertären Traum hin – Papa war gar nicht mein Vater, sondern ein anderer Mann, der Mamas große Liebe gewesen war, und deshalb mochte er mich nicht und sie wagte, aus Angst, verstoßen zu werden, nicht, sich offen zu mir zu bekennen. Sehr überzeugend, wirklich: Ich sah Papa leider ziemlich ähnlich, und Mama mit ihrem Familieneinkommen würde nie verstoßen werden. Und selbst wenn – was verlor sie denn an dem mürrischen Kerl, der dauernd fremd ging und sich kaum um sie kümmerte?
Papas ewige halblaute Telefoniererei nahm schon fast suchtartige Ausmaße an. Ich hatte es aufgegeben, zu lauschen, wahrscheinlich ging es bloß wieder um das Geld, das er irgendwelchen dubiosen Gestalten schuldete.
Ende Januar war ich eigentlich recht zufrieden mit mir, weil ich mehr denn je verdient hatte (schon achttausendsechshunderteinundachtzig Euro standen auf meinem Depotauszug!) und sämtliches Material aus sämtlichen Archiven, Museen und Bibliotheken sich auf meinem Schreibtisch stapelte. Ich wusste sogar schon, wie ich die Arbeit aufziehen wollte, und hatte die Einleitung und das Methodenkapitel schon geschrieben. Mama schleppte sich immer noch zwischen Sofa, Bett und Esstisch hin und her und bat mich um kleine Snacks, die ihr dann nicht schmeckten. Ich beobachtete sie – Irina hatte Recht, wenn sie wirklich so appetitlos war, müsste sie erheblich abgemagerter sein!
Tobi verfolgte eine Frau, die seinen Worten zufolge das Heißeste war, was die die Welt je gesehen hatte. Hochinteressant! Hirn konnte sie keins haben, wenn sie auf ihn einging, aber so war er wenigstens aus dem Haus.
Als Papa mich an diesem Abend in sein Arbeitszimmer bestellte, durchforstete ich hastig mein Gedächtnis – hatte ich etwas angestellt? Das Kostgeld nicht bezahlt? Sollte ich mal wieder etwas Blödes für ihn erledigen? „Setz dich doch! Einen Cognac?“ Was war denn in den gefahren?
„Danke, nein. Ich stehe lieber. Also, was hab ich falsch gemacht?“
„Falsch? Wieso? Nichts natürlich!“
„Das wäre aber das erste Mal“, murmelte ich vor mich hin.
„Ich brauche deine Hilfe“, fing er nach einem tiefen Atemzug an.
„Wobei?“, fragte ich misstrauisch. Sicher etwas Krummes!
„Ich brauche Geld.“
„Du brauchst doch immer Geld. Sorry, ich hab keins.“
„Nicht genug auf jeden Fall.“
„Wie viel brauchst du denn?“ Warum fragte ich denn auch noch!
„Eine größere Summe, äh – ziemlich viel, also, ich weiß auch nicht, wie das –
kurz und gut, äh- “
„Kurz und gut?“
„Eine Viertelmillion.“
„Euro??“ Ich war platt. Das war schon etwas mehr als sonst.
„Natürlich Euro!“
„Was soll ich denn dabei tun? Eine Bank überfallen? Ich denke nicht daran!“
„Nein. Hast du eine Idee?“
„Klar. Verkauf das Haus, zieh mit Mama in eine Mietwohnung und schmeiß Tobi raus. Das Riesengrundstück, in dieser Gegend, ist bestimmt eine Dreiviertelmillion wert.“
„Mama bleibt das Herz stehen! Sie liebt das Haus!“
Was sich allerdings nicht in irgendwelchen Aktivitäten äußerte...
„Außerdem würde das zu lange dauern. Das Problem ist – ich brauche die Summe ziemlich schnell, genau gesagt noch im Februar. So fix lässt sich ein Hausverkauf samt Umzug nicht abwickeln.“
„Was ist, wenn du das Geld nicht rechtzeitig herbeischaffst?“
Er ließ den Kopf hängen. „Dann bin ich meinen Job los und lande im Knast.“
„Du hast in die Kasse gegriffen? Na bravo!“
„Lass deine moralischen Kommentare! Überlege lieber, wo ich das Geld hernehmen soll! Hast du noch Schmuck?“
„Den Familienkram. Der ist keine zweitausend Euro wert, vergiss es. Warum muss ich mir den Kopf zermartern, wenn du deine Firma betrogen hast?“
„Ich hab mir das Geld doch nur geliehen – eine todsichere Anlage, ich hätte es verdoppeln und verdreifachen können, aber...“
„Aber dann kam alles ganz anders, was? Egal, wie du es nennst, du hast deine Firma bestohlen. Sei doch mal ehrlich, auch dir selbst gegenüber!“
Ich kam mir selbst ziemlich moralinsauer vor, aber Papa und Tobi weckten immer meine schlimmsten Instinkte.
„Du kannst mir helfen.“
„Ich? Das ist nicht dein Ernst! Ich verdiene kaum siebenhundert Euro im Monat und muss euch schon mit zweihundert unterstützen. Für eine Viertelmillion müsste ich tausende von Jahren schuften. Und wie käme ich denn dazu?“
„Nicht für mich. Für deine Mutter! Stell dir vor, wenn man mich verhaftet und ihr alles verliert – das überlebt sie doch nicht!“
Ja, das stimmte leider. Ich glaubte zwar nicht, dass sie noch an Papa hing, aber wenn etwas ihre Krankenroutine störte – das vertrug sie nicht. Das würde sicher einen Herzanfall auslösen! „Und was soll ich tun?“, fragte ich misstrauisch, fest entschlossen, sofort abzulehnen, falls der Plan auch nur im Geringsten illegal oder anrüchig wirkte.
„Also, ich kenne jemanden, der würde mir das Geld geben...“
„Eine Viertelmillion? Einfach so? Kann ich mir nicht vorstellen."
„Er will es ja auch nicht umsonst. Er sucht eine Frau.“
„Papa, bist du wahnsinnig? Auch für eine Viertelmillion gehe ich nicht mit einem deiner schmierigen Kumpels ins Bett! Bist du jetzt auch noch unter die Zuhälter gegangen? Das ist wirklich unglaublich!“
Ich verließ das Arbeitszimmer und knallte die Tür zu. Dann sperrte ich mich in meinem Zimmer ein und warf mich aufs Bett. Papa war unerträglich! Kümmerte sich um nichts, nutzte mich in jeder Hinsicht aus, verzockte mehr Geld als er besaß, betrog seine Firma, ruinierte womöglich Arbeitsplätze – und dann wollte er seine Tochter auf den Strich schicken, um das Geld wieder reinzukriegen? Nicht einmal Tobi hätte ich so was zugetraut!
Es klopfte an meiner Tür. „Nathalie, mach doch auf!“
„Ich bin doch keine Nutte!“, kreischte ich, auf meinem Bett liegend. „Du hast ja einen Knall!“
„Du hast das missverstanden. Bitte, Nathalie, ich kann doch nicht so laut reden, sonst hört mich deine Mutter noch.“
„Mir egal! Verpiss dich!“, tobte ich.
„Willst du schuld sein, wenn sie sich aufregt?“
„Wieso ich?“, zischte ich durch die verschlossene Tür, „hab ich eine Viertelmillion unterschlagen oder du?“
„Ich bin doch dein Vater!“
„Ja, leider. Und nicht mein Zuhälter! Lass mich in Frieden!“
Ich wäre gerne ins Bett gegangen, aber ich konnte nicht ins Bad, ohne das Zimmer zu verlassen, und draußen lungerte dieser kranke Vaterersatz herum. Mit irgendeinem seiner widerlichen Freunde schlafen? Wirklich nicht! Gut, Sex machte ohnehin keinen Spaß, man konnte die Augen zumachen und an etwas anderes denken, das hatte ich bei Bernie schon gemacht. Aber so? Gegen Geld? Dann konnte ich mich doch gleich hinter Kirchfelden an die Landstraße stellen!
Außerdem kannte ich Papa – wenn ich einmal zustimmte, dann war ich immer wieder fällig, sobald er Geld brauchte. Dunkel erinnerte ich mich an eine Regency-Erzählung, in der jemand seine Schwester beim Kartenspielen verloren hatte. Allerdings hatte der schöne, junge und völlig betrunkene Gewinner die verstörte junge Frau sofort geheiratet, und da sie schon lange in ihn verliebt war, war sie auch mehr als einverstanden. Was hätte sie gemacht, wenn sie bei einem kugelförmigen, schwitzenden Endfünfziger mit Ehefrau, drei Kindern und sieben Enkeln gelandet wäre? Ich hätte dem Bruder jedenfalls eine gelangt, die er so schnell nicht vergessen hätte!
Vor meiner Tür war mittlerweile Stille eingekehrt. Ich linste durchs Schlüsselloch – der Flur schien leer zu sein. Also schnappte ich mir mein Waschzeug, schoss ins Bad, riegelte mich hastig ein, schrubbte mich, als müsste ich den dreckigen Vorschlag von mir abwaschen, und rannte wieder zurück.
In den nächsten Tagen achtete ich noch sorgfältiger darauf, morgens aus dem Haus zu gehen, bevor jemand anderes wach war, und abends erst zurückzukommen, wenn alle schon schliefen bzw. auf der Piste waren. Damit musste ich zwar mitten in der Nacht meinen Hausfrauenpflichten nachkommen, aber das war immer noch besser, als diese unsägliche Debatte weiterzuführen.
Einmal sah ich Papa im Gang; er warf mir einen leidend-vorwurfsvollen Blick zu, sagte aber nichts. Ach, jetzt wurde ich zur hartherzigen Rabentochter hinstilisiert? Mama lag mit blassen Lippen auf dem Sofa und verschmähte offenbar jedes Essen, von Tobi war nichts zu sehen. Ich versuchte, mich mit der Magisterarbeit abzulenken, meine Vorlesungen und Seminare zur Profilierung zu nutzen und daneben möglichst viel Geld zu verdienen. Die Viertelmillion brächte ich zwar nie zusammen (und wenn, würde ich sie ganz bestimmt nicht Papa geben!), aber der Gedanke an diese astronomische Summe verließ mich nicht mehr. Wie konnte man die aus den Firmenkonten ziehen, ohne dass es irgendjemand merkte? Sicher, Papa war der Geschäftsführer, aber kontrollierte denn niemand von der Holding die Bücher? Oder ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen? Oder war eben deshalb Ende Februar der Termin, bis zu dem das Geld wieder da sein musste? Und wie konnte man in diesen unsicheren Zeiten überhaupt mit hochriskanten Anlagen jonglieren? War Papa denn völlig verrückt geworden?
In den ersten Februartagen erwischte Papa mich doch, als ich abends nach Hause kam, müde und gereizt. „Wir müssen reden. Komm in mein Arbeitszimmer.“
„Ich wüsste nicht, worüber. Deine Nuttennummer kannst du dir abschminken.“
Er zerrte mich ins Arbeitszimmer und schubste mich aufs Sofa. Empört sprang ich wieder auf, aber als ich das Zimmer verlassen wollte, stand er vor der Tür. Jetzt einen Schürhaken! Das blöde Haus hatte natürlich keinen Kamin.
„Du wirst mir jetzt zuhören und den Mund halten, bis ich fertig bin!“
Ich drehte mich um und starrte trotzig aus dem Fenster in den nachtdunklen Garten. „Es geht doch nicht um eine Nacht.“
„Hätte mich auch gewundert, bei so viel Geld. Wie viele Nächte also?“
„Alle.“
Ich fuhr herum. „Was soll das heißen? Verkauf mich doch gleich an ein Bordell!“
„Der betreffende Mann will dich heiraten.“
„Ist der krank oder was? Wer will denn eine Unbekannte heiraten, die gar keine Lust hat? Der soll sich eine Thailänderin oder Russin aus dem Katalog bestellen, die spielen da wenigstens mit.“
„Du solltest doch den Mund halten! Er will aber nun mal dich, ich verstehe auch nicht, warum.“
„Und warum sollte ich das wollen?“
„Schlecht wäre es nicht. Du würdest Mama helfen, sie müsste von der Sache nie erfahren. Du weißt, dass sie das nicht durchstehen könnte! Und – der Mann ist nicht arm. Du wärst eine verheiratete Frau...“
Ich starrte ihn an. „Ist das was Gutes, oder wie?“
Papa starrte zurück. „Aber jede Frau träumt doch davon, zu heiraten. Und du bist ja gar nicht mehr so jung – wer weiß, ob du eine solche Chance jemals wieder kriegst.“
„Die Chance, mir jetzt schon das ganze Leben zu versauen? An der Seite eines deiner ekelhaften Freunde oder der schmierigen Kollegen, die ich immer auf diesen grässlichen Weihnachtsparties abwehren muss?“
„Der Mann ist keiner meiner Freunde und keiner meiner Kollegen.“
„Ach – aber wenn du ihn kennst, ist er doch garantiert nicht koscher! Was ist das für ein kranker Kerl, der sich eine Ehefrau kaufen muss?“
„Er ist nicht krank.“
„Das kannst du doch wohl kaum beurteilen!“, fauchte ich und taumelte im nächsten Moment zurück. Seit mindestens zehn Jahren war das die erste Ohrfeige! Nicht mit mir! Sobald ich wieder fest stand, holte ich reflexartig aus und schlug so zu, dass Papa zu Boden fiel und sich die Wange hielt. Ich stieg über ihn hinweg, riss meinen Mantel von der Garderobe und knallte die Haustür hinter mir zu.
Saukalt, wirklich – und ich hatte die Handschuhe vergessen. Ich stapfte, die Hände tief in den Taschen, wütend durch die Straßen und merkte erst in der Herrnbergstraße, dass es ziemlich angezogen hatte und ich kein Profil mehr auf meinen Stiefeln hatte. Etwas zu schwungvoll bog ich um die Ecke und rutschte aus. Teufel, tat das weh! Ich saß fluchend auf dem kalten, nassen Boden und rieb mir den angeschlagenen Ellbogen, als ich hastige Schritte hörte.
„Kann ich Ihnen – Sie?“
„Sie?“, echote ich dümmlich. Wo kam Freddy eigentlich immer in den seltsamsten Momenten her? Wohnte er hier? Lag er in der Nähe auf der Lauer, um zu gucken, wann ich das Haus verließ? Ziemlich ungemütliches Unterfangen, es hatte bestimmt fünf Grad unter Null!
„Kommen Sie, ich helfe Ihnen auf!“
Ich war von dem ganzen Ärger so erschöpft, dass ich mich nicht wehrte, als er meinen Arm nahm und mich hochzog. „Haben Sie sich verletzt?“
„Nein, nur den Ellbogen angeschlagen.“
„Kommen Sie unter die Laterne, ich glaube, da ist noch mehr.“
„Unsinn“, wehrte ich ab, folgte ihm aber ergeben. „Heben Sie bitte mal den Kopf?“, bat er unter der trüb gelben Laterne, die hier wohl Gemütlichkeit verbreiten sollte.
„Sie haben eine Platzwunde auf dem Wangenknochen“, stellte er dann fest. „Sind Sie aufs Gesicht gefallen?“
„Ich bin doch nicht betrunken!“, begehrte ich auf, „Das ist was anderes.“
„Ja, es sieht auch anders aus. Da sind Sie wohl gegen eine Tür gelaufen?“
„Das geht Sie nichts an“, antwortete ich mürrisch. „Wie Sie meinen. Warum laufen Sie an einem so abscheulichen Abend hier herum?“
„Ich brauchte frische Luft. Und was treiben Sie hier draußen?“
„Ich sammle gestürzte Damen auf.“
„Die wievielte bin ich denn?“
„Die erste. Aber die Nacht ist ja noch lang. Haben Sie Hunger?“
„Nein. Ich möchte nur in Ruhe spazieren gehen.“
„Schon verstanden. Aber es ist wirklich ziemlich glatt – sind Sie sicher?“
„Ja doch.“
„Sie wollen nicht nach Hause zurück?“
„Nicht, bevor alle schlafen“, murmelte ich, aber wohl nicht leise genug.
„Was war das?“, fragte Freddy scharf, und ich erschrak – so autoritär hatte er sich noch nie angehört, und mir fiel wieder auf, dass er viel älter war als ich, fast doppelt so alt. Nein, Unsinn, so viel nun doch nicht.
„Nichts“, brummte ich.
„Ich begleite Sie ein Stück, und dann gehen Sie wieder nach Hause, ja?“
„Meinetwegen“, seufzte ich, von diesem ewigen Gezerre schon wieder ermattet. „Wollen Sie mir nicht sagen, was Sie bedrückt?“
„Nein. Mich bedrückt nichts“, verbesserte ich hastig.
Er seufzte. „Das Lügen sollten Sie aber noch üben, meinen Sie nicht? Sie machen wirklich keinen heiteren Eindruck."
„Ach nein? Tut mir ehrlich Leid“, spottete ich bitter.
„So war es nicht gemeint, und das wissen Sie ganz genau. Wie geht es mit dem Studium voran?“
„Gut.“ Endlich ein unverfängliches Thema! Ich erzählte für meine Verhältnisse direkt ausführlich von meiner Magisterarbeit und den letzten Scheinen, berichtete von der giftigen Debatte zwischen Gegenständlichen und Abstrakten, die ganz plötzlich und ein gutes Jahrhundert zu spät wieder aufgeflammt war und sich an der Zuweisung von Fördermitteln entzündet hatte, und brachte Freddy sogar zweimal zum Lachen.
„Ich mag Ihren ironischen Erzählton“, sagte er schließlich und blieb stehen.
„Ehrlich? Das habe ich auch noch nie gehört“, bekannte ich überrascht.
„Ach nein? Was mögen denn andere an Ihnen?“
„Weiß ich nicht, ich frage nicht und kriege auch nichts Einschlägiges zu hören. Sollte ich nach Komplimenten fischen?“
„Sie müssen doch nicht fischen!“
„Na, wie Sie meinen. Jetzt bin ich ganz brav und gehe nach Hause. Beruhigt?“ Er nickte und fuhr mir leicht mit einem behandschuhten Finger über die aufgeplatzte Wange. „Passen Sie auf sich auf, Nathalie.“
„Sie auch“, antwortete ich mechanisch.
„Ja, das habe ich vor“, erwiderte er und lächelte leicht.
„Nein! Ich habe gemeint, passen Sie auch auf sich auf!“
„Ich weiß, wie Sie es gemeint haben. Und ich weiß, wie ich es gemeint habe. Gute Nacht.“
Er verschwand in der Dunkelheit. Unter der Laterne an der nächsten Ecke wurde seine Silhouette noch einmal sichtbar, dann war er weg. Ich spürte ein seltsames Gefühl, fast, als hätte ich etwas verloren. Eigenartig.
Am Wochenende kam ich der Verwandtschaft natürlich nicht mehr aus, obwohl ich fast bis Ladenschluss beim Großeinkauf herumtrödelte, in der Hoffnung, Papa und Tobi seien schon unterwegs, wenn ich zurückkäme. Waren sie natürlich nicht. Papa zog mich ins Wohnzimmer, da Mama sich ins Schlafzimmer zurückgezogen hatte.
„Hast du dich entschieden?“
„Sicher. Ich denke gar nicht daran. Ich will überhaupt nicht heiraten, und be-
stimmt keinen Idioten, der sich eine Unbekannte für eine Viertelmillion kauft. Der muss doch absolut grässlich sein, sonst könnte er doch kostenlos Frauen anbaggern, bis er die Richtige hat. Und mit so einem soll ich mein Leben verbringen? Herzlichen Dank, wirklich!“
„Er ist nicht grässlich. Er sieht ganz normal aus.“
„Aha! Das sagt man von irgendwelchen Durchgeknallten auch immer, Eigentlich sah er ganz normal aus, wer hätte gedacht, dass er axtschwingend durch die Straßen rennt...“
„Sei nicht so albern. Er ist normal, er ist noch ziemlich jung, ich schätze, um die vierzig, hat tonnenweise Geld und will dich heiraten. Worauf wartest du eigentlich noch?“
„Ja, glaubst du ernsthaft, du findest sonst einen, du fade Kuh?“, fragte Tobi, den ich gar nicht hereinkommen gesehen hatte.
„Heirate du doch eine reiche Schnepfe“, fauchte ich ihn an. „Würde ich sofort, wenn ich eine wüsste, die soviel Geld für meine Dienste abdrückt. Leider kenne ich nur heiße Feger ohne Mäuse. Also wirst du dran glauben müssen. Komm, gib dir einen Ruck, in einem Jahr schon kannst du reich geschieden sein, und dann machen wir uns das schönste Leben.“
„Das läuft ja schon gar nicht! Wieso wir? Wenn du ein schönes Leben willst, dann heirate doch selbst einen Sack voll Geld. Außerdem bin ich nicht so ein Schwein wie du.“ Tobi holte schon aus, aber Papa hielt ihn zurück. Vielleicht hatte er sich überlegt, dass Prügel mich nicht unbedingt geneigter stimmten?
„Denk an Mama, Nathalie. Was soll aus ihr werden? Und wie soll sie das verkraften? Ich habe nur noch drei Wochen Zeit...“
„Woher weißt du eigentlich, wann bei euch die Betriebsprüfungen sind?“, fragte ich misstrauisch. „Sollten die nicht überraschend stattfinden?“
„Das ist ein Routinetermin, keine außerplanmäßige Prüfung“, antwortete er schnell. „Und dann muss Mama zusehen, wie sie mich mitnehmen.“
„Sie werden dich doch wohl in der Firma verhaften“, wandte ich herzlos ein.
„Dann kommen Sie hinterher mit zwei Polizisten an die Haustür, wie bei einem Unfall. Kannst du dir Mama dabei vorstellen?“
Nein, konnte ich nicht. Sie kriegte ja schon Herzrasen, wenn ihr Tee kalt wurde!
„Und wer soll sich dann um sie kümmern?“, fragte ich.
„Was?“ Tobi kapierte mal wieder gar nichts.
„Na, gesetzt den Fall, ich tu´s, dann bin ich doch weg, nicht? Wer versorgt Mama? Ihr zwei kümmert euch doch um nichts!“
„Du kannst ja vorbeikommen“, schlug Tobi gnädig vor.
„Pass mal auf, du Idiot“, schnauzte ich, „wenn – und ich sage ausdrücklich, wenn ich mich von Papa so schäbig gegen seinen verdienten Knastaufenthalt eintauschen lasse, dann glaubst du doch nicht im Ernst, dass ich mit euch noch etwas zu tun haben will? Ihr zwei seid tot, alle beide – ist das klar?“
Als ich es aussprach, erkannte ich, dass der Gedanke fast etwas Verlockendes hatte – kein Papa mehr, kein Tobi, die beiden nie wieder sehen... Tobi schaute wenn möglich noch dümmer drein.
„Ich engagiere eine Pflegerin“, versprach Papa hastig.
„Du? Dir ist doch schon das Haushaltsgeld zu schade! Da fällt mir ein, ich kriege immer noch achtzig Euro von dir, von letzter Woche.“
Papa zückte tatsächlich seine Geldbörse, obwohl Tobi empört schnaufte. „Ich brauche aber auch was! Ich wollte heute in die Schwarze Hexe!“
Papa gab ihm einen Zwanziger. „Das war´s.“
Tobi maulte und wurde aus dem Zimmer geschickt.
„Dir ist klar, dass das nur einmal funktioniert?“
„Wie meinst du das?“
„Na, ich geb dir ein halbes Jahr, dann hast du doch wieder die Polizei auf den Fersen. Was willst du dann machen? Du kannst mich ja schlecht zweimal verheiraten, nicht?“
„Dann bittest du deinen Mann um Hilfe“, schlug Papa hoffnungsfroh vor.
„Hast du eigentlich nichts kapiert?“, fragte ich verzweifelt. „Ich hab´s doch gerade gesagt. Wenn ich mich auf diesen Kuhhandel einlasse, gehöre ich nicht mehr zur Familie. Beim nächsten Mal lasse ich euch verrecken, und mit Mamas Herz braucht ihr dann auch nicht mehr anzufangen, klar? Ich würde euch nach der Hochzeit nicht mehr sehen wollen. Nie mehr.“
„Warum bist du so herzlos?“
„Seit wann kennst du denn solche Worte? Und – Papa?“
„Ja?“
„Mach dich nicht lächerlich, ja?“
Ich knallte die Tür mal wieder hinter mir zu. Sollte ich? Oder nicht? Ich wäre das alles mit einem Schlag los... Aber so ein völlig fremder Kerl, wer wusste denn, welche Macken ich da ertragen musste?
Mama würde Papas Verhaftung nicht überstehen, wohl weniger aus Liebe... aber die Angst vor der Schande, vor den Nachbarn. Das war ein Argument, leider.
Ich würde Freddy nie wieder sehen können – wäre das so schlimm? Ach was! Naja, er war mir schon einigermaßen sympathisch... Aber ich konnte mich ja schlecht mit jemandem treffen, wenn ich verheiratet war! Obwohl, noch harmloser konnte es doch gar nicht sein? Trotzdem... Ach, egal, so wichtig war er mir auch nicht.
Wenn man nur mit jemandem darüber reden könnte! Mama kam natürlich gar nicht in Frage – wenn ich das Ganze überhaupt in Erwägung zog, dann doch nur, um sie zu schonen! Sie fiel schon mal aus. Papa auch, er sah schließlich nur seine eigenen Interessen. Mit Tobi konnte man über gar nichts reden, ich wollte auch gar nicht.
Irina? Sie wäre entsetzt. Sicher, sie hatte Tobi schon unverfälscht genossen und konnte sich mein Familienleben so ungefähr vorstellen, aber dass mein Vater mich an einen Wildfremden verscherbelte, um seinen Hals zu retten, musste sie nicht wissen, fand ich. Das war zu peinlich! Noch peinlicher war beinahe, dass ich mit dem Gedanken spielte, darauf einzugehen, nur um dieser Familie zu entkommen. Nein, Irina kam auch nicht in Frage, und Bea schon gar nicht, mit ihr war der Kontakt auch eher lose.
Esther? Seit Jahren nicht gesehen, wer wusste denn, wie sehr wir uns auseinander entwickelt hatten? Außerdem war sie zwar meine beste Freundin gewesen, aber ich hatte ihr auch nicht alles anvertraut. Über manche Dinge sprach man eben nicht. Ich wenigstens nicht.
Freddy? Wir können uns nicht mehr treffen, ich heirate demnächst. Wen? Weiß ich nicht, ich weiß nur, dass er meinem Vater das Geld gibt, damit der seine Unterschlagungen decken kann. Das hörte sich wirklich unglaublich an. Nein, Freddy kam auch nicht in Frage.
Wusste dieser Mann, wofür Papa das Geld brauchte? Oder hatte Papa ihm eine wilde Lügengeschichte aufgetischt? Mir vielleicht auch? Vielleicht bestand gar keine Gefahr, und er wollte mich bloß endlich irgendwie unter die Haube kriegen? Wie konnte ich das herauskriegen? Und wollte ich das herauskriegen?
War es nicht einfacher, mitzuspielen und dafür aus dem Haus zu kommen? Konnte dieser Mann überhaupt schlimmer sein als Papa und Tobi? Was konnte denn ärgstenfalls passieren? Dass ich dauernd putzen musste? Dass ich nicht weiter studieren konnte? Das sollte er bloß mal probieren! Der Mann kannte mich nicht, er würde es noch bereuen, eine Wildfremde gekauft zu haben, wahrscheinlich wäre er nach einem knappen Jahr heilfroh, sich scheiden lassen zu können.
Vielleicht hatte er kranke Wünsche im Bett... Na und? Sex war so oder so doof, was spielte es da noch für eine Rolle, wenn jemand besonders doofe Vorstellungen hatte? Vielleicht wollte er ganz viele Kinder? Wäre das so tragisch? Wollte ich nicht irgendwann auch Kinder?
Vielleicht war er so wie Papa und Tobi, immer auf der Piste? Umso besser, dann hatte ich doch meine Ruhe! Solange er mich nicht mit irgendwas ansteckte – und das müsste sich doch vermeiden lassen? Ich hatte zwar noch nie ein Kondom in der Hand gehabt, aber theoretisch wusste ich, wie die Dinger funktionierten. Vielleicht verspielte er sein Vermögen (jemandem, der Papa eine Viertelmillion für eine pampige Braut gab, die er nicht mal kannte, was ja wohl alles zuzutrauen) und wir landeten im Elend? Na wenn schon, ich konnte auch arbeiten, und wenn er meinen Hungerlohn versoff oder verspielte, würde ich abhauen, so einfach war das!
Sehr bräutliche Gedanken, wirklich!
Die Vorstellung, Papa und Tobi nie wieder sehen zu müssen, gewann von Moment zu Moment an Reiz. Aber was sollte man denn Mama erzählen? Etwas von einer lang geheim gehaltenen Liebe? Sehr glaubhaft, wenn sie dann einen dicklichen, ältlichen und schwitzenden Manager oder Saufkumpan von Papa traf – denn dass dieser obskure Kandidat nicht aus Papas Bekanntenkreis stammte, kaufte ich ihm nun wirklich nicht ab!
Tja... sollte ich oder sollte ich nicht? Würde es mir überhaupt gelingen, Papa und Tobi auf die Dauer aus meinem Gesichtskreis zu verbannen? Und wie mies war es, jetzt schon eine Scheidung einzukalkulieren? Ach, warum machte ich mir darüber Sorgen? Musste ich wirklich befürchten, mies zu sein gegenüber Leuten, die mich verkauften, um ihre Finanzen zu retten, oder Leuten, die sich eine Ehefrau einfach kauften und dabei die Augen davor verschlossen, wie halbseiden der Verkäufer war? Da brauchte ich auf meinen Charakter nun wirklich nicht mehr zu achten!
Andererseits wollte ich auch nicht auf diesem Niveau spielen, und die offene Frage blieb bestehen: Was erzählte man den Leuten, die die Wahrheit nicht kannten? Mama und Irina, den Rest der Welt würde das Ganze wohl kaum interessieren.
Irina könnte ich weismachen, bei diesem Mann ginge es mir besser als bei Papa und Tobi; sie hatte die beiden gesehen und würde das verstehen, solange auch für Mama gesorgt war. Ob WG-Zimmer oder eheliche Wohnung, Hauptsache raus hier!
Aber Mama – das war schon eher ein Problem! Ach, sollte sich Papa doch eine Lösung überlegen! Ich würde gar nichts sagen. Außerdem war ich mir noch gar nicht sicher. Oder?
Nein. Doch. Wenn ich mich weigerte... Papa im Knast, wegen Untreue oder Unterschlagung oder was auch immer. Wir müssten sicher den Schaden ersetzen, also doch das Haus verkaufen... Ich säße mit der kranken Mama alleine da, im Nacken Tobi, der dauernd herumpöbeln würde, dass ich alleine an der Situation schuld sei (warum sind immer die schuld, die den Tätern nicht beim Vertuschen helfen, nie aber die eigentlichen Täter? Oder sind einfach immer alle anderen schuld?). Das Leben wäre nicht besser, wir hätten nur weniger Platz und weniger Geld. Wie sollte ich denn da mit dem Studium fertig werden und einen Job finden? Irgendeinen Job?
Und wenn ich zustimmte? Ich lebte irgendwo (ich nahm mal an, hier in der Stadt), würde einen hoffentlich nicht allzu üblen Zweipersonenhaushalt versorgen, der Typ war ja wohl von acht bis fünf nicht da, ich konnte zwischendurch sicher in die Uni, in die Bibliothek und in die Museen gehen. Tobi konnte mir im Mondschein begegnen, und eine geduldige Pflegerin überredete Mama, etwas zu essen.
Gut, es konnte mir ergehen wie in Herbstmilch, vielleicht heiratete ich einen Schwung ältlicher Verwandter mit, denen ich die Zehennägel schneiden und das Essen pürieren musste – aber da war ich doch wenigstens nicht zu ergebener Freundlichkeit verpflichtet!
Die Idee gewann immer mehr an Reiz. Eigentlich würde es mir besser gehen als vorher – und dieser Mann wusste doch wohl, dass er sich vielleicht eine pflichtbewusste, aber garantiert keine liebende Ehefrau gekauft hatte! Ich würde ihm jedenfalls nichts vorspielen.
Ganz arm konnte er nicht sein, wenn Papa die Sache mit der Viertelmillion nicht erfunden hatte. Zuzutrauen wäre es ihm freilich! Dass der Mann reich war, verwies ich aber doch ins Reich der Fabel, Papa hielt jeden Menschen für reich, der Geld besaß, dass er selbst gerne gehabt hätte. Und Tobi war genauso: Nur sie beide selbst waren arm, weil es nie für das Partykönig- und Playboydasein reichte, das ihnen vorschwebte. War Papa dafür nicht eigentlich zu alt? Wie alt war er jetzt? Sechsundfünfzig? Was wollten junge Frauen von so einem? So schön war er schließlich nicht, Stil hatte er auch keinen, und er war verheiratet (aber das band er den Mädels sicher nicht auf die Nase).
Ich ging den halben Samstagnachmittag durch den trüben Spätjanuartag spazieren und überlegte. Alles in mir sträubte sich dagegen – ich wollte doch später mal ein Leben für mich alleine haben, damit wäre es dann vorbei.
Aber zu Hause war es auch nicht mehr auszuhalten, und wenn ich nein sagte, würde das nur noch schlimmer. Das Argument hatte ich schon von allen Seiten beleuchtet – was gab es denn noch? Mir fiel nichts mehr ein, und ich kehrte um und ging nach Hause zurück. Als ich um die Ecke bog, stand ein Ambulanzwagen vor der Tür.
O Gott! Ich blieb einen Moment wie erstarrt stehen, dann rannte ich los, die Einfahrt entlang, durch die offene Haustür, ins Wohnzimmer. Mama lag auf dem Sofa, mühsam atmend, ein Sanitäter zog gerade die Nadel einer Spritze aus ihrem Arm und tätschelte ihr die Hand, der andere räumte seinen Koffer wieder ein.
„Nichts Ernstes, Herr Roth“, meinte der erste, „aber achten Sie darauf, dass ihre Frau sich nicht aufregt. Das Herz scheint etwas ungleichmäßig zu schlagen. Sie sollten vielleicht doch mal das Herzzentrum in München aufsuchen, dort könnte man eine präzisere Diagnose stellen, Langzeit-EKG und so. Ich lasse Ihnen ein Informationsblatt da, wenn Sie wollen.“
Papa nickte und nahm das Blatt, das er dann achtlos auf den Esstisch legte. Dann fiel sein Blick auf mich. „Wo warst du?“
„Spazieren. Was ist mit Mama?“
„Sie hatte Schmerzen und bekam keine Luft mehr.“
„Was war vorher? Hat sie sich aufgeregt?“
„Ja... sie konnte das Buch nicht finden, das sie lesen wollte. Wo hast du es hingelegt?“
„Welches Buch?“
Der zweite Sanitäter betrachtete Papa mit gerunzelter Stirn. „Schuldzuweisungen bringen in solchen Fällen gar nichts.“
O doch! Ich wusste, was Papa vorhatte – ab jetzt würde jeder Anfall Mamas meine Schuld sein, weil ich ihn nicht gerettet hatte. Er musste dann gar nicht mehr da sein, um das explizit zu sagen... ich hätte es längst verinnerlicht und würde mein Leben damit verbringen, nichts zu tun, was Mama aufregen konnte. Und sie regte sich leicht auf, über Kleinigkeiten, darüber, dass sie nicht mehr aussah wie fünfundzwanzig, dass ihr Buch nicht da lag, wo sie es gesucht hatte, dass der Tee zu stark, der Fisch zu fettig und ihr Appetit zu schwach war, dass ich nicht da war, wenn sie mich brauchte, dass ich nicht freudig genug sprang, wenn sie überlegte, was ihren Appetit vielleicht – vielleicht! – reizen konnte, dass ich zu Tobi unhöflich war... Nicht etwa darüber, dass ihr Sohn ein egozentrischer Versager war, ihre Tochter hier versauerte und ihr Mann sie seit Jahren betrog! Und alles, aber auch alles wäre meine Schuld!
Ich sah Papa quer durchs Zimmer in die Augen. „Okay“, sagte ich dann. Er nickte in sofortigem Verstehen, und ich machte mich daran, das Buch zu suchen. Ich fand es auf Mamas Nachttisch, wo sie es selbst vergessen hatte, brachte es ihr, wickelte die Decke fester um sie, brachte die Sanitäter zur Tür, kochte schwachen Tee und legte leise Barockmusik auf, wie Mama sie liebte.
„Alles in Ordnung?“
Sie nickte müde, also verließ ich sie und betrat das Arbeitszimmer, ohne zu klopfen. Papa hatte gerade den Hörer abgenommen und legte hastig wieder auf, als ich eintrat.
„Ich habe einige Bedingungen. Erstens: Du besorgst eine kompetente Pflege für Mama.“ Er nickte, und ich wusste genau, er würde es nicht tun.
„Ich schreibe dir alles auf und will eine Unterschrift von dir, also verlass dich lieber nicht darauf, dass ich das sofort wieder vergesse.“
Er nickte wieder.
„Zweitens: Du denkst dir eine Geschichte für Mama aus, warum ich plötzlich einen Unbekannten heirate und verschwinde. Drittens: Du besorgst mir die Faxnummer von dem Kerl. Ich will ihn vor der Trauung nicht sehen und nichts von ihm wissen, er soll nicht glauben, dass das etwas anderes als ein Geschäft ist. Wir werden alles per Fax regeln.“
„Du hast doch gar keins!“
„Ich nicht, aber ich weiß, wer eins hat. Das genügt ja wohl. Den Termin soll der Kerl festsetzen. Standesamt reicht, ich kann bei einem Vertragsabschluss auf Gottes Segen verzichten. So, jetzt kannst du ihn anrufen.“ Damit verließ ich das Zimmer, ohne Papa Gelegenheit zu einer Antwort zu geben.
In meinem Zimmer schaltete ich den Computer ein und tippte das Dokument, mit dem Papa sich verpflichten sollte, für Mama kompetente Pflege sicherzustellen und mir nach der Hochzeit nicht mehr unter die Augen zu kommen. Worauf konnte ich ihn noch festnageln? Dass er seine Finanzen in Ordnung brachte? Nein, das war wirklich ganz alleine sein Problem. Ich druckte das ganze aus, samt Ort und Datum, und brachte es ihm. Papa unterschrieb widerspruchslos und reichte mir einen Zettel mit der Faxnummer.
„Er war ein bisschen erstaunt, aber er meinte, wenn du es so willst...“
Ich warf einen Blick ins Wohnzimmer, wo Mama döste, schaltete den CD-Player wieder ein und machte mich daran, das erste Fax zu entwerfen.
Wie sollte ich ihn anreden? Ich kaute auf einem Bleistift herum und überlegte, dann beschloss ich, die Anrede einfach wegzulassen, und tippte zügig drauf los.
Bitte regeln Sie alles für die standesamtliche Trauung nach ihrem Gutdünken und teilen Sie mir mit, wohin ich welche Dokumente schicken soll. Ich nehme an, dass man eine Geburtsurkunde braucht, ansonsten kenne ich mich nicht aus.
Es genügt, wenn Sie mir den Termin der Zeremonie und den Dresscode mitteilen. Wenn Sie einen Ehevertrag wünschen, informieren Sie mich bitte, wann ich wo was unterschreiben soll – aber bitte nicht in Ihrer Gegenwart.
Mit freundlichen Grüßen, Nathalie Roth
Ich las mir alles noch einmal durch und löschte dann das Mit freundlichen Grüßen wieder. Dann schrieb ich die Faxnummer vom Trieste dazu und druckte das Dokument aus. Tiziano war mit mir zur Schule gegangen, konnte den Mund halten, kam als Juniorchef jederzeit an das Fax im Büro seines Vaters heran und der Laden hatte täglich von elf bis Mitternacht geöffnet – auch heute. Ich steckte das Schreiben sorgfältig in eine Hülle, nahm etwas Geld mit und machte mich auf ins Trieste, wo am späten Samstagnachmittag nicht gerade viel los war. Tiziano stand hinter der Bar und zwinkerte mir zu. Ich setzte mich zu ihm, akzeptierte ein Glas Bardolino und setzte ihm mein Anliegen auseinander.
„Kein Problem. Wenn du mit deinem Wein fertig bist, gehen wir ins Büro.“
„Lieber gleich, es kann sein, dass ich schnell eine Antwort kriege, dann kann ich doch gleich hier darauf warten.“
„Va bene. Dann komm mal mit.“
Das Büro war düster und peinlich aufgeräumt, das Faxgerät ein schickes neues Modell. Ich fädelte das Blatt ein, tippte die Nummer und drückte auf Senden. Dann wartete ich gespannt, und tatsächlich begann das Gerät schon nach wenigen Minuten wieder zu rattern. Saß der neben seinem Faxgerät?
Tiziano zog das Blatt heraus, warf einen Blick darauf und reichte es mir schul-terzuckend. Enttäuscht sah ich es an. Erfolgreiche Sendung.... mehr nicht.
„Komm, trink deinen Wein, danach schauen wir nach, ja?“
Ich fügte mich. „Und, wie geht es dir so?“, fragte ich, als ich wieder an der Bar saß. Tiziano schenkte mir nach und schob mir ein Schälchen Salzmandeln hin. „Gut. Sehr gut. ich habe im Sommer geheiratet, und jetzt bekommen wir unser erstes Kind. Papa und Nonno sind schon ganz aufgeregt, ob es ein Sohn wird, der eines Tages das Restaurant übernehmen wird. Luciano soll er heißen.“
„Glückwunsch. Und wenn es ein Mädchen wird? Kann sie dann kein Restaurant führen?“
„Doch, natürlich. Bis sie alt genug ist, ist der Nonno doch bestimmt hundert und kann nicht mehr zetern. Ein Mädchen soll Chiara heißen.“
„Chiara...“, wiederholte ich nachdenklich. „Klingt sehr hübsch. Warum hören sich im Italienischen alle Namen so viel besser an als bei uns?“
„Weil die Sprache melodiöser ist? Ich weiß es auch nicht.“
„Hast du nicht ziemlich früh geheiratet?“
Tiziano zuckte die Achseln und steckte sich eine Zigarette an. „Finde ich nicht. Ich bin fast fünfundzwanzig, also alt genug. Papa hat mit einundzwanzig geheiratet. Und du? Wann willst du´s wagen?“
„Bald. Das Fax – das sind die Verhandlungen.“
„Was? Wer ist denn der Glückliche?“
„Ob er glücklich wird, steht noch dahin“, murmelte ich in mein Glas, „lach nicht, aber ich kenne ihn nicht. Mein Vater hat das eingefädelt. Du, es kann sein, dass noch mehr Antworten kommen. Legst du sie für mich beiseite?“
„Klar. Papa kümmert sich nie um das Faxgerät, und der Nonno hält das alles für Teufelszeug. Ich hebe sie dir auf. Woran erkenne ich sie?“
„Das weiß ich nicht. Ich denke, sie klingen geschäftsmäßig und sind nicht unterschrieben. Vielleicht tragen sie meinen Namen als Anrede, den kennt er ja. Wenn du mit einem Fax überhaupt nichts anfangen kannst, dann leg es für mich beiseite.“
„Mach ich. Übrigens, Gianna lässt dich grüßen. Sie studiert immer noch in Padua, und nach dem, was sie schreibt und am Telefon erzählt, wird sie wohl auch dort bleiben. Anscheinend hat sie dort auch einen Mann kennen gelernt. Mamma war schon in heller Aufregung, ob da auch alles mit rechten Dingen zugeht.“
„Du meinst, ob sie dann noch in Weiß heiraten darf?“
Tiziano lachte. „Genau. Wer keine Sorgen hat, der macht sich welche, so sagt man doch, oder?“
„Richtig. Glaubst du, es ist schon eine Antwort da?“
„Bräutliche Aufregung?“
„So ähnlich“, murmelte ich und folgte Tiziano ins Büro zurück. Tatsächlich, zwei Blätter! So eine lange Antwort?
Nein, das erste stammte von einem Getränkelieferanten. Ich reichte es Tiziano, der kurz fluchte und das Zimmer verließ. Das zweite stammte von meinem unbekannten Zukünftigen. Nach einer kurzen Übersicht, welche Papiere ich umgehend an die Adresse einer Kanzlei in der Tiepolostraße schicken sollte, schrieb er weiter:
Ich denke, wir sollten den letzten Freitag im Februar ins Auge fassen, wenn Ihnen das Recht ist. Dunkler Anzug bzw. dunkles Kostüm – ich gehe nicht davon aus, dass Ihnen nach bräutlichem Weiß zumute ist?
Einen Ehevertrag halte ich nicht für notwendig, ich schlage die normale Zugewinngemeinschaft vor. Würden Sie mir mitteilen, wie viele Gäste Sie mitbringen möchten?
X.
P.S. Zuerst hat mich Ihr geschäftsmäßiger Ton irritiert, aber er scheint diese etwas ungewöhnlichen Verhandlungen tatsächlich zu erleichtern. Vielen Dank!
Himmel, hieß der Xaver oder so? Oder war er einfach Mr. X, wie beim Spiel Scotland Yard? Von mir aus konnte er auch Eusebius oder so heißen.
Ich setzte mich an den Schreibtisch, nahm mir ein leeres Blatt und schrieb in meiner schönsten Schrift:
Ich habe nicht vor, Gäste mitzubringen, fürchte aber, dass meine Familie (drei Personen) teilnehmen wird. Der Termin ist in Ordnung, ein dunkles Kostüm habe ich. Die Unterlagen bringe ich am Montag zu der angegebenen Adresse. Eine eventuelle Antwort kann ich leider erst morgen abholen.
N.R.
Dann schickte ich dieses Fax auch ab, wartete auf die Bestätigung, rollte alle Blätter zusammen und verließ das Büro wieder.
„Tiziano? Vielen Dank! Was kriegst du von mir? Ist ein Euro pro Seite in Ordnung?“
Tiziano überlegte, seine Gedanken waren nur zu deutlich zu erkennen: Einerseits wollte er natürlich einer alten Schulfreundin kein Geld abknöpfen, andererseits würde sein Papa ihn loben, wenn er es auch noch schaffte, das Fax zu vermieten. Papa siegte.
„Gut. Aber dann war der Wein meine Einladung!“ Das nahm ich gerne an und gab ihm ein Zweieurostück.
Mit meinen Faxen und Antworten kam ich wieder nach Hause und verschwand sofort in meinem Zimmer, wo ich diese abseitige Korrespondenz sorgfältig in einer Mappe verstaute. Dann suchte ich mir die notwendigen Unterlagen heraus, verpackte sie ebenfalls und legte sie bereit, für Montag.
Was würde ich mitnehmen zu meinem Ehemann? Seltsames Wort... In amerikanischen Serien sagten die Frauen das immer ganz stolz, aber die waren ja auch auf Heiraten fixiert, weil Sex prinzipiell etwas Böses war. Ich fand Sex nicht böse, nur überflüssig. Vielleicht würde ich später nicht mein Mann sagen, sondern seinen Namen benutzen. Natürlich, wenn er wirklich Eusebius hieß... Bei der Trauung würde ich seinen Namen ja dann wohl erfahren, spätestens, wenn ich die Urkunde unterschrieb – das musste man doch, oder?
Packen musste ich wohl kaum jetzt sofort, ich sollte lieber mal nach Mama sehen, überlegte ich mir.
Mama lag mit ihrem Buch auf dem Sofa, lächelte schwach und klagte über Beklemmungen und darüber, dass ihr Tee kalt geworden sei. Tobi sei auf eine ganz wichtige Party eingeladen und kleide sich gerade an. Dieser Stolz in ihrer Stimme! Ich kochte frischen Tee und versuchte, mich nicht zu ärgern. Als ich mit dem Tee ins Wohnzimmer trat, stand Tobi vor dem Sofa und ließ sich bewundern – weiße Jeans, weißes Hemd, Sonnenbrille (Ende Januar??) und eine bunte, goldbestickte Krawatte.
„Elvis lebt?“, fragte ich spöttisch und stellte die Teetasse neben Mama ab. Tobi schnaufte nur, sagte aber nichts. Genoss ich jetzt Schonzeit, weil ich den beiden so viel Geld einbrachte? Mein Kaufpreis war ja wirklich recht ansehnlich! Und ich war sicher, dass Tobi einen Teil davon abkriegte, sicher waren die Defizite nicht so hoch, wie Papa behauptet hatte. Er log doch immer!
Ich ging an Papas Arbeitszimmer vorbei und teilte ihm kalt mit, dass die Veranstaltung am letzten Freitag im Februar stattfinden würde. „Das ist der Zweiundzwanzigste, ich hoffe, das reicht noch, um das Geld wieder zurückzulegen.“ Mitten in seinen verlegenen Dankesbezeugungen schloss ich die Tür. Das musste ich mir wirklich nicht anhören!
Bis zum Zweiundzwanzigsten waren es noch knapp drei Wochen. Viel war nicht zu tun, ich musste nur packen, was ich mitnehmen wollte, und den Rest vernichten. Ein Kostüm für die Trauung hatte ich schon, Schuhe auch (wozu etwas Neues kaufen?), Schmuck nicht, weil ich ihn hier zu lassen gedachte.
Lieber sollte ich mich auf die Magisterarbeit und meine letzten – eigentlich überflüssigen - Scheine konzentrieren! Also setzte ich mich an meinen Computer und begann zu arbeiten.
Am Montag brachte ich alle Dokumente in die Kanzlei, die mein künftiger Mann mir genannt hatte. Sowohl die Sekretärin, bei der ich um einen kurzen Termin bei Dr. Eichner bat, als auch Dr. Eichner selbst, ein noch recht gut aussehender Endfünfziger, musterten mich verstohlen und neugierig, sobald ich meinen Namen genannt hatte. Der würde es doch wohl nicht sein? Ganz schön alt... Nein, der trug einen Ehering und hatte ein Foto mit Frau und Kindern auf dem Schreibtisch stehen. Warum guckte er dann so? Ich starrte etwas pikiert zurück, bis er den Blick senkte und die Dokumente durchsah. „Vollständig, ja. Vielen Dank. Wünschen Sie in irgendeiner Hinsicht Beratung?“
„Ich wüsste nicht, worüber. Aber vielen Dank für das Angebot.“ Ich stand auf und ließ mich zur Tür geleiten. Sein Blick wirkte schon wieder so konsterniert. Gut, ich trug Jeans, Pullover und etwas abgetretene Stiefel, aber es war schließlich immer noch Winter, erst der vierte Februar! Was passte ihm denn nicht? Kamen andere Mandanten immer im eleganten Kostüm hierher? Außerdem war ich keine Mandantin, ich hatte ja nur etwas abzugeben! Ich war froh, als ich wieder draußen war, und strebte eilig zur Unibibliothek zurück, wo ich wieder etwas abzuholen hatte. Unterwegs kam ich bei Prechtinger & Garm vorbei. Normalerweise fand ich die Schaufenster einer Spedition nicht so wahnsinnig spannend, obwohl die winzigen Umzugslaster, die über den Boden krochen, schon niedlich waren, aber heute fiel mir das Plakat auf. Aufbewahrung – Schließfächer – Container. Ich trat ein.
Tatsächlich, man konnte ein großes Schließfach für ziemlich wenig Geld mieten – und hier kam ich immer vorbei, wenn ich in der Uni war, also konnte ich, was ich fertig gepackt hatte, hier abstellen. Sehr praktisch! Sie hatten auch recht günstige Reißverschlussboxen aus durchsichtigem Kunststoff mit Henkeln; ich nahm vier Stück mit, Platz sparend gefaltet, und verstaute sie mühsam in meiner Unitasche. Die müssten doch fast reichen?
Irina, die ich in der Vorlesung über den italienischen Manierismus traf, sagte nichts, als das Plastikzeug immer wieder aus meiner Tasche zu quellen versuchte. Wir schrieben beide stumm und eifrig mit (gutes Examensthema!), und erst, als wir schon getrampelt hatten und unseren Kram einzusammeln begannen, sprach sie.
„Du siehst irgendwie besser aus, finde ich. Weniger angespannt. Geht´s deiner Mutter besser? Hat man Tobi tot in einem Puff aufgefunden?“
„Das leider nicht“, kicherte ich, „aber ich fühle mich auch besser. Vielleicht kommt der Frühling. Und der Magister geht ganz gut voran, ich hab schon fast dreißig brauchbare Seiten. Und ungefähr fünfzig, die der reine Schwachsinn sind.“
„Besser als nichts. Schwachsinn ändern ist allemal besser, als auf den leeren Bildschirm zu glotzen.“
„Eben. Wenn ich echt gut bin, hab ich das Ding vielleicht sogar schon Ende März fertig!“
„Hetz dich doch nicht so! Ich versteh dich ja, aber was nützt dir ein schlechter Magister? Damit kriegst du nie eine wirklich gute Stelle!“
„Ja, vielleicht. Ich schau mal, wie weit ich bis zum Termin gekommen bin. Gehst du was essen oder gleich in die Surrealismus-Vorlesung?“
„Was essen. Und du strebst weiter?“
„Klar, du kennst mich doch!“
„Da bin ich mir nicht so sicher“, antwortete Irina zu meinem Erstaunen, „ich glaube, hinter der zurückhaltenden Fassade steckt mehr.“
„Ernsthaft? Das bildest du dir ein. Ich bin so, wie es aussieht, eine langweilige kleine Streberin, die sich nach einem ordentlichen Job und einem Einzimmer-Appartement verzehrt – das sie nie haben wird.“
„Warum nicht?“, fragte Irina erschrocken. Ich winkte ab – beinahe hätte ich mich verplappert! „Ach, nichts. Manchmal glaube ich eben, ich komme da nie raus. Vergiss es, das ist nur ein Bluesanfall. Guten Appetit! Heute sehen wir uns nicht mehr, ich hab nachher drei Führungen nacheinander.“ Irina winkte mir nach, als ich mich mit der Menge zum Ausgang schob. Surrealismus... das war am anderen Ende des alten Unibaus.
In den nächsten Tagen amüsierte ich mich, wenn ich nicht gerade Tee oder leichte Kleinigkeiten für Mama zaubern musste, die sie dann doch nicht aß, damit, meine Sommersachen durchzusehen, sie bis auf drei wirklich schöne T-Shirts, zwei pastellfarbene Paar Jeans, einen schwarzen Badeanzug und ein Paar dunkelblauer Ballerinas in die Altkleidertonne zu stecken, den kläglichen Rest zu waschen und zu bügeln, ihn mit Duftkissen in der ersten Plastikbox zu versenken und dann zu überlegen, was noch in diese Box passen könnte, denn es war noch reichlich Platz. Meinen Winterkram brauchte ich noch. Die alten Wollhandschuhe konnte ich wegwerfen, ein Paar aus Leder reichte schließlich, aber der Rest war im Moment noch unverzichtbar.
Schließlich packte ich das Minifotoalbum mit den Bildern, von denen ich sämtliche Familienmitglieder weg geschnitten hatte, noch dazu und die Mappe mit allen meinen Zeugnissen, Scheinen und sonstigen Dokumenten, außerdem die zehn allerliebsten Bücher, die ich besaß, sorgfältig abgestaubt.
Diese Box landete am nächsten Morgen, als ich mal wieder auf dem Weg zur Unibibliothek war, gleich in dem Schließfach, das ich gemietet hatte.
Professor Werzl, der immer noch eigenartig nervös war, wenn ich in seine Sprechstunde kam, lobte meine Fortschritte mehr, als sie es verdienten, und wieselte um mich herum, dass es mir schon fast peinlich war. Er würde es doch nicht sein? Aber woher sollte ein Kunsthistoriker um die Fünfzig denn eine Viertelmillion Euro haben? Geerbt? Vielleicht machte er Gutachten für Sotheby´s?
Nein, wenn man ihn etwas länger beobachtete, schien er mir doch eindeutig vom anderen Ufer zu sein. Vielleicht machten Frauen ihn einfach nervös? Ach, das war doch auch egal! Jedenfalls war er´s nicht; in seiner Position musste man auch nicht heiraten, um seine wahren Neigungen zu tarnen. Dass er sich über meine Fortschritte so übertrieben freute, konnte ich schließlich auch für meinen Nutzen einsetzen – vielleicht stand da eine Traumnote ins Haus? Jedenfalls versprach ich ihm, zum nächsten Termin, Anfang März wieder in die Sprechstunde zu kommen und neue Erkenntnisse vorzulegen. In dieser Woche kam via Tiziano noch ein Fax des Unbekannten.
Die Trauung findet am 22.2. um 11.00 im Rathaus statt. Möchten Sie Trauzeugen? Vom Gesetz her ist es nicht mehr notwendig. Ich gehe davon aus, dass Sie, speziell vor Semesterende, keinen Wert auf eine Hochzeitsreise legen. Das würde zu unserer ungewöhnlichen Situation wohl auch nicht passen.
Bitte melden Sie sich, wenn Sie noch irgendeinen Wunsch bezüglich der Zeremonie haben, und teilen Sie mir ihre Ringgröße mit.
X.
Er stand mir an Kälte in nichts nach. Gut, jemand, der sich womöglich in heißer Liebe nach mir verzehrte, wäre doch eher peinlich gewesen. Von Tiziano beobachtet, griff ich nach einem Briefbogen und schrieb:
Trauzeugen halte ich für unnötig. Meine Ringgröße ist 1,80 cm. Sind Trauringe denn wirklich notwendig? Selbstverständlich habe ich keine besonderen Wünsche, das kommt doch wohl eher Ihnen zu, nicht? Bitte zögern Sie nicht, sie zu äußern!
N.
„Ziemlich seltsam“, kommentierte Tiziano, als ich den Bogen ins Gerät schob.
Ich zuckte die Achseln. „Ich habe das nicht arrangiert, aber ich bin einverstanden. Der kalte Ton ist mir ganz recht.“
„Du heiratest ohne Liebe?“
„Natürlich. Ich glaube nicht an die Liebe.“
„Du Arme! Ich schon. Wenn Maria und ich uns nicht lieben würden, hätten wir nie geheiratet, wie sollten wir sonst zusammen leben können?“
„Ich habe bis jetzt mit meinen Eltern zusammen gelebt, und das ging auch.“, wandte ich ein. „Und die liebst du nicht?“
„Nein. Papa kann ich nicht ausstehen, Mama tut mir meistens nur Leid. Ich glaube, ich heirate auch, um da herauszukommen.“
Die ganze Wahrheit war das nicht, aber die konnte ich ja auch niemandem erzählen. Wenigstens war jetzt alles geklärt! Ich brachte das schwarze Kostüm in die Reinigung, polierte die schwarzen Lackpumps, suchte die geeignete Wäsche aus und sortierte meine paar Habseligkeiten weiter.
Alle Uniunterlagen, Mitschriften, Seminararbeiten und sonstiges Material landete in zwei vollgepropften Ordnern, die ich in der zweiten Plastikbox versenkte; die dabei eingesparten Ordner landeten, eselsohrig, verbeult und zum Teil mit ausgeleierter Mechanik, in der Mülltonne, bis auf einen, in den ich all mein Magistermaterial verstaute. Der Unbekannte wusste also, dass ich studierte, und nahm sogar Rücksicht darauf. Das fand ich eigentlich nett. Vielleicht war er ganz okay?
Nein, rief ich mich schnell zur Ordnung, wenn er wirklich okay wäre, hätte er mich Papa nicht abkaufen und dadurch meine ganze Zukunft auf den Kopf stellen müssen! Nur ein kranker Kerl machte so etwas! Aber wenn ich Glück hatte, war er bloß krankhaft schüchtern. Allerdings konnte ich mir eher vorstellen, dass eine Viertelmillion Euro ihm das Recht gab, Wohlverhalten und Gehorsam von seiner Ehefrau zu verlangen. Nun, das sollte er haben, aber nicht mehr. Ich würde gehorchen, den Haushalt machen, stets um Erlaubnis fragen, ihm nachts regungslos zu Willen sein, seine Kinder austragen, sie erziehen, seine Gäste bewirten, seine Hemden bügeln und nie ungefragt sprechen. Ob ihm das gefiel? Korrekt bis zur Charakterlosigkeit? Schwer fallen würde mir das wohl nicht, ich war es ja ohnehin nicht gewöhnt, Persönliches auszusprechen oder exzentrische Charakterzüge auszuleben.
Im Wohnzimmer lag Mama auf dem Sofa und schaute sich einen alten Film an. Ihr Blick, als ich in der Tür erschien, war schwer deutbar: Ärger über die Störung? Überlegen, wie man mich beschäftigen konnte? Ratlosigkeit angesichts der überstürzten Hochzeit? Ich wusste gar nicht, was Papa ihr vorgeschwindelt hatte. Vielleicht sollte ich ihn mal fragen, bevor ich mich verplapperte. Aber Mama hatte mich überhaupt noch nicht darauf angesprochen – wusste sie noch gar nichts? War es ihr schlicht egal, solange ihre Versorgung gewährleistet war? Glaubte sie, mir sei irgendetwas peinlich? Wollte sie taktvoll sein?
Jetzt jedenfalls wünschte sie einen fettarmen Zitronenjoghurt und dazu zwei trockene Kekse. Ich eilte, das Gewünschte zu holen und ansprechend zu servieren, aber sie beachtete mich schon gar nicht mehr, sondern verfolgte die Abenteuer von – Himmel, das war ja Marika Rökk! Wie schauerlich...
Mit einem leidenden Lächeln wurde ich verabschiedet und klopfte bei Papa.
„Was hast du Mama erzählt? Damit ich nicht etwas anderes behaupte?“
„Dass du dich Hals über Kopf verliebt hast.“
„Klasse, wirklich. Hat sie nicht gefragt, warum nie von dem Kerl erzähle? Wollte sie nicht wissen, wie er heißt, was er macht, warum er noch nie da war?“
Papa sah mich verblüfft an. „Nein, warum?“
Weil das ein Minimum an Interesse an mir verraten hätte, verdammt!
„Vergiss es. Kommt sie zur Hochzeit?“
„Eher nicht. Das dürfte ihr zu anstrengend sein.“
Aber die Weihnachtsfeier hatte sie durchgehalten! Hatte sich ihr Befinden verschlechtert oder gab es bei einer schlichten Trauung nicht genug Leute, die ihr versicherten, wie jung sie noch aussah? Gott, war ich gehässig!
„Also nur du? Und Tobi wird sich wohl nicht vermeiden lassen, nehme ich an.“
„Er ist dein Bruder! Rede nicht so hässlich von ihm.“
„Bruder oder nicht – euch beide will ich nach der Hochzeit nie wieder sehen, das weißt du doch?“
„Ich hab´s unterschrieben. Du bist wirklich herzlos.“
„Nein“, sagte ich, „ich bin bloß eine Ware, da darf man nicht zu viel erwarten.“ Damit verließ ich sein Zimmer wieder.
In den letzten Tagen vor dem Zweiundzwanzigsten hielt ich mein allerletztes Referat, kassierte den Schein (mit einer Eins!) ein, verpackte auch meine gewaschenen Winterklamotten, soweit ich sie bis Freitagabend nicht mehr brauchen würde, und brachte sie ins Schließfach, besorgte mir eine winzige Reisetasche für Kosmetika (viel hatte ich ohnehin nicht), ein Nachthemd, meinen Kimono und Kleidung für den Samstag, trug alle Bücher in die Bibliotheken zurück, nahm die Vorhänge ab, wusch sie, bügelte sie und legte sie dann in den Schrank, putzte das Zimmer gründlich, vergewisserte mich, dass keine Spuren von mir zurückgeblieben und alle Schränke und Schubladen leer waren, stellte den restlichen Schmuck in Papas Arbeitszimmer und packte alles wirklich Wesentliche, Ausweise, Schließfachkarte, Handy, Geldbeutel in meine kleine schwarze Handtasche.
An diesem Freitag selbst stand ich vor Tau und Tag auf, zog mein Bett ab, lüftete die Daunen gründlich in der Februarkälte, steckte die Bettwäsche in die Waschmaschine, kontrollierte noch einmal das Zimmer, duschte ausgiebig, wusch mir die Haare, zog mich halb an (Kostümrock und T-Shirt), stopfte das Bettzeug in den Trockner und meine Nachtwäsche in die Maschine, zog mich fertig an, Strumpfhose, Pumps, Kostümjacke, legte die trockene Bettwäsche gefaltet zu den übrigen Garnituren im Flurschrank, drehte in meinem ehemaligen Zimmer die Heizung ab, trocknete Nachthemd und Kimono, stopfte alles in die kleine Reisetasche, föhnte meine Haare, steckte sie auf, schminkte mich so dezent wie möglich, verstaute die Reste in der Reisetasche und setzte mich steif auf mein unbezogenes Bett, nachdem ich das Fenster geschlossen hatte. Das Ganze erinnerte mich an einen Film; ich kam mir vor, als müsste ich auf eine Wärterin warten, die mich zur festgesetzten Zeit in die Freiheit entließ.
Endlich war es halb zehn; im Haus rührte sich nichts, umso besser! Vielleicht würden sie gar nicht kommen? Ich nahm meine Reisetasche in die Hand, legte im Flur meinen Hausschlüssel ab, zog die Haustür dann leise hinter mir zu und trug Reisetasche und Handtasche zur Bushaltestelle. Gut, dass der Trauungstermin nicht auf einen Samstag festgesetzt war, da fuhr der Bus nämlich nur so selten!
Nach drei Stationen stieg ich in die U-Bahn um und stand um Viertel nach zehn vor dem Rathaus. Einige Minuten schlug ich damit tot, mir die große Tafel mit den einzelnen Abteilungen zu betrachten, dann hatte ich das Standesamt gefunden. Erster Stock, Zimmer 123-128... Da gab´s wohl mehrere Termine gleichzeitig?
123 entpuppte sich als eine Art Warteraum; ich stellte die Reisetasche in der Ecke unter der Garderobe ab, hängte meinen Mantel auf, streifte die Handschuhe ab und steckte sie in die Handtasche, sah mich suchend um und wählte einen Holzstuhl nahe der Garderobe, möglichst weit weg von dem turtelnden Pärchen nebst reichlicher Verwandtschaft, das das Areal neben der Tür bevölkerte.
Diese Tür öffnete sich nun, und ein grau gekleideter, säuerlich blickender kleiner Mann schaute herein. Ich erschrak kurz, aber er rief in fragendem Tonfall: „Trauung Meier/Turnhuber?“
Die große Gesellschaft stand geräuschvoll auf. „Jetzt wird´s ernst, Ludwig!“, rief jemand und lachte meckernd. Die Braut hatte rote Flecken am Hals und zupfte an ihrem Blümchenkleid herum.
Schließlich hatte sich die Tür hinter der Gruppe geschlossen und es wurde ganz still, nur die Heizung knackte ab und zu vor sich hin. Ich starrte auf das abgenutzte Parkett, von dem die Versiegelung zum Teil abgesprungen war, und wartete. Schließlich öffnete sich die Flurtür wieder. Ich wagte gar nicht mehr, aufzusehen. „So sieht man sich wieder“, hörte ich da und sah verblüfft auf. „Sie? Aber Freddy, was für ein unglaublicher Zufall!“