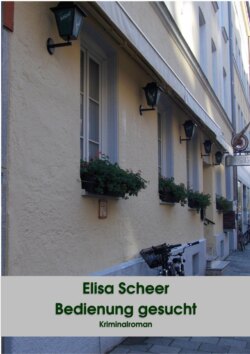Читать книгу Bedienung gesucht - Elisa Scheer - Страница 3
1
ОглавлениеMühsam öffnete ich ein Auge. Was sollte denn das Geklopfe an der Tür? Äh, aufstehen... „Birgit? Birgit – du kommst zu spät in die Uni! Jetzt steh endlich auf, es ist schon fast acht!“
Stöhnend wühlte ich mich aus der warmen Decke.
„Ist ja gut, Anke, ich bin schon wach!“
„Na, Gott sei Dank! Aber schlaf nicht wieder ein!“
Ich schwang die Beine über die Bettkante und saß einen Moment lang so da, das Gesicht in die Hände gestützt und stark in Versuchung, mich einfach wieder rückwärts ins Bett fallen zu lassen. Nein, nicht, solange Anke noch da war! Ich stand auf und schlurfte im Halbschlaf ins Bad. Ein matter Seitenblick verriet mir, dass Anke schon fleißig gewesen war, der Frühstückstisch war gedeckt und sie sortierte gerade Unterlagen in ihre schicke Unitasche. Entnervt wandte ich den Blick ab und schlurfte weiter. Wenigstens das Gesicht waschen und die Zähne putzen. Naja, und mal aufs Klo.
Danach konnte ich dem Tag zwar noch nicht gefasst ins Auge sehen, aber ich war nicht mehr ganz so müde.
„Zurzeit kommst du morgens ja überhaupt nicht mehr hoch“, stellte Anke kritisch fest und goss mir einen Becher starken Tee ein. Ich schlürfte das bittere Gebräu und zündete mir dann eine Zigarette an. „Soll das dein Frühstück sein? Iss doch erstmal was!“, wurde ich sofort getadelt.
„Anke, musst du mich am frühen Morgen schon erziehen?“
„Wenn es nötig ist. Willst du eigentlich nicht zum Dornmeyer gehen?“
„Nö“, murrte ich, „der nuschelt so. Und wozu brauche ich schon Martial?“
„Fürs Examen, du dumme Nuss! Tust du in diesem Semester eigentlich überhaupt nichts?“
„Doch, natürlich. Nachher gehe ich zum Struck in den Stilübungskurs. Und dann in den Lektürekurs beim Speckmann, Sueton, du weißt ja.“
„Die Yellow Press der Antike? Nicht schlecht. Na, Lektürescheine brauche ich keine mehr. Also, ich gehe jetzt. Schau, dass du in die Gänge kommst, du willst doch auch endlich mal Examen machen, oder?“
„Ja doch“, murrte ich und drückte meine Zigarette aus. Als ich mir Tee nachschenkte, verließ Anke, effizient wie immer, gerade mit ihrer Unitasche die Wohnung. Sobald ich ihre Schritte auf der Treppe hörte, zündete ich mir eine neue Zigarette an und angelte nach der Zeitung. Da war mittwochs immer ein hundsgemeines Rätsel drin...
Der fünfte Kugelschreiber funktionierte und ich verbrachte genussreiche Stunden mit dem Raten. Als ich wieder hochschreckte, war es fast elf. Mist! Jetzt musste ich mich aber fürchterlich beeilen! Ich duschte hastig, stapelte das Frühstücksgeschirr in die Spüle, zog mir irgendetwas an, schnappte meinen Collegeblock, Schreibzeug und Schlüssel und trabte los. Immerhin war es nicht besonders weit zur Uni. Um zehn nach elf stand ich vor dem finsteren kleinen Hörsaal, in dem die Stilübungen stattfinden sollten.
Noch schnell ein Blick in meinen Block – was hatten wir in der letzten Woche gemacht? O verdammt – die Übungsklausur war heute – und ich hatte kein bisschen geübt! So einfach war es nicht, philosophischen Schwachsinn, den man schon auf Deutsch kaum verstand, in elegantes Latein zu übersetzen. Sollte ich überhaupt mitschreiben? Oder kam das einem Outing gleich? Ich trat nervös von einem Fuß auf den anderen und konnte mich nicht entscheiden.
„Ach, Frau Limmer! Na, dann kommen Sie gleich mal mit rein!“ Zu spät – wenn der Struck einen erstmal gesehen hatte, gab es kein Entrinnen mehr. Also Mut gefasst...
Nach einer halben Stunde saß ich verzweifelt über meinem Text. Einen Teil hatte ich übersetzt – garantiert mit übelsten Grammatikfehlern, einen anderen Teil konnte ich mangels Wortschatz nicht übersetzen. Wieso war hier auch kein Lexikon erlaubt? Und beim letzten Satz verstand ich schon im Deutschen weder Konstruktion noch Inhalt. Sollte ich das überhaupt abgeben? Oder es noch ein bisschen versuchen? Eine Viertelstunde konnte ich noch nachdenken... Wenngleich aber die Existenz von Göttern nicht aus dem Dasein des Guten abgeleitet werden könne, so sei doch... War das nun indirekte Rede? Und wie funktionierte da die Zeitenfolge? Dasein? Zu esse gab es doch gar kein Substantiv, oder? Vielleicht praesentia? Wieso studierte ich eigentlich lateinische Philologie? Nur weil ich in grauer Vorzeit einen Zufallseinser im Lateinabitur geschafft hatte? Und was sollte ich später damit machen? Noch drei Minuten! Ich entdeckte einen Tempusfehler und strich einen Satz komplett durch, ohne einen besseren Vorschlag machen zu können. Dann kaute ich an meinem Kuli herum, bis Struck mir das Blatt aus der Hand nahm.
Geschlagen trottete ich hinaus. Hier konnte ich mich praktisch nicht mehr sehen lassen, diese Klausur war ja oberpeinlich gelaufen! Und jetzt? Der Suetonkurs? Nein, Scheiß drauf, der Tag war ja ohnehin schon im Eimer. Ich würde mir jetzt etwas Geld am Automaten holen, eine Pizza an der Ecke mitnehmen und mir den einen oder anderen schicken Krimi gönnen. Und dann heim und ins Bett. Naja, abspülen sollte ich schon noch, diese Woche war ich dran. Und heute Abend was kochen, da hatte ich schon eine richtig gute Idee.
Ein Mistwetter war das, typisch Ende November! Ich eilte mit gesenktem Kopf zur Bank an der nächsten Ecke und reihte mich in die Schlange vor dem Geldautomaten ein. Der Schneeregen peitschte mir ins Gesicht. Bei diesem Wetter sollte man wirklich mit einem spannenden Buch und einer Schachtel Pralinen im Bett bleiben. Die Bären machten es richtig, wenn sie Winterschlaf hielten! Endlich war ich dran, schob meine Karte hinein und tippte die Geheimnummer ein. Vierhundert Mark sollte ich schon abheben, fand ich.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
Ich wartete, mit den dünnen Schuhen in einer Pfütze. Ich wartete ziemlich lange, fand ich. Es klickte im Kartenschacht – na endlich!
Leider können wir Sie heute nicht bedienen, bitte sprechen Sie mit Ihrem Bankberater.
Die Karte kam wieder heraus. Was sollte das denn? Und wie sollte ich mit dem Bankberater sprechen, wenn er gerade die Tür von innen abschloss – Mittagspause? Ich verstaute die Karte wieder. Ich hatte noch vierundzwanzig Mark und ein bisschen Kleingeld, sah ich dabei. Toll, wirklich. Die Bank öffnete erst wieder um zwei, und mit Einkäufen konnte ich mir die Zeit ja wohl nicht vertreiben. Für den Suetonkurs war es jetzt auch schon zu spät, die Hälfte war schon vorbei. Na, dann ging ich eben heim und räumte die Küche auf. Unterwegs besorgte ich noch getrocknete Tomaten und Basilikum, damit hatte ich nur noch sechzehn Mark vierundachtzig im Geldbeutel. Wieso wollten die mir kein Geld geben? Der Automat war nicht leer, denn der Typ nach mir hatte ohne Probleme ein Bündel Scheine herausgeholt und mir einen mitleidigen Blick zugeworfen. War das Konto schon wieder am Limit? Der Auszugsdrucker war leider mit einem großen Defekt-Schild verziert gewesen. An der Ecke Florians- und Maria-del-Pilar-Straße war noch eine Filiale, dort holte ich mir wenigstens einen Kontoauszug. Na bravo! Ich war mit über dreitausend Mark im Minus, und mein Dispolimit lag bei zwei fünf. Geld abheben war also wohl nicht drin. Allerdings gab es da noch irgendwo ein Sparbuch! Später, die Bank hatte jetzt ohnehin zu.
Ich stieg die Treppen hinauf und schloss die Wohnungstür auf. Von Anke keine Spur, Kunststück! Die besuchte heute eine Vorlesung, zwei Examenskurse und die Unibibliothek, um letzte Aspekte ihrer Zulassungsarbeit nachzuschlagen. Und ich hatte für den Magister noch nicht einmal ein Thema – genau genommen noch nicht einmal alle Scheine. Und wenn man es ganz genau nahm, dann konnte ich so wenig Latein, dass auch an ein Magisterexamen kaum zu denken war. Meine Nebenfächer, griechische Literatur und alte Geschichte, sahen auch nicht viel besser aus. Anke dagegen hatte das Graecum sogar nachgemacht, innerhalb von drei Semestern. Sie wusste ja auch, was sie werden wollte, Lehrerin für Latein, Französisch und Geschichte.
Und ich? Was machte man mit einem Magister in klassischer Philologie? Heiraten? Sekretärin werden? Lateinprofessorin werden? Ja, sicher. Ich schichtete das Frühstücksgeschirr intelligenter auf und ließ heißes Wasser mit etwas Spülmittel darüber laufen, dann schrubbte ich alles sauber, überließ es im Abtropfgestell sich selbst und putzte die Arbeitsplatten und den kleinen Esstisch.
Die Wohnung war nicht schlecht, die Anke da im ersten Semester aufgetan hatte – Wohnküche, Winzbad und zwei ziemlich ordentliche Zimmer, vor denen sogar ein schmaler Südbalkon klebte. Und gar nicht mal so teuer, jede von uns musste sechshundert Mark warm hinblättern. Hatte ich ein Glück gehabt, dass ich Anke schon in den ersten Unitagen in der Seneca-Vorlesung getroffen hatte, als ich noch verzweifelt nach irgendeinem Zimmer suchte und sie noch keine Mitbewohnerin hatte! Wir waren die ganzen zwölf Semester seitdem glänzend miteinander ausgekommen. Anke war nur viel zielstrebiger als ich. Wenn sie sich vornahm, mit dreißig als Studienrätin auf einer anständigen Planstelle zu sitzen, dann konnte man Gift darauf nehmen, dass ihr das auch gelingen würde. Ich hatte mich ja nur für den Magister entschieden, weil ich nicht genau wusste, was ich wollte – nur, was ich nicht wollte: mich von unerzogenen Teenies tyrannisieren lassen, die ohnehin mit Latein nichts am Hut hatten.
Na, und den heutigen Unitag musste man als misslungen ansehen, eindeutig! Ich kramte in meinem Schreibtisch herum und fand schließlich das Sparbuch – noch achthundertvierundsechzig Mark und einunddreißig Pfennige. Ich steckte es ein, schließlich brauchte ich Geld und musste auch etwas auf mein Girokonto einzahlen. Dass das Geld vom letzten Job so schnell wieder verbraucht war?
Dann sortierte ich den Kram auf meinem Schreibtisch – unleserliche Mitschriften, die völlig jungfräuliche Übung, die ich heute für die Stilklausur hätte machen sollen, zwei Bücher aus der Unibibliothek, die ich überhaupt noch nicht angesehen hatte und die spätestens am Freitag zurückgebracht werden mussten. Ich schlug eins auf, Geschichte der antiken Biographie, und blätterte ein bisschen darin herum. War das öde! Neben meinem ungemachten Bett lag der Krimi, der mir die Müdigkeit heute Morgen eingebracht hatte, weil ich noch wissen wollte, ob der Kommissar es schaffte, seine Assistentin ins Bett zu kriegen. Leider war ich dann doch darüber eingeschlafen. Ich angelte nach ihm, strich die verknitterten Seiten glatt und warf einen Blick hinein. Oh, sie waren ja schon in seiner Wohnung – das musste ich jetzt doch noch lesen! Als ich das Buch zufrieden zuklappte – die Affäre schien zu laufen, und die senile Großmutter hatte den Mord begangen, mit ihrem Krückstock – war es schon Viertel vor drei. Mist! Jetzt aber schnell zur Bank!
Dort stand ich erst einmal in der Schlange und warf neidische Blicke auf Leute, die ganze Bündel Geldscheine einzahlten und Säckchen voller Schlafmünzen zurückbrachten. Ein bildschöner junger Mann tauschte für über zweitausend Mark Lire ein – der wollte wohl zum Skifahren nach Südtirol? Der hatte es gut, der war sicher weder pleite noch erfolglos im Studium.
Ich brauchte dringend einen Job, aber nicht wieder putzen, das nervte zu sehr.
Schließlich stand ich am Schalter. „Ich möchte das Sparbuch auflösen und fünfhundert Mark auf mein Girokonto einzahlen. Den Rest nehme ich bar mit.“
Die Angestellte nahm das Sparbuch kommentarlos entgegen und begann Zahlen einzutippen. Schließlich hatte ich etwas über dreihundertachtzig Mark (Zinsen für 2001!) in der Tasche und mein Konto war nur noch etwas über zweihundert Mark über das Limit hinaus überzogen. Das ging doch? Nur müsste irgendwo Geld herkommen, schließlich hatte ich am Ersten wieder sechshundert Mark zu bezahlen.
Ich brauchte wirklich dringend einen Job!
Leider konnte ich nicht viel Verwertbares, zur Not eben putzen, was mir aber keinen rechten Spaß machte, ein bisschen tippen, aber nicht gerade schnell, und ziemlich gut kochen, aber das interessierte bei solchen Jobs niemanden. Ich sah mich schon wieder in einer Bäckerei verkaufen oder irgendwo die Ablage machen. Egal, in meiner Situation konnte man nicht wählerisch sein!
Mit einigermaßen vollem Geldbeutel kam ich wieder nach Hause und setzte mich ratlos an meinen Schreibtisch. So konnte es auf jeden Fall nicht weitergehen, ich setzte gerade mein Studium in den Sand, war restlos bankrott, ziemlich hässlich und alleine.
Hässlich, ja. Zu dick war ich eigentlich nicht, aber ich hätte lieber etwas mehr Busen und dafür weniger Hintern gehabt, dichteres Haar in einer aufregenderen Farbe als mittelbraun, größere Augen... Mein Leben lang hatte ich von feuchten, dunkelbraunen, exotischen Augen geträumt, wie auf einem indischen Filmplakat, statt langweiligem blassen Blaugrün, umgeben von zu hellen Wimpern. Die im Allgemeinen grämliche Miene machte mich, wenn ich ehrlich war, auch nicht gerade schöner. Und dass ich mit fast sechsundzwanzig immer noch ab und zu Pickel hatte, was überhaupt das Allerletzte.
Das Schicksal war gemein zu mir, fand ich. Freund hatte ich auch keinen. Nicht, dass mir jemand Konkretes vorgeschwebt hätte, alle Männer, die ich vom Studium oder durch Anke kannte, waren irgendwie doof. Und als ich meinen letzten Freund verloren hatte (an eine Schönere?), war ich nicht maßlos traurig gewesen, nur ein bisschen gekränkt, dass es mir nicht gelungen war, zuerst Schluss zu machen. Nein, Tobias wollte ich nicht zurück, das war vorbei. Und schon fast zwei Jahre her, wenn ich es recht bedachte. Gut, Anke war auch solo, seitdem sie beschlossen hatte, sich energisch ihrer Zukunft zu widmen und sich nicht von Menschen ablenken zu lassen, die offensichtlich ihr Hirn nicht im Kopf, sondern ein ganzes Stück tiefer spazieren trugen. Nur – Anke konnte gut sagen Ich mache lieber Karriere; auf welche Karriere sollte ich denn verweisen? Auf die versaute Klausur von heute? Auf geschwänzte Vorlesungen? Auf völlige Orientierungslosigkeit bei der Frage, was ich nach dem Magister, wenn ich ihn denn jemals schaffen sollte, anfangen wollte? Ich räumte lustlos meinen Schreibtisch auf, nachdem der Blick in den herumliegenden Vergrößerungsspiegel nur zu weiterer Frustration und dem vergeblichen Versuch geführt hatte, einen Pickel auszudrücken, der dafür offenbar noch nicht reif war. In meiner Unitasche – nicht so edel wie die von Anke, eher eine umfunktionierte Badetasche aus knallblauem Plastik – fand ich noch drei einzelne Markstücke, zwei U-Bahn-Fahrkarten, mehrere Postkarten, die ich immer noch nicht eingeworfen hatte, lose Kugelschreiber, Kassenzettel und eine versteinerte Breze. Ich leerte alles aus und räumte ordentlich auf. Morgen würde ich in der Uni ein ganz neues Leben anfangen, so konnte es wirklich nicht weitergehen! Was hatte ich morgen überhaupt? Eine Vorlesung über Alexander den Großen, einen Lektürekurs in Griechisch, ein Hauptseminar in Latein, Terenz, Komödien – zusammen mit Anke, die bei dem Professor ihre Zulassung schrieb und damit schon fast fertig war. Und ich? Der Vergleich mit Anke frustrierte mich immer mehr. Als ich die Wohnungstür hörte, hasste ich sie geradezu, obwohl sie doch nun wirklich nichts dafür konnte, dass ich meinen Arsch nicht hochkriegte.
„Na, wir war´s bei dir?“, fragte sie nebenbei, während sie ihren Mantel aufhängte und ihre Tasche in ihr Zimmer stellte.
„Alles Scheiße, deine Elli“, antwortete ich trübsinnig, „der Struck hat eine Klausur geschrieben, und ich hatte keine Ahnung. Den Kurs kann ich schmeißen, was?“
„Warum denn? Der Struck ist das gewöhnt, die meisten versauen die Übungsklausuren. Es kommt doch nur auf die letzte an, auf der Basis gibt´s den Schein. Ich weiß es, ich hab schon zwei Scheine bei ihm gemacht. Er verarscht dich halt, wenn du richtigen Müll produziert hast, aber da musst du eben durch.“
„Ich weiß nicht, ob ich das eigentlich will. Allmählich verstehe ich die Leute, die mich immerzu fragen: „Was willst du denn später mal damit machen?“ Ach, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich will. Und pleite bin ich auch, aber so was von pleite, das glaubst du gar nicht.“
„Du hast ja den totalen Blues“, kommentierte Anke und drückte mir tröstend die Schulter. „Pass auf, jetzt kochst du uns erst mal was, dann geht es dir gleich wieder besser. Ich kenn dich doch! Du vor einem Kochtopf, und die Laune steigt sofort. Und nach dem Essen reden wir weiter!“
„Vielleicht hast du Recht“, murmelte ich und trottete zur Küchenzeile. Mir schwebte eine Sauce mit sonnengetrockneten Tomaten und Basilikum vor, dazu ein Hauch Knoblauch. Frische Ravioli hatte ich gestern gekauft, die mussten ohnehin rasch verbraucht werden. Dazu einen Dill-Gurken-Salat... Beim Waschen, Schneiden, Einweichen und Kochen hob sich meine Laune tatsächlich wieder, und als ich in der Sauce herumrührte, während die Ravioli in reichlich sprudelndem Salzwasser kochten, pfiff ich schon wieder die Songs aus dem Radio mit – wie immer knapp daneben, wie Anke gerne behauptete. Ich deckte den Tisch, stellte den frisch geriebenen Parmesan dazu, mischte den Salat noch einmal durch, goss die Ravioli ab, schwenkte sie in einem Hauch Olivenöl und gab sie auf zwei Teller. Die Sauce kam als großer Klecks darauf. Anke stand schon genießerisch schnuppernd im Weg und nahm mir die Teller nur zu gerne ab.
Dann folgte erst einmal gefräßiges Schweigen. Erst als der Teller schon fast leer war, stöhnte Anke kurz auf. „Mensch, Birgit, du kochst göttlich! Alles genau auf den Punkt und so fein gewürzt. Du, sag mal, ich hätte da einen Minijob für dich!“
„Nämlich?“ Job klang auf jeden Fall gut, aber das Mini davor störte mich etwas.
„Na, ich muss doch nächste Woche die Leute aus meiner Examensgruppe einladen, hab ich vor Ewigkeiten schon versprochen. Könntest du einige richtig feine Salate machen, Knoblauchbrot dazu und diverse kleine Schweinereien? Du weißt schon, du kannst so was so toll, und wenn es das mache, schmeckt es immer irgendwie seltsam oder fad. Und mir werden auch immer die Nudeln zu weich und der Reis klumpig. Ich zahle die Zutaten und für die Arbeit - sagen wir einen Hunderter?“
„Du spinnst ja, Anke! Ich find´s nett, dass du mich aufbauen willst, aber du musst mich doch nicht für die Salate bezahlen, das mach ich so. Allerdings müsstest du mir im Notfall die Dezembermiete ein bisschen stunden.“
„Kein Problem. Aber ich finde schon, dass man ein so tolles Catering auch bezahlen sollte. Komm, sei kein Frosch, du kannst den Hunni brauchen und mir tut´s nicht weh, ich hab doch mit dieser Assistentenstelle ganz nett verdient. Wenn ich selber Salate mache und keiner dann was essen will, das wäre doch wirklich endpeinlich. Bitte, Birgit!“
„Na gut, ehe ich mich schlagen lasse, darfst du mich bezahlen. Was schwebt dir denn so vor? Und für wie viel Leute genau?“
Anke überlegte und schlug mir dann einige Salate vor. Ich notierte mir ihre Wünsche und überschlug, was ich an Zutaten brauchen würde. „Für den Hunderter kriegen wir zumindest alles“, stellte ich dann befriedigt fest.
„Nein, so war das nicht gemeint“, schnappte Anke, „der Hunderter ist fürs Machen, nicht fürs Einkaufen. Pass auf, ich geb dir zweihundert und du behältst, was übrig bleibt, einverstanden?“ Sie reichte mir zwei Scheine über den Tisch.
Ich steckte sie sorgfältig ein. „Lieb von dir. Aber einen Job brauche ich trotzdem, du kannst mich ja nicht durchfüttern, bloß weil ich besser koche als du.“
„Klar, aber ich fände es doch wichtiger, wenn du dich mal um dein Studium kümmern würdest. Birgit, du hast zwölf Semester auf dem Buckel und noch nicht mal mit dem Magister angefangen. Weißt du wenigstens schon, bei wem du sie schreiben willst? Beim Dornmeyer?“
„Bestimmt nicht! Gut, ich werde drüber nachdenken. Aber zurzeit bin ich so schlecht, ich kann eigentlich gar kein Latein mehr.“
„Soll ich mit dir üben? Das schadet mir sicher auch nichts.“
Ich lachte bitter. „Was willst du machen? Mich unregelmäßige Verben abfragen, während ich abspüle?“
„Wenn es sein muss?“
Sie stand tatsächlich mit der Grammatik hinter mir und nervte beim Abspülen, bis ich sie aus der Küche warf. Die Verben da drin konnte ich gerade noch, aber für die Übungsklausur hatte das natürlich nicht gereicht. Verbissen schrubbte ich und trocknete hinterher sogar ab, bis die Küche nur so blitzte und ich mich ein bisschen besser fühlte. Schließlich war hier wirklich überhaupt nichts mehr zu tun und ich musste mich in mein Zimmer und an meinen Schreibtisch zurückziehen. Als ich an Ankes Tür vorbeikam, sah ich sie konzentriert an ihrem Computer sitzen, wahrscheinlich gab sie gerade ihrer Zulassungsarbeit den allerletzten Schliff. Und ich? War ich heute nicht schon mehrmals an diesen Punkt gekommen? Was konnte Anke dafür, dass ich mit meinem Studium nicht vorankam!
Also schrieb ich mir erst einmal sorgfältig auf, was ich für Ankes Geld einkaufen wollte, von der Mayonnaise bis zu Zwiebeln in Balsamico. Dann packte ich meine Unitasche für morgen fertig, stellte fest, dass mir von der Alexander-Vorlesung schon die letzte Stunde fehlte, übersetzte mehr als lustlos ein Kapitel Xenophon und hoffte, dass ich morgen nicht drankam, und blätterte schließlich mehr aus Pflichtgefühl denn aus Interesse die beiden Bibliotheksbücher durch. Naja, in einem war ein Artikel, den ich vielleicht für meine Seminararbeit brauchen konnte. Vierundzwanzig Seiten, also zwölf Kopien, also eine Mark acht. Das konnte ich mir schon noch leisten, also musste ich den Artikel nicht jetzt lesen, wenn ich ihn morgen kopierte.
Im Flur läutete das Telefon, aber das Läuten brach schnell ab, also war es wohl für Anke. Mehr Freunde hatte sie auch. Ich kannte an der Uni kaum Leute, weil ich so selten da war. Vielleicht auch, weil ich immer so ein vergrämtes Gesicht zog?
Anke schaute herein. „Birgit? Ich geh noch mal weg, mit Nicki und Viola, okay? Was machst du noch? Willst du mitkommen?“
„Nö, lass mal, ich räume hier noch ein bisschen auf, für morgen. Viel Vergnügen!“
„Danke, bis morgen dann!“ Sie winkte kurz und ich hörte die Wohnungstür wieder zufallen. Eigentlich hatte ich schon alles aufgeräumt, mehr war ja im Moment nicht zu tun. Gut, ich konnte mal Wäsche in die Maschine werfen, sonst musste ich ohnehin bald im Bett bleiben.
Beim Einsortieren merkte ich, dass meine Lieblingsjeans an den Innennähten schon verdächtig dünn wurden, dass bei meinem Lieblings-BH eines der Plastikdinger zum Verstellen der Träger abgebrochen war – deshalb hatte er beim letzten Tragen auf dem Rücken so übel gekratzt! - und dass das Schwarze Loch in unserer Wohnung schon wieder zwei einzelne Socken eingesaugt hatte. Konnte es nicht wenigstens mal ein Paar nehmen? Also hatte ich auch kaum mehr etwas anzuziehen, fügte ich meiner Jammerbilanz hinzu, als ich die Waschmaschinentür zudrückte und Buntwäsche 40° einstellte. Vielleicht sollte ich mal wieder meine Eltern besuchen?
Hm. War das wirklich eine so kluge Idee? Die fanden doch ohnehin, dass mein Studium wenig sinnvoll war und außerdem schon reichlich lange dauerte. Sandra war schon mit fünfundzwanzig fertig gewesen, und Daniel hatte mit einundzwanzig schon sein Vordiplom geschafft. Außerdem waren Maschinenbau und BWL Fächer, unter denen meine Eltern sich etwas vorstellen konnten. Klassische Philologie nicht unbedingt.
War es unter diesen Umständen opportun, einen kleinen Schnorrversuch zu unternehmen? Eigentlich galt bei uns ja die Regel, dass man ab dem fünfundzwanzigsten Geburtstag keine Zuschüsse mehr bekam. Sandra konnte ich auf keinen Fall anpumpen, die war, gelinde gesagt, geizig wie Ebenezer Scrooge persönlich, jeden Pfennig, den sie nicht für ihre Chefetagen-Kleidung brauchte, steckte sie in teils sichere, teils hochriskante Geldanlagen. Von ihr war höchstens ein Vortrag zur momentanen Wirtschaftslage zu erwarten. Daniel war garantiert nicht zu Hause, der machte geradezu manisch Praktika, vorzugsweise weit weg von zu Hause. Dass ich überhaupt die einzige war, die nicht mehr bei den Eltern lebte, war auch eigenartig. Gut, Sandra hatte sicher kalkuliert, dass es zu Hause billiger war – aber mit siebenundzwanzig? Und Daniel, der mit den Alten dauernd wegen irgendetwas Krach hatte, warum zog der eigentlich nicht aus? Auch, um Geld zu sparen? Verdiente er bei seinen Praktika so wenig? Na gut, aber versuchen sollte ich es mal, wenigstens eine kostenlose Mahlzeit konnte ich so ergattern. Am Sonntagmittag vielleicht?
Ich holte mir erst einmal die Zeitung, vielleicht fand ich ja den perfekten Job im Stellenmarkt. Ich studierte die Seiten sorgfältig, aber gesucht wurden vor allem Empfangsdamen, Sekretärinnen mit sicheren Kenntnissen in Word, Excel und PowerPoint (ich konnte zur Not mit Word umgehen, aber das war´s dann auch schon), Sous-Chefs für diverse Restaurants (und egal wie gerne und gut ich kochte, eine Ausbildung hatte ich eben nicht) und die üblichen Versager für Drückerkolonnen (Unterkunft kann gestellt werden). Ach ja, und Putzfrauen wurden gesucht, ohne Ende. Nein, Putzen machte mir keinen Spaß. Vielleicht sollte ich morgen früh mal zur Uni-Jobbörse gucken, um halb acht wurden dort die Kurzjobs verteilt. Bis jetzt hatte ich dort allerdings auch nie etwas Besseres als Putzen oder Tippen ergattert. Die lustigen Jobs, zum Beispiel Kellerentrümpelungen, waren nur für Männer mit eigenem Auto, vorzugsweise mit einem Pickup. Ich hatte kein Auto, bei meiner Finanzlage kein Wunder. Und der Führerschein war schon fast nicht mehr wahr, so wenig Fahrpraxis hatte ich aufzuweisen! Vielleicht war ich schon reif dafür, von Haustür zu Haustür zu wandern und zu winseln, dass ich nicht fertig studieren konnte, wenn die Leute nicht sofort eine überflüssige Zeitschrift abonnierten? Nein, so tief war ich nun doch noch nicht gesunken!
Eigentlich doch, aber ich weigerte mich, einen solchen Idiotenjob anzunehmen. Außerdem hatte ich mal gelesen – oder war das ein Fernsehfilm gewesen? – dass in solchen Drückerkolonnen ein rauer Ton herrschte und man Prügel bezog, wenn man nicht genügend Abos umsetzte. Dann doch noch lieber bei Aldi an der Kasse!
Auf jeden Fall musste ich morgen ganz brav in die Uni gehen, geschwänzt wurde nicht schon wieder! Und fleißig üben musste ich auch. Voller guter Vorsätze schlug ich den Menge und die Synonymik auf. Nach zwei, drei Sätzen erlahmte mein Eifer zusehends. Himmel, war das schwierig – und ich hatte derartige Lücken... Regale auffüllen – das wäre ein Job, der mich bestimmt nicht überforderte, und Erfahrung hatte ich auch, noch aus der Schulzeit. Leider erstreckte sich die Erfahrung auch darauf, wie schlecht solche Jobs bezahlt wurden. Nein, danke!
Die Römer mussten krank gewesen sein – hatten die außer Kämpfen denn gar nichts im Kopf? Warum diese Fülle an Synonymen? Ich könnte natürlich auch bei MacDonald´s – nein, dann stank ich bis an mein Lebensende nach dem Fett, in dem die Pommes frittiert wurden - schon bei dem Gedanken wurde mir schlecht. Los, den nächsten Satz! Ich schlug fast zehn Minuten lang den benötigten Wortschatz nach, dann gab ich es auf – die Konstruktion war mir schleierhaft. Ich hatte doch von dieser Autorin auch noch den nächsten Krimi gekauft; wie ging es wohl mit dem Kommissar und seiner kessen Assistentin weiter? Nur ein paar Seiten, bestimmt, dann könnte ich wieder eine Viertelstunde übersetzen... Ja, das war eine gute Idee!
Als ich von dem Krimi aufblickte, war es fast elf Uhr nachts – zu spät, um jetzt noch mit Übersetzen anzufangen. Morgen war auch noch ein Tag! Ich putzte mir schnell die Zähne, wusch mir sorgfältig das Gesicht (diese Pickel mussten endlich verschwinden!) und schlüpfte ins Bett, wo ich den Krimi gierig weiterlas, bis ich um zwanzig nach eins endlich wusste, dass es doch nicht der Ehemann gewesen war, den ich entschieden verdächtig gefunden hatte. Mist, und morgen fing die Alexander-Vorlesung schon um acht Uhr an: Ob ich das schaffen würde?
Ich schaffte es natürlich nicht. Trotz Ankes Gezeter vor der Tür war es fast acht, bis ich wenigstens auf meinen Füßen stand und die Dusche anvisieren konnte. Als ich endlich geduscht und angezogen war, hatte Anke bereits wutschnaubend die Wohnung verlassen: „Wenn du dich so hängen lässt – ich gehe jetzt jedenfalls in die Vorlesung. Dass du deinen Arsch gar nicht mehr hochkriegst, finde ich wirklich erbärmlich.“
Wenigstens schaffte ich es in den Lektürekurs und in das Hauptseminar, aber in beiden Veranstaltungen musste ich mir einen Platz mit guter Deckung suchen, damit ich nicht genötigt wurde, mich an der Diskussion zu beteiligen – in Griechisch hatte ich das falsche Kapitel übersetzt und von der Terenzkomödie, die gerade auf dem Programm stand, hatte ich überhaupt keinen Schimmer – ich hatte den Eunuchus gelesen (faulerweise in der deutschen Übersetzung), Die Brüder waren heute aber an gesagt - Mist.
Anke warf mir, während sie eifrig einige Aspekte der Komödie diskutierte, ab und zu vorwurfsvolle Blicke zu, wie ich in meiner schummerigen Ecke klebte und so tat, als würde ich fieberhaft mitschreiben. Hoffentlich fiel ich dem Professor nicht auch noch als totale Loserin auf, bei irgendjemandem musste ich doch schließlich meine Magisterarbeit schreiben! Noch frustrierter verließ ich schließlich mit allen anderen das Seminar und kam mir wieder einmal klein, hässlich und unfähig vor. „Komm, wir gehen nach Hause“, sagte Anke, nachdem sie mir einen kritischen Blick zugeworfen hatte. Unterwegs sprach sie kein Wort, und ich versuchte mich vergeblich dadurch abzulenken, dass ich die Sonderangebote in allen Läden studierte, an denen wir vorbeikamen.
Erst als sich die Wohnungstür hinter uns geschlossen hatte und Anke mir in mein Zimmer gefolgt war, holte sie tief Luft: „Wie soll das mit dir weitergehen? Das war ja heute eine mehr als schwache Vorstellung!“
„Ich hab alles mitgeschrieben!“, verteidigte ich mich kläglich.
„Nicht aus Interesse! Du wolltest bloß tarnen, dass du keinen Schimmer hattest! Birgit, du hast doch mit diesem Studium gar nichts mehr am Hut, oder?“
„Meinst du? Vielleicht hab ich bloß einen Durchhänger?“
„Den hast du aber schon verdammt lange! Mädel, du bist im zwölften Semester, und der Abschluss ist noch nicht mal als fernes Licht am Horizont zu erkennen! Du hängst doch seit dem ersten – na gut, seit dem zweiten oder dritten Semester durch. Kann es sein, dass du dich gegen das Examen wehrst?“
„Unsinn! Warum sollte ich?“
„Weil nach dem Examen das Nichts kommt. Schau, bei mir kommt danach die Referendarzeit, und sicher wird das grauenhaft, aber ich weiß doch wenigstens, wie es weitergeht, aber du? Siehst du dich als Ordinaria für lateinische Literaturgeschichte? Ich weiß ja nicht so recht...“
„Ich auch nicht“, gab ich mit einem schiefen Grinsen zu. „Na, und sonst? Ein Magister führt ja nirgendwo im Besonderen hin, da musst du schon gut sein, um etwas in einem Verlag oder einer PR-Agentur oder so was zu ergattern.“
„Auf eine mit Latein und Griechisch werden die gerade gewartet haben“, murrte ich vor mich hin.
„Eben! Und weil dir das auch klar ist, scheust du dich vor dem Moment, in dem die Uni dich ins Leben entlässt“, folgerte Anke befriedigt. „Du bist hochtrabend“, antwortete ich ärgerlich.
„Aber ich habe Recht, oder?“
„Vielleicht. Nur – was soll ich machen? Jetzt noch abbrechen? Das Fach wechseln? Doch noch fertigmachen?“
„Das weiß ich auch nicht. Birgit, was willst du eigentlich?“
„Keine Ahnung. Nicht das, was ich jetzt habe, aber sonst?“
„Was für eine Art Job würde dir Spaß machen? Oder schwebt dir mehr Familie mit Kinderchen vor? Nur, in der Hinsicht unternimmst du ja auch nichts, oder?“
„Was sollte ich da schon groß unternehmen? Du kennst doch die Kerle, die an der Uni so rumlaufen! Brechmittel, allesamt! Muss ich wirklich nicht haben.“
„Irgendwo gibt es sicher auch andere“, antwortete Anke versonnen, und ich lachte freudlos auf. „Das sagt genau die Richtige! Wer hat denn groß verkündet, Karriere ist wichtiger, und Kerle taugen sowieso alle nichts?“
„Warum machst du mir das nach? Wo ist denn deine Karriere? Worauf konzentrierst du dich, statt deine Zeit mit Männern zu verplempern? Auf die Liebesaffäre des Kommissars mit seiner Assistentin?“ Sie hielt den zerfledderten Krimi anklagend hoch. „Wie viele solcher Schmöker hast du schon gelesen? Du lebst ja fremde Leben und vergisst dein eigenes! Ist das deine Perspektive?“
Ich riss ihr das Buch aus der Hand und warf es hinter mein Bett. „Ich kann doch lesen, was ich will!“
„Klar, du kannst auch machen, was du willst – aber was ist es, was du willst?“
„Fängst du schon wieder damit an? Ich werde es schon noch rausfinden!“
„Ich mach dir einen Vorschlag“, sagte Anke langsam, „du fegst jetzt mal all deinen Unikram vom Tisch, schnappst dir ein leeres Blatt Papier und einen Stift und schreibst dir auf, wie dein Leben in – sagen wir, in zwei Jahren aussieht. Sagen wir, Stichtag ist erster Dezember 2003, ja? Beschreibe das ideale Leben, das du dann führst, und lass dir Zeit zum Nachdenken.“
Ich verzog das Gesicht. „Was soll das werden? So ein Selbsterfahrungskram?“
„Nein“, entgegnete Anke etwas unwirsch, „das nennt man eine Vision. Beschreibe dieses Leben nicht als Wunsch, sondern als Tatsache, das entwickelt motivierende Kräfte.“
„Ernsthaft? Klingt irgendwie esoterisch.“
„Nein, das macht man im Managertraining. Probier´s einfach mal, bei mir hat es durchaus funktioniert, ich hab eine Vision für den letzten Unitag vor Weihnachten, und sie ist schon fast ganz eingetroffen. Nur das mit den rechtzeitig besorgten Geschenken, das war natürlich mal wieder nichts, aber damit kann ich leben. Los jetzt, ab an den Schreibtisch!“
Ich verdrehte die Augen. „Na gut, wenn es dich glücklich macht. Du bist schlimmer als meine Mutter!“
„Es soll nicht mich, sondern dich glücklich machen. Und eine strenge Mama scheinst du ja zu brauchen, wenn ich meinen Blick mal schweifen lasse!“
Ich versuchte, mich selbst und mein unordentliches Zimmer mit ihren Augen zu sehen, und konnte nicht umhin, ihr ein bisschen Recht zu geben. „Also gut, ich brüte über dem Blatt. Aber das muss ich alleine machen!“
„Klar doch. Ich muss ohnehin noch was für morgen vorbereiten, Examensübung in Französisch.“
Ich fegte den ganzen Mist vom Schreibtisch auf den Boden und schob es mit dem Fuß unter das Bett. Der leere Tisch hatte etwas, er wirkte anregend und zugleich frustrierend, als warte er auf neue Aufgaben.
Ein sauberes Blatt war gerade noch aufzufinden. Ich malte das Zieldatum darüber, 1.12.2003, und kaute dann nachdenklich am Kugelschreiber. Was sollte ich schreiben? Wie könnte mein Leben an diesem Stichtag aussehen? Sorgfältig malte ich die Nullen in der Jahreszahl aus, eine bekam ein Karomuster, die andere ein Dessin aus lauter Kreuzchen. Wie Lottokreuzchen. Ja, ein Lottogewinn wäre nicht schlecht, dann hätte ich doch wohl keine Sorgen mehr, oder? Mit ordentlich Millionen aus einem fetten Jackpot könnten mir alle Jobs der Welt gestohlen bleiben!
Ich schrieb hin: „Ich verwalte die Millionen, die ich im Lotto gewonnen habe.“
Klasse, das war genau das, was Anke sehen wollte! Und was machte ich dann den ganzen Tag? Gut, ich könnte jeden Krimi auf der Welt kaufen und lesen, ich hätte eine riesige Wohnung voller Billys, und in jedem Billy endlos viele wohl sortierte Krimis, für jeden Autor – oder besser für jede Autorin - ein eigenes Regalfach. Dazu eine Datenbanksoftware, die alles exakt erfasste. Und ein extra bequemes Sofa für die Lektüre. Feinste Schokolade dazu...
Ich zerknüllte den Zettel und schleuderte ihn Richtung Papierkorb. Dann konnte ich ja gleich den doppelt so breiten Hintern dazu setzen – der wäre bei diesem Leben unvermeidlich. Nein, so sollte das Leben in zwei Jahren nicht aussehen! Ich angelte mir ein frisches Blatt und schrieb wieder das Datum darüber, in betont dynamischen Ziffern, typisch Erfolgsmensch eben. Wie würde ich in zwei Jahren leben? Der erste Dezember müsste ein Montag sein. Also konnte ich beschreiben, wie ich voller Tugend und Pflichtgefühl um sechs Uhr aufstand. Schön – und dann? Aufstehen wozu? Ich hatte die ganze Woche fleißig gearbeitet und gutes Geld verdient. Schön, das gefiel mir.
Was hatte ich aber gearbeitet? Meine Magisterarbeit zum letzten Mal überprüft? Im sechzehnten Semester? Gott, wie peinlich! Nein, ich sah keine Magisterarbeit vor meinem geistigen Auge. Machte ich irgendwo ohne Abschluss Karriere? Sah ich mich im Business-Kostümchen, mit Laptop und dickem Terminplaner ein fettes Projekt leiten? Was für ein Projekt könnte das sein? Etwas Finanzielles? Da war ich ja bei meinem Geschick darin, mit Geld umzugehen, genau die Richtige!
Ich hörte auf, am Stift zu lutschen, und begann zu schreiben, in Großbuchstaben „MEIN KONTO IST IM PLUS“. Die Frage war nur, wie ich es so weit bringen sollte.
Einen Job bräuchte ich.
Irgendwie drehte ich mich sinnlos im Kreis: Welchen Job? Was konnte ich denn? Kochen, putzen, wenigstens zur Not, ein bisschen Latein und ein bisschen mit dem Computer umgehen – und so sollte ich zu Geld kommen? Außerdem wollte ich nicht jahrelang Blödeljobs machen, nur um notdürftig zu leben, dann konnte ich ja wirklich bei Aldi an der Kasse sitzen, die zahlten gar nicht so schlecht. Das war doch keine Vision, das war reines Vegetieren!
Würde ich in zwei Jahren einen Mann haben? Irgendeinen? Nein, das sah ich auch nicht vor mir. Und wo würde ich wohnen? In zwei Jahren wäre Anke schon fast mit der Referendarzeit fertig, und die konnte sie ja sonst wo absolvieren, vielleicht in Aschaffenburg, Lindau oder Hof. Würde sie dann diese Wohnung behalten? Höchst unwahrscheinlich! Und ich konnte sie alleine nicht bezahlen, das war mal klar, zwölfhundert Mark – oder 610 Euro – kalt waren viel zu happig.
Ich schrieb ICH HABE EINE KLEINE WOHNUNG, DIE ICH ALLEINE BEZAHLEN KANN auf das Blatt und stellte frustriert fest, dass ich schon wieder beim ungelösten Kernproblem angekommen war: Womit bezahlen?
Sollte ich Nachhilfestunden geben? Für schlechte Lateiner? Anke hatte zwischendurch damit ganz nett verdient, aber ich hatte keine rechte Geduld. Und dann müsste ich ja immer mein Zimmer aufräumen! Konnte ich es mir überhaupt noch leisten, so herumzuzicken? Ich musste wohl irgendeinen Job annehmen, die paar Hunderter, die ich gestern von der Bank geholt hatte, waren mein unwiderruflich letztes Geld – und einer davon gehörte außerdem Anke, ich musste ja noch für die Salate für ihr Fest einkaufen. Das würde mir jetzt ohnehin viel mehr Spaß machen als über einem Visionenblatt zu brüten, zu dem mir nichts Vernünftiges einfiel. Anke klopfte und sah ins Zimmer. „Ich geh mal eben in die Stadt, wegen Weihnachtsgeschenken. Dann kriege ich meine Vision vielleicht doch noch bis nächste Woche fertig und kann sie fett abhaken. Soll ich dir was mitbringen?“ Ich schüttelte den Kopf. „Ich brauche nichts, außer Geld. Lass mal lieber, aber ich wünsche dir viel Spaß. Was willst du denn kaufen?“
„Weiß noch nicht. Für Astrid vielleicht ihr Lieblingsparfum und für Papa – tja – Väter sind doch immer so schwierig zu beschenken. Jedenfalls keine Krawatte! Die Schratzen... keine Ahnung. Und für dich – das werde ich dir gerade verraten!“ Ich lächelte verzagt. Dann brauchte ich für Anke ja auch ein Geschenk? Ich hatte zwar große Lust, etwas für sie auszusuchen, aber da ging wieder einer meiner letzten Scheine flöten! Sobald die Wohnungstür ins Schloss gefallen war, versuchte ich, erneut über diese dämliche Vision nachzudenken, aber meine Gedanken schweiften dauernd ab. Was konnte ich Anke zu Weihnachten schenken? Ich konnte natürlich Plätzchen backen, Anke liebte meine Spezialnussplätzchen und die Zimtsterne nach Omas altem Rezept. Nein, das war kein Weihnachtsgeschenk! Ein schönes Seidentuch? Sie trug so etwas ganz gerne...
Nein, zurück zum Thema! Wie werde ich am 1. Dezember 2003 leben.... Ich habe eine eigene Wohnung, ich habe keine Miesen mehr auf der Bank – so weit war ich ja schon. Und jetzt?
ICH HABE EINEN JOB, DER MIR FREUDE MACHT, schrieb ich quer über das Blatt. Reine Ausweichtaktik, ich hatte keinen blassen Schimmer, was für ein Job das sein konnte. Nein, so kam ich nicht weiter!
Vielleicht sollte ich ein bisschen spazieren gehen, um herauszufinden, was es überhaupt an Jobs gab? Vielleicht stolperte ich ja über eine geniale Idee? Vielleicht, vielleicht... Meine Daunenjacke war auch schon etwas morsch, stellte ich fest, an der Seitennaht verabschiedete sich gelegentlich eine kleine Feder. Ich schlüpfte in meine Stiefel und steckte Geld und Schlüssel ein. Draußen war das Wetter trübe – seit dem Vormittag hatte es sich nicht gebessert.
Ich wanderte durch die Straßen und hielt Ausschau nach Jobangeboten. Natürlich war in der Florianstraße nichts zu sehen, hier gab es nur allerlei, was ich mir gerne gekauft hätte, aber das kam ja überhaupt nicht in Frage. Hilfskraft im Copyshop? Das wäre gar nicht so übel, aber in den beiden Shops, in denen ich mich erkundigte, brauchten sie niemanden. Kein Wunder, außer Papiernachfüllen und Kassieren fiel dort ja auch nichts an. Und Auftragskopien waren sowieso der allerstumpfsinnigste Job, lieber nicht.
Der Billigmarkt suchte ausgerechnet jetzt keine Kassiererin. Dafür traf ich Angela vor der Buchhandlung, und sie erspähte mich, bevor ich in einem Hauseingang in Deckung gehen konnte. „Hallo, Birgit! Wie geht´s denn immer so?“
„Gut“, log ich sofort, denn Angelas Eltern wohnten fast neben meinen, und sie musste nicht in der ganzen Straße herumtratschen, wie sehr ich am Ende war. „Schön“, freute sie sich und strahlte über ihr ganzes rundes Gesicht, „mir auch! Ich hab den absoluten Traumjob!“
„Erzähl“, verlangte ich und versuchte, meinen Neid zu unterdrücken. „Du weißt doch, dass ich Lebensmittelchemie studiert habe?“
„Ja, sicher.“ Du hast es mir doch tausendmal erzählt, dachte ich mir. „Bist du schon fertig?“
„Ja, seit letztem Sommer. Und jetzt hab ich eine Stelle in einem großen Labor bekommen, wo wir für Stiftung Warentest und verschiedene staatliche Stellen Untersuchungen durchführen. Bei dem Mist, der heutzutage ins Essen gemischt wird, habe ich damit garantiert ausgesorgt. So was können die nie schließen, nicht bei der Panik, die jedes Mal in der Öffentlichkeit ausbricht, wenn wieder etwas herauskommt.“
„Nicht übel“, musste ich zugeben, „das klingt nach einem sicheren Job. Gut bezahlt?“
„Ausgezeichnet, über dreitausend Euro im Monat, netto!“
Mir blieb fast die Luft weg. So viel? Die langweilige Angela hatte sich einen so tollen Job an Land gezogen? Der Neid packte mich mit Macht, aber ich musste zugeben, dass sie etwas hatte, was ich nicht aufweisen konnte – ein abgeschlossenes Studium! „Und Alfie freut sich vielleicht!“, fuhr Angela fort. „Zusammen haben wir jetzt so viel, dass wir uns eine richtig schicke Wohnung leisten können, wenn wir im Februar heiraten. Hach, geht´s mir gut!“
Heiraten würde sie auch noch? War ich darauf auch neidisch? Ich wusste es nicht so recht. Um ihren Alfie beneidete ich sie jedenfalls nicht, der war entsetzlich langweilig und spielte immer noch mit seiner Modelleisenbahn.
„Herzlichen Glückwunsch“, grinste ich also falsch. „Du, entschuldige, aber ich habe gleich einen wichtigen Termin – man sieht sich!“
Ich machte, dass ich weiterkam, bevor sie Einzelheiten meines strahlenden Lebens hören wollte. Was hätte ich schließlich erzählen sollen? Und wenn ich ihr einen Haufen Lügen auftischte, musste ich mir den Unsinn bloß merken, um meinen Eltern das gleiche weiszumachen, sonst flog ich zu schnell auf. Würde ich meinen Eltern aber von rauschenden Erfolgen erzählen, konnte ich sie nicht anpumpen. Nur weg hier! Ich bog in die Graf-Tassilo-Straße ab und trabte dann die Carolinenstraße zurück. Lebkuchen verkaufen? In dem Laden, in dem im Sommer das San Carlo war? Reines Saisongeschäft, und ich sah durch die Scheibe schon zwei Verkäuferinnen – mehr brauchten die wohl auch nicht. Apropos Lebkuchen, wenn Weihnachten vor der Tür stand, konnte man vielleicht als Saisonkraft im Kaufhaus...? Nein, die Jobs wurden im Oktober vergeben, zu spät. Und den ganzen Tag wollte ich ja auch nicht arbeiten, ein bisschen Zeit für die Uni musste schon bleiben, wenigstens für das Terenz-Seminar und die letzten Lektürescheine. Stundenweise wäre am besten, vielleicht im Horizont? Aber Leuten Jeans anzumessen, das war auch nicht das Richtige. Außerdem zahlten die miserabel, mehr als acht Mark die Stunde sprang da nicht heraus.
Ich zündete mir eine Zigarette an und schlenderte weiter. Eine Frau trat auf mich zu, das unvermeidliche Klemmbrett in der Hand.
„Haben Sie vielleicht einen Moment Zeit?“
Ich wollte schon pampig antworten, aber mir fiel ein, dass ich eines Tages vielleicht auch hier stehen und harmlose Passanten belästigen müsste. Man sollte das Schicksal nicht herausfordern. „Wenn es wirklich nur ein Moment ist...“
Sie wollte alles über meinen Margarinekonsum wissen. Ich aß so etwas zwar nicht, aber um ihr den Gefallen zu tun, lobte ich einige Marken, gab mein Urteil zu einer neuen Verpackung ab und nahm eine Probepackung entgegen. Zum Braten konnte man sie immerhin verwenden, hoffte ich und setzte meinen ziellosen Weg fort.
Ich wollte durch die Sophienstraße wieder zurückgehen, aber eine gewaltige Baustelle schreckte mich ab – da musste man wieder dauernd die Straßenseite wechseln und durch diese hölzernen Schutzgänge klappern, die ich nicht ausstehen konnte. Dann nahm ich eben die nächste Straße!
In der Emilienstraße war es wie üblich ziemlich finster, weil hier keine einzige Fassade renoviert war und die Straße so schmal angelegt war, dass im Winter die Sonne auch bei strahlendem Wetter keine Chance hatte.
Schicke Läden gab es hier auch nicht. Ich hatte die Straße schon halb hinter mir, als mir die Kneipe auf der anderen Straßenseite auffiel. Sie sollte wohl eine Art Bistro darstellen und trug den mehr als albernen Namen Rudis Rastplatz. Wem war denn das eingefallen? Die braune Fassade und die halbblinden Fenster wirkten nur mäßig überzeugend, aber die Karte im Schaukasten neben der Tür klang ganz gut. Wenige, aber vernünftige Gerichte.
Rudis Rastplatz? Zwar immerhin ohne falschen Apostroph, aber ein selten blöder Name war es doch. Und putzen musste man da sicher auch mal, und zwar gründlich! Da erst entdeckte ich den Zettel in der Tür Bedienung gesucht und überlegte: Hässliche Kneipe. Aber Bedienen? Gab´s da nicht reichlich Trinkgeld, vielleicht sogar steuerfrei? Und vielleicht könnte man der Speisekarte noch ein bisschen aufhelfen? Sollte ich hineingehen? Und wenn die Wirtsleute Ekel waren? Egal, dann ging ich eben wieder – was sollte schließlich groß passieren? Die Vorhänge müsste man mal waschen, dachte ich, als ich die Tür aufdrückte.
Innen war es dämmerig und roch wie immer in leeren Kneipen – kalter Rauch, abgestandenes Bier, ein Hauch Fritierfett. Eklig, aber durchaus appetitanregend, wenn man länger nichts mehr gegessen hatte. Niemand zu sehen. Keine Gäste, kein Wirt – nach frisch brutzelndem Essen roch es auch nicht gerade. War die Kneipe schon wieder aufgegeben? Nein, als ich gerade wieder gehen wollte, hörte ich im Hintergrund eine Türe klappen, und ein Mann tauchte auf, ein feuchtes Tuch zwischen den Fingern.