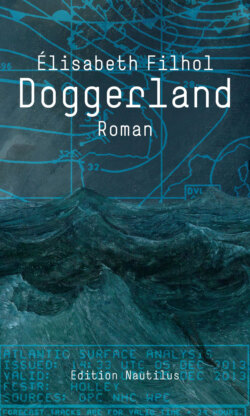Читать книгу Doggerland - Elisabeth Filhol - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеDas Haus der Familie Ross liegt am südlichen Rand der Altstadt von St. Andrews, gegenüber der St. Andrews Church. Draußen geht ein böiger Wind, aber das ist für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich. Margaret Ross steht mit der Fernbedienung in der Hand neben der Couch und zappt von einem Nachrichtensender zum nächsten. Letztlich entscheidet sie sich für Sky News, legt die Fernbedienung auf dem Couchtisch ab und setzt sich hin. Momentan füllt die Moderatorin den gesamten Bildschirm aus, bis oben rechts der Kopf ihres Gesprächspartners eingeblendet wird. Innerhalb von Sekunden kehrt sich das um, nun ist sie im Miniaturformat in der oberen Ecke zu sehen und im Großformat sieht man Außenaufnahmen. Als wäre das nicht genug, werden in einem Laufband kontinuierlich Textzeilen eingeblendet, die in keinem direkten Zusammenhang zum Gesagten stehen. Gerade wurden drei Isobarenkarten gleichzeitig gezeigt, die sich auf den Westen Großbritanniens konzentrieren. Wie kommt es nur, fragt Margaret Ross sich, dass die Rotationsgeschwindigkeit des Windes auf dem Bildschirm derart plastisch hervortritt, ohne jede Animation, nur aufgrund der Tatsache, dass die Isobaren von einer Karte zur nächsten immer enger stehen? Zwischen den drei Aufnahmen liegen jeweils vier Stunden, und obwohl nichts in Bewegung gesetzt wird, ist die Dynamik trotzdem da. Es ist ihr Bruder, Ted Hamilton, der die Karten kommentiert. In dem Moment, als Margaret ihn in dem eingeblendeten Kästchen sieht, kündigt die Moderatorin ihn auch schon an, Ted Hamilton, direkt zugeschaltet aus dem Met Office, und mehr noch als auf die Stimme ihres Bruders oder auf sein Gesicht reagiert sie auf seinen Namen, der so irritierend vertraut klingt, außerdem ist es einfach befremdlich, ihn so vor sich zu sehen, einerseits ist er unglaublich nah und andererseits hat er keinerlei Ähnlichkeit mit der Person, die sie kennt. Er hat eine Nacht Krisenmanagement vor sich und bereits zwei Pressekonferenzen hinter sich. Sie hat Mühe, ihn wiederzuerkennen. Er wirkt weniger kurz angebunden, weniger steif, als er in Wirklichkeit ist. Tatsächlich ist es für sie jedes Mal von neuem ein Wunder, ihn dort zu sehen.
Sie ist allein zu Haus in der Queen’s Terrace, ihr Mann Stephen und ihr Sohn David sind noch nicht da. Sie ist damit beschäftigt, an ihrem Beitrag zu feilen, den sie übermorgen beim Kongress in Esbjerg präsentieren soll. Ihr Laptop steht vor ihr auf dem Esstisch, und nachdem sie das Exposé einmal bis zum Schluss heruntergescrollt hat, überlegt sie, an welchen Stellen sie zwei oder drei Grafiken ihrer Power Point Präsentation streichen könnte, um den ihr zur Verfügung stehenden Zeitrahmen nicht zu überschreiten. Schließlich nehmen fünf Wissenschaftler an dem Runden Tisch teil, jeder soll in einem Eingangsstatement die Möglichkeit bekommen, seine Arbeit und seinen Beitrag zum Thema vorzustellen, und in der sich anschließenden Diskussion wird man dann den einen oder anderen Punkt ergänzen oder vertiefen können. The Storegga Slide tsunami lautet der genaue Titel der Konferenz, die für Freitag elf Uhr angesetzt ist. Vom Norwegischen Storegga, die Große Kante, und vom Englischen slide, im geologischen Sinn des Wortes, also Rutschung.
Die Queen’s Terrace liegt achthundert Meter hinter der Strandpromenade. Sie markiert die südliche Grenze der mittelalterlichen Stadt, die auf einem Felsvorsprung errichtet wurde und deren moderner Teil nicht übermäßig ausufert. Bei Ebbe tritt eine breite Küstenplattform zu Tage, eine durch die Erosion glattpolierte Brandungsplatte, die, so kann man vermuten, den Fuß des Felsens schützt oder zumindest die erosive Kraft der Wellen an einem Tag wie diesem erheblich vermindert, so dass die an der Strandpromenade aufgereihten alten Häuser bis heute erhalten geblieben sind – wäre der Felsen an dieser Stelle in all den Jahren nur um zehn Zentimeter im Jahr zurückgewichen, wären sie längst fortgespült worden.
Obschon die Stadt dem Wind ausgesetzt ist, der quer durch sie hindurchfegt, Regen und Schnee auf sie niederpeitschen und sie wie ein Prellbock dem andauernden Ansturm der Nordsee ausgesetzt ist, hat sie in den sechs Jahrhunderten ihres Bestehens keinen Zoll Land preisgegeben, und die von einem Ende der Strandpromenade aus zu erkennenden Ruinen, Burg und Kathedrale, sind allein von Menschenhand zu solchen geworden. Was von den Bränden und der vorsätzlichen Zerstörung verschont geblieben ist, scheint der Zeit zu trotzen: ein Spitzbogengewölbe, eine Aneinanderreihung von Bögen, ein Portal, ein Turm, von dem aus man den Rasen überblickt, auf dem senkrecht ein Grabstein neben dem anderen steht, im Schutze der Umfassungsmauer, die sich oberhalb des Felsens erhebt, aus dem gleichen Stein gehauen ist wie dieser und seine natürliche Verlängerung bildet, indem auch ihre Farben je nach Licht und Jahreszeit changieren. Nach Oxford und Cambridge ist St. Andrews die älteste Universitätsstadt Großbritanniens. Zu den an der Promenade liegenden Häusern gelangt man durch enge Gassen, manche so schmal wie ein Gang, sie vermitteln einen Eindruck davon, wie groß das Bedürfnis war, sich vor den Elementen zu schützen. In zweiter und dritter Reihe und bis hin zur Queen’s Terrace sind die Fassaden der Häuser aus grauem, schmucklosem, feinporigem Sandstein noch aus der Zeit der Gotik erhalten, oder aber sie stammen aus der Zeit der ersten Colleges und sind ebenso schlicht wie diese. Margaret Ross, eingeschrieben unter dem Namen Hamilton, kam mit neunzehn Jahren hierher und hat den Ort seither nicht mehr verlassen. Sie hat diesen Eindruck von Unveränderlichkeit, von der bewahrenden Kraft der alten Gemäuer, der Architektur, der vier Jahrhunderte alten Studentenrituale, nicht einfach über sich ergehen lassen, sondern darin auf Anhieb genau das gefunden, was sie brauchte: einen festen Rahmen, eine gewisse Stabilität, während sie in ihrer Geburtsstadt Aberdeen, die immer in Bewegung war, sich veränderte, seit den sechziger Jahren eine permanente Revolution erlebte, oft das Gefühl hatte, durch eine Kluft von ihrer Umgebung getrennt zu sein. Bevor sie ihren Laptop ausschaltet und sich ans Kofferpacken macht, loggt sie sich auf der Website des Met Office ein. Die letzten online gestellten Informationen, die Karte mit den Warnhinweisen, auf der inzwischen für drei Viertel des Landes eine Unwetterwarnung besteht, bestätigen die SMS, die ihr Bruder Ted ihr zwischendurch geschrieben hat, und das klingt alles in allem ziemlich beunruhigend.
Xaver ist nicht der erste und sicher nicht der letzte Sturm dieser Saison. Margaret weiß, dass sich in den nächsten Wochen eine fast ununterbrochene Abfolge von Tiefdruckgebieten über dem Atlantik bilden und dabei, je nachdem, welchen Weg sie einschlagen, die mehr oder minder nördlich gelegenen Breitengrade Europas überqueren wird. Aber einen positiven Nebeneffekt hat es auch, denn die so kostspieligen Ausgrabungen, die sie für ihre archäologischen Forschungen benötigen, diese so langwierige und mühsame Arbeit, die erledigt dann das Meer für sie. Jeden Winter wird die Küste von Galizien bis zum Baltikum vom Meer bestürmt. Millionen Tonnen Gestein, Kiesel, Sand werden verschoben. Felsen weichen zurück, Strände senken sich ab, Untiefen werden umgestaltet, das Watt wird stellenweise abgetragen, eine Schicht nach der anderen, bis man Sedimentschichten erreicht, die für diejenigen, die sie zu interpretieren wissen, Videostills ähneln. Der Geologe und Botaniker Clement Reid ist einer von ihnen. Sie weiß noch, wie sich bei der Lektüre von Submerged Forests ein riesiges Forschungsfeld vor ihr auftat. Reid war 1906 der Erste, der nach jedem großen Sturm die englische Küste abschritt, von Yorkshire bis Cornwall, auf der Suche nach Hinweisen, wie Europas Umrisse ausgesehen haben, als es noch größer war, und bevor es dieses Gebiet eingebüßt hat. Wenn der Sturm mit einer Springflut zusammenfällt, legen bei Ebbe freigelegte Gebiete Zeugnis von einer Zeit ab, in welcher der Meeresspiegel im Norden sehr viel niedriger war. Entgegen den weit verbreiteten Auffassungen seiner Epoche schreibt Clement Reid diesen Anstieg des Meeresspiegels der Klimaveränderung zu, überzeugt von den Arbeiten von Penck und Brückner, die in ihrer 1909 aufgestellten Chronologie vier Eiszeiten des Quartärs ausmachen und benennen, Günz, Mindel, Riss und Würm, denen wir die Alpen verdanken. Zum Höhepunkt der Würm-Eiszeit liegt der südliche Teil der heutigen Nordsee trocken. Der nördliche Teil des Nordseebeckens hingegen ist unter der Last des Inlandeises erstarrt, dem Grönländischen Eisschild, der bis nach Yorkshire herunterreicht.
Noahs Wälder. So nennen Clement Reids Zeitgenossen diese in Bänken aus versteinertem Torf verwurzelten freigelegten Schichten, die am Morgen nach einem großen Sturm zu Tage treten. Bereits aus der Ferne erkennt man am Boden liegende Baumstämme, von denen manche noch einen intakten Querschnitt aufweisen, als hätte die Abholzung gerade erst stattgefunden. Da, wo sonst bei Ebbe nur Sand und Schlick waren, bleibt man von einem Tag auf dem anderen an den Wurzeln junger, zerbrochener Stämme hängen oder an denen ausgewachsener Bäume, die so aussehen, als wären sie maschinell gefällt worden. Ihre glatte Schnittfläche fühlt sich bei Berührung seidenweich an, und unter dem Anthrazitgrau, in das die gesamte Szenerie getaucht ist, sind die Jahresringe gut erkennbar. Da, wo sonst nichts war als Sand, soll der Legende zufolge mal etwas gewesen sein, ein Gebiet oder eine Stadt, die vom Meer verschlungen wurden, so wurde es von einer Generation an die nächste überliefert, so etwas wie das antike Reich von Cantre’r Gwaelod oder das untergegangene Land Lyonnesse. Clement Reid veröffentlicht Submerged Forests 1913. Das Werk, das nur wenigen Spezialisten bekannt ist, ist mittlerweile in einer Neuauflage erhältlich, die den Text und die Ikonografie der Originalausgabe übernimmt, wie der Klappentext erklärt, und um eine biografische Notiz und ein Vorwort von Margaret Ross ergänzt wurde, die als leitende Forscherin am Institut für Geografie und Geowissenschaften der Universität von St. Andrews tätig ist. Da man sich bei dem Foto auf der ersten Seite für eine Farbstatt eine Schwarz-Weiß-Fotografie entschieden hat, sind der rosafarbene Dunst am Ende der Bucht und die stellenweise bernsteinfarbenen Lichtreflexe auf dem Schlick zu erkennen, aber von diesen wenigen Nuancen abgesehen ist alles Grau in Grau. Es hat die ganze Nacht gestürmt. Und dann, bei Tageslicht, tauchen sie langsam aus den Nebelschwaden auf: Alte Baumstümpfe, die mit ihren an den Körper gepressten Armen und krummen Beinen losmarschieren wollen, Baumstämme, die am Boden liegen und sich erheben wollen, eine alterslose Armee, die den Fluten bei Niedrigwasser entkommen ist und, noch feuchtschimmernd, unter wild bewegtem Himmel, so wirkt als wolle sie den Strand im Sturm erobern. Es sind sicher mehrere Dutzend Individuen, auch wenn im Vordergrund nur einige wenige zu erkennen sind. Man meint, bei jeder neuen Ebbe müssten ihnen zig andere folgen, erstarrt in der Haltung, die sie hatten, als die Uhr einige Jahrtausende zuvor auf einen Schlag stehen blieb. Jeder Spaziergänger, jeder Laie hat seine eigene Theorie dazu. Ein halbes Jahrhundert vor Entwicklung der Radiokarbonmethode haben Clement Reids Zeitgenossen keine andere Methode der zeitlichen Einordnung zur Verfügung als die biblische, und während er sich bereits für Stratigrafie interessiert, sind die Zeiten um ihn herum vorsintflutlich. Diese versteinerten Wälder, die innerhalb einer Nacht erscheinen, bevor sie wieder in den Wellen verschwinden, nennen sie Noah’s Woods, Noahs Wälder.
In seinem Buch stellt Clement Reid zum ersten Mal die Hypothese auf, dass im Osten von Yorkshire, zwischen England und Dänemark, ein Gebiet zum Vorschein kommt, das früher so ausgedehnt war, dass man trockenen Fußes von einer Seite zur anderen gehen konnte. Mit der Klimaerwärmung und dem Schmelzen der Polkappen im Mesolithikum schrumpfte dieses Gebiet immer weiter. Statt der für die Sintflut verbuchten vierzig Tage und vierzig Nächte dauerte es jedoch sechstausend Jahre, bis der Meeresspiegel nach und nach so weit anstieg. Aber das Ergebnis ist das gleiche, und es gab ein Vorher und ein Nachher. Das Vorher einer vorsintflutlichen Welt, und das Nachher einer bis heute andauernden, historischen Epoche, in der man die Stabilisierung des Meeresspiegelniveaus für gegeben nahm. Dazwischen gab es einen Moment, in dem es kippte, in dem das Gleichgewicht verloren ging. An Orten, die von Gebietsverlusten betroffen waren, existieren über diesen Moment viele Mythen. Darin wird das Ganze wie eine Kollision dargestellt, es wird wie im Zeitraffer betrachtet. Das harrt einer Neubewertung, schreibt Clement Reid, der im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen nicht alles wörtlich nimmt und buchstäblich versteht. Auf seinem Nachttisch liegt eine Ausgabe der viktorianischen Bibel, er schlägt sie auf und liest sie anders, als man sie bisher gelesen hat. Da es keinerlei Artefakte aus Metall aus dieser Zeit gibt, datiert er den bei Ebbe in ganzen Bänken freigelegten versteinerten Torf und die in ihm enthaltenen Überbleibsel auf die Steinzeit. Nicht selten findet man zwischen den Bäumen Knochen von großen Säugetieren. Selbst heute noch ist es keine Seltenheit, dass Fischer Knochen in ihren Netzen nach oben ziehen. Seit Jahrhunderten spuckt das Nordseebecken immer wieder Überreste von Landtieren aus, von Arten, die in unseren Breitengraden nicht mehr existieren oder die generell ausgestorben sind.
Clement Reid stirbt drei Jahre nach Erscheinen seines Buches. Bei seinen Forscherkollegen von der Royal Society genießt er hohe Anerkennung, aber außerhalb dieser Kreise hat er kein großes Publikum und auch die Nachwelt nimmt ihn kaum zur Kenntnis, das hebt Margaret Ross in ihrer biografischen Notiz hervor. In ihr Vorwort flicht sie eine persönliche Anekdote ein und erinnert daran, dass Reid es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, die Fischer am Kai zu erwarten, so wie sie es beim niederländischen Paläontologen Dick Mol am Hafen von Rotterdam beobachtet und ab den neunziger Jahren selber praktiziert hat. Allerdings begann die Quelle langsam zu versiegen, nach einhundertfünfzig Jahren Schleppnetzfischerei auf den Untiefen der Doggerbank, im Zuge derer man inmitten von Fischen und Krebstieren Backenzähne, Stoßzähne, längliche Knochen, flache Knochen, Kiefer und Schädel von etlichen Tieren herausgeholt hatte, von denen sich viele zu Lebzeiten nie begegnet waren: Wolf, Hyäne, Mammut, Bison, Rhinozeros, Rentier, Walross, Elch und viele andere zur Familie der Hirsche zählende Tiere. Ihre jeweiligen Lebensräume haben keinerlei Ähnlichkeit mit unserer heutigen Umgebung, lässt man mal die Nachzügler der Evolution wie Hirsch, Hase, gemeiner Fuchs und Wildschwein außer Acht. Moorlog, so nennen die Fischer dieses Sammelsurium, diesen Mischmasch aus Holzstücken, alten Knochen, Torfblöcken und anderen versteinerten Überresten, die schwer in ihren Netzen liegen und sie beschädigen. Sie mussten erst davon überzeugt werden, im Interesse der Wissenschaft nicht gleich alles wieder über Bord zu werfen, selbst wenn man nur in seltenen Fällen ein handgearbeitetes Objekt darin findet, wie eine Harpune oder ein Steinbeil aus der Jungsteinzeit. Dennoch kommt es vor, dass ein Kapitän – sein Name und der seines Schiffes gehen sicher in die Annalen ein – größeren Forschergeist an den Tag legt, einen Sedimentblock zerbricht und dabei ein Stück von Seltenheitswert findet. Durch die modernen Fangmethoden werden die unterseeischen Ablagerungen verschoben und die Stratigrafie durcheinandergewirbelt. Mit Beginn der Schleppnetzfischerei treffen am Grund der Netze sämtliche Habitate aufeinander, die je existiert haben. Zum Glück kann man durch die Laboranalyse der versteinerten Torfstücke und die Untersuchung der Pollen und Sporen, die sie enthalten, eine Chronologie rekonstruieren und jedes Stück ins richtige Fach einsortieren.
Auf der Oberfläche der ausgedehnten Schwemmlandebene, welche die Nordsee darstellt, wenn sie trockengefallen ist, bei jedem extremen Temperaturanstieg oder -abfall, bei jeder Bewegung der Gletscher folgt eine spezifische Flora und Fauna auf die nächste. Das geschieht in aufeinander folgenden Wellen, der Kreis schließt sich immer wieder neu, ein Zyklus, der sich wiederholt. Eiswüste, Mammutsteppe, Taiga, gemischter Kiefernwald, gemäßigter Wald. Und dann wieder umgekehrt, Borealer Nadelwald, Tundra, Eiswüste. Bei jeder Klimaveränderung hebt und senkt sich das Inlandeis wie bei einem Atemzug. Es schiebt sich nach vorn, wird dicker, dehnt sich, breitet sich in alle Richtungen aus, oder zieht sich, wenn sich das Klima wieder erwärmt, zusammen, weicht zurück, zentriert sich, ist nur noch ein dünnes Packeis, kurz davor auseinanderzutreiben. Dann wird es erneut dicker, breitet sich aus, überzieht das gefrorene Wasser der Arktis und lässt sich auf der Landoberfläche nieder, ragt bei jeder neuen Phase der Abkühlung über seine bisherigen Grenzen hinaus, festigt sich, rutscht durch sein Gewicht und dank der unterirdischen Wasserströme weiter, rückt von den hohen Breitengraden in Richtung der gemäßigteren Breitengrade eines Europas vor, das in dem Moment, wo das Inlandeis es erreicht, schon nicht mehr in einer gemäßigten Zone liegt. Nachdem es sich dort niedergelassen hat, drückt es auf die Kontinentalplatten, die dem Druck an dieser Stelle zunächst standhalten, ihn wegstecken. Dann, in dem Maße, wie das Eis über ihnen wächst, senken sie sich schließlich unter der drei Kilometer dicken Eisschicht im Zeitlupentempo, senken sich immer tiefer und tiefer unter dem Gewicht des kalten Gletscherkörpers ab, der alles verwüstet, abkratzt und abschleift, bei jedem Atemzug, den er tut, bei jeder Verlagerung, jedem Vorstoß oder jedem Zusammenziehen. Unter seinem Bauch hobelt und häuft er alles an, was der felsige Sockel ihm an Material liefern kann, zum Ausquetschen, zum Weitertransportieren, zum Zermalmen, zum Zerkleinern zu Schotter, grobem Sand, feinem Sand, und die allergrößten Blöcke nimmt er gleich im Ganzen mit. Wenn er erst einmal auf dem Festland Fuß gefasst hat, dann gibt er es nicht mehr frei. Er streckt seine Gletscherzungen in Richtung Süden aus, immer massiver und mächtiger, er schluckt ganze Landschaften, und wenn er von ihnen ablässt, sind sie nicht mehr wiederzuerkennen.
Da entscheidet sich die Zukunft des Doggerlands. Auf den sich selbst überlassenen und im Angesicht des Gletschers wiedergewonnenen Flächen. Der Eisschild schiebt zugleich sowohl seine eigene Masse nach vorn als auch das, was er abreißt, was bei seinem Durchzug an der Oberfläche des Sockels friert und aufreißt, er nimmt mit, was über das hinausragt, woran er sich festhält, er nimmt Geröll jeder Art und Größe jedes Ausgangssubstrats und jeder Herkunft mit, das seinen Weg kreuzt, das unter dem Eis hindurch befördert wird, in der Geschwindigkeit, die er vorgibt, manchmal auch schneller. Dieses Geschiebe wird an die Ränder gedrückt und dort zurückgelassen, wenn der Gletscher sich zurückzieht, und sei es nur für den Sommer. Die Moränenfront wird durch das Schmelzwasser ausgewaschen. Dann wird sie erneut verschluckt, manchmal dauerhaft. Und schließlich wird sie endgültig wieder freigegeben, am Tag des Umschwungs, der das Ende der Eiszeiten besiegelt, wenn der Rückzug des Gletschers unumkehrbar wird, und diese Moränenfront, die sein Weggang ohne Wiederkehr vor Ort zurücklässt, anstelle und am Platz der Eisfront, Massive aus Granulat, die aus der größten jemals in Angriff genommenen Zermalmungsarbeit hervorgegangen sind, wird, angeordnet zu Hügeln, zu Bergkuppen, das einzigartige Relief des Doggerlands bilden, von einem Ende der Steppe zum anderen, sie werden die einzigen Hindernisse sein, die einzigen Schutzwälle gegen den Wind.
Vom Eisschild blasen die katabatischen Winde.
Permanent, immer in eine Richtung. In der Eiszeit tragen sie in allen europäischen Sprachen einen Namen.
Sie sind zehn Mal so stark wie ein Mistral und maßlos kalt, ihnen wird in allen Sprachen nachgesagt, dass sie den Menschen das Leben unmöglich machen, und diese sind dann auch Richtung Süden geflohen.
Die zur gemäßigten Flora gehörenden Arten sind ihnen vorausgegangen, haben hier und da eine windgeschützte Stelle gefunden, überall sonst ist ihr Pollen bei Kernbohrungen nicht nachzuweisen. Ausgehend von diesen Zufluchtsorten werden sie sich nach Beginn der Eisschmelze erneut auf den Weg machen, um Europa zu besiedeln. Ihr Eroberungsdrang wird erst gebremst, als die Klimaerwärmung zum Stillstand kommt; als die Temperaturen dann wieder steigen, versetzt ihnen das einen regelrechten Schub, und als das Phänomen an Fahrt aufnimmt, wird die Landschaft in weniger als einem Jahrtausend grundlegend verwandelt.
Bei der Vorlesung über Palynologie von Professor McGregor 1987 begegnet Margaret im Hörsaal Marc Berthelot. Die Palynologie, die Pollenanalyse, ist für Archäologen und Paläontologen aufschlussreich, für alle, die versuchen, unsere Lebensbedingungen in der Vergangenheit zu rekonstruieren. Aber auch die Ölindustrie interessiert sich für die Palynologie, sie begleitet die aufwendigen Explorationsbohrungen im Untergrund der Nordsee. Margaret fällt es leicht, ja, es hat für sie fast etwas Spielerisches, sich Woche für Woche Dutzende von mit dem elektronischen Mikroskop gemachten Pollen-Aufnahmen und die dazugehörigen lateinischen Namen einzuprägen, Pinus, Quercus, Betula. Für Marc Berthelot hingegen ist das eine echte Herausforderung, eine Hürde auf dem Weg zu seinem Wunschberuf, Ingenieur für Erdöl- und Erdgastechnik in der Offshore-Industrie, ein Hindernis, das zwischen ihm und einer vielversprechenden Karriere als Prospektor steht, als Goldsucher, und je mehr Wochen vergehen, je mehr Skripte sich ansammeln, desto unüberwindbarer scheint diese Mauer zu werden.
Er ist Franzose und sie versteht etwas Französisch. Als er auf den Campus kommt, begreift er nicht gleich sämtliche Geheimnisse der studentischen Codes und Rituale, aber er lernt schnell. Sie begibt sich in sein Kielwasser, lässt sich von ihm mitreißen, erlebt durch das Zusammensein mit ihm etwas, das sie vorher nicht hat ausleben können, dieses Jahr 1987, der erste Erasmus-Jahrgang und sein letztes Studienjahr, wird für sie eines der schönsten Jahre überhaupt. Sie feiern den ersten Vertrag, den Marc im folgenden Sommer bei British Petroleum bekommt. Er pendelt zwischen den Bohrarbeiten in der Nordsee und den Analysearbeiten in den Büros von BP in Aberdeen hin und her. Es ist eine Jugend vor Internet und Handy. Er ist unterwegs, ist eine Weile weg, kommt wieder, entscheidet sich, sie anzurufen, den Kontakt wieder aufzunehmen, er hat es in der Hand, aber tut es am Ende immer. Er findet sie so vor, wie er sie verlassen hat, sie freut sich jedes Mal, ihn zu sehen, hat Zeit oder auch nicht, ist ungebunden oder auch nicht, erlaubt sich, was er sich erlaubt. Er geduldet sich, wartet, fährt wieder, sie liebt es, sich bei seiner Rückkehr seine Geschichten anzuhören, sie zieht ihre Schlüsse daraus, füllt die Lücken aus, erfindet für sich einen Text, der zwischen den Zeilen steht, Gesichter, wo vielleicht gar keine sind, stellt ihm nur selten die entsprechende Frage, verlangt aus den gleichen Gründen nichts von ihm, denn ist es einmal ausgesprochen, kommt man nicht mehr daran vorbei. Vier Jahre lang kommt und geht er, taucht auf und verschwindet. In der Zwischenzeit stellt sie sich kaum vor, wie sein Berufsleben aussieht oder sein Leben überhaupt. Sie akzeptiert, dass er die Dinge nimmt wie sie kommen, das Leben nimmt wie es kommt. Er geht, aber er kommt auch wieder zu ihr zurück. Er kennt ihre Schattenseiten, er weiß, dass dieser vorgezeichnete Weg, dem sie folgt, ihr Halt gibt, so dass sie zumindest an dieser Front ihre Ruhe hat, und einen Ankerplatz, er weiß, dass sie an dieser Kontinuität hängt, die ihn mehr als alles andere schreckt, dass ihr das genügt, er zieht sie damit auf. Ihr Verhältnis zu Mobilität, zu Veränderung könnte nicht unterschiedlicher sein, offenbart, wie weit sie auseinanderliegen. Er stellt sich vor, wie ihr Leben in fünf Jahren aussehen wird, in fünfzehn Jahren, erst Studentin, dann Assistentin, eines Tages Forschungsbeauftragte. Er malt ihr ihre Zukunft aus, wie sie sich endgültig in dieser Ecke niederlassen wird, darauf bedacht, ihre Karriere dort zu beenden, wo sie sie begonnen hat, an der Uni, gut integriert, produktiv, genau das wünscht er ihr, ein Leben im Reinen mit sich, im Schutz der Mauern von St. Andrews.