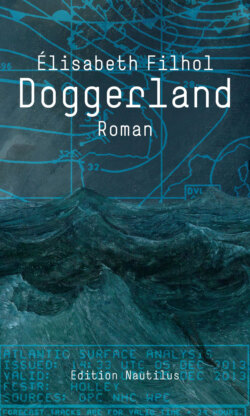Читать книгу Doggerland - Elisabeth Filhol - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеSo plötzlich, wie er auf den Satellitenbildern aufgetaucht ist, so plötzlich wird Sturm Xaver zur Top-Nachricht befördert, er erobert das Land und sucht die Bildschirme heim. Die ersten gesendeten Bilder sind Nachtaufnahmen, austauschbar, mehrheitlich von Strandpromenaden von Küstenorten, aufgenommen an der Westküste um Mitternacht. Dann folgen, entsprechend dem Heranziehen des Sturmtiefs, Bilder von verschiedenen Punkten an der Küste, dazu eine Fülle von Daten und Luftaufnahmen, die spektakulär genug sind, um die gigantische Maschinerie der Direktübertragung am Laufen zu halten. Die mediale Berichterstattung kommt in Gang, man stellt mögliche Szenarien für besonders exponierte, besonders gefährdete Gebiete auf, jede Redaktion ist darum bemüht, ein Filmteam an die Orte zu entsenden, die im Morgengrauen, also in nur wenigen Stunden, im Visier der Kameras vom Sturmtief erreicht werden. Zur Überbrückung zeigt man für die wenigen Zuschauer, die noch wach sind, Archivbilder der durch die Flutkatastrophe von 1953 ausgelösten Überschwemmungen, so als würde man einen Gedenktag begehen. Man übt sich in Geduld, indem man die Verbundenheit der sechzig Jahre zuvor vom Schicksal hart getroffenen Nordeuropäer heraufbeschwört – so hart getroffen, dass man in den Niederlanden daraufhin einen zweihundert Kilometer langen Schutzwall errichtete. Moderatoren und geladene Experten improvisieren, geben eine Warnmeldung nach der anderen heraus, noch stehen sie nicht unter Hochspannung, noch reden sie sich nicht die Köpfe heiß. Insgeheim dankt man Xaver für sein Timing, denn er hätte ja auch zur besten Sendezeit heranstürmen können.
Der Sturm breitet sich aus, in ganz Großbritannien herrscht Warnstufe Rot, man hat sich in seinen vier Wänden eingeigelt, der überwiegende Teil der Bevölkerung schlummert seelenruhig, obwohl sich draußen vor ihrer Tür ein solches Ausnahmeereignis abspielt. Manche schlummern sogar deshalb so gut, weil sie sich im Kontrast dazu hinter der schützenden Wand in der Wärme ihres Zimmers besonders sicher fühlen. So ergeht es zum Beispiel David Ross, dem Sohn von Stephen und Margaret, der in der Villa seiner Eltern an der Queen’s Terrace in St. Andrews eine Einzimmerwohnung im Gartengeschoss bewohnt und in regelmäßigen Abständen durch das Knarzen der alten Holzveranda aufwacht, von der man nicht weiß, ob sie dem Sturm standhalten wird. Jedes Mal, wenn er in diesem komaähnlichen Zustand kurz davor ist, wieder einzuschlafen, lauscht er einen Moment lang auf das Heulen und Pfeifen draußen, um das wohlige Gefühl, in seinem warmen Bett zu liegen, noch etwas länger auszukosten. Dort unten bekommt er von dem Kommen und Gehen oben nichts mit. Er hört noch nicht mal, wie das Parkett über seinem Kopf knarrt, als seine Mutter aufsteht. Er liebt es, dem Wind draußen zu lauschen. Selbst an einem Tag wie heute, vor allem an einem Tag wie heute, wenn Wind und Wasser zugleich in Aufruhr sind. Er liebt dieses Toben, vor dem ihn die Mauern beschützen, dieses Gefühl inneren Friedens, das erst durch die Gewalt der Ereignisse draußen entsteht, und die absolute Gewissheit, außerhalb ihrer Reichweite zu sein. Schon als Kind liebte er es, auf dem Boot in seiner Koje liegend, den Wind und den Regen zu hören, wenn der Sturm draußen das hektische Klirren der Flaggleinen an den Masten übertönte und das Boot, das Innere der Kajüte, vom Rest des Hafens abgetrennt zu sein schien. Nur den Lärm der Trosse, das Knirschen und Ächzen der schlecht vertäuten Haltetaue übertönte er nicht. Ihr Klagen, das vermutlich nur deshalb an die Oberfläche kam und sich seinen Weg übers Wasser suchte, weil es eine besonders schrille Frequenz hatte und sich ständig wiederholte, drang bis an sein Ohr. Er liebte es, im Trockenen zu sein, es warm zu haben, wenn der Regen in Böen aufs Ufer traf und so heftig gegen die Fenster der Steuerkabine hinter der Trennwand prasselte, dass er klanglich mit dem Brüllen des Windes mithalten konnte. Er liebte es, sich vorzustellen, er wäre jetzt auf offener See, würde mit Erfolg gegen die Elemente kämpfen, in dem beruhigenden Gefühl, dass sein Kutter, der schon so manche Bewährungsprobe hinter sich hatte, standhalten würde. Dabei war er voller Bewunderung für diesen Onkel, der erst spät, nach seiner Rückkehr von den Falklandinseln, in ihr Leben getreten war, ihren Horizont erweitert und ihnen einen ganz neuen Blick auf die Nordsee eröffnet hatte, ihm und dem Rest der Familie, die aus lauter Landratten bestand. Beagle lautete der Name des Trawlers. So hieß auch das Segelschiff, auf dem Charles Darwin damals zu seiner Südsee-Expedition aufgebrochen war, aber möglicherweise wusste sein Onkel das gar nicht. Die ersten beiden Werke Darwins, Die Fahrt der Beagle und Über die Entstehung der Arten, stehen neben der Originalausgabe von Submerged Forests in einem der Bücherregale im Wohnzimmer, ein Durchgangszimmer, das nach vorne ebenerdig zur Straße liegt, während es nach hinten, zum Garten hin, im ersten Stock liegt, weil das Gelände ein starkes Gefälle hat. Der Flur, der von vorne nach hinten durchgeht, ist mit schwarz-weißen Zementfliesen im Schachbrettmuster ausgelegt. Im Oberlicht über der Eingangstür zieht der Himmel wie ein Filmausschnitt im Schnelldurchlauf vorbei, nur schwach erleuchtet. Oder, wenn die Sonne zwischen den Wolkenbergen hindurchblitzt, ab und zu auch mal heller angestrahlt.
So gering der Lichteinfall auch ist, er genügt, um die Dunkelheit im Flur zu durchbrechen, so dass Margaret Ross, wenn sie aus dem Badezimmer kommt, den Weg zum Wohnzimmer findet, oder sie schaltet, ohne lange zu überlegen, das Licht in der Vitrine an, die den Flur indirekt beleuchtet und in der einige Stücke aus ihrer Sammlung ausgestellt sind, die sie sich aufgebaut hat, als die Fischer noch regelmäßig archäologische Fundstücke in ihren direkt über der Doggerbank ausgerichteten Schleppnetzen fanden. Normalerweise klingelt ihr Wecker eine Stunde später, dann macht sie sich leise fertig und geht zu Fuß zu den an der Promenade liegenden Gebäuden, in denen das Labor untergebracht ist, in dem sie arbeitet. Sie nutzt die fünfzehn Minuten Fußweg, die sie, wenn es nicht regnet, verdoppelt, in dem sie noch einen Abstecher zu den Ruinen der Kathedrale macht, um sich mental auf das einzustellen, was sie erwartet, um zu ihrer Basis zu finden, von der aus sie den Faden zu ihrer Arbeit und ihrem sozialen Umfeld wieder aufnehmen kann. Heute bricht sie mit dieser Gewohnheit und bereitet sich auf einen Flug in die Hafenstadt Esbjerg vor, an der Westküste Jütlands, wo der alljährliche Kongress der dänischen Unterwasserarchäologen stattfindet. Man erwartet vierhundert Teilnehmer, es gibt etwa zwanzig Gesprächsrunden oder Runde Tische, neben der Kongresshalle stehen diverse Konferenzräume und eine Ausstellungshalle zur Verfügung, und es gibt ein Abschluss-Dîner. Und nun lässt sich das alles komplizierter an als gedacht. Zumindest für die, die wie Stephen und sie dafür noch die Nordsee überqueren müssen.
Das Wohnzimmer der Familie Ross ist gemütlich eingerichtet, mit einem Mix aus ziemlich unterschiedlichen Materialien. Im ersten Moment hat man den Eindruck, eine wohnzimmerartige Hotelbar einer internationalen Kette zu betreten, und so wie dort stellt sich sogleich ein Gefühl von Behaglichkeit ein, es hat den gleichen wenn nicht unpersönlichen, so doch zeitlosen Touch und verbreitet eine Atmosphäre, die man als cosy bezeichnen würde. Eine dieser Hotelbars, in denen man jeden Monat einen anderen Künstler der Stadt ausstellt, um ihm die Möglichkeit zu geben, seine Arbeiten zu zeigen und zum Verkauf anzubieten. In diesem Monat wäre dieser Künstler dann eben zufälligerweise Kevin Hamilton, Margarets jüngster Bruder. Richtig ausgeleuchtet wäre dieses Bild kaum kompatibel mit seiner Umgebung, aber durch die heruntergedimmte Beleuchtung wirkt es weniger krass und fügt sich trotz seines radikalen Charakters, der sich erst bei näherem Hinsehen herausstellt, in das Ambiente ein und trägt auf seine Art zu dem eine Spur unkonventionellen und anheimelnden Charakter des Raumes bei. Die gegenüber der Couchgarnitur nach Süden ausgerichtete Essecke, mit einem Tisch aus hellem Holz in der Mitte und vielen Bücherregalen an den Wänden, dient Margaret zugleich als Arbeitsplatz. Sie hat zwar ein Büro im Gartengeschoss, aber dort ist es nicht so hell und sie hat ihre Bücher nicht griffbereit.
Gestern Nachmittag setzte David sich ihr gegenüber, während sie letzte Korrekturen an ihrem Vortrag vornahm. Er sah ihr wortlos dabei zu und checkte in seinem auf Vibrieren gestellten Handy seine Termine für den Nachmittag. Da fragte sie ihn unvermittelt, ob er damit einverstanden wäre, wenn sie ihm zwei, drei ihrer Ideen vortrüge.
»Ich habe dir jetzt schon so viel darüber erzählt«, rechtfertigt sich Margaret, »dass du dich inzwischen ganz gut damit auskennen dürftest.«
Er nickt. Hatte er denn die Wahl? Es blieb ihm gar nichts anderes übrig, als darauf einzugehen, sich für das zu interessieren, was sie begeistert, denn er ist sich ziemlich sicher, dass sie ihm bereits davon erzählt hat, als er noch in der Wiege lag.
»Man kommt kaum umhin, dir in dein Universum zu folgen«, sagt David lächelnd.
»Es ist nicht weniger interessant als andere.«
»Das leugne ich gar nicht.«
»Andere, die virtueller sind und dich mehr in ihren Bann ziehen …«
»Klar, da gebe ich dir Recht.«
»War es für dich denn wirklich so schwierig, dich auf diese Welt einzulassen?«
»Das habe ich nicht gesagt.«
Er legt sein Handy beiseite und schaut auf.
»Aber es hat schon eine Weile gedauert.« Er überlegt kurz. »Es hat gedauert, bis ich verstanden habe, wo wir uns da eigentlich befanden, was wir da wollten, ob es ein reales Land war oder nur ein Phantasieland. Andere Eltern haben sich für ihre Kinder Geschichten ausgedacht, und du hast mir eben, als ich klein war, davon erzählt. Du sagtest damals zu mir, du hättest keine Phantasie und würdest deshalb nichts erfinden. Dann zeigtest du mit dem Finger auf die Weltkarte und los ging’s. Dann nahmst du mich mit auf diese Reise und ich folgte dir, ganz instinktiv, natürlich aus Interesse, aber nicht nur.«
Er zögert. Dann fährt er fort:
»Auch ein bisschen aus Notwendigkeit, so wie der Sohn einer schwerhörigen Mutter beginnt, die Gebärdensprache zu erlernen.« Er lächelt. »Das ist im Grunde bis heute so. Ich tue mich manchmal schwer, die Dinge richtig einzuschätzen, zu unterscheiden, was Fiktion und was Realität ist. Das liegt daran, dass, wenn wir darüber reden, ich immer eine Brücke zwischen Kindheit und Erwachsenenalter schlage, und dadurch kommt alles Mögliche wieder hoch.«
»Das Doggerland ist keine Fiktion.«
»Ich weiß, es ist ein Stück Realität, das du rekonstruierst.«
»Ich bin nicht die Einzige. So einige haben sich dieser Sache verschrieben.«
»Seit ihr daran arbeitet«, sagt David, »seit du dieses Gebiet abläufst, weißt du da eigentlich wirklich, wonach du dort suchst, ist dir das klar?«
»Nach Artgenossen. Nach Leuten wie dir und mir. Und nach dem Zeitraum, der zwischen ihnen und uns liegt, der Leerstelle, die es zu füllen gilt.«
»Sind dir deine Zeitgenossen nicht genug?«
»Scheinbar nicht …«
»Dieser Ort kann uns möglicherweise etwas mitteilen, uns etwas lehren«, fügt Margaret hinzu.
Er hat für sie genau die richtige Größe, ist weder zu groß, noch zu klein, ist zugleich begrenzt und offen. Begrenzt, weil er durch den Anstieg des Meeresspiegels vom Rest des Kontinents abgetrennt und so zur Insel geworden ist, offen, weil man so wenig über ihn weiß, dass er geradezu dazu einlädt, unterschiedliche Hypothesen über ihn anzustellen, Vermutungen, wie er ausgesehen haben könnte. Allerdings haben diese Darstellungen wenig damit gemein, wie die Bewohner des Doggerlands sich selber und ihr dann nicht mehr zugängliches Gebiet gesehen haben. Offen ist er auch insofern, als diese Menschen zwar ein ebenso hoch entwickeltes Gehirn hatten wie wir, aber einen ganz anderen Bezug zur Welt, und durch ihre Existenzweise, die sich von unserer heutigen stark unterschieden hat, besonders geschärfte Sinne. Zu gerne würde sie die Denkweise dieser Menschen durchdringen, aber dafür sind manche ihrer Kollegen besser gerüstet als sie. Also begnügt sie sich durch ihre Arbeit als Geologin damit, das Material aus dem Untergrund zu Tage zu fördern, das die Paläontologen benötigen. Nachdem sie die Umgebung rekonstruiert hat, die noch frei von jedem menschlichen Leben ist, gibt sie ihre Ergebnisse weiter und ist immer wieder aufs Neue fasziniert, welche Schlüsse sie daraus ziehen.
»Ich liefere ihnen einen bewohnbaren Ort«, sagt Margaret, »und erhalte ihn bewohnt zurück. Dieser Ort eröffnet mir die Möglichkeit zur Zusammenarbeit, bietet Raum für einen Austausch, es ist ein Geben und Nehmen.«
»Ist er für dich genauso real wie Dänemark oder die Niederlande?«
»Auf jeden Fall konkreter als viele Länder, in die ich nie einen Fuß gesetzt habe.«
»Bald fühlst du dich bei diesen Menschen wie zu Hause. Sie sind also unseresgleichen. Aber selbst wenn wir das gleiche Gehirn haben und den gleichen Planeten bewohnen, stößt du bei deiner Arbeit doch an Grenzen. Du besuchst die Erde, die sie trägt, lässt sie auf dich wirken, aber sie gibt dir nur begrenzt Auskunft, du wirst nie erfahren, in welcher Welt sie eigentlich leben.«
»Genau, ihre Kultur bildet eine Barriere. Ich werde nie über die nötigen Codes verfügen. Sie gleichen uns, ja, und sind zugleich so verschieden von uns, dass es nur natürlich ist, dass wir Mühe haben, sie zu verstehen. Wir können das auf die Zeit schieben, die uns voneinander trennt. Auch wenn achttausend Jahre gemessen an der Menschheitsgeschichte nicht gerade viel sind. Die Menschen aus dem Mesolithikum haben keine Pyramiden gebaut, sie haben keine Megalithen errichtet, aber ihre Kultur ist deshalb weder ungeschliffen noch rudimentär. Vielleicht war ihre Gesellschaft im Ganzen betrachtet sogar lebenswerter als unsere, das ist gut möglich.«
Was vom Doggerland übrig ist, die Doggerbank, ruht in fünfzehn bis dreißig Metern Wassertiefe quer über dem 54. Breitengrad. Einige betrachten sie als Fischfanggebiet, andere als eine Erhebung des Meeresbodens, die sich für die Verankerung von Offshore-Plattformen anbietet. Sie ist eine Art Furt inmitten der Nordsee, in der Dinge vorstellbar sind, die anderswo undenkbar wären, und zugleich, da stimmen alle Berichte überein bis hin zu denen von Kapitänen aus der Zeit der Segelschifffahrt, ist dieser Bereich, vor dem die Seeleute schon immer auf der Hut waren, an Sturmtagen eine der gefährlichsten Untiefen und besonders schwer zu umrunden, da sie sehr ausgedehnt ist. Sie hat die Ausmaße der Insel, die das Doggerland am Ende war, bevor auch sie endgültig von der Landkarte verschwand. Über die Art und Weise, wie sie untergegangen ist, gehen die Meinungen auseinander. Aber eins ist sicher, auf dieser Insel ließ es sich gut leben, besser als andernorts in Nordeuropa, und sie war mehrere tausend Jahre lang besiedelt.
1985 brachte ein holländischer Fischer dem Paläontologen Dick Mol das neuntausend Jahre alte Gebiss eines Menschen und damit den allerersten Beleg für die Existenz des Doggerlands. Margaret erinnert sich, wie sie, eine Gruppe von etwa zehn Studenten aus St. Andrews und Birmingham, von dieser Nachricht elektrisiert waren und einige Jahre später die Keimzelle einer multidisziplinär arbeitenden Gruppe bildeten. Auf der Höhe des Thatcherismus fanden sie dort so etwas wie frischen Wind, und diese Art von Schatzsuche zog sie auf jeden Fall mehr in ihren Bann als der Run auf das schwarze Gold. Aber paradoxerweise verdankten sie ausgerechnet der Eisernen Lady und ihrer bedingungslosen Unterstützung der Erforschung und Ausbeutung der Offshore-Kohlenwasserstoffe die Beschleunigung ihrer Forschungen, da sie so unverhofft permanent mit geophysikalischen Daten versorgt wurden, die man am Grund der Nordsee gesammelt hatte.
Das Doggerland wurde dank ihrer Bemühungen vor dem endgültigen Untergang bewahrt. Und umgekehrt. Mit Sicherheit hat das Doggerland auch sie gerettet, stellt es doch einen Schlüsselmoment in ihrem an Schlüsselmomenten nicht gerade reichen Leben dar. Das den Tiefen der See entrissene, in seiner Topografie täuschend echt rekonstruierte Doggerland, das sich auf der Weltkarte orten lässt und insofern absolut greifbar ist, das nachweislich so aussieht, wie sie es sich vorstellt, ist eben kein Werk der Fiktion, ist nicht ihrer Phantasie entsprungen, sondern, nachdem es einmal kartografiert und seine Flora und Fauna dank ihrer täglichen Erkundungstouren inventarisiert waren, ein Ort, an dem sie ihren Mitmenschen entkommen und anderen Mitmenschen begegnen kann, Menschen, die ihr ähneln und die zugleich ein bisschen anders sind, und zwar in genau dem Maße anders, das nötig ist, um ihre eigene Andersartigkeit damit zu kaschieren, um ihre Schwierigkeit, die Wahrnehmungen, Codes und Bräuche der anderen zu teilen, darauf schieben zu können. In ihrem Forschungslabor beschränkt sie sich darauf, den einen oder anderen Umweltparameter zu verändern und sich vorzustellen, wie Menschen, die dort leben, sich daran anpassen können, rein materiell betrachtet, unabhängig von Riten und vom Glauben. Eine Spezialistin für alte Kulturen wäre auch nicht anders vorgegangen, nur musste man sich, um das zu sein, in seiner Umgebung, seiner Herkunftsgesellschaft so beheimatet fühlen, dass man den Unterschied ermessen konnte. Sie hingegen fühlt sich bereits unter ihren eigenen Zeitgenossen ein wenig wie eine Ethnologin, die sich ständig auf unbekanntes Terrain begibt und bezüglich Verhaltensweisen und Sozialisationsregeln alles neu erlernen, sich alles neu aufbauen muss. Seit ihrer Geburt macht sie einen Prozess der Akkulturation durch, so zumindest ihre Einschätzung, ohne jedoch eine Herkunftskultur zu haben, auf die sie sich stützen kann. Sie sind fünf Geschwister und sie ist das einzige Mädchen, insofern schob sie ihr Anderssein zunächst auf ihr Geschlecht, das war lange Zeit die einzig naheliegende Erklärung, die sie hatte und die ihr Gefühl rechtfertigte, nicht dazuzugehören. Es war ihr Glück, dass sie als einziges Mädchen unter lauter Brüdern, das sich in seine Phantasiewelt zurückzog, um sich vor Eindringlingen von außen zu schützen, diesen Sonderstatus hatte. Er lieferte ihrer Familie eine einfache Erklärung, denn wäre sie inmitten von vier Schwestern mit den gleichen Vorlieben und Sorgen so isoliert gewesen und hätte sich derart in ihre eigene Welt geflüchtet, hätte das natürlich Fragen aufgeworfen.
Sie setzte sich damals oft ans Ende der Mole, mit Blick aufs Meer, das sich manchmal farblich kaum abhob, Himmel und Meer eine Einheit, und das manchmal in ein unwirkliches Licht getaucht war. Sie beobachtete die Schiffe bei der Ein- und Ausfahrt aus dem Hafen, und die vor Aberdeen wartenden Versorgungsschiffe. In diesem Moment fühlte sie sich als Teil einer Gemeinschaft, es spielte keine Rolle, ob jemand zur See fuhr oder nicht, davon lebte oder nicht, alle waren ihr zugewandt. Alle Nordseevölker teilten unausgesprochen die gleiche Vergangenheit. Die Küstenbewohner sind mit der Nordsee groß geworden, fühlen sich durch sie eng verbunden, glauben an ihre einigende Macht, glauben, dass sie ihr Denken seit Jahrtausenden prägt, seit sie diesen mal grauen, mal tintenblauen Fluten mit dem unberechenbaren Charakter, von dem man nie weiß, was er im Schilde führt, die Stirn bieten. Ihr Verhältnis zu ihr war lange ambivalent, schwankte zwischen Liebe und Angst. Das ist teilweise bis heute so. Alle, die mit ihr zu tun haben, lieben sie so wie sie ist. Sie verzeihen ihr ihre Wutausbrüche, die von einem Moment auf den anderen in rohe Gewalt münden. Weil das nun einmal ihr Wesen ist. Das Wesen eines nördlichen Meers. Man könnte es sich natürlich südlicher erträumen, friedlicher und wärmer, so wie es früher auch mal war, aber eben jetzt nicht mehr ist. Alle, die sie gut kennen, glauben, dass diese Gewalt, die Konfrontation mit ihrer Gewalt, die immer ihren Preis hat, sie einander nahebringt, ihre Mentalität prägt, von Schottland bis Dänemark, von Norwegen bis zum Pas-de-Calais. Ein Teil ihrer gemeinsamen Kultur geht auf sie zurück, auf den Umgang mit ihr, die Reichtümer, die sie verschafft, die Zerstörungen, die sie anrichtet, die Menschen, die sie für immer verschlingt. Das und noch viel mehr. Vieles, was sie gemein haben, haben sie vergessen. Vieles an Wissen ist verloren gegangen, und die Kultur ihrer Vorfahren, die sich rund ums Nordseebecken niedergelassen haben, bildet nur den Rand dessen. Die Ränder sind einem ständigen Spiel der Kräfte unterworfen, und diese äußersten Ränder einer Insel von der Größe des heutigen Belgiens sind gar nicht so fern, liegen nur zweihundert Kilometer weiter im Norden. Der Schatten dessen, was nicht mehr da ist, lastet auf ihnen. Der Schatten dessen, was noch da sein könnte, wenn die Schmelze des Eisschildes früher zum Stillstand gekommen wäre und der Meeresspiegel dreißig Meter tiefer läge. Dieses Gebiet war einmal ein entscheidender Teil Europas und fehlt nun. Es war reich an Gebräuchen, an religiösen Überzeugungen, ein Ort, der zu Kooperationen führte, aber auch Rivalitäten erzeugte, ein Ort des Austauschs. Dieses Erbe tragen wir mit uns herum. Er ist nicht wirklich weg. Er ist auf indirekte Art immer noch da. Ein Gebiet, das heute mehr denn je Begehrlichkeiten weckt, in Unkenntnis dessen, was es einmal war.
Selbst wenn das Doggerland nicht dieser gesegnete Landstrich ist, der ex nihilo den Menschen aus dem Mesolithikum zum Geschenk dargebracht wurde, selbst wenn es Jahrhunderte unermüdlicher Eisschmelze gebraucht hat und den Rückzug der Gletscher nach dem Beginn der Klimaerwärmung, der zu einer noch nie da gewesenen Ausbreitung der Fauna und Völker geführt hat auf einer vorläufigen und größeren Version Europas, selbst wenn das alles erst nach und nach entstanden ist, nachdem das durch den Permafrost an der Oberfläche gebundene Wasser freigegeben wurde, selbst wenn die Tundra länger standgehalten hat als die Taiga und die Taiga länger als der gemäßigte Wald, geben uns die Pollen, die man durch Kernbohrungen zu Tage gefördert hat, darüber Auskunft, dass sich etwa 8000 vor Christus eine Art Gleichgewicht abzeichnet und es anschließend nur noch eines Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiels bedurfte zwischen den Laubbaumarten, bis sich herausstellte, welche endemische Art am Ende das Rennen machte. Auf dem langen Weg bis zu diesem Gleichgewicht kommen viele Parameter ins Spiel und tragen Etappe für Etappe dazu bei, aus diesem Gebiet einen Garten Eden zu machen. Währenddessen steigen die Meeresspiegel der Ozeane weiter an, sie dehnen sich immer weiter aus, und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, an dem die riesige Schwemmlandebene der Nordsee unwiderruflich überflutet wird. Aber das ist ein langsamer Prozess, und er geht einher mit einem milderen Klima, so als würde die Ebene zu einem niedrigeren Breitengrad herabsteigen, und als Ausgleich zu den damit einhergehenden, steigenden Temperaturen die Konzession eines Gebietsverlustes leichter verschmerzen können. Sicherlich ist das Doggerland während des gesamten Mesolithikums in einem ständigen Wandel begriffen, und zwar in fast jeder Hinsicht, angefangen bei seiner Kartografie. Richtig ist aber auch, dass im Hinblick auf Ressourcen, welche die Menschen zum Leben benötigen, und zwar nicht zum bloßen Überleben, sondern zu einem angenehmen Leben, alles da ist, zu ihrer freien Verfügung, in Hülle und Fülle, und das ist selbst auf der Inselversion des Doggerlands noch so, der konzentrierten, kompakteren Version, die dennoch so ausgedehnt ist, dass es in puncto Biodiversität den Tausenden in Clans organisierten Menschen das Nötige und auch das Überflüssige bietet. Sie werden eine Kultur entwickeln, die der ihrer Cousins vom Festland gleicht und doch eigen ist. Bevor das Doggerland überflutet wurde, war es eine prosperierende Insel. In den Lagunen im Schutz der Dünenketten gab es Fisch im Überfluss und brütende Vögel. Was nach dem Ende der Eiszeit ein anarchisches Wirrwarr von Strömen und Flüssen war in einer steinigen Landschaft, bewässerte in einem komplexen, aber stabilen hydrografischen Netz die Auen, es ermöglichte den Menschen, an den Flussufern zu siedeln, einem präzisen Rhythmus folgend und einer nicht minder komplexen Aufteilung des Territoriums zwischen den unterschiedlichen Gruppen. In der Ebene wuchsen Wälder aus Buchen, Erlen, Eichen und Haselbüschen. Ein See so groß wie der Genfer See, der Outer Silver Pit, der in anderen Zeiten dem Gletscher als Überlauf gedient hatte, dehnte sich in südwestlicher Richtung der Insel aus, an seinen Ufern wuchs Röhricht, es gab feine Sandstrände und Kiefernwälder. Die größten Mündungsgebiete gingen in ein Delta über. Und selbst da, in den Feuchtgebieten, den Salzwiesen, auf dem bei Ebbe riesigen Watt, genügte es, sich zu bücken und die Hand auszustrecken, um etwas zu erhaschen. Ein verlorenes Paradies, sagte David, als sie ihm diese Geschichten erzählte. Es gibt kein verlorenes Paradies, denkt Margaret, nur die Sehnsucht danach, im Einklang mit einer Umgebung zu leben, die einem alles gibt, was man braucht, und das über Dutzende von Generationen hinweg.
Je mehr Wissen man im Lauf der Zeit zusammenträgt, je präziser die Topografie wird, die Morphologie des Ganzen, die Zusammensetzung der Böden, die Flora und Fauna, und je größer die Flächen sind, die man per 3D-Computer-Modellierung darstellen kann, desto mehr läuft man das Doggerland so ab, wie es die Menschen im Mesolithikum taten. Man bekommt nach und nach eine immer genauere Vorstellung ihrer Lebensweise, der Verfahren, mit denen sie die vorhandenen Ressourcen nutzten, aber man wird nie etwas über ihre Kosmogonie erfahren, ihre Sitten und Gebräuche, ihre Künste, die im Gegensatz zu denen des Paläolithikums nur wenige Spuren hinterlassen haben. Man kann ihr Land wieder auferstehen lassen, es aus dem Wasser retten, es dem Vergessen entreißen, und kann ganz konkret, mit Hilfe unserer Art des Denkens und durch Analogien zu anderen, weniger alten Kulturen, wie der Kultur der Native Americans, versuchen, eine Phase zu rekonstruieren, die womöglich eine der letzten war, in welcher der Mensch im Einklang mit der ihn umgebenden Natur lebte, bevor es zur Neolithischen Revolution kam, und versuchen, darüber nachzusinnen, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Man spürt es, ganz intuitiv, dass es da diese Atempause gab, als die Menschen begannen, sesshaft zu werden, als die Bevölkerungsdichte auf diesem begrenzten Gebiet anstieg, und sich die organisierte Bearbeitung der Ressourcen abzeichnete, aber noch ohne die damit verbundenen Nebenwirkungen, das Horten, den Besitz, die Arbeit und den andauernden Krieg, um all das zu verteidigen.
Dieses Areal war bewohnt und versank im Meer. Entweder es wurde innerhalb eines Tages und einer Nacht durch eine Flutwelle ausradiert oder nach und nach überflutet. Dazu gibt es unterschiedliche Thesen, aber in einem sind die Spezialisten sich einig: Als die Neolithische Revolution die Anrainerländer der Nordsee erreichte, war das Doggerland bereits verschwunden. Es ist von den europäischen Gründungsmythen ausgeschlossen, aus dem kollektiven Gedächtnis getilgt. Kann man in dieser Amnesie die Folge eines allmählichen Rückzugs der Insulaner aufs Festland sehen, der sich über mehrere Jahrhunderte hinzog? Schön, wenn das wahr wäre. Es gibt kein verlorenes Paradies, nur ist es schlicht unmöglich, eine unglücklich verlaufene Trennung zu vergessen. Wäre alles gut verlaufen, gäbe es keinen Grund zur Wehmut. Der einzige Verlust, der nicht wiedergutzumachen ist, ist der, den man in sich trägt, dem man in seinem Inneren Exil gewährt. Manche erholen sich davon wieder, andere nicht. Und Margaret gehört zur Kategorie jener, die daraus ein Forschungsobjekt gemacht haben, um diesen Verlust besser zu verwinden. Diesen unergründlichen Ort in ihrem Inneren, der sich nicht topografisch verorten lässt, zu dem sie von Anfang an keinen Zugang hatte, zu dem der Zutritt verboten war und von dem sie sich in der Folge also trennen, langsam lösen musste, den hat sie in die hinterste Ecke verbannt und durch diesen weißen Fleck ersetzt, der noch zu erobern ist, der mitten in der Nordsee neu geschaffen werden muss. Es ist wie eine Trauer um etwas, das nicht existiert, also eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, Trauer um etwas, auf das man nicht zurückblicken und das man nicht wiederherstellen kann, und das, will man es hinter sich lassen, einen zwingt, eine Reise in andere Gefilde anzutreten, zu einem anderen Ort, den man zunächst von den Küsten aus begreift, die ihn fest umschließen und erst dann erforscht. Sie liebt die Ränder für das, was in ihrer Mitte ist, für das, was sie begrenzen. Zunächst hat sie an den Konturen gearbeitet, hat den Umriss des Doggerlands auf ihren Zeichnungen schwarz nachgezeichnet, erst dann hat sie sich mit der Mitte beschäftigt. Sie hat sich von Anfang an auf die Ränder konzentriert. Das Ausfüllen kam erst später, hat sie erst später beschäftigt, immer der Reihe nach, sie hat mit dem angefangen, was zuerst anstand, was am meisten drängte, etwas, an das sie sich halten und durch das sie sich definieren kann, die Ränder, die Hülle, wie das Äußere einer Muschel, durch die man die Form bereits erahnen kann und der man in einer zweiten Phase versuchen muss, eine Beschaffenheit zu geben. Aber es ist eine unglaublich langsame Arbeit, eine Suche, die keine Grenzen kennt, das weiß sie sehr gut. Während einige ihrer Kollegen von der Universität ihre Kräfte bündeln, den Leuten die Türen einrennen, privaten Finanzierungen oder Subventionen nachjagen, während sie an die Öffentlichkeit gehen, Debatten lostreten, sich in Rage reden, vor der exzessiven Ausbeutung der Doggerbank warnen, Seminare organisieren, Symposien, Ausstellungen, die sich an das breite Publikum richten, während sie Gemeinwohl und privatwirtschaftliche Interessen zugunsten ihrer Forschungen in Einklang bringen, während sie einen Pakt mit dem Teufel eingehen, wie David sagen würde, während sie mit Firmen und Marktforschungsunternehmen zusammenarbeiten, während sie ihrem Forschungslabor das Überleben sichern, ihre Teams anleiten, ehrgeizige Programme ins Leben rufen, widmet sie, Margaret, sich ausschließlich der reinen Forschung. Sie erkennt an, dass die Aktivitäten der anderen unerlässlich sind, aber beteiligt sich nicht daran, oder kaum, zumindest nicht in dem Maße, wie man es von ihr erwarten würde, wenn sie bereit wäre, die Führung des Labors zu übernehmen. Das hat sie jedoch wiederholt abgelehnt, auch wenn ihre Qualitäten als Forscherin unbestritten sind und sie in jedem Fall die dafür nötige Legitimation hätte, doch das ist eben ein anderes Betätigungsfeld und sie würde sich dann nicht mehr dem Allerwichtigsten widmen können, dem, was sie gerne tut und was ihr eine Struktur gibt, der Arbeit vor Ort, die man normalerweise ab einem gewissen Alter aufgibt, um sich anderen Aufgaben zu widmen.
Gestern Nachmittag also sitzen sie beide, David und sie, sich an ihrem Esstisch gegenüber. Während sie am Bildschirm ihr Exposé herunterscrollt und die Ideen sammelt, die fächerübergreifend von Interesse sind, ihre Grundthesen, die im Gegensatz zu den Überschriften über den einzelnen Abschnitten nicht unbedingt auf ersten Blick zu erkennen sind, greift David sich das Programm des Kongresses von Esbjerg, das auf dem Tisch liegt. Der Titel der Ausgabe von 2013 lautet: Offshore industry and Archaeology, a creative relationship. Darin werden die Kooperationen zwischen Forschung und Industrie der letzten Jahre aufgelistet, eine seiner Mutter zufolge fruchtbare Zusammenarbeit. Er jedoch betrachtet sie mit gemischten Gefühlen und hat so seine Zweifel, dass sie und ihre Kollegen langfristig wirklich davon profitieren werden. Nachdem er die Liste der Referenten überflogen hat, spult er laut Namen herunter, die von verschiedenen Anrainerländern der Nordsee stammen, und die Namen der Firmen, für die sie arbeiten, Ölkonzerne, Windparkbetreiber, Consulting-Firmen, Gesellschaften, die spezialisiert sind auf die Erhebung von bathymetrischen und seismischen Daten, die ganze kleine Welt der Offshore-Industrie eben, und mittendrin die Wissenschaftler. Sie begegnen sich dort und ergreifen abwechselnd das Wort: Berichte über Ausgrabungen, Projektpräsentationen, Studien zur Umweltverträglichkeit, technische Innovationen. Normalerweise haben diese Leute nichts miteinander zu tun, stellt David fest, sie kommen aus unterschiedlichen Welten und haben eigentlich völlig gegensätzliche Interessen. Das ist so, als würden sich David und Goliath zusammentun. Der eine ist vom Wissensdurst getrieben, der andere hungert nach Profit, der eine möchte Erkenntnisse sammeln und mit anderen teilen, sagt er und schaut dabei seine Mutter an, während der andere den Hals nicht voll bekommt und deshalb so lange Öl fördert, bis er den letzten Tropfen aus dem Boden geholt hat.
»Die Universität kann uns für unser Forschungsprojekt nur lächerliche Mittel zur Verfügung stellen«, merkt Margaret an. »Wenn man unterseeische Ausgrabungen machen will, kommt man nun einmal nicht an ihnen vorbei, nur über sie hat man Zugang zu dieser Masse von Daten, die man dann informatisch verarbeiten kann, analysieren, extrapolieren, zu denen man Hypothesen aufstellen kann. In Stonehenge hat man es leichter, da läuft man ein Stück Erde ab. Das Doggerland ist aber nun einmal unter fünf bis zehn Meter tiefen Sedimentschichten verschüttet, bei einer durchschnittlichen Bodentiefe von zwanzig Metern, und dann auch noch über hundert Kilometer von der Küste entfernt. Wenn wir da mitmischen möchten, sondieren, bohren, kartografieren, 3D-Modelle erstellen, dann brauchen wir Drittmittel.
Es gibt nur wenige Meeresgründe auf dem gesamten Globus, die so systematisch erforscht worden sind wie der Meeresgrund der Nordsee, in diesem Umfang, in dieser kurzen Zeit, unter diesen extrem harten Bedingungen. Dafür wurden gigantische Summen eingesetzt und ein Heer von Arbeitskräften aufgeboten. Wenn wir also Zugang zu bestimmten Datensätzen der Industrie bekommen und die Ressourcen der Unternehmen, die in der Unterwasser-Erkundung am weitesten fortgeschritten sind, in den Dienst der öffentlichen Forschung gestellt werden, eröffnet man damit den Zugang zu vielen Forschungsfeldern, die uns bisher verschlossen waren.«
»Habt ihr denn keine Angst, dass ihr dafür eine Gegenleistung erbringen müsst?«
»Es gibt ja schließlich ein Gesetz zum Schutz des archäologischen Erbes oder zumindest soll es dazu dienen. Alle diese Aspekte werden in Esbjerg am letzten Tag Thema sein und debattiert werden«, sagt Margaret. »Regeln, Regulierung, Harmonisierung und bewährte Verfahren. Das ist das Thema des letzten, halben Konferenztages.«
Er wirkt nicht überzeugt. Sie kennt ihren Sohn, es braucht schon etwas mehr, um ihm seine Zweifel zu nehmen und ihn dazu zu bringen, sein Urteil zu überdenken. Das stört sie nicht. Sie ist daran gewöhnt, dass er radikale Positionen vertritt oder zumindest nicht gerne einlenkt. Es wäre für sie eher ein Grund zur Beunruhigung, wenn er in seinem Alter anders reagieren würde. Außerdem tut es Stephen und ihr ganz gut, wenn sie ab und zu mal ein bisschen in ihren Grundfesten erschüttert werden, ihre Überzeugungen und Denkmuster einem Stresstest unterzogen werden, selbst wenn David dabei manchmal übers Ziel hinausschießt. Jetzt gerade zum Beispiel prognostiziert er ihr nichts Geringeres, als dass ihr Studienobjekt bald nicht mehr existieren wird, sein Verschwinden quasi programmiert ist, unausweichlich, durch die immer expansionistischere Ausbeutung der Doggerbank, von der sie momentan zwar noch profitiert, aber eben nicht mehr lange.
»Die Schleppnetze haben doch schon sämtliche Fossilien aus der Untiefe weggefischt.«
»Viele davon sind bei uns gelandet«, sagt Margaret.
»Die meisten sind für immer verloren. Diesen Zugang zu Informationen, diese Zusammenarbeit mit der Industrie, müsst ihr teuer bezahlen, aber euch ist ja kein Preis zu hoch, wenn ihr nur mit Daten für eure Forschungen versorgt werdet, in der Hinsicht seid ihr einfach unersättlich. Nur habt ihr es leider mit jemandem zu tun, der noch gefräßiger ist als ihr, jemand, der euch gut kennt, der euch durchschaut hat, der weiß, welche Opfer zu bringen ihr bereit seid.«
»Das ist nun einmal das Prinzip der Präventiven Archäologie. Sie verdient diesen Namen eigentlich nicht, da gebe ich dir Recht. Denn schließlich geht es dabei nicht darum, die Ausgrabungsstätte zu schützen, oder nur ausnahmsweise, wenn man einen außergewöhnlichen Fund macht. Das Doggerland ist eine mesolithische Enklave inmitten der Moderne, einige von uns würden ihr gerne zu neuem Leben verhelfen, und unsere Zeit gibt uns dafür die Mittel. Unsere Arbeit ist nur insofern präventiv, als wir verhindern, dass Informationen verloren gehen, indem wir Daten erheben, Proben entnehmen, bestimmte Materialien sammeln. Das ist an Land nicht anders. Man baut einen Parkplatz, eine Autobahn, einen großen Kanal, und die Arbeiten werden während der Ausgrabungen ausgesetzt oder verlangsamt, aber es ist immer ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn früher oder später wird alles, oder fast alles, zerstört werden.«