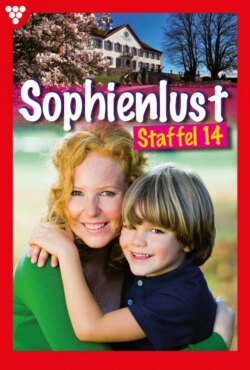Читать книгу Sophienlust Staffel 14 – Familienroman - Elisabeth Swoboda - Страница 6
ОглавлениеDenise von Schoenecker, der die Sommerhitze normalerweise nichts anhaben konnte, fühlte sich unbehaglich. Sie war überzeugt, in dem großen Kaufhaus, in dem sie sich im Augenblick aufhielt, funktionierte die Klimaanlage nicht ordentlich.
Es herrschte ein ziemliches Gedränge, denn auf den Verkaufstischen stapelten sich die Sonderangebote. Zusätzlich aufgestellte Drahtkörbe mit besonders preiswerten Waren verengten die Durchgänge, sodass man kaum daran vorbeikam.
Irgendetwas hätte ich noch besorgen sollen, dachte Denise. Was war es bloß? Sie wollte stehenbleiben, wurde aber vorwärtsgeschoben.
Der Lärm und die schlechte Luft beeinträchtigten ihre Konzentrationsfähigkeit. Ach ja, jetzt fiel es ihr wieder ein. Nick brauchte neue Schwimmflossen. Wo befand sich eigentlich die Sportartikelabteilung?
Energisch bahnte sich Denise einen Weg zur Rolltreppe, neben der sich eine Orientierungstafel befand. Dabei kam sie an Ständern mit Wintermänteln zu unglaublich niedrigen Sommerpreisen vorbei. Der bloße Anblick dieser wärmenden Pracht machte ihr die herrschende Hitze noch unerträglicher. Endlich stand sie neben der Rolltreppe und stellte fest, Sportsachen gab es im dritten Stock.
Denise fuhr nach oben. Dort merkte sie erleichtert, dass in diesem Stockwerk wesentlich weniger Menschen anwesend waren als unten, sodass sie in Ruhe ein Paar Schwimmflossen aussuchen konnte. Dabei erinnerte sie sich, dass Henrik geklagt hatte, seine Taucherbrille sei undicht. Also entschloss sie sich, ihm eine neue zu schenken. Danach blieben ihre Blicke an buntgemusterten Badekleidern aus Frotteestoff hängen. Sie fand, dass diese Kleider für die Mädchen in Sophienlust sehr praktisch wären, wenn sie zum See gingen. Aber Kleider wollte Denise nicht kaufen, ohne dass die Mädchen Gelegenheit hatten, sie zu probieren. Deshalb suchte sie die Stoffabteilung auf, wo sie sich für einen gelb, orange und rot geblümten Frotteestoff entschied, von dem sie annahm, dass er den Kindern am besten gefallen würde. Morgen würde sie dann die Schneiderin anrufen und nach Sophienlust bestellen.
Denise überlegte, wie viel sie von dem Stoff benötigen würde. »Wenn ich pro Kind zwei Meter nehme«, rechnete sie halblaut, »neun mal zwei, das wären achtzehn Meter. Für Heidi und die kleineren Mädchen würde zwar auch etwas weniger genügen, umgekehrt aber schadet es nichts, wenn etwas als Reserve übrigbleibt. Ich möchte zwanzig Meter von diesem Frotteestoff hier«, sagte sie dann laut zu der Verkäuferin, die sie daraufhin ungläubig ansah und anzunehmen schien, dass sie sich verhört habe.
»Zwanzig Meter?«
»Ja, ich rechne für jedes meiner Mädchen zwei Meter. Das ergibt achtzehn Meter, und zwei Meter möchte ich als Reserve«, erklärte Denise etwas ungeduldig.
Die Verkäuferin betrachtete sie mit staunenden Blicken. Sie konnte nicht recht glauben, dass diese schlanke, jugendlich wirkende Frau neun Töchter und vielleicht noch wer weiß wie viele Söhne besitzen sollte. Natürlich wusste sie nicht, dass der Stoff für Denises Schützlinge in Sophienlust bestimmt war.
Die zwanzig Meter Frottee ergaben ein ziemlich schweres Paket. Denise überging im Geist noch einmal ihre getätigten Einkäufe und war nun überzeugt, nichts vergessen zu haben. Sie fuhr die Rolltreppen wieder hinunter und strebte dem Ausgang zu, um ihre Last möglichst schnell im Auto verstauen zu können. Doch knapp vor dem Ausgang geriet sie in ein Knäuel aufgeregt durcheinander redender Menschen. Alle ihre Versuche, sich Durchgang zu verschaffen, schlugen fehl. Sie vermochte nicht zu erkennen, was die Ursache dieses Auflaufs war, doch aus einigen Bemerkungen entnahm sie, dass eine alte Frau plötzlich zusammengebrochen war.
»Die Arme! Wie schrecklich!«
»Ich habe gesehen, was passiert ist. Sie ist einfach umgefallen. Ganz plötzlich.«
»Ein Glück, dass so schnell ein Arzt zur Stelle war.«
»Was fehlt der Frau?«
Denise hasste es, von einer Menge Neugieriger eingekeilt zu sein, aber sie konnte weder vor noch zurück. Doch jetzt hörte sie die Sirene eines Krankenwagens, und das Knäuel vor ihr geriet in Bewegung. Undeutlich nahm sie wahr, dass jemand auf einer Bahre abtransportiert wurde. Nun sah sie auch den Arzt, einen älteren Mann, der achselzuckend erklärte:
»Da war nichts mehr zu machen. Sie muss sofort tot gewesen sein. Meiner Meinung nach Gehirnschlag.«
Nachdem es nun nichts Sensationelles mehr zu sehen gab, verlief sich die Menge wieder. Denise hatte ihr Paket für einen Augenblick auf den Boden gestellt. Sie war durch den Stoffkauf und die Vorstellung, dass sich die Mädchen darüber freuen würden, froh gestimmt gewesen, aber der Tod der unbekannten alten Frau hatte diese Stimmung ins Gegenteil umschlagen lassen. Denise war nun traurig und deprimiert. Trotz der Hitze fröstelte sie. Seufzend wollte sie das Paket wieder aufnehmen, als sie hörte, dass jemand neben ihr leise, doch anhaltend schluchzte. Es gelang ihr unschwer, den Urheber dieses Geräusches festzustellen. Da stand ein kleiner, ungefähr fünfjähriger Junge, zusammengesunken, mit bebenden Schultern. Von seinem Gesicht war nichts zu erkennen, denn er hielt den Kopf gesenkt. Denise sah nur seine blonden, glatten halblangen Haare. Doch niemand kümmerte sich um das Kind. Die Leute hasteten alle vorüber.
»Warum weinst du? Was ist denn geschehen?«, fragte Denise den Jungen.
Ihre Stimme schien ihn trotz des sanften Tons zu erschrecken, denn er zuckte zusammen und warf ihr aus verquollenen Augen einen schüchternen Blick zu. »Meine Großmutti ist fort«, würgte er, von neuerlichem Schluchzen geschüttelt, hervor. Er schnupfte auf und fuhr sich mit dem Handrücken über die Nase.
Denise öffnete ihre Handtasche und holte ihr Taschentuch hervor. Damit putzte sie ihm die Nase und versuchte, auch seine Augen zu trocknen, doch die Tränen rannen ihm immer von neuem über die Wangen.
»Komm, dort drüben ist der Informationsschalter. Ich gehe mit dir hin. Wir wollen die Dame bitten, deine Großmutti über den Lautsprecher auszurufen. Du weißt doch, wie du heißt?«
»Anselm Nissel. Aber das nützt nichts.« Der Junge schüttelte trostlos den Kopf.
»Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bleibe bei dir, bis dich deine Großmutti holt.« Denise nahm den Jungen bei der Hand und wollte ihn wegziehen, doch Anselm rührte sich nicht vom Fleck. Seine Tränen flossen unaufhörlich weiter. Das Taschentuch von Denise war nun schon ganz nass. Sie versuchte den Jungen von neuem zu beruhigen. »Du brauchst doch nicht so sehr zu weinen. Bestimmt sucht dich deine Großmutti. Was wird sie von dir denken, wenn du so verweint bist?«
»Nein, meine Großmutti sucht mich nicht. Sie ist fort und hat mich hier allein gelassen.«
Denise faßte ihn nun genauer ins Auge. Er sah ganz und gar nicht nach einem vernachlässigten Kind aus. Er war hübsch und adrett gekleidet und für einen kleinen Jungen erstaunlich sauber gewaschen.
Denise überlegte, ob er vielleicht so schlimm gewesen war, dass seine Großmutter sich bemüßigt gefühlt hatte, ihm eine Lektion zu erteilen, aber sie verwarf diesen Gedanken sofort wieder. Die schüchternen blaugrauen Augen, der zarte Mund und die etwas blassen Wangen überzeugten sie davon, dass sie einen sehr braven Jungen vor sich hatte.
»Ich weiß nicht, wie ich dir helfen soll. Erzähl mir einmal genau, was vorgefallen ist«, forderte Denise ihn schließlich auf.
Folgsam begann Anselm zu erzählen: »Meine Großmutti wollte eine Salatschüssel und neue Suppenteller kaufen. Wir sind eine Weile herumgegangen und haben geschaut, wo das Geschirr ist. Es war furchtbar heiß, und die Leute haben uns immer wieder weggedrängt.«
Denise nickte. Ihr selbst war es heute genauso ergangen. »Und in dem Gedränge hast du deine Großmutti verloren?«, vermutete sie, als Anselm stockte.
»Nein. Sie hat mich doch an der Hand gehalten. Aber auf einmal ist sie stehengeblieben und hat gesagt, dass ihr schlecht ist und dass wir schnell hinaus auf die Straße gehen sollten. Dabei hat sie mich losgelassen und ist umgefallen. Ich wollte sehen, was los ist, aber da waren so viele Leute. Sie haben mich immer weiter weg von meiner Großmutti geschoben. Und dann ist ein Auto gekommen. Sie haben meine Großmutti hineingelegt und sind fortgefahren.«
Denise war erschüttert. An die Möglichkeit, dass es sich bei der verstorbenen Frau um Anselms Großmutter handeln könnte, hatte sie nicht gedacht.
Anselm blickte vertrauensvoll zu ihr auf. »Vielleicht kannst du mich zu meiner Großmutti bringen?«, schlug er vor.
»Nein. Das ist nicht möglich«, erwiderte Denise. Sie wusste, der Junge hatte noch nicht erfasst, dass seine Großmutter tot war, und sie selbst fühlte sich im Moment außerstande, ihm diese Tatsache beizubringen. »Wo wohnst du denn? Ich werde dich zu deinen Eltern bringen«, sagte sie statt dessen.
»Ich wohne in der Breitegasse Nummer drei, erster Stock, Tür siebzehn. Aber es ist jetzt niemand daheim.«
»Arbeiten deine Eltern? Vielleicht kann ich sie an ihrem Arbeitsplatz erreichen?«
»Meine Mami hat ein Geschäft. Einen Kosmetiksalon.«
»Gut. Sag mir die Adresse. Wir wollen hinfahren.«
»Es ist nicht weit von hier. Hauptstraße hundertneun. Jetzt ist aber nur Frau Kaufmann dort. Meine Mami ist auf Urlaub gefahren.«
Denise war einen Augenblick ratlos, und dieses Gefühl schien sich auf Anselm zu übertragen, denn er begann wieder zu weinen.
»Du brauchst nicht zu weinen, ich lasse dich bestimmt nicht im Stich«, tröstete Denise den Jungen. »Komm, wir wollen erst einmal meine Einkäufe zu meinem Auto tragen. Hilfst du mir dabei?«
Anselm griff willig nach der Tragetasche, in der sich die Schwimmflossen und die Taucherbrille befanden, und folgte Denise. Dieser war inzwischen bewusst geworden, dass Anselm nur von seiner Mutter, nicht aber von seinem Vater gesprochen hatte. Deshalb fragte sie: »Ist dein Vater zusammen mit deiner Mutter auf Urlaub gefahren?«
»Mein Vati? Das weiß ich nicht. Vielleicht.«
Diese vage Auskunft überraschte Denise, aber sie wollte nicht weiter in den Jungen dringen. Doch Anselm erklärte, ohne dass sie ihn dazu aufforderte: »Leider weiß ich nicht, wo mein Vati wohnt. Er besucht uns oft am Samstag oder am Sonntag, aber ich war noch nie in seiner Wohnung.«
Denise hielt es für klüger, auf das Thema Vater nicht näher einzugehen. Anselms Familienverhältnisse schienen etwas undurchsichtig zu sein.
»Wir wollen einmal das Geschäft deiner Mutter und Frau Kaufmann aufsuchen.«
Die Fahrt dorthin war kurz. Denise parkte ihren Wagen in einer Seitengasse und stieg aus. Dann übernahm Anselm die Führung. Er schien sich hier gut auszukennen.«
»Es ist im ersten Stock. Wir müssen läuten.«
Eine blonde, ein wenig übertrieben zurechtgemachte Frau in einem weißen Kittel öffnete. »Ja, Anselm, was machst du denn hier?«, rief sie erstaunt aus. Dann fiel ihr Blick auf Denise, die sich kurz vorstellte und dann fragte: »Sind Sie Frau Kaufmann? Ich muss mit Ihnen eine ernste Angelegenheit besprechen.«
»Ja, gewiss, ich bin Frau Kaufmann. Darf ich Sie in unser Wartezimmer führen? In fünf Minuten stehe ich Ihnen zur Verfügung. Ich habe gerade eine Kundin, aber es wird nicht lange dauern.«
Frau Kaufmann führte Denise in einen geschmackvoll eingerichteten Raum mit elfenbeinfarbenen Tapeten und blauen Polstersesseln. Denise merkte an Anselms Auftreten, dass nun weit sicherer war, dass er sich hier zu Hause fühlte. Er reichte Denise einige Zeitschriften und meinte höflich: »Wenn Sie sich damit inzwischen die Zeit vertreiben wollen, Frau von Schoenecker?«
Denise lächelte. Sie war sicher, dass der Junge diesen Satz seiner Mutter oder Frau Kaufmann abgelauscht hatte.
»Du darfst mich Tante Isi nennen, wie die Kinder in Sophienlust. Leg die Zeitungen wieder weg und setz dich zu mir. Ich werde dir von meinen Söhnen Dominik und Henrik erzählen und von unserem Kinderheim.«
Anselm lauschte gebannt Denises Schilderung. Sie beschrieb ihm Sophienlust, das Haus und den Park, die Kinder und Schwester Regine. Sie hatte vor, ihn zu fragen, ob er mit ihr kommen wolle, um einige Tage in Sophienlust zu bleiben, bis seine Mutter von ihrem Urlaub zurückgekehrt war. Doch der Eintritt Frau Kaufmanns unterbrach ihre Erzählung.
»So, nun habe ich Zeit. Für heute ist niemand mehr vorgemerkt. Womit kann ich Ihnen behilflich sein?« Sie sah Denise neugierig an.
»Ich weiß nicht, wie ich beginnen soll. Anselm hat heute seine Großmutter beim Einkaufen begleitet.« Denise zögerte. Sie bemühte sich, die richtigen Worte zu finden, um Anselm nicht zu sehr zu erschüttern. »Plötzlich ist die Frau zusammengebrochen. Ich war selbst nicht dabei, ich habe nur gehört, wie der herbeigerufene Arzt festgestellt hat, dass sie einem Gehirnschlag erlegen ist.«
»Das ist ja schrecklich. Die alte Frau Nissel ist tot?«, rief Frau Kaufmann entsetzt.
Denise nickte.
»Sie ist doch immer ganz gesund gewesen. Und gar so alt war sie auch noch nicht. Ich habe sie nur immer die alte Frau Nissel genannt, um sie von meiner Chefin zu unterscheiden. Was mache ich jetzt bloß?«
»Großmutti ist tot?« Anselm war bleich geworden. »Ich habe geglaubt, sie sei krank. Ist sie wirklich gestorben, so, wie unsere Gemüsefrau? Kommt sie nun auch nie mehr zurück?«
»Ja, mein armer Kleiner. Was fange ich nun mit dir an, bis deine Mutter zurückkommt?« Frau Kaufmann hatte Anselm in ihre Arme gezogen, was diesem aber nicht zu behagen schien, denn er wand sich los.
Denise schaltete sich ein: »Darüber brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Wenn Anselm einverstanden ist, nehme ich ihn mit nach Sophienlust. Das ist ein Kinderheim in Wildmoos, das ich für meinen Sohn verwalte. Anselm wäre dort gut aufgehoben. Ich will mich natürlich nicht aufdrängen. Wenn Anselm Verwandte hat, bei denen er bleiben kann …«
»Nein, die hat er eben nicht«, fiel Frau Kaufmann ihr ins Wort. »Ich kenne zumindest niemanden. Nicht einmal seinen Vater. Aber die Familienverhältnisse meiner Chefin gehen mich natürlich nichts an«, fügte sie hastig hinzu, als sie Denises ablehnende Miene bemerkte.
Anselm hatte die Bemerkung Frau Kaufmanns über seinen Vater überhört, denn Denises Angebot, ihn mitzunehmen, beschäftigte ihn voll und ganz. »Ich darf wirklich mitkommen?«, fragte er. »Ich werde Heidi, Henrik und alle anderen Kinder kennenlernen?«
»Ja«, versicherte Denise, »aber du darfst nicht ungeduldig sein. Ich muss mit Frau Kaufmann noch einiges besprechen. Zunächst einmal ist es notwendig, dass deine Mutter verständigt wird. Würden Sie das erledigen, Frau Kaufmann?«
Die Angesprochene machte ein betretenes Gesicht. »Wenn es möglich wäre, würde ich es schon übernehmen. Aber ich weiß nicht, wohin Frau Nissel gefahren ist. Sie hat keine Urlaubsanschrift hinterlassen.«
»Sie haben keine Ahnung, wo Frau Nissel sich befindet?«
»Nein. Bis jetzt habe ich auch noch keine Post von ihr bekommen.«
»Mir hat Mami eine Karte geschickt«, meldete sich Anselm.
Erwartungsvoll beugte sich Denise über das Kind. »Steht eine Adresse darauf? Vielleicht von dem Hotel, in dem deine Mutter wohnt?«
»Nein. Ich glaube nicht. Aber ich kann noch nicht lesen. Großmutti«, sein Gesicht umwölkte sich wieder, »Großmutti hat mir alles vorgelesen. Ich habe es mir genau gemerkt: Viele Bussi schickt dir Mami von einem Ausflug in die Wüste. Vorne auf der Karte waren zwei komische Bäume – Palmen heißen diese Bäume – und ein Kamel. Und ein schöner blauer Himmel.«
»Ich fürchte, wir werden warten müssen, bis Frau Nissel von selbst zurückkommt«, meinte Frau Kaufmann. »Darf Anselm so lange in Sophienlust bleiben? Ich kann nicht sagen, wie lange das dauern wird. Meine Chefin hat mich auch über die Länge ihres Urlaubs im unklaren gelassen.« Als sie merkte, dass Denise erstaunt war, fuhr sie fort: »Frau Nissel ist recht häufig abwesend. Sie überlässt dann die Führung des Geschäftes mir. Ich beklage mich nicht darüber, denn Frau Nissel ist sehr großzügig. Ich kann die Arbeit selbständig erledigen und verdiene genügend.«
Rasch erklärte Denise, dass Anselms Aufenthalt in Sophienlust unbegrenzt sei. Dann kam sie auf die notwendigen Formalitäten für das Begräbnis zu sprechen und fuhr fort: »Wenn die Verstorbene keinen Ausweis bei sich hatte, ist nicht einmal ihre Identität geklärt. Den Jungen hat niemand beachtet. Die Leute haben ihn weggedrängt, und niemand wusste, dass er zu der alten Frau gehörte. Wenn ich nicht stehengeblieben wäre, um mein Paket einen Augenblick lang abzustellen, wäre er auch mir nicht aufgefallen.« Denise strich Anselm, dem der Schrecken dieses Nachmittags nun wieder voll zu Bewusstsein kam, tröstend über die Haare. »Du darfst jetzt nicht mehr weinen. Du wirst sehen, in Sophienlust wird es dir gefallen. Wir werden sofort hinfahren.«
»Ja«, stimmte Frau Kaufmann ihr zu, »der kleine Junge muss auf andere Gedanken kommen. Ich werde mich um alles Weitere kümmern. Könnten Sie mir Ihre Telefonnummer geben, damit ich Sie erreichen kann?«
»Ja, natürlich. Hier ist meine Karte. Falls Sie einmal Zeit haben, wird sich Anselm gewiss über Ihren Besuch freuen. Sie sind uns immer willkommen.«
»Danke. Ich bin so froh, dass Sie sich um den Jungen kümmern. Ich wüsste nicht, was ich mit ihm anfangen sollte, aber irgendwie fühle ich mich doch verantwortlich für ihn, da sonst niemand da ist.«
Denise und Anselm verabschiedeten sich von Frau Kaufmann, die Denise noch einmal versicherte, dass sie alles Nötige für das Begräbnis in die Wege leiten würde.
Denise blickte besorgt auf ihre Uhr. Es war spät geworden. Alexander, ihr Mann, würde sich wahrscheinlich schon wundern, wo sie so lange blieb. Aber bevor sie heimfuhr nach Schoeneich, musste sie Anselm noch in Sophienlust abliefern und eine Weile bei ihnen bleiben, damit er sich eingewöhnte. Der Schock, den er eben erlitten hatte, würde lange nachwirken.
Denise nahm sich vor, alles daranzusetzen, dass Anselm den erlittenen Schicksalsschlag überwinden würde. Die Auskunft, die sie über seine Mutter erhalten hatte, stimmte sie nachdenklich. Sie fand es reichlich ungewöhnlich, dass eine Mutter ihr Kind bei der Großmutter zurückließ, um eine Reise von unbestimmter Dauer und mit unbestimmtem Ziel zu unternehmen. Umgekehrt erweckte Anselm aber nicht den Anschein, ein unerwünschtes Kind zu sein. Er wirkte vollkommen normal, wie ein gut und liebevoll erzogenes Kind. Also muss ihn seine Mutter gern haben und lieb zu ihm sein, folgerte Denise.
Da das Abendessen schon vorbei war, als Denise in Sophienlust ankam, brachte sie ihren Schützling in die Küche, wo sie ihn mit der Köchin Magda bekannt machte. Sie bat Magda, ihm etwas zu essen zu richten, während sie selbst inzwischen Schwester Regine und die Heimleiterin, Frau Rennert, über den Neuankömmling unterrichten wollte.
Nachdem Denise die Küche verlassen hatte, stand Anselm schüchtern da und ließ den Kopf hängen.
»Du hast doch nicht etwa Angst vor mir?«, fragte Magda.
»O nein, aber ich mag nichts essen. Ich habe überhaupt keinen Hunger.«
»Das glaube ich nicht. Sobald das Essen auf dem Tisch steht, wird es dir schon schmecken. Eine Kleinigkeit musst du essen. Sonst knurrt dein Magen in der Nacht, und du kannst nicht schlafen. Was möchtest du denn gerne? Ein Wurstbrot? Oder ein weiches Ei? Vielleicht Spiegeleier? Ich könnte auch schnell ein Stück Fleisch braten. Und dazu gibt es Pommes frites. Die essen alle Kinder gern. Du auch?«
Doch Anselm lehnte alle Angebote mit einem höflichen »nein, danke« ab.
Magda gab sich jedoch nicht so schnell geschlagen. »Ich werde für dich einen Fritzi zubereiten. Hast du schon einmal einen Fritzi gegessen?«
Anselm musste zugeben, dass ihm ein essbarer Fritzi unbekannt war. Seine Neugierde war geweckt.
Magda schnitt eine Scheibe Brot ab, bestrich sie mit Butter und belegte sie reichlich mit Wurst. Dann holte sie aus einem Schrank ein Glas Essiggurken und ein Glas mit eingelegten, in Streifen geschnittenen roten Paprikaschoten. Da sie Anselm die Sicht auf das Wurstbrot verstellte, konnte er nicht erkennen, was weiter geschah. Mit etwas Mayonnaise aus der Tube vollendete Magda ihr Werk und präsentierte es dem überraschten Anselm.
»Das ist Fritzi. Er hat Gurkenaugen, Haare aus Paprika und einen Mund und eine Nase aus Mayonnaise. Schau, wie er lacht. Wenn du ihn gegessen hast, wirst du auch wieder fröhlicher werden.«
Gehorsam biss Anselm in Fritzis Haare.
*
Während Anselm in Sophienlust von Denise zu Bett gebracht wurde, saß seine Mutter auf der Terrasse, die zu ihrem Hotelzimmer gehörte, und sah nachdenklich in den Nachthimmel. Das Bild, das sich ihr bot, glich einer Reklame für Fremdenverkehr.
Lauretta Nissel lehnte etwas lässig in dem geflochtenen Korbstuhl. Auf dem Tischchen neben ihr stand ein Glas mit einer gelblichen Flüssigkeit, in der zwei Eiswürfel schwammen. Ihre dichten blonden Haare waren straff aus dem Gesicht gebürstet und im Nacken zu einem Knoten geschlungen. Ihre kleine Nase und der zarte Mund wiesen einige Ähnlichkeit mit den Zügen ihres Sohnes auf, aber ihre Haut war von der Sonne tief gebräunt. Und ihre großen grünen Augen zeigten keinerlei Anzeichen von Schüchternheit. Sie blickten kühl und entschlossen. Das tief ausgeschnittene nilgrüne Kleid passte ihr nicht nur wie angegossen, auch die Farbe harmonierte mit der ihrer Augen.
Aber gerade dieses Kleid bot der zweiten auf der Terrasse anwesenden Person Anlass zu Unmutsäußerungen: »Du hast dich wieder einmal unmöglich angezogen.«
Lauretta erhob sich geschmeidig und ging langsam auf den an der Terrassentür lehnenden Mann zu. »Was ist an meinem Kleid nicht in Ordnung? Passt es nicht? Kannst du irgendwo eine Falte entdecken?« Mit provozierenden Bewegungen drehte sie sich einmal um die eigene Achse.
In seinen Blicken glomm Bewunderung auf, die jedoch von seinem Ärger sogleich wieder erstickt wurde. »Du weißt genau, dass es da keine Falte zu entdecken gibt. Dass dieses Kleid sitzt wie eine zweite Haut, ist weder mir noch den übrigen heute Abend anwesenden Männern entgangen. Sie haben die Köpfe verdreht und sich die Hälse ausgerenkt, als du durch den Speisesaal gingst.«
Lauretta lachte. »Ist mein Schnuck eifersüchtig?«
»Nenn mich nicht immer mit diesem lächerlichen Kosenamen!«
»Wie soll ich dich sonst nennen? Vielleicht so wie deine Frau? Wie pflegt sie dich denn zu rufen?«
»Lass meine Frau aus dem Spiel! Sie hat mit uns beiden überhaupt nichts zu tun.«
»Gewiss. Und sie interessiert mich auch nicht. Ich möchte dich nur daran erinnern, dass ich nicht mit dir verheiratet bin und dass dich meine Art, mich zu kleiden, nichts angeht.«
»Da irrst du dich. Alle hier wissen, dass wir zusammengehören, doch du legst es darauf an, mich lächerlich zu machen. Du genießt es förmlich, wenn sich fremde Männer nach dir umdrehen.«
»Gehören wir denn zusammen?«, unterbrach Lauretta ihn.
»Zweifelst du daran? Du hast ja keine Ahnung, wie lange ich gebraucht habe, um meiner Frau klarzumachen, dass ich in diesem Jahr wieder ohne sie auf Urlaub fahren will. Sie wollte mir nicht glauben, dass ich allein sein muss, um mich wirklich entspannen zu können.«
»Nun, möglicherweise bist du bald allein.«
Er fasste sie hart am Arm. »Was willst du damit sagen?«
»Dass du mich mit deinen überflüssigen Vorwürfen in Ruhe lassen sollst. Du hast kein Recht, eifersüchtig zu sein.«
»Immerhin bist du die Mutter meines Sohnes.«
»Aber nicht deine Frau!«
»Warum betonst du das so? Ist es etwa meine Schuld?«
»Ja.«
»Wie kannst du nur so die Wahrheit verdrehen! Habe ich dich nicht gebeten, mich zu heiraten?«
»O ja. Und gleichzeitig hast du darauf hingewiesen, wie schwierig es sein wird, mit deinem Gehalt eine Familie zu ernähren.«
»Damals konnte ich nicht ahnen, dass ich beruflich so schnell vorwärtskommen würde. Ich stand doch erst am Beginn meiner Karriere.«
»Karriere nennst du das? Dass ich nicht lache. Was bist du denn? Du klebst an deinem Schreibtisch …«
»Immerhin treffe ich wichtige Entscheidungen …«
»Hör auf großzutun. Auf mich machst du damit keinen Eindruck.«
»Ja, ich weiß, du wolltest schon immer höher hinaus.«
»Das ist nicht wahr. Damals wäre ich damit zufrieden gewesen, nur für dich und das Kind dazusein. Aber deine Reaktion auf die Eröffnung, dass ich schwanger sei, werde ich nie vergessen.«
»Mein Gott, im ersten Schock sagt man manches, was nicht so gemeint ist.«
»Ich bin auch aus allen Wolken gefallen, als mir der Arzt damals mitteilte, dass ich in anderen Umständen sei. Aber mir ist niemals der Gedanke gekommen, das Kind abtreiben zu lassen.«
»Habe ich etwa darauf bestanden? Im Gegenteil, ich habe Anselm sehr gern.«
»Und was tust du für ihn? Ab und zu besuchst du uns, und zu Weihnachten und an seinem Geburtstag bringst du ihm ein Geschenk. Das ist alles.«
»Du warst diejenige, die den Namen seines Vaters verschwiegen hat.«
»Ja, weil du mich angefleht hast wegen des Skandals. Du hast gefürchtet, dass dein Großonkel Albert dich enterben würde. Inzwischen ist er zwar gestorben, und du bist in den Besitz seiner Villa und seines Vermögens gelangt, aber jetzt darf wiederum deine Frau nichts erfahren.«
»Ich will ihr den Kummer ersparen.«
»Ja, in dieser Beziehung bist du rücksichtsvoll. Aber an den Wochenenden und in den Ferien lässt du sie allein.«
»Ich habe ihr an unserem letzten Hochzeitstag einen eigenen Wagen geschenkt, damit sie unabhängig ist und hinfahren kann, wohin sie will.«
»Und? Gibt sie sich damit zufrieden?«, fragte Lauretta ironisch.
Er wich ihr aus. »Es hätte gar nicht so weit kommen müssen. Wenn wir damals sofort geheiratet hätten, wären wir jetzt eine glückliche Familie. Ich war dazu bereit. Natürlich musste ich klarstellen, dass es uns anfangs nicht besonders gut gehen würde und dass wir auf manches würden verzichten müssen. Das hat dich kopfscheu gemacht.«
»O nein.«
»O doch. Du hast gezögert und damit begonnen, dich nach einer besseren Partie umzusehen. Einen wohlhabenden Geschäftsmann wolltest du dir angeln. Beinahe wäre es dir sogar gelungen.«
»Nicht nur beinahe«, versetzte Lauretta zornig. »Egon war bereit, mich auf der Stelle zu heiraten.«
»So? Und wieso heißt du noch immer Nissel und nicht Brauner?«
»Weil ich es schließlich nicht über mich bringen konnte, einen Mann zu heiraten, der mir gleichgültig war.«
»Aber du hast es über dich gebracht, dir von ihm einen Kosmetiksalon einrichten zu lassen.«
Lauretta zuckte mit den Schultern. »Er wollte mich unbedingt versorgen. Warum hätte ich es ablehnen sollen? Geld hatte er genügend. Ich habe ihm übrigens alles wieder zurückgezahlt!«
»Wie edel von dir!«
»Spotte nicht. Ich sehe nicht ein, weshalb wir uns hier streiten sollen. Wohin soll das führen? Die Situation, in der wir uns befinden, lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Und du willst es doch auch gar nicht, oder?«
Otmar Wieninger zögerte mit der Antwort.
»Nun?«
»Ich weiß nicht. Es würde für meine Frau einen Schock bedeuten, wenn ich ihr plötzlich eröffnen würde, dass ich mich von ihr scheiden lassen will. Sie ist vollkommen ahnungslos.«
»Und diesen Schock möchtest du ihr ersparen?«
»Ja.«
»Du liebst sie also?«
Wieder war er um eine Antwort verlegen. Lauretta nahm sie ihm ab: »Sicher liebst du sie. Warum hättest du sie sonst geheiratet? Wir beide haben ein Kind, aber du hast eine andere geheiratet.«
»Erst nachdem du mich abgewiesen hattest.«
»Du hättest versuchen können, mich umzustimmen.«
»Das hätte dir so gepasst. Ich hätte dir nachlaufen sollen, während du deinem Egon den Kopf verdrehtest.«
»Aber ich habe meinen Egon, wie du es ausdrückst, nicht geheiratet. Wenn du auf mich gewartet hättest … Aber nein, du bist hingegangen und hast dich mit der Nächstbesten verlobt.«
»Sie ist nicht die Nächstbeste.«
»Warum bist du dann nicht mit ihr hierhergefahren?«
Er stöhnte: »Ach, Lauretta, warum quälst du mich so? Du weißt, dass ich nicht loskommen kann von dir. Ich liebe dich.«
»Davon merke ich wenig.«
Er schöpfte tief Atem. »Was verlangst du von mir? Ich bin nicht frei, aber wenn ich es wäre, würdest du mich dann heiraten und für immer bei mir bleiben?«
Sie schwieg eine Weile. »Nein, ich glaube nicht«, sagte sie endlich. Ihre Stimme klang dabei ein wenig traurig. »Es ist zu spät. Ich kann mich jetzt nicht mehr ändern. Ich will das erreichen, was ich mir vorgenommen habe.«
»Was hast du dir vorgenommen? Sind wir hier in diesem Luxushotel abgestiegen, weil du auf der Suche nach einem reichen Mann bist?«
Lauretta lächelte und schüttelte den Kopf. Sie war wirklich nicht auf Reichtum aus. Ihre Wünsche bewegten sich in einer ganz anderen Richtung.
»Wollen wir nicht diesen dummen Streit beenden?«, bat sie. »Er beeinträchtigt die Urlaubsstimmung. Wir sind hierhergekommen, um uns zu erholen. Zu keinem anderen Zweck.«
Er sehnte sich danach, ihr glauben zu können, aber es gelang ihm nicht, sein Misstrauen ganz zu unterdrücken. Und schon am folgenden Tag stellte sich heraus, dass sein Gefühl ihn nicht getäuscht hatte.
Lauretta erschien in einem durchscheinenden dünnen Badekleid, unter dem sie einen winzigen Bikini trug, zum Frühstück. »Schnuck« erinnerte sich seiner Niederlage vom vergangenen Abend und versagte es sich, ihr einen Vorwurf bezüglich dieses offenherzigen Kleidungsstückes zu machen. Doch dann fielen ihm die Pläne, die sie für den heutigen Tag geschmiedet hatten, ein.
»Hast du vor, heute zum Strand zu gehen?«, fragte er.
»Natürlich.«
»Aber wir hatten ausgemacht, heute die Altstadt von Hammamet zu besichtigen.«
»Ach ja – richtig.« Lauretta tat, als ob ihr dieses Vorhaben völlig entfallen wäre. »Das habe ich ganz vergessen. Ich habe mich zum Baden angezogen.«
»Du könntest dich ja umziehen«, schlug er vor.
»Nein, das ist mir zu lästig. Außerdem ist es so heiß. Ich gehe lieber schwimmen. Möchtest du nicht allein die Altstadt besuchen?«
»Ich bin erst gestern allein in Tunis gewesen, während du gebadet hast«, erwiderte Otmar beleidigt.
»Du hättest auch baden können«, versetzte sie schnippisch.
»Ich wollte mir aber Tunis ansehen. Jeden Tag an den Strand zu gehen, finde ich langweilig.«
»Ich nicht. Das Meer ist herrlich.«
»So? Du hältst dich aber kaum im Wasser auf. Die meiste Zeit über
liegst du faul am Strand und tust nichts.«
»Na und? Ich bin schließlich im Urlaub.«
»Es würde nicht schaden, wenn du dich ein wenig für die Sehenswürdigkeiten, die es hier zu besichtigen gibt, interessieren würdest.«
»Wozu?«
»Ich merke, du willst mich ärgern«, sagte er wütend. »Auch wenn dir nichts an Hammamet liegt, könntest du mich begleiten. Ich habe meinen Filmapparat mit. Ich möchte filmen.«
»Und ich soll dabei hinter dir stehen und dir zusehen? O nein. Ich hätte einen Gegenvorschlag. Komm mit mir an den Strand.«
»Gib ein einziges Mal nach«, bat er.
Doch Lauretta schüttelte den Kopf. »Nein. Du scheinst mich mit deiner Frau zu verwechseln, die immer das tut, was du möchtest.«
»Ich verstehe dich nicht. Vorgestern warst du damit einverstanden, dass wir uns heute die Altstadt ansehen. Ich habe eingesehen, dass du nicht nach Tunis mitkommen wolltest, weil dir die Hitze unangenehm ist und weil du nicht den ganzen Tag in der Stadt verbringen wolltest. Aber ein paar Stunden könntest du heute doch opfern. Ich habe gehört, dass es in Hammamet einen Basar gibt, mit Teppichen, Silberschmuck und Messinggeräten. So groß wie der in Tunis wird er natürlich nicht sein, aber sicher würdest du einige Dinge, die dir gefallen, finden.«
»Reiseandenken kaufe ich im Hotel«, versetzte sie kurz.
Otmar Wieninger wunderte sich, dass nicht einmal die Aussicht, hübsche und überflüssige Sachen einkaufen zu dürfen, Lauretta verlockte. Das Gespräch hatte sich in gefährlicher Weise am Rande eines neuerlichen Streites dahinbewegt, und deshalb lenkte er ein. Er wünschte Lauretta einen angenehmen Vormittag und machte sich allein auf den Weg in die Altstadt, ohne zu ahnen, wie Lauretta den gestrigen Tag verbracht hatte, was sie heute beabsichtigte und welche Konsequenzen sich daraus ergeben würden. Er filmte die Stadtmauer mit dem alten Stadttor, wobei er trachtete, auch einige weißverschleierte Frauen ins Bild zu bekommen, passierte das Stadttor und schlenderte durch die engen, gewundenen Gässchen, vorbei an den kahlen weißgetünchten Mauern der Häuser. Er hätte gern die Moschee besichtigt, doch hier war Fremden der Eintritt verboten.
Schließlich blieb er bei einem Geschäft, um dessen Eingang bunte Teppiche in leuchtenden Farben hingen, stehen. Sofort eilte ein dunkelhäutiger Araber in einem langen Kaftan herbei und pries seine Ware in allen möglichen Sprachen an. An eine Flucht, ohne etwas eingekauft zu haben, war nicht mehr zu denken.
Otmar ergab sich in sein Schicksal und begutachtete die Teppiche. Dabei ertappte er sich bei der Überlegung, welcher davon seiner Frau wohl am besten gefallen würde. Er wählte einen hellen flauschigen Berberteppich mit einem geometrischen braunen Muster. Eine Weile feilschte er um den Preis, und nachdem es ihm gelungen war, einige Dinar herunterzuhandeln, gab er sich geschlagen und kaufte den Teppich, obwohl er das Gefühl hatte, dass der Händler bei diesem Kauf recht gut wegkam. Danach erstand er noch einen silbernen Armreif, den er ebenso wie den Teppich seiner Frau zudachte, denn Lauretta wagte er nicht damit zu überraschen. Er wusste, dass dieser schlichte handgearbeitete Schmuck ihren Ansprüchen nicht genügen würde.
Als er ins Hotel zurückkehrte, war von Lauretta weit und breit keine Spur zu sehen. Da er annahm, dass sie noch unten am Meer sei, beschloss er, ihr entgegenzugehen. Doch als er an den Strand kam, merkte er, dass dieser verlassen und menschenleer in der brütenden Mittagshitze dalag. Die Hotelgäste hatten sich bereits zum Mittagessen begeben. Nur einige einheimische Jungen, denen die Sonne nichts anzuhaben schien, spielten im Sand.
Otmar Wieninger suchte Lauretta danach noch bei dem mit Süßwasser gefüllten Swimmingpool, doch auch hier hatte er keinen Erfolg.
Während er im Speisesaal allein an seinem Tisch saß, zerbrach er sich den Kopf, wo Lauretta sein könnte. Es kamen ihm die absurdesten Ideen. Schon begann er, sich ernstlich zu sorgen. Wilde Geschichten, die er über den Orient gelesen oder gehört hatte, fielen ihm nun wieder ein. Wer wusste, was Lauretta zugestoßen war? Sollte er sich an die Polizei wenden? Oder würde er sich damit lächerlich machen? Es könnte einen ganz harmlosen Grund dafür geben, dass Lauretta nicht zum Mittagstisch erschienen war.
Der männliche Teil des am Nebentisch sitzenden älteren Ehepaares erlöste Otmar aus seinem Dilemma. Nachdem die beiden ihren Nachtisch verzehrt hatten, erhoben sie sich und schickten sich an, den Raum zu verlassen. Dabei mussten sie an Otmars Tisch vorbei, und da sie schon öfters einige Worte mit Otmar gewechselt hatten, blieb Herr Berger stehen und meinte:
»Hoffentlich genießt Ihre Frau heute ihren Ausflug zu Wasser, Herr Nissel.«
»Wie bitte?« Man merkte Otmar die Verwirrung deutlich an, sodass Frau Berger ihn neugierig ansah und sagte: »Mein Mann meint die Fahrt auf der schicken Jacht, die Ihre Frau jetzt gerade unternimmt.«
»Ach!« Otmar hatte sich noch immer nicht gefaßt.
»Eigentlich hat es uns ja gewundert, dass Sie nicht mitgefahren sind«, fuhr Frau Berger fort. »Wird Ihre Frau Sie nicht vermissen? Macht es Ihnen nichts aus, sie den ganzen Tag über nicht zu sehen?«
Endlich fand Otmar die Geistesgegenwart, sich zu einer passenden Antwort aufzuraffen. »Ich wollte Lauretta den Spaß nicht verderben. Ich werde nämlich sehr leicht seekrank«, sagte er, und Frau Berger gab sich mit dieser Auskunft zufrieden.
Nun wusste er also, wo Lauretta sich befand. Auf einer schicken Jacht, irgendwo auf dem Meer.
Otmar saß ganz betäubt an seinem Tisch. Seine Gedanken kreisten einzig und allein um Lauretta. Sie schien freiwillig an Bord der Jacht gegangen zu sein. Aber was hatte sie sich dabei gedacht? Und wem gehörte dieses Fahrzeug? Sollte Lauretta hier zufällig eine Freundin getroffen haben? Warum aber hatte sie ihm dann keine Nachricht hinterlassen? Sie konnte sich doch denken, dass er besorgt sein würde. Ihr Verhalten war rätselhaft. Oder doch nicht?
Jetzt fiel ihm ein, dass Lauretta sich manchmal recht impulsiv und launenhaft verhalten hatte. Auch ihr Benehmen an diesem Morgen erschien ihm nun in einem anderen Licht. Lauretta hatte es darauf angelegt gehabt, ihn zu reizen und zu verärgern. Obwohl ein Ausflug in die Stadt vorgesehen war, hatte sie darauf bestanden, zum Strand zu gehen. Sie hatte ihn zwar aufgefordert, sie zu begleiten, aber sie schien gewusst zu haben, dass er nicht nachgeben würde. Es wurde ihm nun klar, dass sie nichts anderes vorgehabt hatte, als ihn für diesen Tag loszuwerden, um ungestört ihren eigenen Wegen nachgehen zu können. Aber wohin führten diese Wege?
Noch vor dem Abendessen sollte Otmar darüber Aufklärung erhalten. Lauretta erschien aufgeräumt, mit glühenden Wangen und leuchtenden Augen in ihrem Zimmer, wo er auf dem Bett lag und mit düsteren Blicken vor sich hinstarrte.
»Du geruhst also wieder aufzutauchen«, begrüßte er sie sarkastisch und richtete sich auf.
»Bitte, verdirb mir nicht meine gute Laune«, rief sie. »Ich möchte am liebsten die ganze Zeit singen und tanzen.«
»Und was ist der Grund für diesen plötzlichen Überschwang, nachdem du in letzter Zeit nur missmutig und schlecht aufgelegt warst?«
»Stell dir vor, ich war bei René Renard auf seiner Jacht. Ich kann es selbst kaum glauben.«
»René Renard?«
»Ja. Er hat mir eine Filmrolle versprochen.«
»Ach, du willst Schauspielerin werden?«
»Und warum nicht? Schließlich habe ich in München Schauspiel- und Tanzunterricht genommen. Weißt du das nicht mehr? Es war immer schon mein Traum, künstlerisch tätig zu sein, und nun verwirklicht er sich auch endlich.«
»Du bist völlig übergeschnappt. Wer ist eigentlich dieser René Renard?«
»Rede mir bitte nicht ein, dass du den berühmten René Renard nicht kennst.«
»Ich rede dir nichts ein. Der Name ist mir unbekannt.«
»Das sieht dir ähnlich. Du bist eben ein unmusischer Mensch. Hast du den Film ›Helfer des Todes‹ nicht gesehen?«
»Nein.«
»René Renard spielte die Hauptrolle darin. Es war ein einmaliger Film. René Renard war ganz großartig. Er verkörperte einen wahnsinnigen Psychoanalytiker, der seine Patientinnen, eine nach der anderen in den Selbstmord treibt, da sie ihm für die Anforderungen des Lebens zu schade vorkommen. Du musst doch diesen Film auch gesehen haben.«
»Nein, das habe ich nicht. Und ich glaube kaum, dass ich da etwas versäumt habe.«
»Möglich. Für dich mit deinen spießbürgerlichen Anwandlungen wäre der Film zu schade gewesen. Aber mir hat er gefallen. Ich war begeistert. Schon allein René Renards Maske war einmalig. Doch die Art, wie er sich in die Rolle hineinlebte, war unüberbietbar. Er wirkte so überzeugend und lebensecht.«
»Und mit diesem Menschen warst du auf einer Jacht, ohne dich zu fürchten?«
»Sei nicht lächerlich. Ich war nicht nur gestern und heute mit ihm beisammen, sondern habe vor, mit ihm nach Frankreich zu fahren, um dort Probeaufnahmen zu machen.«
Otmar erstarrte. »Das kann nicht dein Ernst sein.«
»Warum nicht? Jahrelang habe ich auf eine derartige Chance gewartet.«
»Willst du mich hier sitzenlassen?«
»Wieso?« Dein Urlaub nähert sich doch sowieso dem Ende«, erwiderte Lauretta kühl.
»Ich meine nicht nur den Urlaub. Wenn du wirklich mit diesem Franzosen wegfährst, ist zwischen uns alles aus.«
»Was soll diese Drohung? Ich bin dir nichts schuldig. Im Gegenteil, es war für dich sehr angenehm, zu Hause eine treusorgende Gattin zu besitzen und außerdem zur Abwechslung noch eine Freundin zu haben.«
»Lauretta, bitte, sei vernünftig. Ich denke nicht nur an mich. Glaubst du denn wirklich, dass aus dir eine Schauspielerin werden kann?«
»Ich kann es zumindest versuchen.«
»Und was wird aus Anselm? Wer kümmert sich um dein Geschäft?«
»Anselm ist bei Mama gut aufgehoben. Er wird mich kaum vermissen. Das Geschäft führt Frau Kaufmann. Sie ist sehr tüchtig. Ich kann mich auf sie verlassen.«
»Wie soll ich Anselm und deiner Mutter beibringen, dass du noch nicht zurückkommst?«
»Das lass meine Sorge sein. Ich werde Mama schreiben. Außerdem habe ich für meine Rückkehr kein genaues Datum angegeben.«
Otmar schwieg eine Weile. Diese Antwort musste er erst verdauen. »Dann hast du von allem Anfang an vorgehabt, dich an diesen René Renard heranzumachen«, sagte er schließlich.
»O nein. Wie kommst du auf diese Idee? Ich konnte doch nicht wissen, dass er ausgerechnet hier seinen Urlaub verbringen würde.« Lauretta bemühte sich um einen überzeugenden Tonfall, konnte aber nicht verhindern, dass sie rot wurde.
»Wenn dieser Schauspieler eine solche Berühmtheit ist, kannst du ohne weiteres aus irgendeiner Zeitung von seinem Urlaubsaufenthalt erfahren haben.«
»Ach, Schnuck! Erinnere dich doch, wir haben schon vor Monaten davon gesprochen, in diesem Jahr nach Tunesien zu fliegen.«
»Dann hast du es eben schon vor Monaten gelesen.«
»Nein. Erst vor vierzehn Tagen.«
»Aha. Also hatte ich doch recht. Glaubst du, ich hätte vergessen, wie du dich damals in München an diesen Theaterregisseur herangemacht hast? Und wie du gejammert hast, als deine Bemühungen vergeblich waren?«
»Vergiss diese alten Geschichten. Diesmal war es ganz anders. Es war reiner Zufall, dass ich ihm am Strand begegnet bin. Und im Übrigen brauche ich mich vor dir nicht zu rechtfertigen.«
»Wie du meinst«, entgegnete er müde und resigniert. »Wenn du meine Warnungen in den Wind schlägst …«
»Das tue ich«, rief sie. »Du willst mir den Erfolg nicht gönnen. Mama ist die einzige, die an mich glaubt.« Lauretta überlegte und fuhr dann fort: »Erzähle ihr nichts von meinem Vorhaben. Ich will sie überraschen. Ich bin überzeugt, dass die Probeaufnahmen gut ausfallen werden und dass ich einen Filmvertrag bekommen werde.«
*
So kam es, dass sich Anselm schon geraume Zeit in Sophienlust aufhielt, während von seiner Mutter noch immer keine Nachricht eingetroffen war. Er hatte sich inzwischen gut eingewöhnt und bald Anschluss an die anderen Kinder gefunden. Besonders gern spielte er mit der kleinen Heidi. Das Mädchen war zwar ein Jahr jünger als er, aber munter und aufgeweckt, und da Anselm eher schüchtern war, ergänzten sich die beiden. Die übrigen Kinder waren alle älter. Trotzdem bemühten sie sich, die beiden Jüngsten in ihre Spiele mit einzubeziehen.
Die Hitzewelle hatte sich vor kurzem in einem starken Gewitter entladen. Seitdem war das Wetter unbeständig. Es war zwar warm, aber der Himmel war meistens mit Wolken bedeckt, sodass man nicht sicher sein konnte, ob es nicht plötzlich zu regnen beginnen würde. An größere Ausflüge war nicht zu denken.
An einem solchen Tag erinnerte sich Henrik, Denise von Schoeneckers jüngster Sohn, an eines seiner Lieblingsspiele vom vergangenen Sommer. »Wie wäre es, wenn wir wieder einmal Indianer spielen würden«, schlug er vor.
»Ja, fein!« Fabian war von der Idee begeistert.
Die Mädchen hingegen hielten nicht viel davon. »Da können wir wieder stundenlang am Lagerfeuer sitzen und Kartoffeln braten. Und zum Dank dafür bindet ihr uns dann an den Marterpfahl.«
»Ihr müsst eben die Kartoffeln ordentlich in Alufolie einwickeln, damit sie nicht verkohlen.«
»Aha. Vermutlich so, wie es die echten Indianer getan haben?«
»Ich weiß, dass die echten Indianer keine Alufolien hatten, aber so genau muss man es nicht nehmen. Wir haben euch schließlich auch nicht echt gemartert, oder?«
»Nein. Ihr habt uns nur so fest angebunden, dass wir keine Hand frei hatten, um die Stechmücken, die uns in Scharen umschwärmt haben, abzuwehren. Ihr seid auf die Jagd gegangen, und als ihr endlich zurückgekommen seid, waren wir von Kopf bis Fuß zerstochen.«
»An die Stechmücken haben wir nicht gedacht. In diesem Jahr wissen wir es und können aufpassen. Was ist, Nick, machst du auch mit?«
Der fünfzehnjährige Dominik kam sich zwar für Indianerspiele schon etwas zu erwachsen vor, konnte aber der Versuchung nicht widerstehen. »Ich muss wohl«, sagte er, »sonst stellt ihr wieder irgendeinen Unsinn dabei an.«
»Wie wollen wir heißen?«, fragte Henrik und beantwortete seine Frage gleich selbst. »Heidi kann diesmal Silberschlange sein, ich bin der Große Häuptling …«
Unerwarteterweise erhob der sonst so zurückhaltende Fabian einen Einspruch. »Nein, in diesem Jahr möchte ich der Große Häuptling sein. Du könntest Adlerauge heißen.«
»Abgemacht. Pünktchen heißt Punktegesicht …«
»Nein. Wenn ich überhaupt mittue, dann heiße ich Schönes Haar.«
»Meinetwegen.«
»Wegen der Namen könnt ihr euch später auch noch streiten«, meinte Nick. »Zuerst sollten wir die Zelte errichten. Wir brauchen dazu Stöcke. Ich gehe mit den Jungen in den Wald und schneide welche ab. Wir müssen schöne lange und gerade aussuchen.«
»Gut. Wir besorgen inzwischen die Decken«, antwortete Pünktchen.
Als die Kinder mit der Errichtung von vier großen, allerdings etwas windschiefen Zelten fertig geworden waren, war der Vormittag vergangen. Die von den Mädchen herbeigeschafften Decken hatten nicht ganz ausgereicht, denn sie hatten für den Zeltbau nur alte Decken verwenden dürfen. Für das vierte Zelt hatten sie sich mit zwei Leinentüchern begnügen müssen.
»So, das Schwierigste wäre nun getan.« Stolz betrachtete Henrik das Werk.
»Wo sind denn die Ziegel, die wir voriges Jahr rund um das Lagerfeuer gelegt haben?«, fragte Angelika.
»Ich weiß es nicht. Wir wollen Schwester Regine fragen. Vielleicht kann sie sich erinnern, wohin wir sie getan haben. Jetzt müssen wir ohnedies unterbrechen. Das Lagerfeuer zünden wir dann gegen Abend an. Gut, dass wir im Wald so viele dürre Zweige gefunden haben..«
Später gingen Pünktchen und Heidi noch einmal in die Küche, um von Magda schöne große Kartoffeln und eine Stange Wurst zu erbitten. Es war nämlich äußerst unwahrscheinlich, dass die tapferen Krieger mit ihren selbstgebastelten Bogen und Pfeilen ein Stück Wild erlegen würden.
Vergnügt saßen die Kinder dann um das Lagerfeuer, brieten Kartoffeln und sangen fröhliche Lieder. Die Wolken hatten sich verzogen, der Himmel war sternenklar. Anselm fühlte sich in dieser Runde glücklich und geborgen. Er dachte zwar oft an seine Großmutter, aber er weinte nun nicht mehr so häufig. Dass seine Mutter von ihrem Urlaub noch nicht zurückgekehrt war und dass er keine Nachricht von ihr erhalten hatte, nahm er hin, ohne darüber ein Wort zu verlieren. Aus seinen Erzählungen ging hervor, dass sie öfters für längere Zeit verreist war. Überhaupt schien sie extravagante Angewohnheiten zu haben. Denise von Schoenecker wusste nicht recht, ob sie allem, was Anselm erzählte, Glauben schenken sollte. Vor allem dann, wenn er von seinem Vater sprach, neigte sie zu Skepsis. Anselm zählte die Geschenke auf, die er zu verschiedenen Anlässen von seinem Vater erhalten hatte, doch Denise glaubte ihm nicht recht. Sie meinte, dass er sich das alles nur ausgedacht habe in dem Wunsch, einen Vater zu besitzen.
*
Nicht weit vom Kinderheim Sophienlust entfernt lag das Haus des Tierarztes Dr. Hans-Joachim von Lehn. An dem Abend, an dem Anselm in der Runde seiner Spielkameraden beim Lagerfeuer saß, berichtete Hans-Joachim seiner Frau Andrea von einem Vorkommnis, mit dem er an diesem Tag in seiner Praxis konfrontiert worden war.
»Hat dir Herr Koster schon von unserem neuen Pflegling erzählt?«, begann er.
»Nein.« Andrea sah ihren Mann fragend an.
»Es ist ein Foxterrier. Ungefähr zwei Jahre alt. Er heißt Billie.«
»Den muss ich mir sofort anschauen.«
»Halt, warte. Er ist verletzt und braucht Ruhe. Er soll sich möglichst wenig bewegen.«
»Verletzt? Das arme Tier. Wie ist denn das geschehen?«
»Seine Verletzungen sind nicht lebensgefährlich. Voraussichtlich wird er sich bald wieder erholen. Aber ich dachte, es ist das gescheiteste, wenn ich ihn im Tierheim unterbringe.«
»Ja, sicher. Ich freue mich, dass wir einen Zuwachs bekommen haben. Aber du hast meine Fragen nicht beantwortet.«
»Ja, das ist eine sonderbare Geschichte.« Hans-Joachim schwieg und betrachtete nachdenklich seine Fingernägel, die sich in einem tadellosen Zustand befanden und keiner weiteren Aufmerksamkeit bedurften.
»Wieso ist das eine sonderbare Geschichte?«, fragte Andrea. »Spanne mich nicht so auf die Folter. Erzähle mir endlich, woher du Billie hast.«
»Ich weiß nicht, wie ich es dir schildern soll. Vielleicht irre ich mich, denn die Frau machte im Grunde genommen einen sehr netten Eindruck.«
»Welche Frau?«
»Frau Wieninger.«
»Ich kenne keine Frau Wieninger.«
»Natürlich nicht. Wie solltest du auch? Ich kannte sie bisher auch nicht. Das ist ja das Sonderbare daran. Zumindest teilweise.«
»Es ist sonderbar, dass du diese Frau Wieninger nicht kanntest? Wenn du mir nicht jetzt sofort alles von Anfang an erzählst, dann …« Andrea fiel keine passende Drohung ein, doch das war auch nicht notwendig.
»Gut. Ich werde dir alles genau erzählen. Ich bin neugierig, welche Schlussfolgerungen du ziehen wirst. Also, heute kam eine Frau mit einem verletzten Hund in meine Sprechstunde. Es war ein Foxterrier.«
»Ja, das habe ich inzwischen begriffen. Er hieß Billie. Weiter.«
»Der Hund hatte arge Quetschungen, und außerdem waren alle vier Beinchen verstaucht. Nachdem ich ihn untersucht habe, fragte ich seine Besitzerin …«
»Frau Wieninger?«
»Ja, Frau Wieninger. Ich fragte sie also, wie es zu diesen Verletzungen gekommen sei, und da wurde sie rot und begann zu stottern.«
»Warst du unfreundlich zu ihr?«
»Nicht im Geringsten. Frau Wieninger ist eine sehr sympathische Frau. Ich habe sie durchaus freundlich gefragt und habe durchblicken lassen, dass ein Unfall jederzeit passieren kann. Sie hat mir schließlich geantwortet, dass der Hund vom Fensterbrett des Schlafzimmers gefallen sei, das sich im ersten Stock ihrer Villa befindet.«
»Das wäre möglich.«
»Ja. Sie hat dann noch hinzugefügt, dass er auf alle vier Pfoten gefallen sei.«
»Und dabei hat er sie sich verstaucht.«
»Also, wenn du mich fragst – ich bin der Meinung, dass Frau Wieninger gelogen hat.«
»Wieso?«
»Wenn der Hund glatt auf seine Pfoten gefallen ist, woher stammen dann die Quetschungen? Ich bin kein Detektiv, aber ich weiß genau, dass zwischen Billies Verletzungen und der Erzählung Frau Wieningers, wie Billie sich die Verletzungen zugezogen habe, eine Diskrepanz besteht.«
»Hast du irgendeine Vermutung, was dem Hund wirklich zugestoßen sein könnte?«
»Es sah ganz danach aus, als ob ihm jemand einige heftige Fußtritte versetzt hätte.«
»So etwas lässt sich ein Foxterrier nicht gefallen. Er würde ganz einfach beißen.«
»Eben. Also hatte er entweder einen Beißkorb um und war dadurch wehrlos, oder eine ihm nahestehende Person, etwa sein Herrchen oder sein Frauchen, hat ihn misshandelt.«
»Also die nette Frau Wieninger?«
»Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie wirkte aufgeregt und verschüchtert. Und den Hund schien sie sehr zu lieben. Ich traue ihr einfach nicht zu, dass sie das Tier gequält hat.«
»Wie sieht sie denn aus?«, fragte Andrea neugierig.
»Recht hübsch. Ein bisschen mollig …«
»Du willst sagen fett.«
»Nein. Gut proportioniert. Gerade an den richtigen Stellen.«
»Oh! Findest du, dass ich zu mager bin?«
»Aber nein. Musst du denn alles gleich persönlich nehmen? Wenn du das tust, werde ich dir nie wieder etwas erzählen.«
Andrea wusste genau, dass er diese Drohung nicht wahrmachen würde, lenkte jedoch ein. »Fahr mit der Beschreibung fort. Wie sieht die Frau sonst aus – abgesehen davon, dass sie zu dick ist.«
Hans-Joachim wollte Andrea berichtigen und sagen, sie sei nicht dick, besann sich jedoch eines Besseren. »Sie hat braunes Haar und schöne blaue Augen.«
»Blaue Augen habe ich auch. Wie findest du die meinen? Davon hast du schon seit einiger Zeit nicht mehr gesprochen.«
»Du hast die schönsten Augen, die es gibt«, stellte Hans-Joachim fest. Dabei beugte er sich über seine Frau, um sie zu küssen.
*
Hans-Joachims Vermutung, dass es bei Billies Unfall nicht mit rechten Dingen zugegangen war, stimmte. Billies Frauchen, Irene Wieninger, saß im Wohnzimmer ihrer prächtigen Villa, hatte den Kopf in die Hände gestützt und brütete vor sich hin. Sie war wirklich recht hübsch. Ihre großen klaren Augen waren von dunklen Wimpern umrandet, sie besaß eine kleine Nase und einen wohlgeformten Mund. Ihr Gesichtsausdruck war jedoch alles andere als fröhlich. Er ließ deutliche Rückschlüsse auf ihre Gemütsverfassung zu, und diese war traurig.
Immer noch stand die widerwärtige Szene vor ihren Augen, als ihr Mann den Hund, der sein Herrchen schwanzwedelnd hatte begrüßen wollen, mit einem heftigen Fußtritt zur Seite geschleudert hatte. Doch nicht genug damit. Als das Tier jaulend liegengeblieben war, hatte er es die Treppe hinuntergestoßen. Dann war er in seinem sogenannten Arbeitszimmer verschwunden und hatte die Tür mit einem heftigen Knall hinter sich zugeschlagen.
Irene war hinuntergelaufen und hatte den Hund aufgehoben. Er hatte noch gelebt, schien aber schwer verletzt zu sein. Es war ihr klar gewesen, dass sie ihn sofort zu einem Tierarzt bringen musste. Doch sie hatte sich vor den Fragen gefürchtet, die Dr. Schmid, mit dem sie recht gut bekannt war, ihr zweifellos stellen würde. Da war ihr eingefallen, dass ihre Freundin Erika, die einen Drahthaardackel besaß, schon öfter von dem freundlichen Tierarzt in Bachenau, Dr. von Lehn, geschwärmt hatte.
Irene war zurück ins Haus geeilt, um ihre Wagenschlüssel und ihre Handtasche zu holen. Dann hatte sie den verletzten Hund vorsichtig auf den Rücksitz gebettet und war langsam losgefahren. Otmar hatte sich die ganze Zeit über nicht blicken lassen.
Die Fahrt nach Bachenau war für Irene ein Albtraum gewesen. Sie hatte Angst gehabt, dass Billie sterben könnte.
Endlich hatte sie die Praxis Dr. von Lehns erreicht, nachdem sie zwei Mal nach dem Weg hatte fragen müssen. Sie hatte erleichtert aufgeatmet, als der Tierarzt festgestellt hatte, dass Billies Verletzungen nicht lebensgefährlich seien. Doch dann hatte sie einen neuen Schock erlebt. Die Fragen, von denen sie befürchtet hatte, dass Dr. Schmid sie ihr stellen würde, hatte ihr nun Dr. von Lehn gestellt. Natürlich hatte er wissen wollen, wie Billie sich seine Verletzungen zugezogen hatte.
Sie hatte nur ein unzusammenhängendes Gestotter herausgebracht, das, wie sie deutlich gemerkt hatte, Dr. von Lehn nicht befriedigt hatte. Obwohl er sie durchaus freundlich behandelt hatte, war sie unter seinen misstrauischen Blicken zusammengeschrumpft. Als er eine Andeutung gemacht hatte, dass es jederzeit leicht zu einem Unfall kommen könne, hatte sie dankbar nach dem Strohhalm gegriffen und erzählt, dass Billie aus dem Fenster gefallen sei. Sie hatte zwar den Eindruck gehabt, dass ihn diese Antwort auch nicht zufriedenstellte, doch er hatte das Thema fallenlassen. Dafür hatte er gefragt, wer dem Hund die vorgeschriebenen Impfungen verabreicht habe, als er noch ein Hundebaby gewesen war, und als sie erwidert hatte, Dr. Schmid, hatte er sich gewundert, dass sie diesmal ihn und nicht wieder seinen Kollegen in Maibach aufgesucht hatte. Das wäre doch viel näher gewesen, hatte er gemeint und sie war wieder um eine Antwort verlegen gewesen. Doch die Wahrheit hatte sie ihm unmöglich sagen können.
Als Dr. von Lehn ihr dann den Vorschlag gemacht hatte, Billie bis zu seiner Genesung im Tierheim Waldi u. Co. unterzubringen, hatte sie erleichtert zugestimmt. Sie hatte zwar den Verdacht gehabt, dass er ihr dieses Angebot nur gemacht habe, weil er Bedenken hatte, ihr den Hund anzuvertrauen, aber das war ihr egal gewesen. Hauptsache war für sie, dass Billie wieder gesund wurde und dass Otmar nicht in seine Nähe kam.
Irene hatte sich von Billie getrennt und war zurück nach Maibach gefahren. Ihr Mann war nicht mehr in seinem Arbeitszimmer gewesen, aber auch nicht in einem anderen der zahlreichen Räume der Villa. Er war wieder weggegangen. Irene war darüber erleichtert gewesen. Seine Abwesenheit hatte ihr Muße gegeben, über die Situation nachzudenken.
Da saß sie nun, auf einem weichen Fauteuil, vor einem niederen Tischchen, in einem wunderbar aufgeräumten Zimmer. Aber im Augenblick gewährte ihr die Umgebung keinerlei Trost, obwohl sie sich für gewöhnlich gern in dem großen Wohnzimmer mit den altmodischen Möbeln, die Otmar zusammen mit der Villa geerbt hatte, aufhielt. Sie hatten nur das Schlafzimmer und zwei Gästezimmer neu eingerichtet. In den übrigen Räumen hatten sie die alten Möbel, unter denen sich einige wertvolle Stücke befanden, gelassen.
Otmars Stimme, als er sie zum ersten Mal durch das Haus geführt hatte, klang Irene noch immer im Ohr.
»Hier soll unser Schlafzimmer sein. Dieser Raum und der anschließende sind die ruhigsten Zimmer im ganzen Haus. Außerdem haben sie den Vorteil, dass gleich gegenüber das Badezimmer liegt. Natürlich müssen sie hergerichtet werden, und das alte Gerümpel muss entfernt werden.«
»Und was hast du mit dem anschließenden Zimmer vor?«, hatte Irene gefragt und die Verbindungstür geöffnet.
»Das soll das Kinderzimmer werden«, hatte Otmar, ohne zu zögern, erwidert.
Irene war rot geworden und hatte etwas von abwarten und Tee trinken gemurmelt, doch Otmar hatte weitergeredet, ohne ihren Einwurf zu beachten.
Otmar hatte die Einrichtung des Kinderzimmers mit so viel Begeisterung geplant, dass Irene von Anfang an klargewesen war, dass er unbedingt Kinder haben wollte und ein liebevoller Vater werden würde. Sie hatte sich darüber gefreut, denn auch sie liebte Kinder.
Diese Liebe hatte sogar ihre Berufswahl bestimmt. Vor ihrer Ehe war sie Lehrerin gewesen. Sie hätte ihren Beruf gern weiterhin ausgeübt, aber Otmar war dagegen gewesen. Kurz nach ihrer Heirat war an Otmars Arbeitsplatz, der Kreissparkasse in Maibach, die Stelle des Vorstandsstellvertreters freigeworden, und Otmar hatte sie erhalten. Dieser Aufstieg war mit einer Gehaltserhöhung verbunden gewesen. Damals hatte Otmar gesagt: »Du hast es jetzt nicht mehr nötig zu arbeiten. Wir können uns sogar eine Putzfrau leisten. Trotzdem gibt es für dich noch genug zu tun. Das Haus ist groß, und außerdem haben wir mit dem Garten eine Menge Arbeit. Sobald wir Kinder haben, wirst du voll ausgelastet sein.«
Sobald wir Kinder haben … Das war eine Redewendung, die Otmar häufig in den Mund genommen hatte. Auch Irene hatte Luftschlösser gebaut. Nur war sie etwas bescheidener gewesen als Otmar. Sie hatte sich einstweilen nur ein Kind vorgestellt, einen kleinen Jungen. Natürlich würde er Otmar ähnlich sehen, glatte blonde Haare und Otmars Mund und Nase haben. Aber die Augen würde er vielleicht von ihr geerbt haben.
Diese Träume hatten Irene umfangen, während sie im Garten Rosen gepflanzt und Unkraut gejätet hatte. Doch die Zeit war vergangen, und der Wunsch nach Kindern hatte sich nicht erfüllt. Lange Zeit war ihr nicht aufgefallen, dass Otmar immer mürrischer wurde und immer seltener zu Hause war. Sie langweilte sich nicht. Sie hatte ja das Haus und den Garten und ihre Träume.
Zu Anfang ihrer Ehe war ihr ihre neue prachtvolle Umgebung als etwas Unwahrscheinliches erschienen. Sie hatte kaum fassen können, dass sie nicht mehr in einem engen Untermieterzimmer hausen musste. Ihre Eltern lebten in München, aber dort hatte sie keine Stelle gefunden, als sie mit ihrer Ausbildung fertig gewesen war. Deshalb war sie nach Maibach gekommen und hatte hier in einer Volksschule unterrichtet.
Eines Tages hatte sie Otmar kennengelernt. Es war Liebe auf den ersten Blick gewesen. Er war groß, blond, braungebrannt und hatte dunkle Augen. Schon nach einer Bekanntschaft von zwei Monaten hatte er sie gefragt, ob sie seine Frau werden wolle, und sie hatte freudig eingewilligt. Drei Wochen später waren sie verheiratet gewesen.
Irene hatte ihren Mann so sehr geliebt, dass sie sich ihm völlig unterordnete und ihm jeden Wunsch von den Augen abgelesen hatte. Als ihr klargeworden war, dass in ihrer Ehe etwas nicht stimmte, hatte sie den Fehler bei sich selbst gesucht. Sie hatte ein schlechtes Gewissen gehabt, weil Otmar in materieller Hinsicht sehr viel in die Ehe mitgebracht hatte, sie hingegen nur ihre Liebe.
Und dann waren die von ihm und auch von ihr so heiß ersehnten Kinder ausgeblieben. Irene hatte in immer kürzer werdenden Abständen einen Frauenarzt aufgesucht, der ihr jedoch jedes Mal versichert hatte, dass alles mit ihr in Ordnung und kein Grund vorhanden sei, warum sie keine Kinder bekommen sollte. Sie müsse bloß Geduld haben. Die hatte sie ja, nur bei Otmar lag die Sache anders. Er sprach nun nicht mehr von der Einrichtung des Kinderzimmers, schien überhaupt keine Pläne mehr für die Zukunft zu machen. Er vernachlässigte Irene, schützte dringend notwendige Überstunden vor und verbrachte einen großen Teil seiner Freizeit in irgendwelchen Vereinen, bei irgendwelchen Veranstaltungen, zu denen er Irene nie einlud.
Irene hatte ihn nach wie vor verwöhnt, seine schlechte Laune hingenommen und ihn umsorgt. Doch allmählich war sie in Lethargie verfallen, was ihrer Freundin Erika gründlich missfallen hatte. Bei ihrem nächsten Besuch hatte sie Billie mitgebracht.
Otmar war über den neuen Hausgenossen nicht sonderlich erfreut gewesen, aber er hatte ihn geduldet. Irene jedoch hatte Billie sofort ins Herz geschlossen. Da war nun endlich jemand, der sie über ihre Einsamkeit hinwegtröstete und der ihr durch seine Anhänglichkeit deutlich zeigte, dass er ihr die Liebe, die sie in ihn investierte, wieder zurückgab.
Otmar hatte sich kaum um Billie gekümmert und im Übrigen die wachsende Freundschaft zwischen Irene und Billie mit amüsierter Überlegenheit betrachtet.
»Du und dein Hund!«, pflegte er zu sagen, wenn er gut aufgelegt war. Wenn er schlechter Laune war, setzte er noch hinzu: »Ja, wenn wir Kinder hätten! Für sie wäre Billie ein idealer Spielgefährte. Aber dass du so kindisch bist und mit dem Hund stundenlang spielst, verstehe ich nicht.«
Irene hatte zu diesem Vorwurf geschwiegen, obwohl sie mancherlei hätte entgegnen können. Etwa, dass Otmar sie vernachlässigte, während Billie für jede Minute, die sie ihm widmete, dankbar war. Aber Irene liebte Otmar und wollte keinen Streit heraufbeschwören, was ihr indessen immer schwerer fiel, denn Otmars Gereiztheit ihr gegenüber stieg von Tag zu Tag. Allmählich hatte sie das Gefühl, dass ihm überhaupt nichts mehr an ihr lag, dass sie ihm im Gegenteil nur lästig war.
Und heute war die aufgestaute Spannung zum Ausbruch gekommen. Irene saß da, grübelte über die fürchterliche Szene und konnte keine Erklärung dafür finden. Billie hatte Otmar doch nichts getan. Als er gehört hatte, dass sein Herrchen die Eingangstür aufschloss, war er schwanzwedelnd durch die Diele gelaufen, um ihn zu begrüßen, während Irene gesagt hatte: »Schau, Otmar, wie sich unser Billie freut, dass du heute schon so zeitig heimgekommen bist.«
Otmar hatte kein Wort erwidert, sondern den nichtsahnenden Hund mit dem Fuß weggeschleudert und ihn dann noch die Treppe, die zu der Haustür führte, hinuntergestoßen.
Immer wieder ging Irene in Gedanken die Szene durch. Hatte sie einen Fehler gemacht? Hatte sie Otmar zu wenig freundlich begrüßt? Was hatte er nur gegen sie? Unklar fühlte sie, dass sein Zorn eigentlich nicht dem Hund, sondern ihr gegolten hatte. Billie war nur das unschuldige Opfer, sozusagen der Prügelknabe, gewesen. Trotzdem kam auch sie sich ganz zerschlagen vor. Unfähig, einen Entschluss zu fassen, wie sie sich Otmar gegenüber in Zukunft verhalten sollte, ging sie schließlich zu Bett.
Otmar kam erst spät in der Nacht nach Hause, und sie stellte sich schlafend. Am nächsten Tag wich sie ihm aus, soweit es möglich war. Er schien das nicht zu bemerken und erwähnte den Vorfall vom Vortag mit keinem Wort.
*
Billie erwies sich als widerstandsfähig und robust, denn seine Genesung machte rasche Fortschritte. Das war allerdings auch auf die sachkundige und liebevolle Pflege zurückzuführen, die ihm im Tierheim Waldi u. Co. zuteil wurde.
Irene besuchte ihren vierbeinigen Liebling beinahe täglich, und im Anschluss an diese Besuche unternahm sie ausgedehnte Wanderungen durch den Wald. Leider hatte sie nur wenig Spaß daran. Sie nahm die herrliche Umgebung, in der sie sich befand, kaum wahr, hatte keinen Blick für die goldenen Sonnenstrahlen, die sich im Geäst der Bäume verfingen, und auch die Blumen neben den Wegen ließen sie kalt. Ihre Gedanken kreisten einzig und allein um ihre Ehe. Musste sie diese als gescheitert betrachten?
Seit dem Tag, an dem Otmar Billie misshandelt hatte, lebten sie und Otmar nebeneinander her. Otmar war zu ihr sogar wieder etwas freundlicher, aber sie traute dem Frieden nicht. Er schien Billie gänzlich aus seinem Gedächtnis gestrichen zu haben. Es war, als ob der Hund nie existiert hätte.
Irene wusste, dass sie eine Aussprache mit Otmar hätte herbeiführen sollen, doch sie schreckte davor zurück. Wer weiß, welche Konsequenzen sich daraus ergeben würden? überlegte sie.
Irene wollte sich auch keinem Menschen anvertrauen. Ihre Freundin Erika hatte für Otmar nie viel übriggehabt. Sie würde ihr deshalb sofort zur Scheidung raten. Ihre Eltern wiederum würden ihr den gegenteiligen Rat erteilen. Mutter würde sie zwar trösten, ihr aber gleichzeitig zu verstehen geben, dass man eine Ehe nicht leichtfertig aufs Spiel setzen dürfe. Und natürlich würde Irene niemandem die ganze Wahrheit über Otmars Benehmen enthüllen können.
Manchmal begegnete sie auf ihren Spaziergängen in Bachenau und Wildmoos einer Schar fröhlicher Kinder. Sie ging dann immer rasch an ihnen vorbei, ohne deren freundliche Grüße zu erwidern. Der Anblick fremder Kinder verbitterte sie, obwohl diese an ihrem Unglück keine Schuld trugen.
Wahrscheinlich hätte sich Irene immer mehr in ihre Verbitterung hineingesteigert, doch eines Tages wurde sie ganz unvermittelt aus diesem Zustand der Selbstbemitleidung herausgerissen.
*
Jede Hausfrau hätte beim Anblick der wohlgeordneten Reihe von sechsunddreißig Einsiedegläsern, von denen jedes ein Kilo Heidelbeermarmelade zum Inhalt hatte, aufgejubelt. Nicht so Magda, die Köchin von Sophienlust. Obwohl die Marmelade in Ordnung war und sich nirgends Anzeichen von Schimmelpilzen sehen ließen, betrachtete sie die Früchte ihres Fleißes mit leichtem Stirnrunzeln. Schließlich sagte sie zu Frau Rennert, der Heimleiterin: »Ich zähle sie immer wieder, aber es werden nicht mehr. Es sind bloß sechsunddreißig.«
»Wie viel hatten sie im vorigen Jahr?«
»Achtundvierzig. Und vor zwei Jahren waren es sogar zweiundfünfzig. Trotzdem waren sie sehr bald wieder leer.«
»Ich fürchte, die Kinder haben in der Umgebung schon alles abgesucht. In ganz Wildmoos dürfte nicht mehr eine einzige Beere zu finden sein.«
Magda gab sich nicht so leicht geschlagen. »Waren die Kinder auch schon in dem Wald bei Bachenau?«
»Ich werde sie fragen. Wenn nicht, könnten sie heute Nachmittag hingehen. Falls es nicht Regen gibt.« Frau Rennert warf einen besorgten Blick zum Himmel empor, der wieder einmal dicht bewölkt war.
Die Kinder zeigten sich über die Aussicht, am Nachmittag Beeren sammeln zu müssen, nicht übermäßig begeistert.
»Wir haben ohnedies schon körbevoll davon gepflückt«, meinte Irmela.
Pünktchen pflichtete ihr bei. »Mir tut der Rücken noch immer weh vom vielen Bücken.«
Fabian verstieg sich sogar zu der Bemerkung: »Hoffentlich regnet es, dann kann ich wenigstens in Ruhe mein Buch fertiglesen.«
Fabians Wunsch ging jedoch nicht in Erfüllung. Die Wolken waren zwar noch immer da, aber es fiel kein einziger Tropfen Regen, und so machten die Kinder sich unter der Führung Schwester Regines, mit Körben bewaffnet, auf den Weg.
»Wenn ihr essbare Pilze findet, könnt ihr sie auch mitbringen«, hatte Magda ihnen noch ans Herz gelegt, bevor sie losgezogen waren.
Bald erwies sich, dass die Meinungen der Kinder über die Essbarkeit von Pilzen geteilt waren. Die kleineren Kinder hatten nämlich ganz andere Ansichten als die größeren, ließen sich jedoch gern belehren.
Gleich zu Beginn des Ausflugs fand Anselm ein Prachtexemplar von einem Pilz, mit einem großen mattbraunen Hut und einem rötlichgrünen Stengel. Zum Glück zeigte er seinen Fund Schwester Regine. »Schau, wie schön der ist. Er wird gewiss gut schmecken«, meinte er dabei.
»Und wie groß er ist!«, lobte Heidi.
»Nein, den kann man nicht essen.« Schwester Regine brach den Pilz entzwei, sodass sich die weißen Bruchstellen bläulich verfärbten.
»Das ist ein Satanspilz«, mischte sich Vicky ein. »Wir haben in der Schule gelernt, dass er sehr giftig ist.«
»Ja, Vicky hat recht«, bestätigte Schwester Regine. »Wir würden alle krank werden, wenn wir davon essen würden.«
»Wir alle? Von dem einen Pilz?« Heidi konnte es nicht glauben. »Wie krank würden wir denn werden?«
»Wir würden Bauchweh bekommen und wahrscheinlich brechen müssen«, entgegnete Schwester Regine. »Ich halte es für klüger, wenn wir es nicht ausprobieren.«
»Gib mir die Stücke«, bat Pünktchen. »Ich will sehen, ob ich den Stamm von der hohen Fichte dort drüben treffe.«
»Nein, lass mich, du wirfst ja doch daneben«, rief Nick. Aber es war schon zu spät. Pünktchen hatte weit ausgeholt und beide Teile des giftigen Satanspilzes in Richtung Fichte geschleudert, wo sie an dem Stamm zerschellten.
»Siehst du, ich habe getroffen«, triumphierte sie.
»Schade«, sagte Heidi und betrachtete bedauernd Pünktchens Zerstörungswerk.
»Wir werden andere Pilze finden«, tröstete Pünktchen die Kleine. »Vielleicht finden wir Eierpilze. Die sind zwar nicht so groß und prächtig, aber dafür kann man sie essen. Sie schmecken sehr gut. Wenn ich einen sehe, zeige ich ihn dir, Heidi. Du kannst auch selbst welche suchen. Sie sind gelb und sehen ein bisschen aus wie ein Trichter. Man kann sie gar nicht mit einem anderen Pilz verwechseln.«
»Vergesst nicht die Heidelbeeren«, warnte Schwester Regine. »Eigentlich sind wir zum Beerenpflücken hergekommen.«
Die Kinder zerstreuten sich nun im Wald, wobei Schwester Regine ihnen einschärfte: »Geht nicht zu weit weg! Ihr müsst immer in Rufweite bleiben.« Sie selbst blieb bei den beiden Jüngsten, Heidi und Anselm. Auf Anselm musste sie nicht sonderlich achten, denn der Junge pflückte mit großem Eifer Beeren, aber Heidi streifte in der Hoffnung herum, Pilze zu finden. Es war öfters nötig, sie zurückzurufen, wenn sie sich zu weit entfernte.
Von Zeit zu Zeit blickte Schwester Regine besorgt zum Himmel empor. Hier zwischen den Bäumen konnte man nicht viel vom Himmel sehen, doch das Stückchen, das man sah, war eindeutig grau. Es schien nicht so, als ob die Sonne heute noch einmal unter der Wolkendecke hervorkommen würde. Im Gegenteil, es wurde immer finsterer, und dabei war es noch nicht einmal fünf Uhr.
Da Schwester Regine sich nicht weit vom Waldrand entfernt hatte, trat sie auf das angrenzende Feld hinaus. Von hier aus hatte sie einen guten Fernblick. Doch das, was sie sah, beruhigte sie keineswegs. Vom westlichen Horizont her schob sich eine Wolkenbank heran, die eine grauviolette Färbung aufwies. Das konnte nichts Gutes bedeuten.
Schwester Regine beschloss, die Kinder zu rufen und sofort den Heimweg anzutreten. Sie rief die Namen der Kinder, so laut wie sie konnte, in den Wald hinein, wurde jedoch von Heidi, die noch lauter schrie, glatt überboten. Natürlich dauerte es eine Weile, bis alle Kinder um sie versammelt waren. Inzwischen war ein scharfer Wind aufgekommen.
»Kommt schnell, wir müssen uns beeilen.«
»Ich kann nicht so schnell laufen«, jammerte Heidi. »Ich verliere meine Pilze. Ich habe sie so mühsam gesucht, und jetzt fallen sie aus dem Körbchen.«
»Gib welche davon in mein Körbchen, das ist leer«, bot Henrik ihr an.
»Aha, du bist faul gewesen«, rügte Nick.
»Lass mich einmal in deinen Korb sehen, der ist bestimmt auch nicht voll«, entgegnete Henrik.
»Kinder, bitte, streitet jetzt nicht«, wies Schwester Regine sie zurecht. »Heidi soll schnell einige Pilze in Henriks Korb geben, und dann gehen wir weiter.«
»Schau, hast du den Blitz gesehen?«, rief Pünktchen. »Er ging über den halben Himmel.«
Sie eilten nun weiter. Zumindest Schwester Regine bemühte sich, schnell vorwärtszukommen. Die Kinder blieben immer wieder stehen, um einen der immer häufiger werdenden Blitze zu bewundern. Für sie war das herannahende Gewitter eine schaurige Sensation, vor der sie sich aber nicht besonders fürchteten.
»Was soll uns denn geschehen?«, sagte Nick. »Wir werden höchstens nass. Das macht doch nichts. Es ist ohnehin sehr warm.«
»Ein Blitz könnte einen von uns treffen und töten«, erwiderte Schwester Regine..
»Das glaube ich nicht. Die Bäume im Wald sind doch viel höher als wir.«
»Außerdem ist das Gewitter noch weit weg. Man hört nicht einmal den Donner.«
»Ihr werdet ihn noch früh genug hören. Übrigens sind die Wolken sehr dunkel. Was macht ihr, wenn es hagelt? Die Hagelkörner tun weh.«
Diese Worte trieben die Kinder nun doch zur Eile an. Der Wind zauste an ihren Haaren.
Plötzlich blieb Schwester Regine wie angewurzelt stehen. »Anselm! Wo ist Anselm? Hat jemand von euch den Jungen gesehen?« Sie sah die Kinder der Reihe nach an. Alle waren da, außer Anselm. »Wo kann Anselm stecken? Wer hat ihn zuletzt gesehen?«
»Als du uns gerufen hast, ist er auch gekommen. Das weiß ich ganz genau.«
»Ja, das stimmt. Ich kann mich auch erinnern«, bestätigte Pünktchen Heidis Auskunft. »Seine Knie waren voll Heidelbeerflecken.«
»Und dann? Ist er mit uns gekommen?«
Niemand wusste darauf eine Antwort. Schwester Regine war mit der Aufgabe, die Kinder zur Eile anzutreiben, voll beschäftigt gewesen. Ihr war Anselms Abwesenheit nicht aufgefallen. Und die Kinder hatten auf die Wolken und die Blitze, nicht aber auf den kleinen Jungen geachtet.
»Was machen wir jetzt bloß?«, fragte Pünktchen.
»Wir müssen Anselm suchen«, erwiderte Schwester Regine. »Vielleicht hat er sich im Wald verirrt. Du und Nick, ihr bleibt bei mir und helft bei der Suche, während Irmela mit den übrigen nach Sophienlust geht.«
»Ja.«
»Ihr folgt alle brav Irmela und tut das, was sie sagt«, schärfte Schwester Regine den Kindern noch ein.
Die Kinder nickten. Sie waren alle über den Zwischenfall so erschrocken, dass ihnen im Moment die Lust an übermütigen Späßen vergangen war.
*
Anselm war, als er Schwester Regine hatte rufen hören, aufgestanden und zu ihr gelaufen. Während sie noch überprüft hatte, ob alle Kinder da waren, hatte er bemerkt, dass sich neben ihm am Boden das welke Laub bewegte. Er hatte sich gebückt, und da war ein Ding, das unter den Blättern versteckt gewesen war, hervorgekommen und in weitem Bogen davongehopst. Anselm war neugierig zu der Stelle gerannt, auf der es gelandet war. Doch kaum war er dort gewesen, war es schon wieder weggesprungen.
Anselm war wieder hinterhergeeilt. So war das eine Weile fortgegangen. Jetzt endlich hatte er das kleine Wesen erreicht, das er verfolgt hatte.
Anselm kauerte sich ins Gras, stellte seinen Korb ab und beobachtete den komischen Hüpfer. Es war ein kleines, braunes Tier, das aussah wie ein Frosch. Aber Frösche sind doch grün, dachte Anselm. Großmutti hat mir oft aus dem Märchenbuch die Geschichte vom Froschkönig vorgelesen, und ich habe mir die Bilder angesehen. Sollte dieses Tier eine Kröte sein? Aber Kröten waren doch hässlich, und dieses Geschöpf war recht niedlich. Anselm konnte sehen, wie es atmete. Seine Flanken hoben und senkten sich in regelmäßiger Folge. Es war auch nicht nass und schlüpfrig.
Anselm streckte seinen Zeigefinger aus, um es zu berühren. Doch da sprang es ihm schon wieder mit einem weiten Satz davon. Diesmal landete es in einem dichten Gebüsch, und Anselm konnte keine Spur mehr von ihm entdecken. Eine Zeitlang blieb er vor dem Strauch stehen und wartete, ob es wieder zum Vorschein kommen würde. Als es sich aber nicht mehr blicken ließ, drehte er sich um und ging zurück.
Wo hatte er nur seinen Korb gelassen? Er schaute sich suchend um, sah ihn jedoch nirgends. Außerdem herrschte eine beängstigende Stille. Das einzige Geräusch, das es hier gab, wurde vom Wind verursacht, der durch die Wipfel der Bäume fegte.
»Schwester Regine, Pünktchen, Heidi – wo seid ihr?«, rief Anselm angstvoll.«
Ein lautes Krächzen antwortete ihm. Ein paar schwarze Vögel flatterten auf und flogen davon. Dann war es wieder still.
»Schwester Regine! Heidi!«, schrie Anselm erneut. Doch es kam keine Antwort. Diesmal rührte sich überhaupt nichts.
Allmählich wurde es Anselm bewusst, dass er völlig allein war. Wo waren nur die anderen? Er erinnerte sich, dass Schwester Regine die Kinder zu sich gerufen hatte, um den Heimweg anzutreten. Da hatte er plötzlich den braunen Frosch entdeckt und war ihm nachgelaufen. Während er ihn verfolgt hatte, musste Schwester Regine mit den übrigen Kindern weggegangen sein.
Was sollte er jetzt anfangen? Er kannte sich hier nicht aus. Wenn er nur wenigstens aus dem Wald herausfinden würde!
Anselm überlegte, welche Richtung er einschlagen sollte. Zuerst war er bergab gelaufen, folglich musste er jetzt bergauf gehen.
Der Junge setzte sich in Bewegung. Es wurde immer dunkler. Wurde es schon Abend? Da zuckte ein greller Blitz auf, dem bald ein grollender Donner folgte. Anselm hatte Angst, nahm sich aber zusammen. Schließlich war er schon ein großer Junge, wie ihm seine Mami oft versichert hatte. Vor einem Gewitter durfte er sich nicht fürchten. Vielleicht vermisste ihn Schwester Regine bereits und kam zurück, um ihn zu suchen?
Da kam aus einem Gebüsch neben ihm ein lautes Knacken. Anselm vergaß seine mühsam aufrechterhaltene Beherrschung und stürzte in wilder Panik davon.
Keuchend blieb er schließlich stehen und blickte ängstlich zurück. Niemand folgte ihm. Trotzdem ließ die Furcht ihn nicht mehr los. Er dachte an die Märchen, die seine Großmutter ihm vorgelesen hatte. Ob es hier einen bösen Wolf gab? Was hatte ihm sein Vati über die Wölfe erzählt? Anselm bemühte sich, die Stimme seines Vaters heraufzubeschwören. »Ach, Unsinn«, hatte er gesagt, als Anselm ihn bei einem Ausflug gefragt hatte, ob sie einen Wolf treffen würden. »In Deutschland gibt es keine Wölfe mehr. Höchstens im Zoo. Wenn du willst, fahren wir einmal zu einem Zoo und schauen uns die Wölfe an.«
Damals hätte es Anselm nichts ausgemacht, im Wald einem Wolf zu begegnen. Wenn sein Vati bei ihm war, fühlte er sich sicher und hatte vor nichts Furcht. Aber jetzt war sein Vati leider nicht bei ihm, und er fürchtete sich sehr. Ob das knackende Geräusch vielleicht von einem Hasen oder von einem Reh gekommen war? Oder sollte eine Hexe es verursacht haben? Großmutti hatte ihm erklärt, dass Hexen nur im Märchen vorkämen. Aber stimmte das wirklich?
Während Anselm diese Überlegungen anstellte, achtete er nicht auf den Weg. Er lief geradewegs in ein zwischen zwei Bäumen gespanntes Spinnennetz. Pfui, wie das klebte. Anselm schüttelte sich vor Abscheu und versuchte, mit den Händen die Spinnweben aus seinem Gesicht zu wischen. Aber nun konnte er die Tränen nicht länger zurückhalten. Er setzte sich ins Gras und schluchzte bitterlich.
*
Trotz des drohenden Gewitters war Anselm nicht der einzige Mensch, der sich im Wald aufhielt. Irene Wieninger hatte Billie im Tierheim besucht und im Anschluss daran einen Spaziergang unternommen.
Die dichten Wolken, die sich am Himmel zusammengebraut hatten, waren ihr nicht entgangen, aber sie hatte sich herzlich wenig darum gekümmert. Sollte es nur regnen. Das würde so richtig zu der Stimmung, in der sie sich befand, passen. Sie war zwar erst gestern beim Friseur gewesen, aber trotzdem war es ihr gleichgültig, ob ihre Haare nass wurden oder nicht. Billie war ihr Aussehen egal. Er liebte sie auch mit herunterhängenden Haarsträhnen, und was Otmar betraf, dem war ihr Aussehen ebenso egal. Aber zum Unterschied von Billie liebte er sie überhaupt nicht.
Die ersten Blitze, die am Horizont aufleuchteten, bemerkte Irene nicht, denn sie befand sich inzwischen ziemlich tief drinnen im Wald. Als aber nun ein heller Blitzstrahl aufzuckte und der dazugehörende Donner nicht lange auf sich warten ließ, erschrak sie. Ein Gewitter im Wald konnte gefährlich werden. Wenn ein Blitz in einen Baum in ihrer Nähe einschlug, konnte der Baum auf sie stürzen und sie erschlagen.
Diese Vorstellung war Irene nicht gerade angenehm. Trotzdem zuckte sie mit den Schultern. Dann hätte wenigstens ihr ganzer Kummer ein Ende. Niemand würde um sie trauern, wenn sie tot wäre. Im Gegenteil, Otmar würde sogar froh sein, dass er sie losgeworden war. Oder würde er ihren schrecklichen Tod doch bedauern? Würde es ihm vielleicht sogar leid tun, dass er sie so schlecht behandelt hatte? Möglicherweise würde er sie dann doch vermissen und sein böses Verhalten bereuen. Aber dann würde es zu spät für die Reue sein.
Dieser Gedanke veranlasste Irene, laut aufzuschluchzen. Schuldbewusst blickte sie sich um. Nein, hier war niemand. Sie brauchte sich nicht zu beherrschen. Sie konnte ihrem Schmerz freien Lauf lassen. Die Tränen rannen ihr auch schon über die Wangen und vermischten sich mit den ersten Regentropfen, die vom Himmel fielen.
*
Als Anselm das Geräusch von näherkommenden Schritten hörte, wollte er zuerst aufspringen und die Flucht ergreifen. Doch er beherrschte sich diesmal. Er kroch bloß hinter einen Busch und spähte vorsichtig hervor. Zwischen den Bäumen erblickte er die Gestalt einer Frau, die langsam auf ihn zukam. Da sie immer wieder von Bäumen verdeckt wurde, gelang es ihm nicht, Einzelheiten zu erkennen. Vielleicht war es Schwester Regine, die ihn suchte. Sollte er rufen? Wenn es aber vielleicht doch die böse Hexe war?
Anselm schwieg und rührte sich nicht. Er wagte kaum zu atmen. Als Irene zwischen den Bäumen hervortrat und auf die kleine Lichtung kam, merkte er, dass die Frau zwar nicht Schwester Regine, aber ebenfalls jung und hübsch war. Also konnte es sich nicht um eine Hexe handeln, denn die waren bekanntlich alt und hässlich, hatten einen Buckel, eine lange Nase und ein spitzes Kinn. Außerdem weinte die fremde Frau. Wahrscheinlich hatte sie sich auch im Wald verirrt, genau wie er, und fand nun nicht mehr nach Hause.
Anselm erhob sich, kam hinter seinem Gebüsch hervor und fragte: »Haben Sie sich auch im Wald verirrt? Oder sind Sie womöglich doch die böse Hexe?«
Irene blieb überrascht stehen und betrachtete verwirrt den kleinen Jungen, der so plötzlich vor ihr aufgetaucht war. Träumte sie? Das Kind hier glich in so auffallender Weise ihrem jahrelang gehegten Traumbild, dass sie an der Realität seiner Erscheinung zweifelte. Nur hatte sie sich immer einen sauberen, frisch gewaschenen und gekämmten Jungen vorgestellt, während dieser hier ein verschmiertes Gesicht, Spinnweben in den Haaren und schmutzige Knie aufwies. Diese Tatsachen überzeugten Irene, dass sie kein Trugbild vor sich hatte.
»Was tust du denn hier?«, fragte sie schließlich nicht gerade geistreich.
Anselm zögerte. Die fremde Frau sah durchaus vertrauenerweckend aus. Auf keinen Fall schien sie die Absicht zu haben, ihn in ihr Knusperhäuschen schleppen zu wollen. Er entschloss sich zu einer vorsichtigen Antwort. »Ich habe Heidelbeeren gepflückt. Und dann habe ich einen Frosch gesehen«, sagte er.
»Bist du allein hier? Darfst du so tief in den Wald hineingehen, ohne dass dich jemand begleitet?«
Nun musste der Junge mit der Wahrheit herausrücken.
»Zuerst bin ich mit Schwester Regine und Heidi beisammen gewesen. Dann habe ich den braunen Frosch verfolgt, und auf einmal war ich ganz allein.«
»Findest du jetzt nicht mehr nach Hause?«, fragte Irene scharfsinnig.
Anselm schüttelte stumm den Kopf.
»Na, dann ist es ein Glück, dass ich dich getroffen habe. Ich werde dich heimbringen. Wo wohnst du?«
»Ich wohne in der Breitegasse Nummer drei in Maibach. Aber jetzt ist meine Mami verreist, und ich wohne deshalb in Sophienlust.«
»Sophienlust? Ach ja, das ist das Kinderheim in Wildmoos. Ich habe davon gehört, aber ich war noch nie dort.«
Irene überlegte und kam schnell zu einem Entschluss. »Ich weiß nicht genau, wo das Kinderheim ist. Das klügste wäre, wenn ich mit dir nach Bachenau zum Haus von Dr. von Lehn ginge. Von dort aus können wir in Sophienlust anrufen, damit dich jemand abholt.«
»Ja, fein!« Anselm war einverstanden. »Gehen wir zu Tante Andrea und zum Tierheim Waldi und Co.«
»Du kennst es?«
»Ja freilich. Ich war mit Tante Isi und Schwester Regine und den anderen schon ein paarmal dort.«
Die Tatsache, dass die junge Frau den Tierarzt Dr. von Lehn erwähnt hatte, ließ Anselm Vertrauen zu Irene fassen. Willig ließ er sich von ihr bei der Hand nehmen.
Für Irene war es ein eigentümliches Gefühl, als sie die kleine Kinderhand, die sich in ihre eigene Hand schmiegte, spürte.
»Wie heißen Sie«, fragte Anselm.
»Irene Wieninger.«
»Irene? Das ist ein hübscher Name. Er gefällt mir. I-r-e-n-e.« Anselm kostete den Klang voll aus.
Irene lächelte. Sie fühlte sich irgendwie geschmeichelt. Mit einer solchen Begeisterung hatte schon lange keiner mehr ihren Namen ausgesprochen.«
»Sag du und Tante Irene zu mir«, schlug sie dem Jungen vor.«
»Ja, Tante Irene.«
»Gut. Nun musst du mir aber auch deinen Namen verraten.«
»Ich heiße Anselm Nissel.«
»Das ist ebenfalls ein sehr schöner Name.«
Nachdem die beiden diese gegenseitigen Komplimente ausgetauscht hatten, kamen sie zu dem Waldweg, von dem Irene vorhin abgezweigt war. Der Weg führte nach Bachenau. Irene passte ihre Schritte denen von Anselm an. Es blitzte und donnerte nun nicht mehr, aber der Regen war heftiger geworden. Obwohl die Bäume den größten Teil davon abfingen, wurden Anselm und Irene ziemlich nass, was aber beide nicht sonderlich störte. Irene war der Regen sowieso gleichgültig gewesen, und Anselm spürte nichts anderes als die Erleichterung, nicht mehr allein im dunklen Wald herumirren zu müssen. Er fragte Irene, ob sie Tante Andrea kenne, und Irene erwiderte ja, sie sei ihr schon einmal begegnet, als sie Billie besucht habe.
Diese Erklärung brachte die Rede naturgemäß auf Billie, und Irene erzählte Anselm von ihrem Hund.
»Ich habe mir auch einmal einen Hund gewünscht«, sagte Anselm, »aber Großmutti war dagegen. Sie sagte, dass sie mit mir genug Arbeit habe. Ein Hund würde ihr gerade noch fehlen.«
»Vielleicht gelingt es dir eines Tages, deine Großmutti umzustimmen«, meinte Irene.
»Nein«, sagte Anselm traurig, »meine Großmutti ist tot.« Danach erzählte er Irene, wie er nach Sophienlust gekommen war. Kaum war er damit fertig geworden, hörten sie laute Rufe, die durch den Wald hallten.
»Anselm! Anselm!«
Irene blieb stehen. »Horch einmal, ich glaube, da hat jemand deinen Namen gerufen.«
»Anselm!«
»Jetzt wieder. Hast du es gehört?«
»Ja. Das ist die Stimme von Schwester Regine! Schwester Regine!«, schrie Anselm.
Nach einigem Hin- und Herrufen trafen sie einander. Auch Nick und Pünktchen, die Anselm hatten schreien hören, kamen herbeigelaufen.
»Gott sei Dank, dass wir dich gefunden haben.« Man merkte Schwester Regine die Erleichterung deutlich an. »Wo hast du denn gesteckt?«
Anselm schilderte ihr recht eindrucksvoll seine Begegnung mit dem braunen Frosch, dann das verdächtige Knacken im Gebüsch und wie er ziellos durch den Wald gelaufen war, bis ihn schließlich Tante Irene gefunden hatte.
Schwester Regine dankte Irene Wieninger und fügte hinzu: »Sie sind genauso durchnässt wie wir alle. Kommen Sie doch mit nach Sophienlust. Sie können sich dort umziehen. Ich leihe Ihnen trockene Sachen.«
Noch bevor Irene auf diesen Vorschlag eingehen konnte, fragte Anselm: »Gehen wir denn jetzt zurück nach Sophienlust?« In seinem Ton lag eine gewisse Enttäuschung.
»Was hast du denn geglaubt?«, entgegnete Nick. »Willst du weiter im Wald herumlaufen und Frösche aufstöbern? Falls es überhaupt einer war. Du bist tropfnass. Genügt dir das nicht?«
Durch diese kurze Strafpredigt entmutigt, ließ Anselm den Kopf hängen. Aber er wagte immerhin noch einen Einwand. »Ich hätte so gern Billie kennengelernt«, sagte er.
»Billie? Was für einen Billie?«
»Tante Irene wollte mit mir zum Tierheim Waldi und Co. gehen und mir ihren Billie zeigen.«
»Billie ist mein Hund«, erklärte Irene. »Er ist bei Herrn Dr. von Lehn in Pflege. Da ich nicht genau weiß, wo Sophienlust liegt, hatte ich vor, Anselm zum Tierheim zu bringen und von dort aus zu telefonieren.«
»Und mir Billie zu zeigen«, schaltete Anselm ein.
»Das verschieben wir am besten auf morgen.« Irene sah Schwester Regine fragend an. »Wäre es möglich, dass ich Anselm morgen abhole und mit ihm zum Tierheim gehe?«
»Ja, natürlich«, erwiderte Schwester Regine. »Möchten Sie vormittags oder nachmittags kommen?«
»Am Nachmittag. Da habe ich länger Zeit«, sagte Irene.
»Also, das wäre abgemacht. Jetzt wollen wir aber aufbrechen. Mir wird schon kalt. Kommen Sie mit?«
»Nein, danke. Mein Auto steht ganz in der Nähe, und die Fahrt nach Maibach dauert nicht lang.«
Irene verabschiedete sich. Anselm bestürmte sie, ihn nicht zu vergessen, sondern morgen unbedingt zu kommen. Irene versicherte ihm, dass sie ihr Versprechen halten würde. Obwohl ihr das Haar schwer ins Gesicht hing, das nasse Kleid an ihrem Körper klebte und das Wasser aus ihren Schuhen rann, fühlte sie sich froh und beschwingt.
*
Der folgende Vormittag verging für Irene viel zu langsam. Sie konnte es kaum erwarten, nach Sophienlust zu fahren und Anselm wiederzusehen. Endlich war es soweit.
Der Junge begrüßte sie voll Freude. Irene lernte Denise von Schoenecker, Frau Rennert und die Kinder kennen. Dann machte sie sich mit Anselm auf den Weg nach Bachenau. Dabei fiel ihr auf, dass der Junge sie von Zeit zu Zeit kritisch betrachtete.
»Warum siehst du mich so an? Ist etwas nicht in Ordnung?«, fragte sie.
»Deine Haare hängen so glatt herunter«, erwiderte er.
»Daran ist der gestrige Regen schuld.«
»Hast du sie nicht neu eingelegt? Meine Mami wickelt ihre Haare jeden Morgen auf Lockenwickler.«
Irene lächelte. »In Zukunft werde ich das auch machen, damit ich dir gefalle.«
Aber Anselm war mit seiner Kritik noch nicht am Ende. »Du hast mitten auf der Nase einen roten Pickel. Und auf der Stirn einen zweiten«, sagte
er.
»Ja, das ist wahr.« Irene fuhr mit dem Zeigefinger über die beanstandeten Stellen. »Ich habe versucht, sie zu überpudern, aber das scheint nichts geholfen zu haben. Man sieht es wohl trotzdem.«
»Puder nützt da nichts«, äußerte Anselm altklug. »Du musst dein Gesicht kosmetisch behandeln lassen.«
Irene glaubte nicht recht zu hören. Sie warf dem kleinen Jungen einen überraschten Blick zu. »Was verstehst denn du davon?«, fragte sie schließlich.
»Meine Mami hat einen Kosmetiksalon in Maibach. Du musst einmal hingehen. Da bekommst du eine weiße Paste auf dein Gesicht gestrichen, die trocknet ein und wird dann wieder abgenommen. Maske nennt man so etwas. Nachher ist die Haut jung und glatt.« Anselm hatte nicht umsonst so häufig seine Mutter und Frau Kaufmann bei der Behandlung schönheitsdurstiger Kundinnen beobachtet. »Geh gleich morgen hin«, schlug er vor.
»Ich habe geglaubt, deine Mutter ist verreist?«
»Ja, schon. Aber Frau Kaufmann ist dort. Die Adresse ist Hauptstraße hundertneun.«
»Du machst ja sehr eifrig Reklame.«
»Reklame? Wieso? Was ist das?« Als Anselm merkte, dass Irene etwas unglücklich dreinsah, fügte er hinzu: »Sei nicht traurig, du gefällst mir auch so. Ich mag dich sehr gern.«
»Ach, du hast schon recht. Ich muss etwas gegen die Pickel unternehmen. Aber wenn ich morgen in den Kosmetiksalon gehe, kann ich dich nicht besuchen.«
»Geh am Vormittag.«
»Da habe ich keine Zeit. Ich muss mich um meinen Haushalt und um den Garten kümmern.«
»Melde dich bei Frau Kaufmann telefonisch an, da brauchst du dann nicht zu warten. So machen es viele.«
»Du scheinst dich gut auszukennen.«
»Früher war ich oft bei Mami und bei Frau Kaufmann im Geschäft.« Anselm seufzte.
Er hat Sehnsucht nach seiner Mutter, dachte Irene. Doch seine folgenden Worte widerlegten diese Annahme.
»Aber viel lieber war ich bei meiner Großmutti.«
Irene war inzwischen aufgefallen, dass Anselm immer nur von seiner Mutter und von seiner Großmutter sprach. Seinen Vater hatte er bisher noch kein einziges Mal erwähnt. Doch obwohl Irene alles, was den Jungen betraf, sehr interessierte, wagte sie keine Frage.
Mittlerweile waren sie in Bachenau angelangt, und Anselms Wunsch, Billie kennenzulernen und ihn zu streicheln, ging in Erfüllung. Billie erfreute sich bereits wieder bester Gesundheit. Er begrüßte sein Frauchen mit einem lauten Kläffen und heftigen Wedeln seines Stummelschwanzes.
Anselm war von der neuen Bekanntschaft begeistert, und auch Billie schien an dem zweibeinigen Spielgefährten Gefallen zu finden. Natürlich hielten sich Irene und Anselm wesentlich länger als geplant gewesen war, im Tierheim auf. So kam es, dass Otmar schon längst zu Hause war, als Irene endlich eintraf.
Irene erwartete, dass er sie fragen würde, wo sie gewesen war, doch er erkundigte sich nur, wann das Abendessen fertig sein würde.
»Das …, das Abendessen?«, stotterte sie und sah auf die Uhr. »Ich habe vergessen, die notwendigen Lebensmittel einzukaufen. Und jetzt ist es zu spät. Die Geschäfte haben bereits geschlossen.«
»Dann werden wir also heute hungern?«, fragte Otmar in einem sarkastischen Tonfall.
»Nein. Es ist genügend Brot da, und im Kühlschrank habe ich Schinken und eine Menge Eier. Ich werde für dich ein Schinkenomelett machen. Das ist schnell fertig.«
»Meinetwegen brauchst du dich nicht zu bemühen. Ich gehe in ein Restaurant essen.«
Statt zu protestieren und ihn zu bitten, doch daheimzubleiben, wie es bisher ihre Gewohnheit gewesen war, schien Irene voll und ganz mit dieser Idee einverstanden zu sein. »Ja, du hast recht. Geh nur, dort bekommst du sicher etwas Ordentliches zu essen.«
»Nun, wenn ich es mir so recht überlege …« Otmar zögerte.
»Nein, ein Schinkenomelett ist zuwenig. Es war dumm von mir, dass ich es dir angeboten habe.«
Nach diesen Worten blieb Otmar nichts anderes übrig, als sich in das nächstgelegene Restaurant zu begeben. Dort bestellte er sich einen Zigeunerspieß auf Reis. Als ihm dieser nach geraumer Wartezeit serviert wurde, fand er das Fleisch zäh und den Reis matschig und geschmacklos. Er ärgerte sich über Irene, weil sie es abgelehnt hatte, ihm ein Schinkenomelett zuzubereiten.
Irene kramte unterdessen in einem Karton, in dem sie verschiedene Stoffreste aufgehoben hatte. Irgendwo muss doch der Plüschrest sein, dachte sie dabei. Sie hatte im vorigen Winter für Erikas kleine Tochter einen weißen Kapuzenmantel genäht, und dabei war ein Stück des Stoffes übriggeblieben. Aha, jetzt fiel es ihr wieder ein. Sie hatte ihn extra in einem Papiersäckchen verstaut.
Nachdem sie den Plüschrest gefunden hatte, breitete sie ihn auf dem Küchentisch aus und betrachtete ihn nachdenklich. Es war ein verhältnismäßig großes Stück. Irene hatte vor, daraus einen Plüschhasen für Anselm anzufertigen. Aus dem Karton holte sie noch ein Restchen rosa Seide, um damit die Ohren zu füttern, und begann sofort mit dem Zuschneiden. Die Arbeit verlangte ihre volle Konzentration. Daher konnte sie keinen einzigen Gedanken an Otmars Nahrungssorgen verschwenden.
*
Den folgenden Tag widmete Irene der Verschönerung ihrer Person und einem neuerlichen Besuch in Sophienlust. Diesmal vergaß sie jedoch nicht, für das Abendessen Vorsorge zu treffen. Trotzdem lieferte sie Otmar einen Grund, ihr wiederum eine Rüge zu erteilen.
Otmar war, nachdem er das sorgfältig zubereitete Abendessen mit Behagen verspeist hatte, in seinem Arbeitszimmer verschwunden. Von dort rief er plötzlich mit lauter Stimme: »Irene, komm her! Was soll das bedeuten?«
Erschrocken erschien sie. »Was ist los?«
Er deutete auf seinen Schreibtisch, auf dessen Platte sich noch Abfälle, die vom Spitzen seiner Bleistifte herrührten, befanden.
Irene folgte seiner Geste mit verständnislosen Blicken. »Du hast deine Bleistifte gespitzt und den Mist auf deinem Schreibtisch liegenlassen. Hast du mich deshalb gerufen?«, fragte sie.
»Warum hast du das nicht weggeräumt?«, lautete seine Gegenfrage.
»Ich habe es nicht gesehen.«
»Es liegt aber schon seit gestern da.«
»Ich habe heute dieses Zimmer nicht betreten.«
»Hast du nicht aufgeräumt?«
»Nein. Wozu? Es ist ohnedies alles in Ordnung. Sei froh, dass ich heute nicht Staub gewischt habe. Du ärgerst dich jedes Mal, wenn deine Sachen nicht mehr an genau der gleichen Stelle liegen wie vor dem Aufräumen.«
»Über diesen Mist hier ärgere ich mich auch.«
»Er stammt von deinen Bleistiften, die du selbst gespitzt hast. Du hättest ihn gleich beseitigen können. Außerdem weiß ich genau, dass du mich bloß schikanieren willst.« Mit diesen der Wahrheit entsprechenden Worten, die Otmar trotzdem überraschten, verließ Irene den Raum.
Otmar fegte mit einer einzigen Handbewegung die Abfälle in den Papierkorb. Dann setzte er sich und dachte nach. Früher war ihm Irenes liebevolle Aufmerksamkeit immer auf die Nerven gegangen. Ihr jetziges kühles und gleichgültiges Verhalten ihm gegenüber gefiel ihm aber noch viel weniger. Es verblüffte ihn. Er war sich jedoch darüber im Klaren, dass er den Grund dafür sich selbst zuzuschreiben hatte.
Damals, als Irene, ohne ein Wort zu verlieren, den Hund weggeschafft hatte, war er erleichtert gewesen. Er hatte seine unbeherrschte und grausame Handlungsweise beinahe sofort bereut. Aber es war nun einmal geschehen. Er schämte sich und hatte gehofft, dass Irene ihm stillschweigend verzeihen würde. Aber nun wurde ihm klar, dass das nicht der Fall war. Er musste sich zu einer Aussprache mit ihr aufraffen. Leicht fiel ihm das nicht.
Zögernd betrat er das Wohnzimmer, Irenes Lieblingsraum, aber sie war nicht hier. Sollte sie schon zu Bett gegangen sein? Schließlich fand er sie in der Küche, wo sie auf dem Tisch ihr Nähzeug ausgebreitet hatte.
»Was tust du hier? Warum hältst du dich ausgerechnet in der Küche auf?«, fragte er erstaunt.
Da sie diesen Raum in der Hoffnung, hier ungestört zu bleiben, aufgesucht hatte, war sie um eine Antwort verlegen. Otmar wartete auch gar keine Antwort ab, denn er sah, woran sie arbeitete.
»Was soll das werden? Ostern ist doch längst vobei.«
»Es ist nicht für Ostern«, erwiderte Irene kurz. Dann blickte sie ihn fragend an. »Hast du noch etwas entdeckt, das ich wegzuräumen vergessen habe?«
Durch diesen unerwarteten Angriff wurde Otmar aus dem Konzept gebracht. Er fing sich aber rasch wieder. »Nein. Du hast mich vorhin missverstanden. Ich wollte dir keine Vorwürfe machen.«
»Nein? Was sonst?«
»Irene, bitte, hör mir zu. Es kann so nicht weitergehen. Ich weiß, dass ich dir Grund genug gegeben habe, auf mich böse zu sein. Aber ich werde alles wiedergutmachen. Du sollst einen neuen Hund haben.«
»Einen neuen Hund?« Irene wusste im Moment nicht, worauf Otmar hinauswollte. »Ach so, du glaubst, dass du Billie umgebracht hast. Und jetzt willst du dich großzügig erweisen und mir einen neuen Hund kaufen. Ist dir nicht klar, dass ein Hund ein Lebewesen ist und nicht irgendein lebloses Ding, das man rücksichtslos zerbrechen und wegwerfen kann, weil es so leicht ist, jederzeit ein neues anzuschaffen?«
»So habe ich es nicht gemeint. Was soll ich denn tun? Was verlangst du von mir?«
»Nichts. Billie ist noch durchaus lebendig und erholt sich prächtig.«
»Warum hast du mir das nicht erzählt?«
»Weil ich nicht geglaubt habe, dass es dich interessiert.«
»Du bist so anders als sonst. Kannst du mir nicht verzeihen? Ich weiß, dass ich nicht immer der beste Ehemann war. Aber wenn wir manchmal nicht der gleichen Meinung waren …«
»Du meinst, wenn wir uns gestritten haben«, fiel Irene ihm ins Wort.
»So würde ich es nicht nennen. Jedenfalls haben wir uns immer wieder geeinigt.«
Irene war nahe daran zu sagen, ja, weil ich immer nachgegeben habe. Aber sie schwieg. Sie wollte keinen neuen Streit heraufbeschwören. Diese Auseinandersetzung war ihr unerwünscht, denn sie war mit sich selbst noch nicht im Reinen. Außerdem wollte sie unbedingt noch heute den Hasen für Anselm fertig machen.
Otmar wartete auf eine Reaktion von Irene. Bisher war sie ihm stets freundlich entgegengekommen und hatte ihm dadurch die Versöhnung immer erleichtert. Da sie aber diesmal kein Wort äußerte, meinte er: »Ist dir Billie wirklich so wichtig, dass du seinetwegen die Existenz unserer Ehe gefährden willst? Du hast mir gerade erzählt, dass es ihm wieder gut geht.«
»Er hätte tot sein können«, murmelte Irene.
»Ich versichere dir nochmals, dass es mir leid tut. Du brauchst keine Angst zu haben, dass es wieder vorkommen könnte. In Zukunft werde ich mich besser beherrschen.«
»Billie hat dir doch nichts getan«, sagte Irene – eigentlich gegen ihren Willen, denn sie hatte nicht vor, sich auf eine längere Debatte einzulassen.
»Das weiß ich. Es war nur …« Otmar zögerte und sprach schließlich die Worte, die ihm auf der Zunge lagen, nicht aus, um Irene nicht zu verletzen. Die Sehnsucht, anstelle des Hundes sein Kind vor sich zu sehen und von ihm begrüßt zu werden, hatte ihm einen Augenblick lang die Beherrschung geraubt.
»Ich war einfach schlecht aufgelegt«, vollendete er den begonnenen Satz. »Wollen wir den Vorfall nicht einfach vergessen« bat er.
»Ja, reden wir nicht mehr davon«, stimmte Irene zu.
Otmar wertete dies als Zeichen der Versöhnung und umarmte seine Frau, was sie jedoch regungslos geschehen ließ. Gleich darauf hielt sie den fast fertigen Plüschhasen mit ausgestrecktem Arm von sich weg und begutachtete ihn mit zurückgelehntem Kopf von allen Seiten. »Ich hätte die Ohren doch lieber mit rotem Stoff füttern sollen«, meinte sie dabei.
Otmar hatte sich die Versöhnungsszene etwas anders vorgestellt. Aber er fand nicht die rechten Worte, Irene das begreiflich zu machen. Außerdem hoffte er, dass sich mit der Zeit alles von selbst wieder einrenken würde. Deshalb sagte er nur: »Rosa ist genau die richtige Farbe für die Ohren. Der Hase ist dir sehr gut gelungen.«
Mit diesem Lob gedachte er Irene zu erfreuen. Doch nichts in ihrer Miene ließ darauf schließen, dass ihm das gelungen war.
*
Anselm nahm Irenes Geschenk mit großer Freude entgegen. Die beiden schlossen sich immer enger aneinander an. Irene besuchte den Jungen nun jeden Tag. Meist wanderte sie dann mit ihm zum Tierheim, wo sie Billie, der schon wieder gut laufen konnte, zu einem Spaziergang durch den Wald abholten.
Obwohl Anselm ein eher scheues Kind war, hatte er zu Irene solches Zutrauen gefaßt, dass er mit ihr freimütig über alles, was ihm in den Sinn kam, plauderte. Unter anderem beschrieb er ihr mit begeisterten Worten die elektrische Eisenbahn, die er von seinem Vater zu seinem fünften Geburtstag bekommen hatte.
Irene hörte ihm aufmerksam zu, doch sie war der Meinung, dass die Phantasie mit dem Jungen durchging. Im Kosmetiksalon hatte sie von Frau Kaufmann einigen Tratsch über deren Chefin, Frau Nissel, vernommen. Zwangsläufig war dabei auch die Rede auf Anselm, der ja Irene sozusagen, hingeschickt hatte, gekommen. Frau Kaufmann, froh, eine so interessierte Zuhörerin gefunden zu haben, hatte sich dabei kein Blatt vor den Mund genommen.
»Der arme Junge«, hatte sie gesagt. »Er kann einem richtig leid tun. Die einzige Person, die sich wirklich um ihn gekümmert hat, war seine Großmutter. Und die ist jetzt tot. Ich weiß nicht, was nun mit dem Jungen geschehen soll.«
»Er hat doch eine Mutter«, hatte Irene eingewandt.
»Ach, Frau Nissel!« Das hatte ziemlich abschätzig geklungen. »Ich will gewiss nichts Schlechtes über sie sagen. Sie hat mich immer gut behandelt und ist geradezu die ideale Chefin. Mit den Kundinnen weiß sie in einmaliger Weise umzugehen, nur auf die Behandlung von Kindern versteht sie sich weniger.«
»Ist sie nicht nett zu Anselm?«, hatte Irene gefragt.
»O doch. Sie liebt ihn sehr. Aber sie ist einfach nicht fähig, auf das Kind einzugehen. Man kann ihr daraus gar keinen Vorwurf machen. Sie ist eben nicht der Typ dafür. Es ist so ganz und gar nichts Mütterliches an ihr.«
»Und Anselms Vater?«, hatte Irene zu fragen gewagt.
»Vater? Von einem Vater habe ich nie etwas gesehen oder gehört.«
*
Denise betrachtete die wachsende Freundschaft zwischen Anselm und Irene einerseits wohlwollend, andererseits mit Besorgnis. Der Junge gewöhnte sich immer mehr an Irene. Er sprach nun nicht mehr so oft von seiner Großmutter und schien den Schmerz über ihren Tod teilweise überwunden zu haben. Dafür begann beinahe jeder seiner Sätze mit den Worten: Tante Irene.
Denise überlegte besorgt, wie wohl Anselms Mutter darauf reagieren würde. Da von Frau Nissel noch immer keinerlei Nachricht eingetroffen war, wusste Denise nicht, wie sich Anselms Zukunft gestalten würde. Der Junge hatte erst vor kurzem seine Großmutter verloren. Würde er nun plötzlich von Irene getrennt werden, wäre das ein schwerer Schlag für ihn.
Irene verdrängte Denise gegenüber diese Absicht und fragte sie um ihre Meinung. Denise äußerte Bedenken. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Mutter so ohne weiteres auf ihr Kind verzichtet«, sagte sie.
»Das habe ich nicht gemeint«, beeilte sich Irene zu versichern. »Ich will ihr das Kind doch nicht wegnehmen. Aber da Anselm bisher hauptsächlich bei seiner Großmutter war, habe ich gedacht, ob nicht ich deren Platz einnehmen könnte. Ich würde gewiss gut zu ihm sein.«
Denise betrachtete Irene mit nachdenklichen Blicken. Sie hatte von ihrer Stieftochter Andrea von Lehn die rätselhafte Geschichte von Billies Verletzung vernommen und fragte sich, ob sie es überhaupt wagen durfte, Irene das Kind anzuvertrauen. Freilich glaubte sie ebensowenig wie Hans-Joachim und Andrea, dass Irene die Schuld an Billies sogenanntem Unfall trug. Denise fand Irene sehr sympathisch, und dass Anselm so schnell Vertrauen zu ihr gefaßt hatte, sprach für sie.
Vorsichtig fragte Denise: »Sie sind doch verheiratet? Was sagt Ihr Mann zu dem Plan, Anselm zu sich zu nehmen?«
Irene errötete. »Ich habe ihn noch nicht gefragt. Aber ich bin überzeugt, dass er sich freuen würde. Er hat Kinder sehr gern. Seit wir verheiratet sind …« Irene brach ab und seufzte leise.
»Sie wollen also Ihrem Mann eine Freude machen?«, fragte Denise, die Irenes Seufzer richtig interpretiert hatte.
»O nein«, wehrte Irene erschrocken ab. »Es geht mir nicht um Otmar oder um mich. Es stimmt, unsere Ehe ist nicht gerade glücklich. Wenn wir Kinder hätten, wäre das bestimmt ganz anders. Aber ich will Anselm nicht dazu benützen, den Bruch in unserer Ehe zu kitten. Es geht mir einzig und allein um das Wohl des Jungen. Sollte Otmar gegen Anselm voreingenommen sein, so …« Irene scheute sich, den Satz zu vollenden. Sie hatte sagen wollen …, so würde ich mich eben von ihm trennen. Sie erschrak, wie selbstverständlich sie diesen Gedanken hatte aussprechen wollen. Lag ihr wirklich nichts mehr an Otmar?
Denise beobachtete Irene schweigend und sagte schließlich: »Es hat keinen Sinn, sich jetzt schon den Kopf über Anselms Zukunft zu zerbrechen. Einstweilen ist er in Sophienlust gut aufgehoben. Wenn seine Mutter zurückkommt, wird sich ja herausstellen, was sie mit ihm vorhat.«
»Ja. Aber da ist noch eine Sache, die ich mir nicht erklären kann. Anselm erzählt so gern von seinem Vater. Aber von Frau Kaufmann habe ich gehört, dass Anselm seinen Vater gar nicht kennt. Dabei schildert ihn der Junge so plastisch und mit allen möglichen Details.«
Denise lächelte: »Das tun Kinder gern. Sie malen sich Phantasiegestalten aus und steigern sich mit einer solchen Intensität in ihre Träume hinein, dass sie schließlich selbst daran glauben. Ich halte Anselms Vater auch für ein derartiges Wunschbild.«
*
Nach diesem Gespräch hing Irene immer stärker ihren Träumen nach. Wenn Otmar Anselm nicht akzeptieren würde – nun, dann würde sie allein für den Jungen sorgen. Sie würde ihre Arbeit wieder aufnehmen und sich eine Stelle als Lehrerin suchen. Dann würde ihr für das Kind noch genügend Zeit bleiben. Und sicher würde es mir gelingen, irgendwo eine Wohnung zu finden. Doch wahrscheinlich würde das gar nicht notwendig sein. Otmar würde sicher an Anselm Gefallen finden. Der Junge war doch ein so liebes und anschmiegsames Kind.
Als Irene und Anselm wieder einmal mit Billie unterwegs waren, sagte Anselm plötzlich: »Schade, dass mein Vati Billie nicht kennt. Ich meine, deinen Billie. Mein Vati hat nämlich auch einen Hund, der Billie heißt.«
Irene beschloss, auf das Spiel einzugehen. »Und wie sieht der Billie von deinem Vati aus?«, fragte sie.
»Das weiß ich nicht«, erwiderte Anselm überraschenderweise. »Mein Vati hat ihn mir nie gezeigt. Er hat mir bloß von ihm erzählt.«
»Aber Anselm, das bildest du dir doch alles nur ein«, sagte Irene unbedachterweise.
»Nein, mein Vati hat mir wirklich oft von Billie erzählt«, beteuerte Anselm.
»Na ja, wenn du es sagst, wird es schon stimmen«, erwiderte Irene. Doch ihre Miene drückte dabei eine solche Ungläubigkeit aus, dass Anselm rief: »Natürlich stimmt es. Denkst du, ich schwindle? Vielleicht glaubst du auch nicht, dass ich einen Vati habe. Aber ich habe einen Vati. Er ist groß und blond und hat braune Augen. Am liebsten trägt er einen grauen Anzug und eine rotblau gestreifte Krawatte.«
Irene lächelte. Anselm schien von seinem Wunschvati eine sehr genaue Vorstellung zu haben. Was sie daran so freute, das war, dass Otmar ganz gut in das von Anselm beschriebene Bild passen würde. Würde Otmar mit Anselm einverstanden sein, so würde es auch umgekehrt der Fall sein. Irene sah die Zukunft in einem rosigen Licht.
*
Billie war inzwischen vollkommen genesen. Ein Aufenthalt im Tierheim war nun nicht mehr notwendig.
Andrea machte Irene eine diesbezügliche Mitteilung. »Billie ist jetzt wieder gesund«, sagte sie. »Sie brauchen sich keine Sorgen mehr um ihn zu machen und können ihn ohne weiteres mit nach Hause nehmen.«
Andrea hatte erwartet, dass Irene mit Freude und Dankbarkeit auf diese Eröffnung reagieren würde, aber da täuschte sie sich. Trotz dieser erfreulichen Auskunft wurde Irenes Gesicht traurig. Ein wenig Verzweiflung war aus ihrer Stimme herauszuhören, als sie sagte: »Muss ich ihn mitnehmen? Darf ich ihn nicht noch eine Weile im Tierheim lassen? Hier ist er so gut aufgehoben.«
Andrea zeigte deutlich ihre Überraschung. »Ich habe geglaubt, Sie haben Billie gern?«, fragte sie.
»Das stimmt. Trotzdem wäre es mir lieber, wenn er hierbleiben könnte.«
»Ich an Ihrer Stelle wäre froh, wenn ich ihn bei mir haben könnte.«
»Ja …« Die Gedanken wirbelten Irene durch den Kopf. Natürlich, es musste sonderbar wirken, dass sie ihren Hund nicht bei sich haben wollte. Kein Wunder, dass Frau von Lehn annahm, sie habe ihn nicht gern. Dabei hatte Billie noch vor kurzem den Mittelpunkt ihres Lebens dargestellt. Dank Anselm war das nun anders. Trotzdem hatte sie Billie noch genauso gern wie früher. Aber sie fürchtete sich vor dem Zusammentreffen des Hundes mit Otmar. Ob der Hund vergessen hatte, was ihm sein Herrchen angetan hatte? Und wie würde sich Otmar in Zukunft dem Hund gegenüber verhalten? Vielleicht würde er ihn doch wieder misshandeln, allen Beteuerungen zum Trotz? Aber womit sollte sie ihr Zögern, Billie nach Hause zu nehmen, Frau von Lehn gegenüber motivieren?
»Wollen Sie den Hund überhaupt nicht mehr?«, fragte Andrea, der das Schweigen allmählich zu drückend wurde. »Sie können ihn uns eventuell ganz überlassen. Das wäre immerhin günstiger, als ihn zu fremden Leuten zu geben, die ihn quälen.«
Irene wusste nicht, was sie erwidern sollte. Es war ihr klar, dass Frau von Lehn auf Billies Verletzungen anspielte.
»Bei uns würde ihm nichts Böses zustoßen«, fuhr Andrea fort, während Irene immer verlegener wurde.
»Nein, ich will Billie nicht hergeben. Nicht für ständig«, sagte sie endlich. »Nur im Moment … Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen erklären soll …«
»Sie sind mir keine Erklärung schuldig.« Andreas Antwort klang ziemlich kühl.
Es wurde Irene bewusst, dass sie die Wahrheit nicht länger verschweigen konnte. Zumindest nicht Andrea gegenüber. »Es fällt mir nicht leicht, darüber zu reden«, begann sie, »aber wenn ich Ihnen von dem Vorfall erzählt habe, werden Sie wahrscheinlich besser verstehen, wie peinlich mir die ganze Angelegenheit ist.« Danach beschrieb sie, wie Billie sich die Verletzungen zugezogen hatte.
Andrea hörte ihr entsetzt zu. »Ihr Mann muss ein abscheulicher Mensch sein!«, rief sie spontan aus.
»O nein«, widersprach Irene, »er ist nicht abscheulich.«
»Ein Mann, der ein wehrloses Tier misshandelt, ist in meinen Augen ein, ein …« Andrea suchte nach einem passenden Ausdruck, aber es fiel ihr keiner ein.
»Otmar war früher nicht so«, sagte Irene leise, mehr zu sich selbst. »Am Anfang unserer Ehe waren wir sehr glücklich.«
Andrea betrachtete Irene mit einer Miene, die deutlich ihren Unglauben ausdrückte. »Ich könnte mit so einem Menschen nicht zusammenleben«, stellte sie fest.
»Ach«, seufzte Irene, »seit damals habe ich nachgedacht und nachgedacht, aber ich bin zu keinem Entschluss gekommen.«
»Warum nicht? Soviel ich weiß, haben Sie keine Kinder. Das würde eine Scheidung doch erleichtern.«
»Ja, sicher«, erwiderte Irene gedehnt.
»Sind Sie finanziell von Ihrem Mann abhängig? Haben Sie Angst, keine Arbeit zu finden, wenn Sie sich von ihm trennen?«
»Nein, das ist nicht der Grund für mein Zögern. Ich bin Lehrerin. Ich würde bestimmt nicht verhungern, wenn ich allein wäre, aber …«
»Aber? Was kann Ihnen denn an einem solchen Menschen liegen? Nachdem er zu dem armen Billie so grausam war, müsste es Ihnen leichtfallen, sich von ihm zu trennen.«
»Hm«, meinte Irene ohne Überzeugung.
»Sie werden sehen, wie erleichtert Sie sein werden, wenn Sie ihn erst einmal losgeworden sind«, meinte Andrea. Doch ihre Worte schienen Irene nicht zu begeistern, was ihr deutlich anzusehen war.
»Warum klammern Sie sich so sehr an ihn?«, fragte Andrea deshalb.
»Ich kann mir einfach nicht vorstellen, nicht mehr mit Otmar beisammen zu sein«, entgegnete Irene. »Ein Leben ohne ihn … Ich fürchte, ich liebe ihn eben«, gestand sie.
Andrea öffnete schon den Mund, um zu sagen, dann ist Ihnen eben nicht zu helfen, schluckte aber diese offenherzigen Worte noch rechtzeitig hinunter. Doch später legte sie Hans-Joachim gegenüber weniger Zurückhaltung an den Tag. Sie erzählte ihm von ihrer Unterredung mit Irene und fügte hinzu: »Ich kann mich in Frau Wieninger einfach nicht hineinversetzen.«
»Das ist auch gar nicht notwendig«, erwiderte Hans-Joachim etwas trocken. »Bleib nur schön brav meine Andrea.«
»Mach dich nicht lustig über mich. Du weißt schon, was ich meine. Ich verstehe nicht, dass sie mit einem
solchen … Scheusal zusammenleben kann.«
Hans-Joachim lächelte nachsichtig. »Sie hat dir klipp und klar erklärt, dass sie ihn liebt. Genügt dir das nicht?«
»Aber wie kann man einen Menschen, der ein Tier derart quält, lieben?«
»Vermutlich war das eine einmalige Entgleisung.« Hans-Joachim wurde ernst. »Natürlich ist das keine Entschuldigung für seine Handlungsweise, aber es kann jedem einmal passieren, dass er die Beherrschung verliert.«
»Jedem? Nein, das glaube ich nicht«, rief Andrea. »Du würdest so etwas nie tun.«
»Na, das wollen wir doch hoffen«, erklärte Hans-Joachim, keineswegs geschmeichelt durch Andreas Ausruf. »Es ist wohl eine Selbstverständlichkeit, dass ich nicht nach Hunden trete.«
»Siehst du«, erwiderte Andrea. »Herr Wieninger ist eben doch ein schlechter Mensch.«
»Mag sein. Das heißt, ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht. Aber wenn ihn seine Frau liebt, so ist das ihre Angelegenheit. Sie muss zu einem Entschluss kommen. Du kannst ihr da nicht helfen.«
»Leider. Aber Billie wollen wir einstweilen noch bei uns behalten, nicht wahr?«
»Natürlich.«
*
Der Gegenstand dieser Erörterung, Otmar Wieninger, fühlte sich keineswegs wohl in seiner Haut. Davon, dass Irene ihn immer noch liebte, merkte er nichts. Im Gegenteil, sein Argwohn, dass er ihr gleichgültig geworden sei, stieg von Tag zu Tag. Er hatte gehofft, dass mit seiner Entschuldigung, die ihm schwer genug gefallen war, der alte Zustand wiederhergestellt sein würde, doch hierin sah er sich getäuscht. Obwohl er sich hütete, Irene zu ärgern, und sich ihr gegenüber aufmerksam und liebevoll wie schon lange nicht mehr benahm, war es, als ob eine unsichtbare Mauer zwischen ihnen stehen würde. Er konnte sich nicht über Unfreundlichkeit seiner Frau beklagen. Das Essen stand auch jeden Tag pünktlich auf dem Tisch, und das Haus war tadellos aufgeräumt. Aber Irene schien sich in einem Zustand ständiger geistiger Abwesenheit zu befinden.
Otmar dachte, dass der Grund dafür Billie sei und sprach Irene daraufhin an: »Machst du dir Sorgen wegen Billie? Geht es ihm schlecht?«
»Billie?« Irene schreckte aus ihrem Gedankengang auf. »Ach so, ja, Billie. Dem geht es gut.«
Da sie ihn nicht ermuntert hatte, das Gespräch fortzusetzen, und das Thema Billie für ihn nur beschämend war, wagte er keine weiteren Fragen. Immerhin wusste er nun, dass es nicht der Hund war, der Irene so beschäftigte.
Es war Otmar nicht entgangen, dass Irene die Nachmittage außer Haus verbrachte. Und zwar nicht im Garten, der deutliche Spuren von Vernachlässigung aufwies. Das Unkraut wucherte bereits zwischen den Rosen und sogar zwischen den Steinplatten des Weges. Das war ein Zustand, den Irene bisher nie geduldet hatte. Doch diesmal schien sie ihn gar nicht zu bemerken. Deshalb machte Otmar sich an einem Wochenende selbst an die Arbeit, während Irene in ihr Auto stieg und davonfuhr, ohne zu sagen, wohin.
Die Verrichtung der Gartenarbeit ließ Otmar genügend Muße zum Nachdenken. Bisher war immer er derjenige gewesen, der Irene an den Samstagen und Sonntagen allein gelassen hatte. Sogar den Urlaub hatte er ohne sie verbracht, und ihre Klagen darüber waren ihm nur lästig gewesen. Jetzt begann er einzusehen, dass sie berechtigt gewesen waren. Er hatte Irene schlecht behandelt, nun ging sie ihrer eigenen Wege. Wenn er nur wüsste, wo sie sich aufhielt! Ihre Freundin Erika war in Urlaub gefahren. Bei ihr konnte Irene nicht sein. Aber mit wem war Irene beisammen?
Da Otmar es von Anfang an mit der ehelichen Treue nicht allzu genau genommen hatte, gab es für ihn auf diese Frage nur eine Antwort: Irene hatte einen Mann kennengelernt. Zugleich wunderte er sich, mit welcher Erbitterung ihn dieser Gedanke erfüllte. Irene gehörte zu ihm, und zu niemandem sonst.
Otmar warf die Grasschere, mit der er die wuchernden Graseinfassungen entlang den Blumenbeeten gestutzt hatte, fort und ging ins Haus. Das Glas Whisky, das er sich an der Hausbar eingoss, gewährte ihm nur geringen Trost. Es war ihm klar, er musste etwas unternehmen. So konnte es nicht weitergehen. Zuallererst musste er herausfinden, wo und mit wem Irene ihre freie Zeit verbrachte. Zu diesem Zweck würde er ihr am nächsten Tag heimlich nachfahren.
Am Abend – Irene kam erst ziemlich spät heim – flammte beinahe ein Streit zwischen ihnen auf. Denn Otmar konnte es sich nicht verkneifen zu sagen: »In letzter Zeit bist du mehr unterwegs als zu Hause. Ein Glück, dass du keine Kinder hast. Sonst müsstest du deinen Unternehmungsgeist wohl etwas dämpfen.«
Irene erwiderte gereizt: »Das soll wahrscheinlich wieder einmal ein versteckter Vorwurf sein. Aber wir wollen die Sache ein für alle Mal klarstellen: Meine Schuld ist es nicht, dass wir keine Kinder haben.«
»Nein?«
»Ich war oft genug beim Frauenarzt. Er hat mir jedes Mal erklärt, dass ich vollkommen gesund und bei mir alles in Ordnung sei.«
Otmar gab darauf keine Antwort, sondern zuckte nur die Schultern.
»An mir liegt es also nicht«, fuhr Irene fort. »Aber es muss doch nicht unbedingt die Frau diejenige sein … Ich meine, es gibt Fälle, wo der Mann …«
»Willst du andeuten, dass ich an unserer Kinderlosigkeit schuld sei?«
»Nun ja …«
»Schlag dir das aus dem Kopf.«
»Bitte, sei nicht gleich zornig. Ich will dich ja nicht beleidigen. Aber du warst doch noch nie beim Arzt. Ich meine, aus diesem Grund …«
»Das ist nicht notwendig.«
»Aber wie willst du wissen …« Irene konnte aus Verlegenheit nicht weitersprechen.
»Soll ich dir einen Beweis dafür liefern, dass ich sehr wohl fähig bin … Ach, zum Kuckuck, lass dieses Thema fallen. Es führt zu nichts.«
Otmar verließ schnell den Raum, noch bevor Irene weitere Einwände vorbringen konnte.
*
Irene ahnte nichts von Otmars Entschluss, ihr heimlich zu folgen. Sie hatte ihm noch nichts von Anselm und ihrer Hoffnung, den Jungen zu sich nehmen zu dürfen, erzählt. Sie hielt sich strikt an Denises Rat, nichts zu überstürzen. Solange Anselms Mutter nicht zurückgekehrt war, konnte keine Entscheidung getroffen werden.
Es wäre Irene nie in den Sinn gekommen, dass Otmar sich dafür interessieren könnte, wohin sie fuhr. Deshalb achtete sie nicht auf die Autos, die hinter ihr fuhren, und wusste nicht, dass Otmar ihr folgte. Sie fuhr wie immer nach Sophienlust, um Anselm abzuholen und mit ihm zum Tierheim zu wandern.
Die Fahrt dauerte nicht lange. Bei der Ortstafel von Wildmoos verringerte Irene ihr ohnedies nicht übermäßig schnelles Tempo. Als sie bei der hohen Hecke, die Sophienlust umgab, angelangt war, parkte sie ihren Wagen neben der Straße, stieg aus und ging zu Fuß weiter.
Otmar hielt sein Auto ebenfalls an, fuhr dann im Rückwärtsgang ein Stück zurück und stellte den Wagen neben einigen Büschen ab. Dann schlich er Irene nach, wobei er sich dicht an die Hecke drückte. Doch dieses Manöver war vollkommen sinnlos, denn Irene drehte sich nicht um. Ohne die geringsten Anzeichen von Nervosität oder schlechtem Gewissen ging sie immer geradeaus, bis sie plötzlich aus seinem Blickfeld entschwand.
Otmar beschleunigte seine Schritte und lief nun beinahe, bis auch er zu dem großen schmiedeeisernen Tor gelangte, hinter dem Irene verschwunden war. Nun sah er sie wieder. Sie ging unbeirrt die Auffahrt entlang, die zu einem großen weißen Herrenhaus führte, stieg die Freitreppe empor und betrat das Haus.
Otmar zögerte. Bei dem Park und dem Haus handelte es sich zweifellos um einen Privatbesitz, den zu betreten er sich scheute. Er blieb eine Weile stehen und spähte vorsichtig durch das Gitterwerk des Tores. Von Irene konnte er keine Spur entdecken, dafür erblickte er eine Schar fröhlicher Kinder, die hinter einem riesigen, braunweiß gefleckten Bernhardiner herliefen und sich mit ihm auf dem Rasen balgten. Otmar beobachtete sie etwas sehnsüchtig bei ihrem Spiel. Es ging um einen kleinen roten Ball, dessen Besitzverhältnisse unklar zu sein schienen.
»Komm, Barri, sei ein braver Hund und gib mir den Ball«, lockte eines der Kinder.
»Nein, Barri, das ist mein Ball!«
»Lauf nicht weg!«
»Hierher, Barri, komm!«
»Brav, Barri! Bist ein braver Hund!«
»Nein, der Ball gehört mir!«
»Lauf, Barri, lauf!«
Als endlich eines der Kinder den Ball endgültig erobert hatte, war nicht mehr viel davon übrig.
»Barri hat den Ball ganz zerrissen«, sagte ein trauriges Stimmchen.
»Mach dir nichts daraus. Er war sowieso schon alt.«
»Ja, und ganz weich. Er ist nicht mehr ordentlich gesprungen.«
»Aber er war so schön rot.«
»Du bekommst einen neuen. Der wird viel schöner sein.«
Da Otmar fasziniert der Balgerei zugesehen hatte, war ihm Irenes Wiedererscheinen entgangen. Sie war schon fast beim Tor angelangt, als er sie bemerkte. Doch beim Anblick ihres Begleiters stockte ihm der Atem. In seiner Verbohrtheit war er fest überzeugt gewesen, dass sich Irene hier mit einem fremden Mann treffe. Doch das, was er jetzt sah, übertraf seine schlimmsten Befürchtungen. Das ist doch nicht möglich!
Irene und der Junge kamen, eifrig miteinander plaudernd, auf ihn zu. Noch hatten sie ihn nicht erblickt. Otmar kämpfte mit sich. Es drängte ihn, seinem ersten Impuls nachzugeben, davonzulaufen, heimzufahren und die Sache zu vergessen. Aber genau das konnte er eben nicht. Wenn er so handelte, war er schlicht und einfach ein gewissenloses Ungeheuer.
Da sah Irene ihn. Sie blieb überrascht stehen. Doch es war Anselm, der ihn jeglicher weiterer Überlegung enthob.
»Vati!«, rief der Junge. Er eilte auf Otmar zu und umschlang dessen Knie.
»Aber Anselm!« Irene war dem Jungen rasch gefolgt und zog ihn von Otmar weg. Sie dachte, dass nur der Wunsch, einen Vater zu besitzen, Anselm dazu getrieben habe, sich in dieser Weise auf Otmar zu stürzen. Sie sah sich um. Gott sei Dank, niemand aus Sophienlust hatte den Zwischenfall, der ihr wirklich peinlich war, bemerkt.
»Otmar! Was tust du hier? Wie kommst du hierher?«, fragte sie.
»Dasselbe könnte ich dich fragen«, erwiderte er.
Anselm beobachtete die beiden Erwachsenen mit weit aufgerissenen Augen. Ihre Stimmen klangen so unfreundlich, dass er sich fürchtete.
»Frag mich nur. Ich habe nichts zu verbergen«, sagte Irene.»Ich komme jeden Tag hierher, um Anselm zu einem Spaziergang abzuholen.«
»Ja, Vati, das ist wahr«, bestätigte der Junge.
Irene war ihm dafür jedoch nicht dankbar, sondern warf ihm einen strafenden Blick zu. »Das ist doch nicht dein Vati«, meinte sie dabei.
»O ja!« Anselm ließ sich nicht beirren. »Du glaubst schon wieder, dass ich schwindle. Aber das stimmt nicht. Ich sage die Wahrheit, nicht wahr, Vati?«
Otmar brachte nichts weiter als einen krächzenden Ton heraus.
Irene blickte ihn daraufhin erstaunt an. Sein Gesichtsausdruck erschreckte sie. »Aber …, aber Anselm hat doch gar keinen Vater«, stotterte sie.
»Ich habe einen Vati. Er steht doch da vor dir.«
Irene sah von dem einen zum anderen und hatte dabei das Gefühl, sich in einem Albtraum zu befinden. Stand sie wirklich hier, mitten in Wildmoos, und erlebte, dass ein kleiner Junge, der nicht ihr Kind war, Otmar allen Ernstes als seinen Vater bezeichnete? Es musste ein Irrtum sein. Otmar konnte sie doch nicht die ganzen Jahre hindurch belogen und ein Doppelleben geführt haben. Aber warum stritt er Anselms Behauptung nicht ab? Warum stand er da und schwieg verbissen?
Mitten in diese Überlegungen hinein, die durch Irenes Kopf wirbelten, fragte Anselm: »Kommst du mit, Vati? Wir gehen zu Billie.« Dann fügte er unschuldig hinzu: »Kennst du überhaupt Tante Irene, Vati?«
»Ja, ich kenne sie«, entgegnete Otmar mit schwankender Stimme.
»Fein, das freut mich. Ich habe sie nämlich sehr lieb.«
Anselm war über das plötzliche Zusammentreffen mit seinem Vater nicht übermäßig verwundert. Er war daran gewöhnt, ihn stets in unregelmäßigen Abständen zu treffen. Weshalb er gerade jetzt hierhergekommen war, darüber machte er sich keine Gedanken. Hauptsache, er war hier.
Trotzdem fühlte das Kind vage, dass irgend etwas nicht in Ordnung war. Tante Irene war so blass geworden, dass Anselm fürchtete, sie sei krank geworden, würde womöglich umfallen und tot sein, wie damals seine Großmutter. Er sprach diese Befürchtungen auch aus, worauf Irene erwiderte: »Ja, das würde ich jetzt am liebsten tun.«
»Nein, Tante Irene, das wäre schrecklich. Dann würde ich dich nie mehr wiedersehen, genau wie meine Großmutti. Du darfst nicht sterben!«, rief Anselm voll Angst.
»Unsinn. So schnell stirbt man nicht.« Otmar hatte seine Sprache wiedergefunden.
»Doch. Meine Großmutti auch – ist umgefallen …«
»Denk jetzt nicht daran. Tante Irene ist noch jung. Ihr passiert so etwas nicht.« Otmar ergriff Anselms Hand und sagte dabei leise zu Irene: »Ich bitte dich, nimm dich jetzt zusammen und mache mir vor dem Kind keine Szene. Später erkläre ich dir alles.«
Irene war zu keiner Antwort fähig.
*
Der Nachmittag verlief für die beiden Erwachsenen äußerst unbehaglich. Sie vermieden es, miteinander zu sprechen oder einander auch nur anzusehen.
Dem Jungen blieb dieser Zustand der stummen Zwietracht natürlich nicht verborgen. Er ahnte nichts von dem Verhältnis, in dem Otmar und Irene zueinander standen, und wusste nicht, dass sein Vati Tante Irenes Mann war. Aber die Blicke voll kalter Verachtung, die Irene Otmar zuwarf, erregten seine Aufmerksamkeit. »Warum siehst du meinen Vati so an, Tante Irene? Magst du ihn nicht?«, fragte er.
»Ich sehe ihn gar nicht an. Du irrst dich«, wich Irene aus.
Auf Anselms Drängen, Billie zu besuchen, damit sein Vati den Hund kennenlernen könne, war Irene nicht eingegangen. Sie hatte keine Lust, im Tierheim vielleicht Andrea zu begegnen und dieser ihren Mann vorstellen zu müssen, der sich zu allem Überfluss auch noch als Anselms Vater entpuppt hatte.
Irene konnte nicht mehr klar denken. Sie hatte das Gefühl, plötzlich verrückt geworden zu sein. Der klare Spätsommertag, der Sonnenschein und der tiefblaue Himmel, alles kam ihr unwirklich vor. War das sie selbst, die hier neben Anselm und Otmar durch den stillen Wald ging? Und was würde nun weiter geschehen? Sobald sie Anselm wieder in Sophienlust abgeliefert hatte, würde Otmar Gelegenheit haben, seine Erklärungen vorzubringen. Wie würden sie lauten?
In Irenes Kopf summte es. Doch eine Tatsache blieb bestehen: Otmar hatte ein Kind mit einer fremden Frau. Er hatte sie demnach betrogen, oder doch nicht? Anselm war über fünf Jahre alt, während sie mit Otmar erst seit vier Jahren verheiratet war. Also war Anselm vor ihrer Ehe zur Welt gekommen. Warum hatte Otmar ihr die Existenz seines Kindes verschwiegen? Sie hätte ihm doch deswegen gar keine Vorwürfe gemacht. Wozu also diese Heimlichtuerei?«
Irene konnte sich auf diese Fragen nur eine Lösung denken: die Mutter des Kindes. Wahrscheinlich bedeutete Frau Nissel Otmar immer noch mehr als sie selbst.
Da der Weg durch den Wald nur schmal war, ließ Irene Otmar und Anselm vorausgehen und blieb ein Stück zurück. Sie wusste nun, dass ihre Sympathie für Anselm kein bloßer Zufall war. Unbewusst hatte das Kind sie an Otmar erinnert, aber früher war ihr die Ähnlichkeit zwischen den beiden natürlich nicht aufgefallen.
Die Minuten dehnten sich und kamen Irene wie Ewigkeiten vor. Wenn nur dieser schreckliche Nachmittag schon vorbei wäre! So gern sie Anselm hatte, jetzt war ihr seine Gegenwart unerwünscht, denn sie war nahe daran, die Beherrschung zu verlieren.
Anselm erzählte seinem Vater inzwischen von Sophienlust und plauderte fröhlich darauflos. Das war ein Glück, denn von Otmar erhielt er nur einsilbige Antworten. Auch den Wunsch, in das Kinderheim mitzukommen, um Tante Isi, Schwester Regine und Magda kennenzulernen, schlug ihm sein Vater ab.
»Ein anderes Mal. Heute ist es schon zu spät«, lautete die lahme Ausrede.
Es blieb Irene überlassen, Anselm nach Sophienlust zurückzubringen. Denise war nicht anwesend, und so überfiel Anselm Schwester Regine mit der großen Neuigkeit, dass er seinen Vater getroffen habe.
Schwester Regine blickte Irene fragend an. »Ist das wahr?«, Ich habe immer geglaubt, dass …« Sie brach ab, denn Anselm hörte aufmerksam zu.
»Ja, das habe ich auch geglaubt. Aber ich bin eines Besseren belehrt worden«, antwortete Irene.
Schwester Regine war über die Bitterkeit, die in Irenes Stimme durchklang, überrascht. Doch da sie Irenes Verlangen, den Jungen zu sich zu nehmen kannte, führte sie Irenes Verstimmung darauf zurück, dass dieser Plan nun durch das unerwartete Auftauchen von Anselms Vater vereitelt worden war. »Warum ist dein Vati nicht mit hereingekommen?«, fragte sie Anselm.
»Das weiß ich nicht.«
»Das ist eine sehr sonderbare Angelegenheit.« Schwester Regine wandte sich wieder an Irene. »Ich verstehe das Ganze nicht. Können Sie mir erklären, was vorgefallen ist?«
»O bitte, ich kann jetzt nicht.«
Nun erst fiel Schwester Regine Irenes erschreckende Blässe auf.
»Sind Sie krank? Fühlen Sie sich nicht wohl?«, fragte sie besorgt.
»Es geht schon. Ich werde morgen wiederkommen und Ihnen alles erzählen, soweit ich dazu imstande bin.«
Mit diesem etwas rätselhaften Versprechen verabschiedete sich Irene und ließ Schwester Regine höchst verwundert zurück.
*
Otmar und Irene fuhren nach Maibach zurück.
»Du hast mich also die ganze Zeit hindurch belogen?«, begann Irene, zu Hause angelangt, da sie das Schweigen nicht länger aushielt und trotz ihres ausgeglichenen Temperaments nahe daran war zu platzen.
»Irene! Bitte! Du darfst das Ganze nicht so tragisch nehmen.«
»Habe ich nicht allen Grund dazu? Du verschweigst mir das Vorhandensein eines Kindes … Wo ist übrigens Anselms Mutter?«
»Woher soll ich das wissen?«
»Versuch mir nicht einzureden, dass du mit Anselms Mutter nichts zu tun hast.«
»Ich habe sie seit langem nicht mehr gesehen.«
»Seit wann?«
Otmar zögerte. Aber dann beschloss er, die Wahrheit zu sagen, denn er erkannte, dass er nichts mehr zu verlieren hatte.
»Ich war mit ihr in Tunesien.«
»Ach! Und mir hast du eingeredet, dass du im Urlaub allein sein müsstest, wenn du dich erholen sollst.«
»Schrei nicht so.«
»Darf ich nicht mehr schreien? Du betrügst mich ununterbrochen …«
»Nein, das habe ich nicht getan.«
»Nicht? Und deine häufigen Überstunden? Und die Kartenabende bei den Kollegen? Und die Fußballspiele am Wochenende? Ich bin überzeugt, dass das alles nur Ausreden waren, damit du mit dieser Frau beisammen sein konntest.«
»Es ist mir dabei nicht um Lauretta, sondern hauptsächlich um Anselm gegangen.«
»Spiel jetzt nicht den liebevollen Vater. Anselm ist schon seit Wochen in Sophienlust, ohne dass sich jemand um ihn gekümmert hätte. Wir alle haben gedacht, dass er gar keinen Vater besitzt. Warum hast du ihn nicht längst von dort weggeholt, oder ihn zumindest besucht?«
»Ich wusste doch nicht, wo Anselm war.«
»Und heute hast du es erfahren?«
»Ja. Irene, bitte, lass dir alles erklären. Es war reiner Zufall, dass ich heute nach Sophienlust fuhr. Das heißt, ich bin dir gefolgt.«
»Du bist mir gefolgt?«, wiederholte Irene verständnislos.
»Ja. Ich wollte wissen, wohin du immer fährst.«
»Du spionierst mir also nach?«
»Nenn es, wie du willst. Das ist doch jetzt Nebensache. Ich hatte keine Ahnung, wo Anselm war. Es hat mir einen ziemlichen Schock versetzt, als ich dich mit ihm zusammen erblickte. Das kannst du mir glauben.«
»Ich fürchte, ich bin etwas schwer von Begriff, denn ich komme da nicht ganz mit. Anselm hat mir oft von seinem Vati erzählt, nur habe ich geglaubt, dass das eine Phantasiegestalt sei. Aber aus seinen Erzählungen ging hervor, dass du oft bei ihm warst. Hast du denn nichts vom Tod seiner Großmutter gewusst?«
»Das schon. Als ich aus Tunesien zurückkam, wollte ich Anselm besuchen. Von einer Nachbarin erfuhr ich, dass die alte Frau Nissel plötzlich verstorben war. Was mit Anselm geschehen war, konnte sie mir jedoch nicht sagen.«
»Warum hast du nicht weiter nachgeforscht?«
»Versteh doch, ich wollte keinen Staub aufwirbeln. Niemand wusste, dass ich Anselms Vater bin.«
»Du hättest doch nur in dem Kosmetiksalon nachzufragen brauchen. Oder ist dir dessen Vorhandensein unbekannt?«
»Sei nicht zynisch. Natürlich weiß ich über Laurettas Kosmetiksalon Bescheid, aber ich war nie dort.«
»Warum nicht?«
»Lauretta wollte es nicht. Und ich auch nicht. Es hätte mich doch jemand sehen können. Womöglich wäre es zu Tratschgeschichten gekommen?«
»Wie schrecklich!«, warf Irene ironisch ein.
»Nun, ich habe Rücksicht auf meine Position zu nehmen.«
»Gar so großartig ist deine Position nicht«, stellte Irene kühl fest. »Und außerdem – wenn dir dein Ansehen so wichtig ist, warum hast du nicht Anselms Mutter geheiratet? Noch bevor Anselm zur Welt kam?«
»Lauretta wollte mich nicht heiraten. Und ich …, ich war enttäuscht von ihr.«
»Ich verstehe. Da hast du dann eben mich genommen. Als Lückenbüßer sozusagen.«
»Nein, Irene. Ich hatte mich in dich verliebt. Du warst so anders als Lauretta. Bei dir konnte ich mir vorstellen, dass wir ein schönes und zufriedenes Familienleben führen würden. Auf Anselm musste ich verzichten. Er trägt nicht einmal meinen Namen. Aber ich habe gehofft, dass wir beide Kinder haben würden.«
»Und ich habe deine Erwartungen enttäuscht.«
»Nein. Ich weiß jetzt, dass es falsch und ungerecht von mir war, dir wegen unserer Kinderlosigkeit Vorwürfe zu machen und ungeduldig zu sein, aber es war beinahe eine fixe Idee von mir. Ich wollte einen Ersatz für Anselm, den ich nicht immer bei mir haben konnte.«
»Du liebst Anselm also?«
»Natürlich. Ich war fast verrückt vor Sorge, als ich nicht wusste, wohin der Junge gebracht worden war. Aber ich wagte nicht, etwas zu unternehmen. Deshalb habe ich dem Hund gegenüber die Beherrschung verloren. Du hast Billie liebevoll umsorgt und ihn beinahe wie ein Kind behandelt, während ich nicht wusste, was mit Anselm geschehen war. Ich hielt deine Fürsorge um den Hund für Verschwendung und stellte mir vor, dass auch Anselm sie brauchen könnte.«
»Anselm hat eine Mutter. Es ist ihre Pflicht, sich um ihn zu kümmern, nicht die meine.«
»Ja«, gab Otmar zu.
»Wo steckt also deine Freundin Lauretta?«
»Ich nehme an, in Frankreich. Im Übrigen ist sie nicht meine Freundin.«
»Du lügst.«
»Nein, glaube mir doch. Zwischen Lauretta und mir ist alles aus. Wir haben uns nie richtig verstanden. Bitte, vertrau mir. Nur das eine Mal noch.«
»Nein. Vor vier Jahren habe ich dir vertraut. Und was ist daraus geworden? Wenn du mir früher von Anselm erzählt hättest, wäre alles in Ordnung. Aber es ist dir nicht nur um deinen Sohn gegangen, sondern auch um dessen Mutter. Auf sie wolltest du nicht verzichten.«
»Vergiss Lauretta. Ich gebe zu, sie verfügt über sehr viel Anziehungskraft …«
Das hätte Otmar lieber nicht aussprechen sollen, denn Irene unterbrach ihn sofort und erwiderte: »Eben. Es wird dir leichterfallen, mich aufzugeben als sie.«
»Irene! Bleib da. Was hast du vor?«
»Meine Koffer zu packen«, entgegnete sie knapp und schloss sich im Schlafzimmer ein, wo sie dann eine schlaflose Nacht verbrachte und viele Tränen vergoss.
*
Am nächsten Morgen, als Otmar das Haus verlassen hatte, um zur Sparkasse zu fahren, packte Irene dann wirklich ihre Sachen zusammen und verstaute sie in ihrem Auto.
Der Wagen war ein Geschenk von Otmar. Irene hätte ihn gern zurückgelassen. Da sie aber voraussah, dass sie ihn brauchen würde, verzichtete sie auf diese edle Geste.
Irenes Ersparnisse waren gering, deshalb musste sie sich bald eine Arbeit suchen. Sie beschloss, zuallererst nach Sophienlust zu fahren, da sie Schwester Regine noch eine Erklärung schuldig war. Insgeheim hoffte sie, dass Denise von Schoenecker anwesend und ihr vielleicht einen Rat hinsichtlich der nächsten notwendigen Schritte erteilen würde. Irene kam sich so hilflos vor wie ein kleines Kind. Niemals hatte sie damit gerechnet, dass ihr Leben eine derartige Wendung nehmen könnte.
Schwester Regine war schon zeitig in der Frühe mit den Kindern zu einem Ausflug aufgebrochen, um die letzten Ferientage der Kinder noch ausgiebig auszunutzen. Dafür war Denise in Sophienlust. Schwester Regine hatte ihr von dem gestrigen Vorfall berichtet, sodass sie über Irenes frühen Besuch nicht erstaunt war.
Irenes schlechtes Aussehen wäre auch einer weniger feinfühligen Frau als Denise von Schoenecker aufgefallen. Sie führte Irene in das Biedermeierzimmer, das Ruhe und Behaglichkeit ausstrahlte, und bat Irene, sich zu setzen. Behutsam fragte sie dann: »Was ist gestern Nachmittag geschehen? Schwester Regine hat mir erzählt, dass Anselms Vater plötzlich aufgetaucht sei. Das heißt, Anselm hat das behauptet. Ist es wahr?«
»Ja.«
Denise wartete auf eine nähere Erklärung von Irene, aber diese schwieg. So fuhr sie nach einer Weile fort: »Ich verstehe, dass Sie das hart trifft, weil Sie gehofft haben, Anselm zu sich nehmen zu dürfen. Wenn nun ein Vater da ist, wird das nicht möglich sein. Aber muss es gerade Anselm sein? Sie sind noch so jung und werden sicher bald eigene Kinder bekommen.«
»Nein«, flüsterte Irene mit heiserer Stimme, »jetzt nicht mehr.«
Denise warf ihr einen verwunderten Blick zu. Irene schien sich in einem Zustand größter Niedergeschlagenheit zu befinden. Trotzdem wollte Denise Klarheit über Anselms Vater erlangen, und da Irene außer dem Jungen die einzige war, die diese geheimnisvolle Person gesehen hatte, war sie gezwungen, Irene mit weiteren Fragen zu behelligen.
»Ich verstehe nicht, warum Anselms Vater wieder verschwunden ist, ohne sich bei uns blicken zu lassen. Dieses Verhalten finde ich mehr als eigentümlich. Wissen Sie eine Erklärung dafür? Kennen Sie seinen Namen? Wenn man Anselms Schilderung Glauben schenken darf, waren Sie den ganzen Nachmittag mit dem Vater beisammen.«
»Ja.« Irene hatte den Kopf gesenkt und kratzte mit den Fingernägeln auf dem vor ihr stehenden Tisch herum. Denise beobachtete sie mit gemischten Gefühlen, denn die Platte war frisch poliert.
Endlich beendete Irene diese nutzlose Tätigkeit, sah auf und blickte Denise voll an. »Es fällt mir schrecklich schwer, darüber zu sprechen«, begann sie, »aber ich muss es Ihnen erzählen. Alles. Von Anfang an.«
Trotz dieser Ankündigung verfiel Irene wieder in Schweigen und stellte Denises Geduld auf eine harte Probe.
»Wenn Sie mir den Namen von Anselms Vater sagen würden«, schlug Denise vorsichtig vor, »das wäre sehr wichtig.«
»Der Name. Das ist ja das Arge.«
»Wieso? Was ist daran arg?«
Irene nahm sich zusammen. Es gab jetzt kein Zurück mehr. »Anselms Vater ist mein Mann. Ich habe nicht das Geringste davon geahnt, dass er ein Kind hat. Er hat es mir verheimlicht.«
Sie erzählte nun, wie es zu dem
gestrigen Zusammentreffen gekommen war, schilderte Denise den anschließenden Streit und erwähnte auch, dass sie ihren Mann verlassen habe.
Denise verstand nun Irenes Niedergeschlagenheit. Sie sah ein, dass die junge Frau Grund dafür hatte. »Und was wollen Sie jetzt beginnen?«, fragte sie schließlich.
»Ich möchte mir eine Stelle suchen. Ich bin Lehrerin.«
»Ich bin überzeugt, dass Sie bald etwas finden werden.«
Denise überlegte rasch und gründlich. Irene schien die Trennung von ihrem Mann kaum verwinden zu können. Aber Denise war sicher, dass sie ihn immer noch liebte. Vielleicht ist noch nicht alles verloren, dachte sie. Ich muss dafür sorgen, dass Irene in der Nähe ihres Mannes bleibt.
Laut sagte Denise: »Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir haben hier in Sophienlust drei Gästezimmer. Sie könnten hierbleiben, bis Sie eine Wohnung und eine Stelle gefunden haben. Vielleicht finden Sie irgendwo in der näheren Umgebung eine freie Stelle.«
Irene war über Denises Anerbieten so erleichtert, dass sie es, ohne sich zu zieren, annahm. Sie war froh, nicht allein zu sein und über Otmars Untreue nachgrübeln zum müssen. Hier in Sophienlust hatte sie die Möglichkeit, auf andere Gedanken zu kommen. Eifrig fragte sie: »Kann ich mich irgendwie nützlich machen? Braucht eines der Kinder Nachhilfestunden?«
»Ja. Eventuell Fabian. Und Vicky. Mathematik ist nicht gerade die Stärke der beiden.«
*
Anselm war über Irenes Aufenthalt in Sophienlust hellauf begeistert. Natürlich verstand er die Zusammenhänge noch nicht und quälte Irene mit Fragen, die für sie schmerzlich waren. Zum Beispiel wollte er wissen, ob ihn sein Vati bald wieder besuchen würde und ob sie wieder zusammen im Wald spazierengehen würden.
Irene bemühte sich, ihren Kummer zu unterdrücken und sich dem Kind gegenüber nichts anmerken zu lassen. Es war ein Glück, dass sie an dem Tag, an dem Anselms Mutter überraschend in Sophienlust aufkreuzte, nicht anwesend war. Sie war in ein nicht weit entfernt gelegenes Dorf gefahren, um dort wegen einer Stelle zu verhandeln. Eine der Lehrerinnen erwartete ein Baby und würde für mindestens ein Jahr zu Hause bleiben.
So entging Irene Laurettas Auftritt.
Lauretta hatte nicht nur die Probeaufnahmen erfolgreich beendet, sondern auch schon eine Filmrolle halbwegs einstudiert. Nun war sie nach Maibach gekommen, um ihrer Mutter davon zu berichten, und sie und Anselm nach Frankreich mitzunehmen. Sie hatte ein Telegramm vorausgeschickt, aber am Flugplatz hatte sie niemand erwartet. Eine Nachbarin hatte sie dann über den plötzlichen Tod ihrer Mutter unterrichtet.
Lauretta ging in den Kosmetiksalon, wo sie von Frau Kaufmann aufgeregt begrüßt wurde: »Wissen Sie es schon? Das von Ihrer Mutter? Es ist zu schrecklich.«
»Ja, es ist wirklich schrecklich«, erwiderte Lauretta müde und sank in einen der Fauteuils im Wartezimmer. Es waren im Augenblick keine Kundinnen anwesend, sodass sie ihren Gefühlen freien Lauf lassen konnte. »Mit so etwas habe ich nicht gerechnet – besonders jetzt nicht, da ich geglaubt hatte, alles erreicht zu haben.« Um ihren schön geschnittenen Mund lag ein bitterer Zug. »Sie wäre so stolz auf mich gewesen. Sie war der einzige Mensch …« Lauretta sprach nicht weiter. Sie war nicht der Typ, der sich mit sinnlosen Klagen abgab. »Wissen Sie, wo Anselm ist?«, fragte sie nach einer kurzen Pause. »Meine Nachbarin konnte mir darüber keine Auskunft geben.«
»Oh, ich weiß, wo Anselm steckt. Es ist alles in Ordnung. Er war die ganze Zeit über gut aufgehoben.« Frau Kaufmann erzählte Lauretta nun von Sophienlust und von Denise von Schoenecker. »Eigentlich hatte ich vor, ihn öfters zu besuchen«, fügte sie etwas schuldbewusst hinzu, »aber es ist mir dauernd irgendetwas dazwischengekommen. Übrigens hat Anselm eine Freundin gefunden. Tante Irene nennt er sie. Sie war ein paarmal hier und hat sich Hautunreinheiten beseitigen lassen. Anselm dürfte für uns Reklame gemacht haben.«
Die Geschäftstüchtigkeit ihres Sohnes hätte Lauretta normalerweise aufgeheitert, aber jetzt war sie zu traurig und deprimiert. Die Existenz ihrer Mutter war für sie eine Selbstverständlichkeit gewesen. Sie konnte deren plötzlichen Tod noch immer nicht begreifen.
Lauretta erkundigte sich bei Frau Kaufmann nach dem Weg, der nach Sophienlust führte, lieh sich deren Auto aus und fuhr sofort hin.
Ihre Ankunft löste beträchtliches Aufsehen unter den Kindern aus, denn ihre Erscheinung war ziemlich auffallend. Die Mädchen musterten sie mit neidischen Blicken, bevor eines von ihnen Anselm herbeiholte.
»Anselm! Stell dir vor, deine Mutti ist gekommen.«
»Meine Mami?«
»Ja, deine Mami. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schön ist«, fügte Vicky naiv hinzu.
Lauretta war in die Halle geführt worden und wartete dort auf ihren Sohn. Anselm betrat schüchtern den großen Raum. »Mami?«, vergewisserte er sich und trat zögernd näher. »Was ist denn mit deinen Haaren geschehen? Das ist aber eine komische Farbe.«
»Davon verstehst du nichts«, erwiderte Lauretta gereizt. Sie hatte sich das Wiedersehen mit ihrem Sohn ganz anders vorgestellt. »Willst du mir keinen Kuss geben?«
»Doch.« Anselm stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste Lauretta zaghaft auf die Wange. Dabei konnte er seinen Blick nicht von ihrem Haar losreißen. Sie trug es nicht mehr im Nacken zu einem Knoten geschlungen, sondern ließ es in weichen Wellen über ihre Schultern fallen. Das Hervorstechendste aber war die Farbe: ein helles leuchtendes Rotblond.
»Deine Haare gefallen mir gar nicht«, sagte Anselm. »Kannst du nichts gegen diese hässliche Farbe tun? Kauf dir so ein Ding, eine … eine Perücke.«
»Anselm!« Lauretta war über diese Kritik entrüstet. »Meine Haare sind doch schön. Jeder hat das gesagt. Ich habe sie färben lassen, weil René meinte, rot würde besser zu meinem Image passen.«
»Kannst du dir nicht ein neues Imetsch kaufen? Muss es unbedingt gelb sein?«
»Gelb? Wieso gelb? Ach so, du meinst mein Kleid. Du bist dumm, Anselm, mit dir kann man nicht vernünftig reden.«
Anselm war beleidigt, doch Lauretta bemerkte das nicht. Sie sprach weiter: »Eigentlich bin ich gekommen, um dich und Großmutti nach Paris zu holen. Aber jetzt – ich weiß noch nicht, was ich mit dir anfangen soll. Ich werde nicht genügend Zeit haben, um mich mit dir zu beschäftigen. Nun, ich werde nachdenken, bis mir eine Lösung einfällt. Wie steht es mit dir? Möchtest du gern mit mir nach Paris fahren?«
Diese Frage konnte Anselm nicht so schnell beantworten. Er freute sich zwar, dass seine Mami gekommen war, aber dass sie ihn von hier wegholen wollte – von Tante Isi, Schwester Regine, Tante Irene und den Kindern, mit denen er so herrlich spielen konnte – nein, das freute ihn gar nicht. Nur, wie sollte er ihr das sagen, ohne sie zu kränken?
Pünktchen, die gerade eintrat, enthob ihn dieser Sorge. Zum Unterschied von Anselm maß sie Lauretta mit Blicken, die ihre volle Bewunderung ausdrückten und Lauretta wohltaten.
»Frau von Schoenecker möchte mit Ihnen sprechen. Ich führe Sie zu ihr«, verkündete Pünktchen.
Die Unterredung zwischen Denise und Lauretta verlief etwas gezwungen, obgleich Lauretta überschwängliche Dankbarkeit dafür an den Tag legte, dass Denise sich um Anselm gekümmert und ihn nach Sophienlust gebracht hatte.
Es war Denise, die sich Zurückhaltung auferlegte. Obwohl sie sich bemühte, Lauretta unvoreingenommen zu begegnen, sah sie in ihr doch den Hauptgrund für Irenes Kummer. Über Irene aber wollte sie zu Lauretta nicht sprechen. Sie ließ sich auch nicht anmerken, dass sie wusste, wer Anselms Vater war. Deshalb bot sie Lauretta nur an, Anselm weiterhin in Sophienlust zu lassen. Das allerdings in sehr eindringlichen Worten. Sie machte Anselms Mutter klar, dass es nicht günstig für den kleinen Jungen sein könne, ihn in ein fremdes Land und zu fremden Leuten zu bringen, noch dazu ohne die Gewissheit, sich ihm widmen zu können.
»Anselm würde Sie nur belasten«, sagte Denise abschließend. »Sie würden kaum Zeit für ihn haben. Hier bei uns ist er hingegen gut aufgehoben.«
*
Als Irene nach Sophienlust zurückkehrte, war Lauretta längst wieder gegangen, nachdem sie Denise versprochen hatte, sich noch zu überlegen, was mit Anselm geschehen solle.
Der Junge erzählte Irene natürlich sofort von der Rückkehr seiner Mutter. »Stell dir vor, Tante Irene«, sagte er, »Mami will mich nach Paris mitnehmen!«
»So?« Irene bemühte sich, dem Kind ihre Niedergeschlagenheit nicht zu zeigen. »Das ist ja fein. Freust du dich?«
Anselm machte ein langes Gesicht. »Nein, eigentlich freue ich mich gar nicht. Ich mag lieber bei Tante Isi und Schwester Regine bleiben. Und bei dir.« Plötzlich hellte sich seine Miene auf. »Könntest du nicht mitfahren nach Paris? Wenn du mitkommst, macht es mir bestimmt Spaß. Mami hätte Großmutti auch mitgenommen, damit sie auf mich aufpasst. Das könntest du doch auch machen.«
»Nein«, erklärte Irene mit fester Stimme. »Ich fahre nicht mit nach Paris.«
»Schade.« Anselm überlegte eine Weile, dann meinte er: »Ich werde auch hier in Sophienlust bleiben. Außer …« Er schwieg, und Irene konnte sehen, wie es hinter der kleinen Stirn arbeitete. »Außer, du heiratest meinen Vati«, platzte er plötzlich heraus. »Mach nicht so ein böses Gesicht. Magst du meinen Vati denn gar nicht? Es wäre so schön, wenn du Vati heiraten würdest. Ich hätte dann eine Mutti und einen Vati, und wir wären alle glücklich. Wenn Mami nach Paris gefahren ist, könntet ihr in unsere Wohnung einziehen«, bot er Irene an.
»Warum willst du denn nicht, dass deine Mami deinen Vati heiratet?«, fragte Irene, als sie ihre Stimme wieder wiedergefunden hatte.
»Nein, das tut Mami nicht. Sie wird nie heiraten, und schon gar nicht Vati.«
»Oh.« Irene schnappte nach Luft. »Woher weißt du das?«
»Ich habe gehört, wie Mami das einmal zu Großmutti gesagt hat.«
*
Lauretta entschloss sich unterdessen dazu, Otmar in seiner Villa aufzusuchen. Sie tat das äußerst ungern, denn erstens hatte sie sich in Tunesien von ihm im Streit getrennt, und zweitens bestand ein stillschweigendes Übereinkommen zwischen ihm und ihr, dass sie seinem Heim fernblieb. Lauretta verspürte auch nicht den geringsten Wunsch, Otmars Frau zu begegnen, aber jetzt musste sie dieses Risiko in Kauf nehmen. Sie brauchte jemanden, dem sie ihre Probleme anvertrauen konnte, und dafür kam nur Otmar infrage. Schließlich ist Anselm auch sein Kind, sagte sie sich. Er hat sich lange genug vor der Verantwortung gedrückt.
Das war jedoch nicht ganz gerecht, denn Lauretta hatte selbst darauf bestanden, dass nur sie allein über Anselm zu bestimmen habe.
Lauretta war erleichtert, als Otmar ihr auf ihr Läuten selbst öffnete, obwohl sein Gesicht keinerlei Begeisterung über den unerwarteten Besuch ausdrückte.
»Du?«, fragte er erstaunt, fügte jedoch sofort hinzu: »Komm herein.«
Lauretta zögerte. »Wenn es dir lieber ist, können wir auch woanders miteinander reden. Ich will niemand stören.«
»Du störst nicht. Ich bin allein«, versetzte er kurz und führte sie ins Haus.
Lauretta kam gleich zur Sache: »Ich muss mit dir wegen Anselm sprechen. Weißt du schon, dass meine Mutter gestorben ist?«
»Ja, es tut mir leid.«
»Es war für mich ein schrecklicher Schock, als ich zurückkam. Ich war doch vollkommen ahnungslos.«
Otmar zuckte schweigend. Nach einer kurzen Pause sagte Lauretta: »Ich hatte ursprünglich vor, Anselm und meine Mutter nach Paris zu holen, doch das ist jetzt nicht mehr möglich. Frau von Schoenecker …«
Hier unterbrach Otmar sie: »Du warst also schon bei Anselm in Sophienlust?«
»Ja, natürlich. Aber woher weißt du, dass Anselm in Sophienlust ist?«
»Ich weiß es eben«, erwiderte Otmar etwas grimmig, denn der Augenblick, da er Anselm entdeckt hatte, stand noch gut vor seinen Augen.
»Frau von Schoenecker meinte, dass es für Anselm nicht gut wäre, in ein fremdes Land zu kommen«, fuhr Lauretta fort, »und ich muss ihr zustimmen. Sie hat mir vorgeschlagen, Anselm weiterhin in Sophienlust zu lassen.«
»Und? Was habe ich damit zu tun?«
»Otmar!«, rief Lauretta zornig aus. »Anselm ist auch dein Kind. Ist er dir denn vollkommen gleichgültig? Du hast immer so getan, als ob du ihn gern hättest.«
»Ich habe nicht nur so getan, ich habe ihn wirklich gern. Er bedeutet mir … Ach, lassen wir das. Warum bist du gekommen? Was willst du von mir?«
»Wenn ich in Frankreich bin, kann ich mich nicht um Anselm kümmern …«
»Die Probeaufnahmen haben also geklappt?«, fragte Otmar.
»Ja. Ich habe auch schon eine Filmrolle.«
»Gratuliere.«
»Reden wir nicht davon. Dir ist das doch gleichgültig. Ich wollte dich bitten, dich um Anselm zu kümmern und ihn ab und zu zu besuchen.« Lauretta zögerte, sie schien nach den rechten Worten zu suchen. »Natürlich müsstest du dann zugeben, dass du sein Vater bist«, sagte sie endlich. »Würde dir das schwerfallen? Ich meine, vermutlich würde es dann auch deine Frau erfahren.«
»Das spielt keine Rolle mehr«, entgegnete Otmar.
»Nun, im Grunde genommen ist es ja auch nicht so schlimm. Du warst ja noch nicht verheiratet, als Anselm zur Welt kam. Sag einmal, ist dir noch nicht aufgefallen, dass der Teppich voll Asche ist?«, unterbrach sie sich.
Otmar starrte sie überrascht an. »Hast du keine anderen Sorgen als meinen Teppich?«
»Oh, doch. Ich wundere mich nur. Überhaupt …« Lauretta sah sich kritisch in dem Wohnzimmer um, das Irene früher so liebevoll gepflegt hatte und das jetzt unaufgeräumt und vernachlässigt wirkte. »Ich will deiner Frau ja nicht nahetreten …«
»Dann lass es bleiben. Übrigens kannst du ruhig die Wahrheit erfahren: Irene hat mich verlassen. Und die Putzfrau habe ich hinausgeworfen«, fügte er trotzig hinzu. »Sie hat mich verrückt gemacht mit ihren ständigen Fragen, wann die gnädige Frau wiederkommt.«
»Deine Frau hat dich verlassen?«
»Ja.«
Lauretta musste die Neuigkeit erst verdauen. Trotzdem sah Otmar ihr an, dass sie keinen Kummer dabei empfand.
»Du scheinst dich ja sehr darüber zu freuen.«
»Ja. Ein wenig Schadenfreude musst du mir zugestehen. Du hast jahrelang geglaubt, dass du zwischen Ehefrau und Freundin hin und her pendeln könntest, und jetzt sitzt du gewissermaßen zwischen zwei Stühlen. Oder hast du vielleicht schon eine neue Freundin gefunden?«
»Hör auf! Das ist kein Thema, über das man Witze macht.«
»Nein.« Lauretta wurde sofort wieder ernst. »Wie ist es dazu gekommen?«, fragte sie.
Otmar schilderte ihr den Vorfall in Sophienlust in allen Einzelheiten. Lauretta hörte aufmerksam zu und wurde immer nachdenklicher. Otmar beendete seine Erzählung mit der Schilderung seines letzten Streites mit Irene.
»Dann ist es also teilweise meine Schuld, dass deine Frau dich verlassen hat«, stellte Lauretta fest.
Otmar widersprach ihr nicht.
»Wir hätten schon viel früher Schluss machen sollen«, fuhr Lauretta fort. »Ich selbst habe dazu auch die ehrliche Absicht gehabt. Aber dann kamst du, um Anselm zu besuchen, und so …«
»Ich bin nicht nur wegen Anselm gekommen. Ich konnte dich nicht vergessen, Lauretta. Du warst meine erste Liebe.«
»Ich hätte dir nicht nachgeben dürfen.« Lauretta sprach mehr zu sich selbst. »Nachdem du geheiratet hattest, hätte für mich unsere Liebe zu Ende sein müssen.«
»Ich hatte dich so sehr gebeten, meine Frau zu werden, noch bevor Anselm geboren wurde.«
»Ja, ja, dieses Thema haben wir oft und oft durchgesprochen. Ich bereue meine Handlungsweise, aber jetzt ist es zu spät. Ich kann nichts mehr ungeschehen machen.«
»Nein, du nicht. Aber vielleicht sollte ich …« Lauretta kaute an ihren makellos lackierten Fingernägeln. Es war eine Angewohnheit, von der sie überzeugt gewesen war, dass sie sie seit Jahren abgelegt hatte. Als sie merkte, was sie tat, nahm sie die Finger schnell aus dem Mund.
»Deine Frau hat dich also verlassen?«, fragte sie nochmals. »Endgültig?«
»Ich fürchte, ja.«
»Und ich bin daran mitschuldig«, murmelte Lauretta. »Irgendwie ist es meine Pflicht, nachdem ich jahrelang deine Geliebte war und wir ein Kind haben …«
»Wovon redest du? Was ist deine Pflicht?«
»Nun, wenn sich deine Frau meinetwegen von dir scheiden lässt, muss ich dich wohl heiraten.«
»Bietest du dich als Ersatz an?«
»Ich biete mich gar nicht an. Mit dir verheiratet zu sein, hat mich nie gereizt«, entgegnete Lauretta mit einiger Schärfe. »Ich will nur das wiedergutmachen, was ich verschuldet habe. Es geht mir dabei um Anselm. Das Kind kann nicht für immer in Sophienlust bleiben. Es hat schließlich einen Vater und eine Mutter.«
»Jetzt auf einmal kümmerst du dich um deinen Sohn?«
»Ich habe ihn nie vernachlässigt«, verteidigte sich Lauretta. »Ich habe gewusst, dass er bei meiner Mutter gut aufgehoben war. Er hat nie etwas vermisst. Ich kann doch nichts dafür, dass alles ganz anders gekommen ist, als ich mir vorgestellt hatte.« Ihre Augen füllten sich mit Tränen, die sie eilig hinunterschluckte. Sie wollte sich vor Otmar keine Blöße geben.
»Und was geschieht mit deinem Filmvertrag?«
»Ich weiß, dass ich darauf verzichten muss«, entgegnete Lauretta müde. »Es fällt mir sehr schwer, denn es ist mir nicht in den Schoß gefallen. Ich habe jahrelang auf diese Chance gehofft und gewartet. Jetzt haben sich meine Hoffnungen endlich erfüllt, und es ist alles umsonst.«
»Es wäre also für dich ein Opfer, wenn du auf die Filmrolle verzichten müsstest?«
»Natürlich. Wie kannst du nur so fragen? Ich weiß jetzt, dass ich begabt und imstande bin, eine gute Schauspielerin zu werden, egal, wie du darüber denkst. Du hast immer nur darüber gespottet.«
»Ich spotte nicht mehr«, erwiderte er ernst. »Du würdest mich nur Anselm zuliebe heiraten, damit das Kind ein Heim bekommt?«
»Ja«, sagte Lauretta ehrlich, »und vielleicht auch, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Würde ich jetzt nach Paris fahren, würde ich mir wohl dauernd den Vorwurf machen, dass ich Anselm eine schlechte Mutter bin und dich im Stich gelassen habe.«
»Du hast bisher nur über eine eventuelle Heirat gesprochen, aber von Liebe hast du nichts gesagt.«
»Liebe? Was erwartest du von mir? Ja, ich habe dich geliebt, damals, als ich noch jung und unbekümmert war. Vielleicht auch noch später. Aber jetzt? Nein. Du hast dich verändert seit damals, und ich auch. Deine Ansichten sind so anders als die meinen. Vielleicht verhindert auch mein Ehrgeiz jedes tiefere Gefühl für dich.«
»Und auf einer solchen Grundlage willst du eine Ehe aufbauen?«, fragte Otmar.
Lauretta seufzte. »Was soll ich denn tun? Verstehst du mich nicht? Du kannst von mir nicht verlangen, dass ich dich liebe. So etwas lässt sich nicht erzwingen.« Sie sah ihn an. »Und wie steht es um dich? Kennst du überhaupt deine eigenen Gefühle? Hast du ehrlich darüber nachgedacht?«
Er schwieg.
»Ich bin überzeugt, dass auch du mich längst nicht mehr liebst. Sonst hättest du auf meinen Vorschlag, zu heiraten, ganz anders reagiert. Du wärst freudig darauf eingegangen, ohne nach meinen Motiven zu forschen.«
»Ja, du hast recht. Aber ich wollte dich nicht abweisen. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, wenn ich aufrichtig sage, dass es mir weit lieber wäre, wenn du nach Paris fahren und dort einen Film drehen würdest.«
»Nein, ich nehme dir das nicht übel.« Lauretta lächelte etwas mühsam. »Im Gegenteil, ich bin erleichtert. Nur – was geschieht mit Anselm?«
»Ich werde nach ihm sehen, während du fort bist«, versprach Otmar.
»Schade, dass deine Frau dir davongelaufen ist«, bemerkte Lauretta. »Aus deiner Erzählung ging hervor, dass Anselm sich an sie angeschlossen hat. Das ist ein merkwürdiger Zufall …«
»Bitte, reden wir nicht von Irene«, unterbrach Otmar sie.
»Geht es dir so nahe?«
»Ja.«
»Dann liebst du Irene?«
»Ja, ich liebe sie. Wie sehr, weiß ich erst, seit sie fort ist.«
»Warum versuchst du nicht, sie zurückzuholen?«
»Ich habe keine Ahnung, wohin sie gefahren ist.«
»Das herauszubekommen, kann doch nicht so schwierig sein. Leben ihre Eltern noch?«
»Ja, in München.«
»Dann fahre nach München. Ich würde mich in einer solchen Situation zu meinen Eltern flüchten. Wahrscheinlich hat das auch deine Frau getan.«
»Glaubst du?«
»Natürlich. Sei nicht so schwerfällig. Soll ich dich vielleicht an die Hand nehmen und nach München führen?«
»Nein. Aber warum bist du plötzlich so eifrig darauf bedacht, dass ich mich mit meiner Frau versöhne?«
»Weil das mein schlechtes Gewissen beruhigen würde. Außerdem – wenn sie Anselm wirklich so gern hat, wie du mir erzählt hast, vielleicht würde sie sich um den Jungen kümmern?«
»Du meinst also, ich soll nach München fahren und versuchen, Irene zurückzuholen?«
»Wenn du Wert auf eine Versöhnung mit deiner Frau legst, wird dir nichts anderes übrigbleiben. Von selbst wird sie nicht zurückkommen, nach allem, was du ihr angetan hast.«
»Das sagst du? Ergreifst du jetzt die Partei meiner Frau?« Otmar war ziemlich fassungslos.
Lauretta zuckte nur die Schultern und ging. Otmar musste mit seinen Problemen allein fertig werden.
Gleich am nächsten Tag nahm er sich Urlaub und fuhr nach München, um seine Schwiegereltern aufzusuchen. Die beiden begrüßten ihn freundlich, zeigten aber deutlich ihr Erstaunen über seinen unangekündigten Besuch. Dann fragten sie ihn, warum er denn Irene nicht mitgebracht habe, sie hätten sich so darüber gefreut, ihre Tochter wieder einmal zu sehen.
So erwies sich die Fahrt nach München als Fehlschlag.
*
Da Lauretta bestrebt war, in der kurzen Zeit, die sie noch in Maibach sein würde, Anselm möglichst oft zu besuchen, war ein Zusammentreffen zwischen ihr und Irene unvermeidlich. Irene bemühte sich zwar, Anselms Mutter auszuweichen, aber sie hatte nicht mit Anselms Hartnäckigkeit gerechnet.
Irene saß gerade mit Vicky im Aufenthaltsraum und versuchte, dem Kind den Unterschied zwischen einer Schnittmenge und einer Vereinigungsmenge klarzumachen. Da Vicky insgeheim darauf brannte, hinauszulaufen, um mit den anderen Kindern zu spielen, war diese Aufgabe nicht einfach. Irene zeichnete unermüdlich Kreise, Schnittlinien, bunte Dreiecke und Vierecke, als sie von dem hereinstürmenden Anselm unterbrochen wurde.
»Tante Irene! Mami ist gekommen. Heute bist du endlich einmal auch da und kannst sie kennenlernen. Komm mit mir.«
»Nein, Anselm. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mit Vicky …«
Doch Vicky hatte längst die günstige Gelegenheit genutzt und die Flucht ergriffen. So blieb Irene nichts anderes übrig, als Anselm in die große Halle zu begleiten, wo Lauretta sie erwartete.
Nun standen die beiden Frauen einander gegenüber.
Irene war betroffen über Laurettas Schönheit. Sie dachte, dass eine Konkurrenz mit Frau Nissel von vornherein zum Scheitern verurteilt sei.
»Geh hinaus spielen, Anselm«, befahl Lauretta. »Ich möchte in Ruhe mit Tante Irene sprechen. Ich habe gerade gesehen, dass ein kleines Mädchen hier vorbeigelaufen ist. Lauf ihm nach.«
Anselm fügte sich widerspruchslos diesem Befehl.
Irene sah ein, dass sie um ein Gespräch mit Lauretta nicht herumkommen würde. Sie schlug ihr daher vor, mit ihr in den Aufenthaltsraum zu gehen, wo sie ungestört sein würden, da sich alle Kinder draußen im Freien befänden.
»Ich weiß, dass Sie mir gegenüber keine freundschaftlichen Gefühle hegen«, begann Lauretta, »und das ist nur allzu verständlich. Trotzdem muss ich mit Ihnen sprechen. Natürlich gibt es für mein Verhalten keine Entschuldigung. Es wäre zu viel verlangt, wenn ich Sie bitten würde, mir zu verzeihen.«
Irene hörte mit wachsendem Staunen zu.
Lauretta sprach weiter: »Obwohl ich wusste, dass Otmar verheiratet ist, habe ich mir über seine Frau nie den Kopf zerbrochen. Das heißt, ich war ziemlich verärgert, als er mir erzählte, dass er geheiratet habe, aber ich habe es hingenommen, und es ist alles beim alten geblieben. Über Ihre Gefühle habe ich nicht nachgedacht. Außerdem habe ich angenommen, dass die Sache zwischen Otmar und mir immer geheim bleiben würde.«
»Warum erzählen Sie mir das alles?«, fragte Irene.
»Weil ich von Otmar gehört habe, dass Sie ihn verlassen haben, und weil mir das leid tut.«
»Wieso? Das müsste Sie doch freuen. Otmar ist jetzt frei.«
»Nein, das freut mich ganz und gar nicht. Einen Augenblick lang habe ich Schadenfreude empfunden, aber dann ist mir klargeworden, dass er sich in einem bedauernswerten Zustand befindet.«
»So?«, fragte Irene interessiert.
»Die Trennung von Ihnen hat ihn völlig niedergeschmettert, und deshalb …«
»Das glaube ich nicht. Das ist Unsinn«, unterbrach Irene sie mit einiger Schärfe.
»Es ist die Wahrheit«, beharrte Lauretta. »Mir ist es nicht leichtgefallen, hierherzukommen und mit Ihnen zu sprechen. Sie hassen und verachten mich, und das mit Recht. Ich hatte jedoch gehofft, dass ich einiges wiedergutmachen könnte, wenn ich Ihnen sage, dass Otmar Sie liebt und sich mit Ihnen versöhnen möchte.«
»Das sagen Sie mir?«, fragte Irene verwundert. »Ich verstehe nicht, wieso Sie daran interessiert sind, dass ich mich mit Otmar versöhne. Sie müssten sich doch freuen, dass ich mich von Otmar scheiden lassen will und er dann frei ist.«
»Ich erkläre Ihnen noch einmal, dass mich das nicht freut. Es klingt unmoralisch, aber ich hatte nie den Wunsch, Otmar zu heiraten.«
»Ich dachte … Lieben Sie ihn denn nicht?«
»Nein. Früher einmal habe ich ihn geliebt. Aber selbst damals war mir klar, dass wir niemals zusammenpassen würden. Otmar, mit seinen spießbürgerlichen, kleinlichen Anwandlungen … Verzeihung, ich wollte Sie nicht kränken.«
»Das kränkt mich nicht, obwohl ich fürchte, dass ich Otmars Ansichten in gewisser Weise teile. Eigentlich passt es gar nicht zu ihm, dass er eine Freundin wie Sie hatte«, meinte Irene versonnen.
»Eben«, stimmte Lauretta eifrig zu. »Es wäre mit mir und Otmar nie gutgegangen.«
»Warum haben Sie ihn dann weiterhin getroffen und sind sogar mit ihm auf Urlaub gefahren?«
»Ich gebe zu, dass das nicht richtig war. Irgendwie habe ich nie zur Kenntnis genommen, dass Otmar verheiratet ist und dass ich Ihnen damit weh tun könnte. Es war vor allem Anselm, der uns immer wieder zusammengeführt hat. Doch ich versichere Ihnen, jetzt ist zwischen Otmar und mir alles zu Ende. Ich werde in ein paar Tagen nach Frankreich fahren, um in Paris eine Filmrolle zu übernehmen.«
»Oh, Sie fahren wirklich nach Paris? Für lange?«
»Ja. Ich hoffe es zumindest. Wenn der Film gut wird, und davon bin ich überzeugt, steht meiner Karriere nichts mehr im Wege.«
Irene beneidete Lauretta um ihr Selbstbewusstsein. Aber sie gestand sich ein, dass Lauretta aufrichtig bemüht war, ihr zu helfen. Sie selbst hätte es nie über sich gebracht, hier zu erscheinen und eine Unterredung mit der betrogenen Ehefrau zu suchen.
Da durchzuckte sie ein plötzlicher Schreck. Anselm! Er hatte ihr doch anvertraut, dass seine Mutter ihn nach Paris mitnehmen wolle. Beklommen fragte sie Lauretta: »Und was geschieht mit Anselm? Haben Sie vor, ihn mitzunehmen?«
»Ursprünglich wollte ich es tun. Aber Frau von Schoenecker hat mir ganz entschieden davon abgeraten. Und ich sehe ein, dass ihre Argumente richtig sind. Ich weiß, dass ich nicht das Idealbild einer Mutter darstelle, doch ich habe Anselm wirklich gern und will nur das Beste für ihn. Deshalb werde ich ihn hierlassen.«
Man merkte Irene deutlich die Erleichterung an, die sie bei diesen Worten empfand. Das gab Lauretta Mut, die Bitte zu äußern, die sie auf dem Herzen hatte: »Eigentlich wollte ich hauptsächlich wegen Anselm mit Ihnen reden. Er hat mir mit einer solchen Begeisterung von Ihnen erzählt, dass ich davon überzeugt bin, dass er Sie sehr liebgewonnen hat. Und Sie haben ihn doch auch gern, nicht wahr?«
»O ja.«
»Ich wäre so erleichtert, wenn ich die Gewissheit hätte, dass Sie sich ab und zu um ihn kümmern würden und ihn in Sophienlust besuchen würden.«
»Das will ich gern tun.«
»Noch schöner wäre es allerdings, wenn Sie sich mit Otmar versöhnen würden. Dann könnte Anselm bei Ihnen wohnen und hätte eine richtige Familie.«
Irene seufzte. Sie hatte Mühe, die Tränen, die ihr in die Augen stiegen, zurückzuhalten. Lauretta sprach genau das aus, was sie sich so sehr gewünscht hatte. Aber jetzt war es zu spät. Wenn sie geahnt hätte, dass alles so kommen würde, wäre sie bei Otmar geblieben. Doch woher hätte sie wissen sollen, dass Lauretta keinerlei Absichten auf Otmar hatte? Sie hatte angenommen, dass er und Lauretta sofort heiraten würden.
Diese Gedanken behielt Irene jedoch für sich. Laut sagte sie nur: »Es ist zu spät. Ich kann jetzt unmöglich zu Otmar zurück.«
»Nein, natürlich nicht. Das wäre grundfalsch«, bestätigte Lauretta. »Er muss zu Ihnen kommen und Sie um Verzeihung bitten. Es wird ihm nicht schaden, wenn er noch eine Zeitlang im ungewissen bleibt.«
Lauretta verabschiedete sich von Irene in gehobener Stimmung. Sie war erleichtert, weil sie eine Möglichkeit sah, das, was sie verschuldet hatte, wiedergutzumachen. Es war für sie nicht schwer gewesen zu begreifen, dass Irene gegen eine Versöhnung mit Otmar nichts einzuwenden hatte. Sie brauchte also nichts weiter zu tun, als Otmar mitzuteilen, wo sich Irene aufhielt. Allerdings wollte sie damit bis zu ihrer Abreise warten, um Otmar Zeit zu lassen, gründlich in sich zu gehen. Je mehr er Irene vermissen würde, desto glücklicher würde er sein, wenn er sie fand.
Einstweilen weihte Lauretta Denise von Schoenecker in ihren Plan ein. Sie war nicht sonderlich überrascht, als sie erfuhr, dass Denise über Anselms Vater bereits Bescheid wusste.
Denise freute sich, dass ihr Wunsch, Irene wieder glücklich zu sehen, in greifbare Nähe gerückt war. Auch Anselm würde davon provitieren. Über Irene war Denise mit Lauretta einer Meinung: Sie würde sofort bereit sein, zu ihrem Mann zurückzukehren. Nur was Otmar betraf, peinigten Denise gewisse Zweifel. War er es überhaupt wert, dass Irene ihm verzieh? Und legte er wirklich Wert darauf?
*
So kam der Tag von Laurettas Abreise heran. Lauretta hatte sich von Anselm verabschiedet und ihm versprochen, viele bunte Ansichtskarten zu schicken. Anselm fiel der Abschied von seiner Mutter nicht allzu schwer. Er sah darin nichts Besonderes, denn er war gewohnt, dass sie verreiste.
Ein wenig stolz war er schon auf seine schöne Mami, die von den anderen Kindern in Sophienlust so bewundert worden war. Trotzdem war er lieber mit Tante Irene beisammen, obwohl diese manchmal traurig war. Aber er konnte mir ihr spielen und herumtollen. Es machte ihr nichts aus, wenn dabei ihr Kleid schmutzig wurde.
Irene war noch immer auf Arbeitssuche. Sie hatte zwar schon etwas in Aussicht, aber die Lehrerin, die das Baby erwartete, würde erst in ein paar Wochen daheim bleiben. Irene hätte lieber sofort mit einer ernsthaften Arbeit begonnen. Gewiss, es war angenehm, in Sophienlust zu sein, den Kindern ein wenig Nachhilfeunterricht zu erteilen und mit Ihnen zu spielen. Aber auf die Dauer lenkte sie das nicht von ihren Sorgen ab. Sie wusste auch noch immer nicht, sollte sie nun die Scheidung einreichen oder nicht. Lauretta hatte gemeint, es würde nichts schaden, Otmar noch eine Weile im ungewissen zu lassen, aber Irene fehlte Laurettas kühle Zielstrebigkeit. Sie brachte es nicht fertig, leidenschaftslos darüber zu entscheiden, welcher Weg für sie der günstigste wäre. Sie quälte sich mit Zweifeln ab. Vermisste Otmar sie überhaupt? Sollte sie hierbleiben oder zu ihm zurückkehren? Nein, das ließ ihr Stolz doch nicht zu.
*
Lauretta hatte inzwischen so gehandelt, wie sie es sich vorgenommen hatte. Kurz vor ihrer Abreise hatte sie Otmar mitgeteilt, dass sich Irene in Sopienlust aufhalte.
Otmar war Lauretta für diese Aufklärung dankbar, aber er teilte nicht Laurettas Optimismus. War es denn sicher, dass Irene ihm verzeihen würde?
Bei Laurettas Abreise hatte er nichts anderes als Erleichterung gefühlt. Dieses Kapitel seines Lebens war nun abgeschlossen. Doch würde Irene ihm das glauben? Dabei fehlte sie ihm so sehr, dass er es kaum noch ertragen konnte. Aber auch nach Anselm hatte er Sehnsucht. Vor allem die Abende, die er einsam in seiner Villa verbrachte, trieben ihn beinahe zum Wahnsinn.
In der Nähe der Sparkasse lag ein Spielwarengeschäft, an dem Otmar oft vorüberkam. Einmal fiel ihm im Schaufenster ein großer bunter Ball auf. Er erinnerte ihn an das kleine blonde Mädchen in Sophienlust, das so traurig gewesen war, weil der Bernhardiner seinen Ball zerbissen hatte. Ob es wohl schon einen neuen bekommen hatte? Kurz entschlossen betrat Otmar das Geschäft und kaufte den Ball, den er anschließend in die Sparkasse mitnahm.
Nach Dienstschluss fuhr Otmar nach Sophienlust. Er parkte seinen Wagen genau an dem gleichen Platz, an dem er ihn das letzte Mal abgestellt hatte. Doch diesmal zögerte er nicht bei dem Tor, das in den Park führte, sondern schritt rasch hindurch.
Otmar hatte Glück. Anselm spielte mit einigen anderen Kindern im Freien und lief seinem Vater entgegen.
»Das ist fein, Vati, dass du kommst«, rief der Junge. »Oh, ist das ein schöner Ball. Gehört der mir?«
»Nein. Ich habe ihn für das kleine Mädchen mit den hellblonden Schwänzchen mitgebracht. Wo ist es denn?«
»Du meinst Heidi. Ich werde sie suchen.«
»Nein, warte, gib du ihr den Ball. Ich bin eigentlich gekommen, weil ich mit jemandem sprechen will.«
Ein größeres Mädchen löste sich aus der Gruppe. »Wollen Sie mit Frau Rennert, der Heimleiterin, sprechen?«, fragte es.
Otmar nickte.
»Kommen Sie, ich führe Sie zu ihrem Zimmer«, versprach das Kind und ging voraus durch die große Halle. Dann trat es zu einer Tür, klopfte und öffnete die Tür.
»Tante Ma, Anselms Vater ist gekommen, um mit dir zu sprechen«, sagte das Mädchen und ließ Otmar eintreten.
In dem Raum befanden sich zwei Frauen. Die ältere der beiden blickte Otmar etwas neugierig entgegen, aber es war die jüngere, die das Wort ergriff.
»Sie sind also Herr Wieninger«, sagte Denise. »Ich muss gestehen, ich habe Sie schon viel früher hier erwartet. Ich bin Frau von Schoenecker«, fügte sie hinzu.
Otmar fühlte sich äußerst unbehaglich und wünschte sich, weit weg zu sein. Daran änderte sich auch nichts, als Denise ihn bat, Platz zu nehmen.
»Ihr Sohn ist bereits ziemlich lange bei uns«, fuhr Denise fort. »Es wundert mich daher, dass Sie uns erst heute aufsuchen.«
»Ich wusste nicht, dass Anselm hier war«, verteidigte sich Otmar.
»So?« Denise hatte nicht vor, Otmar die Situation zu erleichtern. Es blieb ihm daher nicht erspart, von Lauretta und seinem Verhältnis zu ihr zu berichten. Frau Rennert und Denise hörten ihm schweigend zu.
»Ich habe gehört, dass sich auch meine Frau hier aufhält«, sagte Otmar schließlich. »Ich würde sie gern sehen.«
»Ja, Ihre Frau ist hier«, entgegnete Denise. »Ich weiß allerdings nicht, ob sie über Ihren Besuch erfreut sein wird.« Als sie merkte, dass es keinen Sinn hatte, Otmar noch länger hinzuhalten, fügte sie hinzu: »Ihre Frau ist in der Bibliothek. Zweite Tür links.«
Damit war Otmar entlassen. In seiner Aufregung öffnete er zuerst die Tür zum Speisesaal. Da sich darin aber weder Bücher noch Irene befanden, erkannte er rasch seinen Irrtum und suchte weiter.
Bei der nächsten Tür hatte er mehr Glück. Irene blätterte gerade in einem dicken Lexikonband, den sie bei Otmars Eintritt fallen ließ. »Otmar!«, rief sie, wobei er nicht unterscheiden konnte, ob in ihrer Stimme Freude oder Schrecken lag. »Was willst du hier? Bist du gekommen, um Anselm zu besuchen?«
»Ja – nein«, verbesserte er sich. »Ich bin deinetwegen gekommen. Um dich zu bitten, zu mir zurückzukehren. Ich weiß nicht, wie ich dich davon überzeugen kann, aber glaube mir, ich werde mich ändern.«
Irenes Schweigen verwirrte ihn. Warum gab sie ihm keine Antwort? War alles umsonst?
»Du hast eben Anselm erwähnt«, sprach er weiter. »Wenn du schon von mir nichts wissen willst, möchtest du nicht ihm zuliebe zurückkommen? Seine Mutter ist damit einverstanden, dass er bei uns lebt.«
»Ja, ich weiß. Sie hat es mir selbst gesagt.«
»Dann hast du mit Lauretta gesprochen?«
»Ja.«
»Hat sie dir nicht auch erzählt, dass zwischen uns alles zu Ende ist? Es war nie so richtig … Ich meine, ich habe sie nie so geliebt, wie ich dich liebe. Lauretta und ich haben nie zusammengepasst. Ich hätte mich nie mit ihr einlassen dürfen. Es ist nichts Gutes dabei herausgekommen.«
Irene lächelte, obwohl ihr die Tränen in die Augen stiegen. »Du vergisst Anselm«, erinnerte sie ihn.
»Du hast den Jungen gern, nicht wahr? Du könntest ihm die Mutter ersetzen, und wenn wir wieder beisammen wären, würdest du mit der Zeit einsehen, dass ich meine guten Vorsätze wirklich einhalte. Willst du es nicht versuchen? Ich will dir nie wieder Anlass zu Kummer geben«, erklärte er.
Irene war zu keiner Antwort fähig. Sie nickte nur.
Otmar schloss sie in seine Arme. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie schrecklich die letzten Wochen für mich waren«, sagte er dabei.
»Doch, ich kann es mir vorstellen«, erwiderte Irene leise. »Sie waren auch für mich nicht angenehm.«
»Du hast mich also doch noch ein bisschen lieb?«
»Ja, ein bisschen.«
»Wein’ doch nicht. Jetzt wird alles wieder gut. Wir wollen ganz neu anfangen. In Zukunft steht nichts mehr zwischen uns.«
Irene hatte die Tränen nicht länger zurückhalten können. Die Anspannung war einfach zu groß für sie geworden.
Otmar streichelte und tröstete sie. »Komm, wir wollen Anselm suchen. Hoffentlich freut er sich, wenn er erfährt, dass er mit uns kommen soll.«
»Leicht wird ihm der Abschied von Sophienlust und den Kindern nicht fallen«, meinte Irene.
»Ja, doch jetzt hat er Eltern, die ihn gern haben und für ihn sorgen. Meinst du nicht, dass er sich daran gewöhnen wird?«, fragte Otmar ein wenig besorgt.«
»O ja«, beruhigte Irene ihn.
»Und wo ist Billie? Er darf nicht fehlen. Ich hoffe, er nimmt sich an seinem Frauchen ein Beispiel und verzeiht mir ebenfalls.
»Wir werden Billie gleich holen. Es ist nicht weit.«
Gemeinsam mit Anselm machten sie sich auf den Weg nach Bachenau. Anselm war gar nicht so sehr überrascht, als er erfuhr, dass sein Vati und Tante Irene ihn zu sich nehmen wollten. Es war doch sein Wunsch gewesen, dass Vati und Tante Irene heiraten sollten, und auf geheimnisvolle Weise schien dieser Wunsch in Erfüllung gegangen zu sein.
Während sie durch den Wald gingen, erzählte Anselm von seinen Spielen und Abenteuern in Sophienlust. Sowohl er als auch Irene sprachen dabei über Frau von Schoenecker mit einer geradezu schwärmerischen Verehrung, sodass sich Otmar bewogen fühlte, Einspruch zu erheben: »Mir gegenüber war sie nicht sehr freundlich.«
»Ach!« Mehr sagte Irene nicht. Sie beschloss aber bei sich, Otmar im Wald warten zu lassen, während sie Billie abholte. Sie hatte die Absicht, ihm eine Begegnung mit Andrea von Lehn zu ersparen, denn sie fürchtete, dass diese noch weit unfreundlicher zu Otmar sein würde als Frau von Schoenecker. Sie würde ihm rückhaltslos ihre Meinung kundtun, falls man ihr Gelegenheit dazu bieten würde.
Wie recht sie mit diesen Befürchtungen hatte, erfuhr Irene nicht. Als Denise am nächsten Tag Andrea erzählte, dass sich Irene und Otmar versöhnt hatten, kritisierte Andrea: »Ihr habt ihn viel zu leicht davonkommen lassen. Ich hätte es ihm schwerer gemacht und ihn noch eine Weile zappeln lassen. Überhaupt – schade, dass ich ihn nicht kennengelernt habe. Von mir hätte er einiges zu hören bekommen.«
Denise lächelte und meinte: »Das kann ich mir vorstellen. Aber ich denke, dass Herr Wieninger all das, was du ihm gern gesagt hättest, ohnedies weiß.«