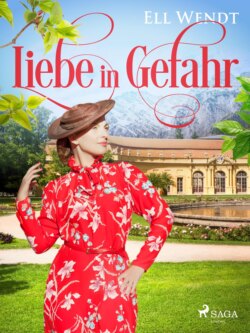Читать книгу Liebe in Gefahr - Ell Wendt - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.
ОглавлениеSibylle räumte auf. Sie breitete die Decke über den Diwan und wedelte mit dem Staubtuch spielerisch über die Gegenstände auf dem Toilettetisch hin. Die Tür zum Vorflur stand offen und gewährte ihr einen Ausblick auf die beträchtliche Rückseite ihrer Zugeherin, Frau Genoveva Natterer. Frau Natterer — Alexander hatte sie die Natter im Komparativ getauft — kniete am Boden, eifrig bestrebt, die Wasserfluten wieder aufzuwischen, die sie reinigungshalber kurz zuvor aus einem Eimer in den Flur ergossen hatte. Sie war, rein äußerlich betrachtet, eine Frau von Format. Außerdem besaß sie neben den Vorzügen des Fleißes und der Ehrlichkeit einen starken Sinn für das Quadratische. Nachdem sie aufgeräumt hatte, standen alle Dinge viereckig zueinander. Vergebens hatte Sibylle sich bemüht, Frau Natterers Auge für die zwanglose Anordnung der Gegenstände in ihrer Wohnung zu schärfen, die Natter im Komparativ beharrte eisern auf einer Weltanschauung, in der Quadrate gleichbedeutend mit Ordnung waren.
Aus dem Atelier kam Alexanders Stimme: „Eins, zwei und drei! Rhythmus, wenn ich bitten darf! Und Fis! Herrgott, Mensch, spielen Sie doch endlich Fis! Vorzeichen sind kein Buchschmuck!“
Sibylle lächelte in sich hinein.
Armer Herr Dimpflinger! Seine Begabung stand im umgekehrten Verhältnis zu der glühenden Begeisterung, die er dem Klavierspiel entgegenbrachte. Er mühte sich buchstäblich im Schweiße seines Angesichts, er rang mit dem Genius, der sich ihm hartnäckig versagte. Wenn er zur Stunde kam, die gelbe Notenmappe unter dem Arm, ein erwartungsvolles Lächeln um die Lippen, war es ihm anzusehen, daß er geübt und sich redlich geplagt hatte. Aber waren es Hemmungen, die ihn befielen in dem Augenblick, da es galt, sein Können zu beweisen, war es seine unglückliche Liebe zur Kunst? Sobald er am Flügel saß, schien er von allen guten Geistern verlassen.
Nach den Stunden mit Herrn Dimpflinger lief Alexander händeringend im Atelier umher und rief, es sei hoffnungslos, ganz und gar hoffnungslos, er habe als anständiger Mensch die Pflicht, von jeder weiteren musikalischen Betätigung abzuraten. Aber Sibylle widersprach. Man dürfe keinen Menschen seines Steckenpferdes berauben; es sei sehr wahrscheinlich, daß die Stunden, die Herr Dimpflinger am Klavier verbringe, zu den glücklichsten seines Lebens zählten.
„Ausgerechnet Beethoven will er spielen, der Unglücksmensch“, berichtete Alexander, „die Appassionata! Hat man so etwas schon gehört! Ich schwöre dir: eher bringe ich es zum Trapezakrobaten, als Dimpflinger zur Appassionata!“
Sibylle mußte daran denken, während sie Herrn Dimpflinger an einer Haydn-Sonate herumstottern hörte. Der Montag war ein schwarzer Tag für Alexander. Am Nachmittag kam der 12jährige Gustl Felgentreff. Justizrat Felgentreffs hatten die unter der Birkschen liegende Wohnung im dritten Stock inne. Gustl, ihr einziges Kind, das sich obendrein erst nach fünfzehnjähriger Ehe eingestellt hatte, war ein Lausbub von hohen Graden. Seine Eltern jedoch hielten ihn für ein Wunderkind, und es war Sibylle zu Ohren gekommen, daß Frau Felgentreff den übrigen Hausbewohnern gegenüber Alexander für die mangelnden Fortschritte ihres Sohnes verantwortlich machte.
Den Beschluß bildete an diesem Tage Fräulein Glut, Mimi Glut. Ohne eigene Ambitionen in bezug auf die Kunst des Klavierspiels, gehorchte sie dem Gebot ihrer Eltern, die der altmodischen Ansicht huldigten, eine gewisse Fertigkeit auf dem Klavier lasse ein junges Mädchen begehrenswert erscheinen. Dabei gab sich Mimi Glut durchaus keinem Irrtum hin, wenn sie sich auch ohne dies begehrenswert fand. Schwarzlockig, mit Mandelaugen und dem törichten Lächeln eines Mannequins hatte sie alle Aussicht auf Erfolg beim männlichen Geschlecht.
Sibylle war fertig. Sie beschloß, auszugehen und bei dem Geschäft, für das sie arbeitete, nachzufragen, ob etwas von ihren Sachen verkauft worden sei. Ein Blick in die Zigarettenschachtel, darin sie ihr Haushaltungsgeld aufbewahrte, hatte sie belehrt, daß wieder einmal Ebbe drohte.
Sie setzte vor dem Spiegel den Hut auf. Polster, seine Chance witternd, sprang jaulend und kläffend an ihr hoch, er rannte in dem kleinen Flur hin und her und gebärdete sich wie ein Besessener.
„Hundsviech, greisliches“, schalt die Natter im Komparativ, während Alexanders Kopf, rot wie eine Päonie, aus der Tür fuhr.
„Ruhe!“ donnerte er. Sibylle hatte ihn im Verdacht, daß seine ganze Verzweiflung über Herrn Dimpflinger sich in diesem Ausruf entlud.
Draußen flutete ihr heller Sonnenschein entgegen. Die häßlichen Häuser waren freundlich übergoldet, eine Ölpfütze am Straßenrand spiegelte die Sonne in allen Regenbogenfarben wieder. Es war einer jener Föhntage, die auf eine beglückende Weise über das wahre Gesicht der Jahreszeit hinwegtäuschen.
Neben dem trübseligen Café an der Ecke betrieb die Witwe Penzkofer einen Obst- und Gemüseladen. Sie stand, an etwas Grauwollenem strickend, in der Ladentür und grüßte freundlich.
„Frische Orangen hättn mer do! Geht nix ab, Frau Birk?“
„Danke, nein“, sagte Sibylle, bemüht, Polster an sich zu locken, der im Begriff war, einen mit Kartoffeln gefüllten Korb neben der Ladentür als Laternenpfahl zu benutzen.
„Ja, der Polster“, sagte die Penzkoferin wohlwollend, „da geh her, Polsterl, i hob was für di.“
Sie brachte aus der Tiefe des Ladens ein fettig glänzendes Päckchen mit Wurstresten zum Vorschein; der Hund machte sich gierig darüber her.
„A Wetter is dees heit!“ nahm sie die Unterhaltung wieder auf, „da mecht mer fei a spaziern gehn.“
Sibylle fühlte den dunklen Drang, sich zu entschuldigen, weil sie am hellichten Alltag den Anschein sorglosen Lustwandelns erweckte. Aber just in diesem Augenblick geriet Polster in Händel mit einem pudelähnlichen Hund, der die Absicht kund tat, sich an den Wurstresten zu beteiligen. Sibylle hatte alle Mühe, die streitenden Parteien zu trennen.
„Er ist rauflustig“, sagte sie verlegen, nachdem Polster an die Leine genommen war, „aber wenn ich ihn daheimlasse, stört er meinen Mann bei der Arbeit.“
„Jo freili, der Herr Birk“, erwiderte die Witwe verständnisvoll, obwohl sie in ihrem umfangreichen Busen eine tiefe Verachtung nährte für Künstler und ähnliches „G’schwerl“, das dem lieben Herrgott die Tage stehle.
„Leicht tut sich die Frau Birk nicht mit dem spinneten Uhu“, hatte sie eines Tages zu ihrer Tochter geäußert und nach einer gedankenvollen Pause hinzugefügt: „Aber a schöner Mensch is halt!“
Sibylle wanderte stadtwärts. Sie atmete mit Entzücken die milde Luft, sie freute sich am lichten Grün der Theatinerkuppeln vor der blauen Kulisse des Himmels. Zwischen der Ludwigskirche und dem pompösen Bau der Staatsbibliothek gab es hinter Bogengängen einen kleinen Hof mit alten Bäumen; jedesmal, wenn Sibylle daran vorbeikam, dachte sie, so müsse es in Italien sein. Sie stellte sich Italien unbeschreiblich herrlich vor, dank den Erzählungen ihres verstorbenen Vaters, der alljährlich hinuntergefahren war, ohne sie jemals mitzunehmen. Sibylle war indessen in der Obhut von Fräulein Rosina Schupfinger zurückgeblieben. Rosina, ein ältliches Mädchen mit einem Pferdegesicht, betreute sie und den Vater mit der gleichen grämlichen Sorgfalt. Sibylle hatte ihre Mutter nie gekannt, aber Rosina tat, was sie konnte, sie die mütterliche Liebe nicht vermissen zu lassen. Ihre Zärtlichkeit war rauh und stachlig, so, als schäme sie sich ihrer. Aller Wahrscheinlichkeit nach war sie schon mit zwanzig ein altes Mädchen gewesen und hatte die Liebe niemals kennengelernt. Alles, was ihr unerschlossenes Herz an Güte barg, schenkte sie Sibylle. Es war für Sibylle, als verliere sie die Mutter zum zweiten Male, als sie sich nach dem Tode des Vaters von Rosina trennen mußte, weil die Verhältnisse sie zwangen, die Wohnung aufzugeben. Rosina hatte bald darauf auf Grund einer Zeitungsannonce einen Oberpostsekretär geheiratet und lebte seitdem in Pirmasens. Von Zeit zu Zeit bekam Sibylle kleine, karge Briefe von ihr, die sie lächeln machten, weil Rosina nicht aufhören konnte, sie als Kind zu behandeln. „Ziehe dich nicht zu leicht an bei dem kalten Wetter“, hieß es in den Briefen, „du weißt, wie schnell du einen Schnupfen hast.“ Oder: „Hoffentlich achtet dein Mann darauf, daß du nicht zu wenig ißt —“ Gute Ros’l! Zärtlich geliebte Erinnerung an Kindheit und Vaterhaus!
Am Hofgartentor angelangt, konnte Sibylle der Versuchung nicht widerstehen, einzutreten und nachzusehen, ob schon Tische und Stühle herausgestellt waren für die Unentwegten, die beim ersten Sonnenstrahl ihren Kaffee im Freien trinken wollten. Vielleicht gab es auch schon Krokusse und Leberblümchen auf den Rasenflächen.
Sie schlenderte, Polster an der Leine, die Wege entlang. Nein, es war noch nichts mit Krokussen und Leberblümchen; die Rabatten, auf denen es im Sommer in allen Farben blühte, glänzten schwarz und feucht, und der Musiktempel mit der graziösen Diana auf dem Dach steckte noch in seiner hölzernen Winterverschalung. Aber ein paar Tische standen tatsächlich draußen, und an einem von ihnen saß, die Beine weit von sich gestreckt, den weichen Hut genießerisch ins Genick geschoben — —
„Andi!“ rief Sibylle überrascht.
„Hallo, Billie!“ Andreas Keller stand auf und kam Sibylle entgegen. Er war ein breitschultriger, gut aussehender Bursche mit einer Vorliebe für englische Sportsakkos und starkfarbige Krawatten. Sein krauses, blondes Haar hatte die Neigung, widerspenstig vom Kopf wegzustehen, eine Neigung, der Andreas entgegenkam, indem er bei jeder Gemütsbewegung mit allen Fingern hineinfuhr. Innenarchitekt von Beruf, begabt und fleißig, freundlich und zuverlässig, erfreute er sich großer Beliebtheit und war auf dem besten Wege, es zu Erfolg und Ansehen zu bringen.
Sein gutmütiges Gesicht erglänzte in einem breiten Grinsen, während er Sibylle unter vielen Hallos die Hand schüttelte.
„Ein guter Engel führt dich mir in den Weg“, behauptete er, „trinken wir einen Vermouth zusammen! Wenn man zwei Stunden lang mit Frau Direktor Nothnagel verhandelt hat, ist man trost- und stärkungsbedürftig.“
„War es so schlimm?“ erkundigte sich Sibylle teilnahmsvoll.
Sie ließen sich am Tisch nieder, Andreas bestellte den Wein.
„Schlimm ist gar kein Ausdruck“, sagte er. „Es ist eine Art Fegefeuer, ich weiß nicht, womit ich es verdient habe. Seit Wochen geht das nun hin und her, ich mache einen Entwurf nach dem anderen, aber sie ist phantasielos wie eine Kuh —“
„Aber Andi! Eine würdige, ältere Dame!’
„Wozu fragen die Leute einen Innenarchitekten, wenn sie sich nicht von türkischen Rauchtischchen und wollenen Schlummerrollen trennen können?“ rief Andreas aufgebracht.
Sibylle lachte. Der Vermouth schmeckte süß und aromatisch, es war herrlich, in der Sonne zu sitzen und sich vorzustellen, es sei Frühling. Sie nahm den Hut ab, ein sanfter Wind spielte in ihrem kurzen Haar.
Andreas betrachtete sie sinnend durch eine Wolke von Zigarettenrauch.
„Ich mag das“, sagte er unvermittelt, „deine bubenhaften Haare, deine Art, dich zu kleiden. Eigentlich bist du gar keine Frau, Billie.“
„Erlaube mal“, verwahrte sich Sibylle, aber er fuhr eifrig fort: „Frauen sind kokett, Frauen haben Launen. Du bist alles andere als kokett, und ich habe dich noch nie launenhaft gesehen. Mit dir kann man Pferde stehlen. Beneidenswerter Tonkünstler!“
Sibylle lachte ihn an. „Seit wann bist du so frauenfeindlich? Wenn Elisabeth dich so reden hörte!“
Andreas vollführte eine Armbewegung, die eine Frau namens Elisabeth weit aus seinem Gesichtskreis zu schieben schien.
„Habt ihr euch etwa gestritten?“ fragte Sibylle ahnungsvoll.
„Sie ist nach Berlin gefahren“, gestand Andreas. „Beim Abschied sagte sie, sie hoffe mich nie im Leben wiederzusehen.“
„Ach, Andi! Und ich glaubte, ihr wolltet heiraten. Arme Elisabeth!“
Sibylle sah die kleine, dunkellockige Malerin vor sich, wie sie vor der Staffelei stand und ihr ungebärdiges Temperament in leuchtenden Farbklecksen auf expressionistische Manier austobte. Seitdem sie Andreas auf einem Faschingsfest begegnet war, hing sie ihm blindlings an, und es hatte den Anschein gehabt, als sei auch er — —
„Es ist immer das gleiche“, unterbrach Andreas ihre Gedanken, „die wenigsten Frauen können Maß halten. Am liebsten fräßen sie uns mit Haut und Haar. Männer wollen zuweilen alleingelassen werden. Als ich dies Elisabeth klarzumachen versuchte, behauptete sie, ich liebe sie nicht mehr. Ich nannte sie eine dumme Gans. Ein Wort gab das andere, und da es nicht der erste Streit dieser Art war —“
Er drückte grimmig seine Zigarette aus. „Noch einen Vermouth, altes Mädchen?“
„Um Gottes willen, nein!“ Sibylle warf einen erschrockenen Blick auf ihre Armbanduhr. „Ich muß nach Hause. Wenn Alexander sein Mittagessen nicht pünktlich bekommt, wird er fürchterlich wie der Amtsgerichtsrat. Eigentlich wollte ich ins Geschäft, um zu fragen, ob etwas verkauft worden sei.“
„Wieder mal Ebbe?“ grinste Andreas teilnahmsvoll.
„Ein chronischer Zustand, an den man sich trotzdem nicht gewöhnt. Gehen wir durch die Arkaden?“
Sie liebten beide die Arkadengänge, die den Hofgarten von zwei Seiten umschließen, mit dem warmen, pompejanischen Rot der Wände und den Fresken, die in verblichenen Farben sehr bevölkerte Bilder aus Bayerns Geschichte darstellen. Da war beispielsweise Herzog Ludwig des Reichen Sieg bei Giengen im Jahre 1462. Sibylle wußte nicht, wo Giengen gelegen war, noch, wen Ludwig der Reiche besiegt hatte. Auf jeden Fall hatte er es unter einem gewaltigen Aufwand an bäumenden Rossen, schimmernden Rüstungen und wallenden Federn getan. Der Krieg schien im Jahre 1462 eine sehr prunkvolle Angelegenheit gewesen zu sein.
Am Odeonsplatz verabschiedeten sie sich.
„Lili befindet sich mal wieder in Reparatur“, sagte Andreas, „sonst würde ich dich nach Hause fahren. Es ist ein Kreuz mit den Weibern!“
Sibylle gab ihm die Hand. „Servus, Andi. Überleg dir’s noch mal mit Elisabeth!“
„Grüß den Tonkünstler!“ rief Andreas. Er winkte ihr nach, während sie auf der Plattform der Straßenbahn davonfuhr; seine kirschrote Krawatte wehte, weithin sichtbar, im Winde.
Als Sibylle die Treppen zur Wohnung hinaufhastete, hörte sie Alexander üben. Gott sei Dank, er hatte sie noch nicht vermißt! Aufatmend verlangsamte sie den Schritt. Hinter der Tür von Amesmeiers im zweiten Stock erscholl wütendes Kindergeschrei, aus allen Wohnungen drangen Küchendüfte und vermischten sich zu einem unbeschreiblichen Ganzen, darüber der Geruch siedenden Krautes schwebte, wie eine triumphierende Fanfare.
Dem Treppenhaus mit seinen knarrenden Stufen, den gelb gestrichenen Wohnungstüren und den bunten, im wildesten Jugendstil bemalten Fenstern, konnte selbst Sibylle nicht den bescheidensten Reiz abgewinnen. Es war jedesmal, als betrete sie eine selige Insel, wenn sie die eigene Tür hinter sich schloß.
Sie warf Mantel und Hut ab und entzündete in der Küche die Gasflamme unter der am Morgen vorbereiteten Suppe. Kochen gehörte nicht zu Sibyllens starken Seiten, sie fand Essen unwichtig und begriff nicht, wie jemand viel Aufhebens davon machen mochte. Zu der Zeit, da sie nach dem Tode des Vaters als Kunstgewerbeschülerin ein möbliertes Zimmer bewohnte, hatte es ihr nichts ausgemacht, tagelang von Brot und einem Viertel billigen Aufschnitts zu leben.
Nicht so Alexander! An die zarten Braten und erlesenen Gemüse im Hause Birk gewöhnt, legte er großen Wert auf eine gepflegte Küche. Das Essen und seine Beschaffenheit war ein wunder Punkt in ihrer Ehe. Es kam auf die jeweilige Stimmung an, ob Alexander Sibyllens kochkünstlerische Erzeugnisse mit der Miene des stillen Dulders herunterschlang, oder aber mit verletzendem Hohn Vergleiche zwischen Beefsteaks und alten Schuhsohlen anstellte.
Gefolgt von Polster, trug Sibylle das Geschirr ins Atelier und deckte den Tisch vor dem Récamiersofa.
Alexander fuhr verstört auf. „Ist es schon so spät?“ Er wiederholte eine schwierige Passage. „Ich werde dies spielen bei Osterwalds. Chopin langweilt die Leute noch am wenigsten.“
„Es ist wundervoll“, sagte Sibylle überzeugt, „aber ich glaube, du solltest die Sache nicht unter diesem Gesichtspunkt betrachten.“
Alexander stand auf.
„Frau Osterwald ist unmusikalisch wie ein Regenschirm. Sie veranstaltet Hauskonzerte aus Snobbismus. Bach zum Beispiel findet sie langweilig. Was kann man von Menschen erwarten, die Bach langweilig finden?“
„Eigentlich ist es anständig, daß sie es offen zugibt“, meinte Sibylle und stellte ein Glas mit Tulpen in die Mitte des Tisches; sie vertrat die Ansicht, daß es nur eines hübsch gedeckten Tisches bedürfe, um die einfachste Mahlzeit zu einem Fest zu gestalten. „Ich bin überzeugt, es gibt eine Menge Menschen, die Bach langweilig finden, ohne es zu sagen.“
„Es ist eine Schande“, sagte Alexander, und da er in diesem Augenblick den ersten Löffel Suppe zu sich nahm, blieb es unklar, ob dieser Ausspruch dem menschlichen Unverständnis galt oder vielmehr der Kochkunst seiner Frau.