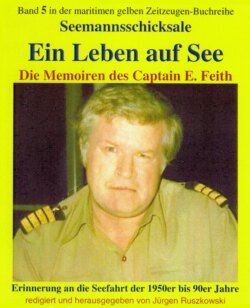Читать книгу Ein Leben auf See - Emil Feith - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort des Herausgebers
ОглавлениеSiebenundzwanzig Jahre lang hatte ich als Heimleiter des Seemannsheimes am Krayenkamp neben dem Hamburger Michel Kontakt zu Tausenden Seeleuten aus aller Welt und lebte mit ihnen hautnah unter einem Dach zusammen.
Ende Januar 1999 traf ich als Ruheständler bei einem Besuch im Seemannsheim den mir vom Ansehen bekannten Kapitän Emil Feith. Nachdem wir kurz ins Gespräch gekommen waren, ob er denn immer noch fahre, erwähnte er beiläufig, er habe seine Memoiren bereits fertig geschrieben in der Schublade zu liegen. Das Wort „Memoiren“ war für mich das entscheidende Reizwort, denn ich sammle seit 1991 Portraits von Fahrensleuten und hatte bereits etwa fünfzig solcher Lebensläufe und Erlebnisberichte von Seeleuten im ersten Band meiner maritimen gelben Buchreihe „Seemannsschicksale“ zusammengetragen und zunächst über die Seemannsmission, dann im Ruhestand im Eigenverlag insgesamt über 3.000 Stück davon an ein maritim interessiertes Publikum vertreiben können. Herr Feith war so freundlich, mir eine Kopie seiner Aufzeichnungen zum Lesen zur Verfügung zu stellen, und ich war begeistert über diese sehr detaillierte und farbige Darstellung seines interessanten Lebens als Seemann, angefangen von der Zeit als 16jähriger Moses auf einem Kümo vor dem Mast im Jahre 1952. Obwohl sich in seinem Lebensbericht viele Parallelen zu den von mir gesammelten Seemannsportraits finden, erschien mir Herrn Feiths Darstellung der Seefahrt der 1950er, 60er Jahre und 90er so lebendig und typisch, dass ich meine, sie müsse als zeitgeschichtliches Dokument einer breiteren maritim interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dieser Bericht gibt die harte und oft gefahrvolle Wirklichkeit des Seemannsalltags an Bord und in den Häfen der Welt wieder und strotzt von prallem vitalem Leben. Der Umgang mit der eigenen Libido in dem entbehrungsreichen Alltag dieser junger Männer auf See und in den hafennahen Kaschemmen der ganzen Welt wird ohne Tabus drastisch und offenherzig geschildert. Der Leser sollte frei von gutbürgerlicher Prüderie an die Lektüre dieser Memoiren herangehen. Zarte Seelen könnten von dem öfter rauen Ton, den deftigen Ausdrücken und der moralischen Unbekümmertheit sonst leicht schockiert werden. Bei meiner redaktionellen Überarbeitung wollte ich in den Originaltext möglichst wenig eingreifen und deshalb auch nicht moralisch zensierend die Sprache des Seemanns verändern.
In diesem Zusammenhang wurde ich bei der Lektüre des Manuskripts an den bekannten Theologieprofessor und langjährigen Prediger auf der Kanzel des Hamburger Michels, Helmut Thielicke, erinnert, der 1958 eine Seereise nach Japan auf einem Frachtschiff der Hapag unternahm und seine Erlebnisse an Bord in dem Buch „Vom Schiff aus gesehen“ zusammenfasste. Seine hautnahen Begegnungen auf dieser wochenlangen Reise mit Seeleuten brachten ihn zu dem Bekenntnis, dass ihm eine ganz neue, bisher unbekannte Welt erschlossen worden sei und er nun eigentlich sein kurz zuvor veröffentlichtes Ethikwerk umschreiben müsse. Es erscheint mir deshalb angebracht, ihn hier etwas ausführlicher zu zitieren:
Professor Helmut Thielicke
„In den stillen Tropennächten habe ich mit Offizieren und Matrosen viele Gespräche geführt. Denn da verkroch man sich nicht in seine Kammern, sondern setzte sich unter den südlichen Gestirnen an Deck zusammen. Die Art, wie ganz anders gebaute Menschen existieren, die Gesetze der See und des engsten monatelangen Zusammenlebens haben mich aufs höchste interessiert und mir ebensoviel neue Aspekte geöffnet, wie der Blick in fremde Städte, in Dschungel und exotische Gesichter. Diese scharf umgrenzte und höchst eigenartige Erlebniswelt als eine Totalität zu erkennen und dann auch sichtbar zu machen, habe ich mich all die Monate über bemüht und dadurch neue Reichtümer empfangen... Es ist erstaunlich, was alles in diesen Herzen beieinander ist und sich verträgt, und wie die ethischen Alternativen durchaus da sind, aber wie sie sich völlig anders verteilen als in meiner gesellschaftlichen Schicht. Die Art, wie sie im selben Atemzug von ihrer Familie und von der Geisha in Kobe erzählen können, wie sie zartfühlend und geradezu rührend in dem einen, und wie sie völlig indifferent in dem anderen Lebensraum sein können, das alles gibt mir Fragen über Fragen auf. Als Theoretiker der Ethik könnte ich manchmal zu der Diagnose geneigt sein: Sie leben in einer völligen ethischen Schizophrenie. Einige von ihnen sparen und opfern für ihre Familien; hier gibt es Liebe und innerstes Engagement; und daneben „gehen sie fremd“, ohne dass sie auch nur das geringste dabei fänden. Aber diese Diagnose stimmt irgendwie nicht. Man hört sozusagen nirgendwo das Knacken eines Hebels, der beim Übergang von dem einen in den anderen Raum umgelegt würde; es wird nicht auf einen anderen Gang geschaltet. Es scheint vielmehr stets derselbe Gang zu sein. Ich frage mich allen Ernstes, ob hier eine durch Gesellschaft und Lebensstil – in diesem Fall durch das Leben auf See – bedingte andere Struktur der Humanität vorliegt. Sie haben einen Raum in ihrem Leben, in dem die leibseelische Totalität des Geschlechtlichen intakt ist; das ist ihre Heimat, ist ihre Ehe oder ist ihre „beste Freundin“. Und sie haben einen anderen Raum, in dem nur physiologisch bedingte Hormonvorgänge ähnlich Verdauungsprozessen stattfinden. Manchmal ist es noch komplizierter: Sie haben feste Freundinnen in verschiedenen Häfen, und es sind nach Ton und Inhalt ihrer Schilderungen gelegentlich sicher mehr als nur körperliche Augenblickskontakte. Es ist nun so, als ob die geographischen Entfernungen und die Isolierschicht der Meere das Problem der Konkurrenz, der „Polygamie“, gar nicht aufkommen ließen, als ob sich die Frage der Treue hier ganz anders stelle. Indem ich mich sorgfältig vor vorschnellen moralischen Interventionen hüte – durch die ich das unbefangene Erzählen und mein eigenes unbefangenes Hören ja nur blockieren würde -, versuche ich in aller Vorsicht meine Fragen anzubringen. Zum Beispiel so: „Wenn diese verschiedenen Mädchen so in Ihrem weiten Seemannsherzen nebeneinander Platz haben - wie sieht das nun vom Standpunkt dieser Mädchen her aus? Gerade wenn sie so „prima“ sind, wie Sie sagen, wenn sie herzig und fürsorglich sind und Sie lieben: meinen Sie, es wäre ihnen dann egal, wenn sie erführen, dass sie nur eine unter mehreren oder gar vielen sind? „Natürlich dürfen sie nichts voneinander wissen“, ist die Antwort. „Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und es liegen ja immer so lange Zeiten dazwischen, dass ihnen nichts abgeht. Ist man in einem Hafen, dann ist man ja ganz für die Betreffende da... Natürlich geht das Gespräch noch weiter, und gelegentlich kommt es auch zu einem etwas betretenen Schweigen. Aber als ob das alles, was sie für einen Augenblick verstummen ließ und nachdenklich machte, nur in einem schnell durchmessenen Vorraum stattgefunden hätte, erzählen sie plötzlich weiter, naiv, unbekümmert. Die Grammophonnadel hat ihre Rille wiedergefunden. Sie war nur für Augenblicke aus der Bahn gebracht. Ich kann mich nicht doktrinär darüber erheben und muss die Frage, die in alledem liegt, ernst nehmen. Da schreibt man dicke Bücher über Ethik, will sich auf einer Schiffsreise von dieser Strapaze erholen, und nun tauchen eben auf diesem Trip mit seinen ganz anderen Zielen plötzlich fundamentale und neue Probleme für eben diese Ethik auf. Vielleicht muss es in meinem Unternehmen noch ein ganz neues Kapitel geben, das vielleicht heißen könnte: „Ethik und Typus“ oder auch „die Brechung der Gut-Böse-Normen in den verschiedenen Lebensmedien“. Erst bei solchen Gelegenheiten merkt man, wie relativ homogen der Menschentypus ist, mit dem wir es in unseren Berufen üblicherweise zu tun haben, auch wenn man sich, wie in meinem Falle, in recht verschiedenartigen Kreisen bewegt. Aber wie sehr fehlt einem die Innenansicht völlig anderer Lebenssituationen... Ich bemühte mich nach Kräften, offen zum Hören zu bleiben und - so schwer es mir fällt - selbst meine stabilsten Meinungen in diesem thematischen Umkreis als mögliche Vorurteile zu unterstellen, die vielleicht einer Korrektur bedürfen. Ich frage mich ernstlich, was an diesen meinen stabilen Meinungen christlich und was bürgerlich ist. So radikal wie hier, ist mir diese Frage noch nie gestellt worden, auch während meiner Soldatenzeit nicht. Ich merke, wie schwer es ist, sich im Hinblick auf alles Doktrinäre zu entschlacken und einfach hinzuhören - immer nur hören zu können und alles zu einer Anfrage werden zu lassen... Sie haben zum Teil einen verzehrenden Dienst, wenn ich an die 50 bis 60 und noch mehr Grade in der Maschine denke - einen Dienst, der nach einem Ausgleich durch Weichheit und eine andere Art von Wärme ruft. Ich denke auch daran, dass die Seefahrt selbst schon eine Art von Selektion in puncto Vitalität und körperlicher Kraft besorgt. Und vor allem überlege ich mir, dass diese gesunden und simpel gebauten Burschen ja nicht wie die Gebildeten anderer Gesellschaftsschichten die Möglichkeit der Sublimierung, die Abenteuer des Geistes und der Seele, die Feste der Bücher und Gedanken, „ästhetische“ Erfüllungen, die Hineingenommenheit durch ein Gespräch und vieles andere kennen. Der Massivität der Seelen entspricht auch die Massivität des Erlebens, und das Vakuum des Erlebnisraumes, das sich in der „Eintönigkeit“ der Seefahrt ergibt, schreit nach Füllung... Merkwürdig, wie diese Seereise zunächst ganz andere Effekte für mich zeitigt, als ich sie erwartete: alles, was ich bisher zu sehen bekam - und wie viel ist das immerhin schon! –, tritt zurück hinter dieser Attacke auf gewisse Selbstverständlichkeiten meiner Anthropologie. Ich gehe mehr und mehr in der Welt des Schiffes auf, deren Bewohner zu unablässigen Exerzitien des Geistes nötigen und zu harten Revisionen zwingen. Wie merkwürdig sind diese Bewohner doch! Diese jungen Bären, die in jedem Honig der Welt herumwühlen, sind verschämt und verschüchtert, wenn unsere beiden Mädels in das Schwimmbassin steigen. Auch jetzt noch würden sie niemals gleichzeitig hineingehen. Sie haben so etwas wie eine fromme Scheu und sind auf einmal wieder kleine Buben. Bei meiner Bibellektüre achte ich darauf, wie nachsichtig Jesus Christus mit den Sünden der Sinne ist und wie hart und unerbittlich er den Geiz, den Hochmut und die Lieblosigkeit richtet. Bei seinen Christen ist das meist umgekehrt.“
Wenn auch nicht mehr jeder deutsche Knabe einen Matrosenanzug trägt, wie einstmals, so ist doch seit der wilhelminischen Zeit her in unserer Gesellschaft trotz des Niederganges und der gewaltigen Strukturveränderungen der deutschen Seeschifffahrt in den letzten Jahren bei vielen Menschen immer noch ein romantisch verklärtes Interesse an der Seefahrt vorhanden, was seinen Niederschlag in der Langlebigkeit der Hafenkonzert-Rundfunksendungen, der Hans-Albers- und Freddy-Quinn-Romantik findet.
Die Verhältnisse in der deutschen Schifffahrt änderten sich ab Anfang der 1970er Jahre gewaltig. Anfang bis Mitte der 1970er Jahre eroberte der Container und in den 80er Jahren die Elektronik die Schifffahrt. Die Gewerkschaften erstreikten nie geahnte Errungenschaften für die Seeleute. Wurden diese „Fortschritte“ für die deutschen Seeleute bald zum Fluch? Die Hafenliegezeiten reduzierten sich drastisch. Landgang in fremden Häfen wurde immer kürzer und seltener möglich. Die Zahl der Besatzungsmitglieder eines großen Überseefrachters sank in den letzten Jahrzehnten von 40 über 20 auf 12 Mann. Das ferngesteuerte unbemannte Überseeschiff ist nicht nur denkbar, sondern wurde bereits getestet. Obwohl im letzten Vierteljahrhundert Zehntausende deutscher Seeleute freigesetzt wurden und in Landberufe abwandern mussten, ist die Seefahrt ohne die Menschen an Bord noch nicht ganz denkbar. Langlebige Vorurteile in der Gesellschaft gegenüber den Seeleuten treffen heute nach meinen jahrzehntelangen Erfahrungen nur noch sehr eingeschränkt zu. Wer sich als deutscher Seemann heute noch beruflich behaupten kann, muss fachlich hoch qualifiziert und zu großen Opfern an Anpassung, Stress und Vereinsamung an Bord bereit sein. Nur aus Edelholz geschnitzte Charaktere halten das noch durch. Hinzu kommt eine gehörige Portion Glück.
Die Seefahrt brachte in Jahrhunderten eine eigene Kultur hervor, die auszusterben droht mit dem Einzug der Hochtechnologie und des Containers an Bord und dem dramatischen Sterben des Seemannsberufes in Europa. Träger dieser Kultur sind Menschen, Menschen, die in den letzten Jahrzehnten in der Seefahrt arbeiteten, die mir im Seemannsheim begegneten, die vereinzelt noch heute an Bord tätig sind. Das Schicksal dieser Menschen sollte nicht in Vergessenheit geraten. Einer davon ist Kapitän E. Feith, der über sich, seine Berufswelt und viele seiner Kollegen in seinen vorliegenden Memoiren höchst aufschlussreich und spannend erzählt.
Herr Feith ist inzwischen leider verstorben.
Ein besonderer Dank gilt Herrn Jochen Esdohr † aus Magdala und Frau Monica Maria Mieck für das Korrekturlesen.
Hamburg, 2003 / 2014 Jürgen Ruszkowski