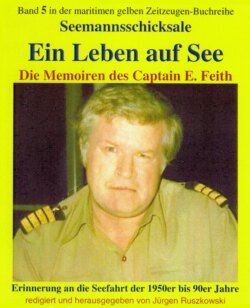Читать книгу Ein Leben auf See - Emil Feith - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vor dem Mast
ОглавлениеMoses auf dem Kümo „RÜGEN“
Eines Morgens musste ich mich bei unserem Hausvater melden, der mir mitteilte, dass ich sofort zu der Schiffsagentur Thode gehen sollte, da ein Kümo (Küstenmotorschiff) einen Schiffsjungen suchen würde. Auch bestehe die Möglichkeit, dass ich schon am folgenden Tag an Bord gehen müsse. Die Agentur Thode, eine altehrwürdige Hamburger Firma, hatte ihr Kontorgebäude gleich um die Ecke, und eine Stunde später hatte ich bereits meinen Heuerschein für das Kümo „RÜGEN“ und eine Fahrkarte nach Kiel in der Tasche, außerdem fünf Mark für Spesen. Mein Schiff sollte im Laufe des nächsten Tages in die Holtenauer Schleuse einlaufen und dann weiter in die Ostsee nach Finnland gehen. Ich hätte mich am folgenden Morgen an der Kanalschleuse bei der Schiffsagentur Zerssen & Co, die bereits unterrichtet wäre, zu melden. Das Motorschiff RÜGEN sei ein Kümo von ca. 500 Ladetonnen und gehe in Ballast nach Finnland, wo es Schnittholz laden solle. Man nannte die Kümos damals allgemein „Arschbackenkreuzer“, ein Ausdruck, der in der ganzen deutschen Seefahrt geläufig war. Die Schiffsführung bestand allgemein aus dem Kapitän und einem Steuermann mit kleinem „Küstenbefähigungszeugnis“, auch „Kleines Patent“ genannt, welches den Inhabern erlaubte, in der Nord- und Ostsee herumzuschippern. Als Besatzung waren in der Regel vier Mann vorgeschrieben, wovon einer ein Vollgrad (Vollmatrose) sein musste.
Es war ein schöner sonniger Julimorgen, als ich an der Schleuse Holtenau stand und bangen Herzens auf mein Schiff wartete. Da es noch nicht gemeldet war, hatte ich meinen Pappkoffer bei der Agentur Zerssen & Co abgestellt und beobachtete die in die Schleusen ein- und auslaufenden Schiffe. Sie kamen entweder aus der Ostsee, um durch den Kanal in die Elbe und Nordsee zu gelangen, oder sie verließen den Kanal in Richtung Ostsee. Vom Kümo bis zum großen 15.000-Tonner machten sie in den Schleusen fest und ich beobachtete, wie die Besatzungen auf dem Vorschiff und dem Heck die Schiffsleinen an Land gaben oder beim Ablegen einholten. Ich kam ins Träumen und stellte mir schon vor, dass ich selbst bald auf dem Vorschiff oder am Heck stehen würde, um als wichtiges Rädchen im Bordbetrieb die Befehle des Kapitäns zu befolgen.
Gegen Mittag wurde bei der Agentur die Ankunft des M/S RÜGEN für den nächsten Schleusendurchgang gemeldet, und ich machte mich zusammen mit dem Vertreter der Agentur auf den Weg zur Schleusenkammer. Das erste Schiff, ein großer Finne, machte gerade fest, dem einige andere mittelgroße Frachter folgten. Da die Schleuse schon voll besetzt schien und mein Schiff nicht darunter war, wollten wir schon zurückgehen, bis sich doch noch ein „Winzling“ von Kümo in die Schleusenkammer schob und hinter dem letzten Frachter festmachte. Der Name RÜGEN prangte in übergroßen weißen Lettern an den beiden Seiten des Bugs und hätte einem Ozeanriesen zu Ehren gereicht. Mein Schiff war angekommen! Wir stiegen an einer langen Holzleiter hinab an Deck und meldeten uns beim Kapitän. Nachdem der Agent den Messbrief eingesehen hatte, schickte mich der Kapitän nach einer kurzen Begrüßung ins Mannschaftslogis unter die Back (Steven unter dem Vordeck). Kurz darauf lief die RÜGEN aus der Schleuse in die Ostsee Richtung Finnland und ich hatte Gelegenheit, meine zukünftigen Bordkameraden und unsere Unterkunft kennen zu lernen.
Wir hausten, anders kann man es nicht nennen, zu viert unter der Back in einem Massenlogis ganz vorne am Steven (Bug) des Schiffes. Wir: das waren ein Leichtmatrose, ein Jungmann ein befahrener Moses und ich der unbefahrene Neuling. Der Leichtmatrose hieß Günther und war schon 32 Jahre alt. Der Jungmann, Manfred, war 19 Jahre und kam aus Hamburg. Den Namen des befahrenen Moses habe ich vergessen, weiß aber, dass er nach dieser Reise Jungmann werden sollte und da wir bereits einen solchen hatten, abmustern wollte.
Eigentlich war ein Matrose vorgeschrieben, aber dessen höhere Heuer wollte der Eigner sparen. Bekam er Schwierigkeiten mit den Behörden, fuhr der Eigner, der ein Kapitänspatent besaß, bis zum nächsten ausländischen Hafen als Kapitän, der angeheuerte Kapitän wurde solange Steuermann und der Steuermann derweil „Bestmann“, was dem Bootsmann auf großen Schiffen entsprach. Im nächsten ausländischen Hafen oder auch schon kurz vor Auslaufen, wenn die Behördenvertreter das Schiff verlassen hatten, ging der Eigner von Bord, und alles lief wie vorher gehabt. Musste aber wirklich mal ein Matrose gefahren werden, wurde dafür gesorgt, dass er nach einer Reise wieder von Bord ging. Aber davon später mehr.
Die Autoritätsperson unter der Back war Günther, der Leichtmatrose, da er den höchsten Rang hatte und der älteste unter uns war. Er hatte schon eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Während des 2. Weltkrieges hatte er von Anfang an bei der Kriegsmarine gedient und nach Kriegsende Maler gelernt. Nach der abgeschlossenen Lehre hatte er als Steward bei der alten Hamburger Reederei Llaeisz auf einem der neuen Bananenschiffe gearbeitet, auf denen auch Passagiere mitfuhren. Hier bei uns an Bord fuhr er gleich als Leichtmatrose. Da ihm die Marinezeit angerechnet wurde, übersprang er somit die Moses- und Jungmannzeit. Es gab damals viele solcher Sonderregelungen für ehemalige Marineleute und -offiziere. Die normale Laufbahn eines Seemannes begann als Schiffsjunge, der dann über den Jungmann und Leichtmatrosen zum Matrosen befördert wurde. Danach konnte man sein Steuermannspatent machen und anschließend nach zwei Jahren Steuermannszeit das Kapitänspatent. Kapitän und Steuermann meines ersten Schiffes waren richtige Kümoschipper, und in meiner langjährigen Seefahrtszeit habe ich selten Leuteschinder solchen Formats und animalischer Primitivität erlebt. Der Kapitän war von kleinem, aber athletischem Wuchs. Er war dunkelhaarig mit asketischen zigeunerhaften Gesichtszügen. Im Kontrast zu seinem dunklen Gesicht waren seine Augen von hellgelber Farbe. Ich habe solche Augen bei keinem anderen Menschen vorher oder später gesehen. Sie erinnerten mich an unsere Hauskatze, die solche gelben Augen hatte. Unser Kapitän mochte etwa 42 Jahre alt gewesen sein und wurde von der Crew meistens „Giftzwerg“ genannt. Sonst heißt es an Bord allgemein „der Alte“, wenn vom Kapitän die Rede ist. Wurde er einmal wütend, lächelte er immer zuerst freundlich und wurde dann handgreiflich und gemeingefährlich.
Unser Steuermann war 32 Jahre alt. Im Gegensatz zum Alten war er ein großer sehniger Mann mit hellblondem Haar und schmalen Gesichtszügen. Er hatte hellblaue Augen und einen sehr jähzornigen Charakter. Wurde er wütend, was oft vorkam, warf er mit allem um sich, was ihm in die Hand kam. Er kriegte regelrechte Tobsuchtsanfälle. Dazu fluchte er fürchterlich, und das Objekt seines Zorns musste sich schnell in Sicherheit bringen. Ansonsten war er schweigsam, meist mürrisch und der geborene Antreiber und Leuteschinder. Seine Denkweise war primitiv und unkompliziert. Es ging das Gerücht, er habe sein Steuermannspatent nur nach mehrmaliger Wiederholung geschafft. Er war mit einer Sekretärin verheiratet, die ihm bildungsmäßig hoch überlegen war. Die Bindung muss vorrangig sexuelle Gründe gehabt haben, denn das einzige Thema, über das man mit ihm reden konnte, war das „Bumsen“. Sein Sexualtrieb muss stark ausgeprägt gewesen sein, denn wir haben es später selbst erlebt, dass, wenn seine Frau an Bord kam, eine stabile Person mit einem bemerkenswerten Hinterteil, keine zehn Minuten später die Matratze in seiner Kammer rhythmisch knarrte. Seine Kammer lag Wand an Wand mit unserer Kombüse, so dass wir diese Geräusche gut mitverfolgen konnten. Diese Vorgänge wiederholten sich dann sporadisch den ganzen Tag über. Wenn seine Frau das Schiff wieder verlassen hatte, war er anschließend einige Zeit lang ganz verträglich. Er war ein ausgezeichneter Seemann, und es gab keine seemännische Arbeit, die er nicht perfekt beherrschte.
Während sich unsere Mannschaftsunterkunft vorne unter der Back befand, wohnten der Alte und der Steuermann im hinteren Schiffsteil, wo sich auch Brücke, Maschinenraum, die Kombüse und das einzige Rettungsboot befanden. Das Schiff hatte zwei Ladebäume, die mit Handwinden hochgedreht wurden, und zwei Motorwinden für den Lade- und Löschbetrieb. Vorne auf der Back befand sich das Motorankerspill und darunter der Kettenkasten für die beiden Anker, gleich neben unserem Mannschaftslogis. Unser Logis unter der Back bestand aus einem spitz zulaufenden Raum. Vier kastenförmige Kojen, je zwei übereinander, waren an das hintere Kollisionsschott angebaut. Eine zusätzliche Koje befand sich an der Backbordseite am vorderen Schott zum Kettenkasten. Links daneben war ein kleiner Waschraum von ca. 1,50 x 1,50 m abgeteilt. Am hinteren Schott backbordseits führte ein Aufgang zum Deck. Steuerbordseits stand ein fester kleiner Tisch mit einer Sitzbank direkt unter einem Bullauge. Gleich neben dem Tisch befanden sich ein Kanonenofen und ein Kohlenkasten. Zum Stauen der Ankerkette waren zwei Öffnungen neben der vorderen Koje in die Wand eingelassen. Wurde der Anker aufgehievt, musste einer von uns im Logis die Klappe zum Kettenkasten öffnen und dann während des Hievens mit einem Handhaken die Ankerkette stauen. So verhinderte man, dass sich beim nächsten Ankerwerfen die Kette vertörnte. Das Logis sah danach immer entsprechend aus! Wasser zum Waschen war rationiert und musste in einem Eimer von achtern nach vorne geschleppt werden. Die Toilette, eine kleine Kabine an Deck, befand sich vorne hinter der Back neben dem Niedergang zum Logis. Saß man bei bewegter See auf der Brille, peitschte das Seewasser durch das Abflussloch hoch und man musste seine Testikel in Sicherheit bringen.
Die Wohn- und hygienischen Verhältnisse waren schrecklich, aber wir waren jung, kannten es nicht anders und dachten, es müsse so sein. Da die Verhältnisse auf anderen Kümos ähnlich waren, nahmen wir alles als gegeben hin. Bei schwerem Wetter wurden wir vorne in unserem Massenlogis wie in einer Zentrifuge unhergeschleudert. Dazu kam das schlagende Geräusch der Ankerketten im Kettenkasten. Es hörte sich wie das Geläut von Kirchenglocken an. Im Winter musste bei schwerem Wetter auf See der Schornstein für unseren Kohleofen auf der Back abgebaut werden und es konnte deshalb nicht geheizt werden. Dann wurde es lausig kalt und nicht selten froren unsere Matratzen an der Eisenwand fest. War das Wetter zu schlecht, konnten wir unser Logis zur Wachablösung nicht verlassen, da es unmöglich war, über Deck nach achtern zu gelangen. Wir wären sonst über Bord gespült worden. Im Sommer herrschte in unserem Loch eine furchtbare Hitze und die Luft stand wie eine Glocke im Raum. Da konnte auch das kleine Bullauge keine Abhilfe schaffen. Wasser gab es pro Mann nur einen Eimer pro Tag zum Waschen. Zeugwäsche wurde grundsätzlich nur mit Seewasser und einer speziellen Seife für Salzwasser erledigt. Die Spülung erfolgte während der Fahrt mit Hilfe einer Wurfleine, an der die Wäsche im Kielwasser hinterhergeschleift wurde. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich mich während meiner 17monatigen Bordzeit auch nur ein einziges Mal mit warmem Wasser gewaschen hätte. Von einer Dusche träumten wir damals noch nicht mal. Der dumpfe, muffig-feuchte Geruch hing immer in unserem Logis so dass wir es schon gar nicht mehr merkten.
Als unbefahrener Moses stand ich in der Rangordnung an Bord natürlich ganz unten und musste, wie damals üblich, die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da ich von nichts eine Ahnung hatte, nicht steuern konnte und so an Deck nicht zu gebrauchen war, steckte man mich zunächst für einen Monat in die Kombüse, auch wenn ich vom Kochen überhaupt nichts verstand.
Die Autoritätsperson unter der Back war also, wie bereits erwähnt, Günther. Er trug einen Schnauzbart, sprach gerne und sehr viel und verstand seinen Job. Uns Junggrade hatte er tüchtig unter Zug, wobei der Marinemaat immer wieder durchkam. Wir respektierten ihn. Er wollte noch bis zur Beförderung zum Matrosen an Bord bleiben und dann abmustern und hatte seine Zeit bald herum. Der nächste in der Rangordnung war Manfred, unser 19jähriger Jungmann, den wir alle „Hundepint“ nannten. Er war blond, groß und hatte schon auf zwei Kümos gefahren, auf der „Adelheid“ und „Käthe Hamm“. Den Spitznamen „Hundepint“ soll er bekommen haben, als er eines Morgens nackt aus seiner Koje sprang und ein Kollege beim Anblick seiner erigierten „Wasserlatte“ erstaunt ausrief: „Mensch, du hast ja einen Hundepint.“ Auf Plattdeutsch heißt dieser Begriff „Hundepenis“, und es gibt in der Seemannssprache einen solchen Begriff, der ein spitzzulaufendes Tauende so benennt. Dieses ist vorne eigens mit Segelgarn bewickelt und dadurch besser durch eine Öse oder Block zu stecken. Da wir im Sommer fast alle nackt schliefen und nicht prüde waren, konnte ich mich selbst davon überzeugen, dass der Spitzname zutreffend war. Er hatte wirklich ein langes, nach vorne spitz zulaufendes Glied mit einem fingerhutförmigen Kopf. Sein Glied war fast immer erigiert, und die „Mädchen an der Küste“ schwärmten von seiner Potenz.
Manfred kam aus Hamburg und war in der Nähe der Reeperbahn groß geworden. Sein Vater war im Krieg gefallen, und seine Mutter arbeitete als Schaffnerin bei der Straßenbahn. Er war ein guter, aber empfindlicher Kamerad, und ich verstand mich mit ihm am besten von allen. Da ich auf meiner ersten Reise von nichts eine Ahnung hatte, half er mir an Bord bei meinen Schwierigkeiten, wo er nur konnte. Er war ein guter Seemann und sollte bald Leichtmatrose werden. Anschließend wollte er auf „Große Fahrt“ gehen. An den anderen befahrenen Moses kann ich mich nicht mehr so gut erinnern, da er auch nicht lange an Bord blieb. Ich weiß nur noch, dass er ein ruhiger 17jähriger Bursche war und einen ziemlich deprimierten Eindruck machte. Später, nachdem ich selbst längere Zeit an Bord war, konnte ich ihn verstehen. Auch ich war manchmal nahe dran, alles hinzuschmeißen und die Seefahrt an den Nagel zu hängen. Da wir schon einen Moses an Bord hatten, nannten mich alle merkwürdigerweise nur „Seemann“, und diesen Namen sollte ich die ganzen 17 Monate, die ich an Bord blieb, behalten. Der Ton zu uns Junggraden an Bord war rau und Worte wie „Dummes Schwein“, „ich trete dir in den Arsch“ oder „ich hau dir welche an den Hals“ waren an der Tagesordnung und manchmal setzte es wirklich was.
Da ich als unerfahrener Neuling an Deck nicht zu gebrauchen war, wurde ich also in die Kombüse gesteckt. Aber auch dort hatte ich von nichts eine Ahnung. Nach drei Tagen intensiver Einweisung durch den Steuermann mit Fußtritten, Flüchen und Drohungen wie beispielsweise „ich hau dich an die Wand, dass du Lumpen kotzt“ oder „dich hätte die Hebamme gleich nach der Geburt erwürgen sollen“ wusste ich in etwa, wo es lang geht. Kochen konnte ich zwar immer noch nicht, und der Steuermann musste einspringen, aber zumindestens konnte ich den Kohleherd anzünden und Kaffee und Tee aufgießen. Mein Tag begann in der Frühe um 5.30 Uhr, wenn die 6.00-12.00-Uhr-Wache geweckt wurde. Um 6 Uhr heizte ich den Kohleherd an, was bei Regenwetter und schwerer See nicht immer gleich gelang, und manchmal musste ich mit einer Konservendose voll Gasöl nachhelfen. Wehe, wenn mich der Alte oder der Steuermann dabei erwischte! Dann setzte es Maulschellen und Fußtritte. Nach dem Herdanheizen musste ich mit der Handpumpe den Kombüsentank mit Trinkwasser (seemännisch ausgedrückt: mit Frischwasser) auffüllen und Kaffee auf die Brücke zum Alten bringen. Die Kaffeebohnen hatte der Steuermann, der die Wache an den Alten übergab, vorher abgezählt. Bei dieser Gelegenheit bekam der Bordhund seine halbe Dose Kondensmilch in seinem Napf zum Frühstück serviert. Wir vier vorne unter der Back mussten mit einer Dose die ganze Woche auskommen. Nachdem der Steuermann mit meiner Assistenz das Mittagessen vorbereitet hatte, brachte ich um 7.30 Uhr eine große Kanne „Muckefuck“ (Ersatzkaffee) nach vorne. Unser Frühstück war spartanisch: außer genügend schwarzem „Kommissbrot“, Margarine und Heizer-Jam (Marmelade in Dosen) gab es nichts.
Wir lebten noch unterhalb des vorgeschriebenen Proviantsatzes. Gemäß Speiserolle hatte jeder einmal in der Woche 50 g Bohnenkaffee zu beanspruchen, den wir dann alle am Sonntag zusammenwarfen und uns eine anständige Tasse Kaffee gönnten. Auch standen uns pro Woche zwei Eier zu, die wir dann zu unserem Kaffee zum Frühstück verspeisten. Die Speiserolle billigte uns auch jede Woche einen Zipfel Dauerwurst, eine Scheibe Käse, etwas Zucker und ein Scheibchen Butter zu, aber unser Alter fuhr eben unter dem Satz der Speiserolle. Nicht gespart wurde an Zucker und schwarzem Tee. Nach dem Frühstück törnten (arbeiteten) die anderen an Deck zu, während ich das Mittagessen kochen musste. Da es damals auf den Kümos weder Kühlschränke, geschweige denn Kühlräume gab, wurde, wenn die Reise länger dauerte, wie in historischen Seefahrtszeiten viel Rauch- oder Salzfleisch verwendet. Nur während der Hafenliegezeiten und zwei Tage danach konnte man frisches Fleisch kaufen und verzehren. Am Essen wurde radikal gespart, und wir hatten an Bord eigentlich immer Hunger. Es wurde auch ständig über das Essen gemeckert, meistens berechtigt, aber gelegentlich auch unberechtigt. Beschwerden beim Alten hatten fast immer Entlassung zur Folge, denn das Thema Proviant und Essen an Bord war innerhalb der deutschen Seefahrt eine Heilige Kuh, die man nicht anzutasten hatte. Man konnte sich über die Arbeit, die Behandlung oder die Vorgesetzten beschweren, nicht aber über das Essen. So wurde meist intern unter der Back über den Fraß oder die zu kleinen Portionen geschimpft und da ich ja gewissermaßen für das Essen zuständig war, musste ich dafür herhalten. Ob ich Schuld hatte oder nicht, spielte keine Rolle. Die Speisepalette reichte von der Linsensuppe über Labskaus, „Frische Suppe“ bis zum seltenen Braten im Hafen. Satt wurden wir nie.
Nur einmal im Monat konnten wir uns den Bauch voll schlagen: Da gab es „Plum un Klüten“, ein altes norddeutsches Gericht: Backobst wurde mit einer Speckseite zusammen gekocht, dazu gab es mit Wasser hergestellte Mehlklöße. Jeder von uns bekam ein gut bemessenes Stück Speck und wir aßen, bis wir nicht mehr konnten. Ein beliebtes Schlagwort des Alten war: „Ihr seid hier nicht an Bord, um satt zu werden, sondern nur zum Überleben.“ Wenn unser „Giftzwerg“ einen getrunken hatte, änderte er sein Motto in: „Wir wollen euch hier nicht mästen, sondern nur am Leben erhalten.“ Abends gab es immer nur Bratkartoffeln mit Zwiebeln, Tag für Tag, Monat für Monat. Uns hingen die Bratkartoffeln zum Halse raus, aber man hatte wenigstens etwas im Magen. Ich weiß nicht, ob es auf anderen Kümos besser war, bei uns jedenfalls war Schmalhans Küchenchef. Versaute ich einmal ein Mittagessen, gab es „was an die Wäsche“ oder ich musste die ganze Woche den Fraß aufgewärmt alleine essen. Einmal hatte ich aus Gedankenlosigkeit die Bohnen zweimal gesalzen, was ich erst beim Abschmecken merkte. In meiner Angst und Verzweiflung wollte ich das durch eine gleiche Menge Zucker wieder ausgleichen. Der Fraß schmeckte wie „Knüppel auf den Kopf“, aber irgendwie gelang es mir, die anderen und sogar den Steuermann zu überzeugen, dass es an den Bohnen gelegen habe. Gott sei Dank waren es unsere letzten Bohnen gewesen.
Ein großes Problem war für mich auch der verflixte Kohleherd, der bei Regenwetter überhaupt nicht zog und ich dann in Folge das Essen nicht rechtzeitig fertig bekam. Dann erschien der Alte und fluchte fürchterlich. Sein Lieblingswort war dabei „Wichskopf“: „Du verfluchter Wichskopf bist sogar zu dumm zum Feuermachen, dich sollte man über Bord werfen.“ Von den Kommentaren und Flüchen der übrigen unter der Back ganz zu schweigen. Hatte ich einmal vergessen, den Kombüsen- oder Scheißhaustank achtern mit der Hand aufzupumpen, drehte er durch und ich musste sehen, dass ich wegkam. Bekam er mich zu fassen, gab es Prügel und an eine Gegenwehr war nicht zu denken. Während der Alte und der Steuermann in einer kleinen Nische neben der Kombüse aßen, musste ich das Essen für uns in besonderen „Backen“, drei Behälter übereinander in einem Traggestell, nach vorne unter die Back schaffen. Bei schlechtem Wetter oder Deckslast war das ein abenteuerliches Unternehmen und nicht immer kam ich heil an. Dann gab es vorne kein Essen und die Stimmung war explosiv. Bei zu schwerem Wetter wurde nicht gekocht und es gab nur „kalt“. Die Mahlzeit bestand dann meistens aus einer kleinen Dose Corned Beef und ein paar Ölsardinen.
Kamen wir einmal nach Schweden, verkauften wir alle „schwarz“ unsere eine Flasche „Eau de Vin“, die uns der Alte pro Monat aus dem Kantinenschrank zusammen mit den Zigaretten aushändigte. Wir bezahlten für die Flasche zollfrei 1,36 DM und verkauften sie in Schweden für ca. 20 Kronen, was in etwa 18 Mark entsprach. Da in Schweden der Alkoholverkauf bzw. -konsum staatlich kontrolliert war, was einem Verbot gleichkam, war der Zoll besonders scharf, und die „Schwarze Gang“ filzte jedes Schiff. Die Strafen waren horrend. Es braucht wohl nicht erwähnt zu werden, dass der Alte und der Steuermann den Schnaps kistenweise, im Maschinenraum versteckt, schmuggelten. Sie wurden nie erwischt. Das fuchste uns schon, da wir mit nur einer Flasche abgespeist wurden. Am liebsten hätten wir sie beim Zoll hochgehen lassen, aber das wagte dann doch niemand. Wenn wir unsere Flasche verkauft hatten, stürzten wir mit dem Geld in die nächste Konditorei, wo wir uns dafür Kuchen kauften, den wir gleich an Ort und Stelle verputzten. Das muss furchtbar ausgesehen haben, denn einmal fragte uns die Verkäuferin, ob wir Deutsche seien und es bei uns an Bord keinen Kuchen gäbe. Wir schilderten unsere Situation in den düstersten Farben, und der armen Frau muss eine Gänsehaut heruntergelaufen sein. Jedenfalls durften wir während der Liegezeit in diesem Hafen nach Geschäftsschluss den Bruch oder die nicht verkauften Reste abholen. Wir veranstalteten dann vorne richtige „Kuchenfressorgien“. Einmal kam der Steuermann, der misstrauisch geworden war, und dann ging mit ihm der primitive Neidinstinkt durch. Er bekam einen roten Kopf und schrie: „Nur jeden Tag Kuchen fressen und nichts in der „Mau“ haben.“ Anschließend verschwand er wutentbrannt aus unserem Logis.
In der Kombüse lernte ich auch das in der Rangordnung noch über mir stehende „Besatzungsmitglied“ kennen, mit dem mich ein 17monatiges Hass- und Freundschaftsverhältnis verbinden sollte: die bereits erwähnte vierjährige Bordhündin des Eigners, die sich schon zwei Jahre an Bord befand und außergewöhnliche Privilegien besaß. Der Rasse nach war sie eine mittelgroße schwarze Pudelhündin aus Dänemark mit Stammbaum. Gleich auf meiner ersten Reise verscherzte ich mir meine Sympathien bei unserer Hundelady „Daisy“. Da ich ja kein Bettzeug besaß, musste ich auf der nackten Seegrasmatratze in meinen Arbeitsklamotten schlafen. Da jeder sein eigenes Bettzeug hatte, war nirgends eine Decke aufzutreiben. In einem Anfall von unbegreiflicher Menschlichkeit, die ihm gewiss enorme Überwindung gekostet haben muss, gab mir der Alte Daisys Decke. Jeden Morgen, wenn ich in die Kombüse kam, roch sie ja an mir ihre geliebte Decke und reagierte äußerst aggressiv mit gefletschten Zähnen. Um das Maß voll zu machen, stahl ich auch einen Teil von ihrer Milch. Ich wusch also am Abend vorher ihren Napf besonders gründlich sauber und wartete dann am anderen Morgen, bis der Steuermann die Milch eingeschüttet hatte. Wenn er gegangen war, schüttete ich die Hälfte davon in eine kleine Dose und verdünnte Daisys Milch mit Wasser. Die geraubte Milch brachte ich dann nach vorne für unsern Kaffee. Daisy war nicht dumm, merkte das und vergaß es mir nie. Wir wurden nie gute Freunde. Aber irgendwie waren wir auch aufeinander angewiesen und das verband uns. Ich weiß nicht, wie oft sie mich hasserfüllt angebellt hat, aber ich war der einzige an Bord, der sie manchmal an Land ausführte und das wusste sie. Meistens war sie beim Alten oder Steuermann auf der Brücke, und nur bei schwerem Wetter verkroch sie sich bei mir in der Kombüse. Die Kümos rollen bei schwerer See fürchterlich, und es war mir dann oft nicht möglich, nach vorne zu kommen, ohne über Bord gespült zu werden. Dann saßen wir beide in Notgemeinschaft zusammengedrängt in der Kombüse wie zwei Häufchen Elend und warteten auf Wetterbesserung. War alles vorbei, bestand wieder der alte gespannte Zustand zwischen uns.
Nach dem Geschirrabwaschen und „Aufklaren“ in der Küche und vorne und dem Reinigen der Kammern des Alten und des Steuermanns begab ich mich auf See auf die Brücke um steuern zu lernen. Der Steuermann schickte dann den Rudergänger zum Arbeiten an Deck, während ich bis 17 Uhr am Ruder stand. Das erste Mal am Steuerrad stehen zu dürfen, war für mich ein erhabener und ehrfurchtsvoller Augenblick. Das große hölzerne Steuerrad war mit Kettenzügen mit dem Ruderblatt verbunden und man musste schon kräftig drehen, damit das Schiff gehorchte. Bis ich soweit war, dass ich nach dem Kompass steuern konnte, musste ich viele Fußtritte und Flüche einstecken. Manchmal, wenn ich bei gefährlicher Annäherung eines anderen Schiffes aus dem Ruder scherte, sprang der Alte oder der Steuermann ans Ruder, wobei ich weggeschleudert wurde, bis die Situation wieder klar war. Anschließend hagelte es Flüche und Drohungen bis zum „Sack“. Den „Sack geben“ bedeutete die Entlassung und war die häufigste und gefährlichste Drohung. Denn war man entlassen und hatte dadurch eine schlechte Fahrzeit im Seefahrtbuch, musste man mit diesem Makel eventuell monatelang auf ein neues Schiff warten.
Entlassen konnte der Kapitän nach Belieben. Ein Grund fand sich immer. Nur die 48 Stunden Kündigungsfrist musste er einhalten. So war die Drohung: „Im nächsten Hafen bekommst du den Sack!“ die schlimmste und zog immer. Um 17 Uhr, nach dem Steuern, musste ich schon wieder das Abendessen, eben die erwähnten Bratkartoffeln, bereiten. Nach dem Abendessen und der „Backschaft“ ließ mich der Alte noch bis 20 Uhr steuern. Zwischendurch hatte man mir auch schon beigebracht, wie man die Maschine auf See während der Fahrt „abschmiert“ und mit der Handpumpe den Brennstofftank aufpumpt. So lösten mich der Alte oder der Steuermann alle zwei Stunden am Ruder ab und schickten mich zum Abschmieren in den Maschinenraum. Um etwa 21 Uhr durfte ich dann nach vorne zum Schlafen gehen, wo ich mich nach einem Fünfzehnstundentag todmüde in die Koje fallen ließ. Nach den Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes hätte man mir einige Pausen zubilligen müssen. Aber daran hielt sich niemand in der Küstenschifffahrt.
Im Hafen musste ich mit an Deck arbeiten. Es gab einen Begriff an Bord, welchen die Kümoschipper und Reeder erfunden hatten: „Schiffsinteresse“. Das Schiffsinteresse erfordere von der Besatzung, auch mal ohne Bezahlung zu arbeiten. In diesem Sinne wurde auch das Wort „Schiffssicherheit“ oft verwendet, denn Arbeiten, die der Sicherheit des Schiffes dienten, durften nicht verweigert werden. Auch wenn es sich nur um Instandsetzungsarbeiten handelte, wurden sie oft als der Schiffssicherheit dienend deklariert. Man konnte ein Schiff außenbords malen lassen und sagen, dies diene der Schiffssicherheit, da ja der Rostfraß das Schiff angreife. Es gab dafür natürlich genau definierte gesetzliche Regelungen, aber wir waren in diesen Dingen unerfahren und kannten es nicht anders. Zeigte jemand zu wenig „Schiffsinteresse“ und wollte während der Hafenliegezeit im Sommer nach 18 Uhr nicht ohne Bezahlung arbeiten, wurde er bei günstiger Gelegenheit wegen Interesselosigkeit und mangelnder Zuverlässigkeit entlassen. Auch mussten wir damals froh sein, überhaupt eine Anstellung an Bord zu haben.
Unsere Reise ging also nach Finnland, wo wir in einem kleinen Hafen, er hieß wohl Haukipudas, auf Reede Schnittholz luden. Das Holz wurde mit Lastkähnen an das Schiff gebracht und dann mit unseren zwei Ladebäumen in den Laderaum gehievt. Dort wurde es Brett für Brett von Frauen in Lagen gestaut und festgekeilt. Es war das erste Mal, dass ich Frauen als Hafenarbeiterinnen sah. An den Motorwinden für die Schwingladebäume lösten sich der Steuermann, der Leichtmatrose Günther und unser Jungmann „Hundepint“ ab. Wir Schiffsjungen durften noch keine Winde bedienen. Im Grunde waren auch der Leichtmatrose und Jungmann als „Junggrade“ nicht dazu berechtigt, und der Alte hätte zwei erfahrene Windenleute von Land anheuern müssen. Aber solange kein Unfall geschah und keine Kontrolle stattfand, nahm er es eben auf seine Kappe. Es durfte eben nichts passieren! Wir waren natürlich alle scharf auf die Frauen, da auch einige sehr junge dabei waren, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass sich eine von ihnen verführen ließ. Wahrscheinlich unterstanden sie einer strengen Disziplin und hätten sofort ihren Arbeitsplatz verloren. Da keine von ihnen deutsch und wir nicht finnisch sprachen, konnten wir uns mit ihnen nur in Zeichensprache verständigen, was viel Gekicher und Gelächter auslöste. Wenn unser Steuermann das mitbekam, brach wieder sein primitiver Neidinstinkt durch, und er trieb uns zur Arbeit an.
War der Unterraum vollgestaut, musste die Luke seefest verschlossen werden, was harte Knochenarbeit bedeutete. Auf die geschlossene Luke kam eine Deckslast Holz. Da die Arbeiter während dieser Unterbrechung nicht weiter stauen konnten und Zeit Geld bedeutete, musste jeder von uns heran, selbst der Alte. Zuerst mussten mit den Ladebäumen und den Winden die schweren „Scheerstöcke“, große eiserne Querträger, von oben in die Luke eingesetzt werden. Dadurch wurde die Luke in einzelne Partien geteilt, in die dann Holzlukendeckel, ca. 150 Stück, per Hand eingesetzt wurden. Jeder Holzlukendeckel war zwei Meter lang und an den Enden mit Eisen beschlagen, so dass nur zwei Mann sie heben konnten. Sie wurden von zwei Leuten vom Deck auf das Lukensüll gestemmt und dort von zwei anderen in den einzelnen Partien ausgelegt. Anschließend wurde die so geschlossene Luke durch drei schwere übereinandergelegte Persennige abgedeckt und durch Holzkeile an den Lukensüllseiten festgekeilt. Danach wurde das Ganze durch zwölf schwere Eisenbügel, die querschiffs lagen, mit Schraubverschlüssen befestigt. Darüber kam dann die Holzdeckslast, die nach Beendigung des Ladens durch schwere Ketten gesichert wurde, die quer zum Schiff über die Ladung gespannt werden mussten.
Solche Decksladungen mit Schnittholz waren für kleine Kümos bei schlechtem Wetter äußerst gefährlich, besonders im Winter, wenn Vereisungsgefahr bestand. Schlägt die See nämlich eine Zeitlang über die Deckslast, saugt sich das Holz voll Wasser und wird an der Luvseite schwerer. Durch Vereisung erhöht sich das Gewicht, so dass das Schiff Schlagseite bekommen und kentern kann. So passierte es manchmal, dass man morgens auf See bei 20 Grad oder mehr Schlagseite aufwachte. Dann war „Holland in Not“, und es bestand höchste Lebensgefahr. Schlugen nun weitere Brecher auf die Schlagseite, konnte das Gewicht noch vergrößert und somit das Schiff zum Kentern gebracht werden. Der Alte drehte das Schiff dann in einer solchen Situation mit dem Bug in den Wind, und wir mussten angeseilt bei dem schweren Wetter und der Schräglage die Decksladung in die See werfen: Eine mörderische und gefährliche Arbeit! Man musste die Ketten, die in der Mitte mit einer Spannschraube und einer Slipvorrichtung die Ladung zusammenhielt, „slipen“ (gleiten / lösen), so dass die Ladung durch die Schräglage in die See stürzte und das Schiff sich aufrichten konnte. Da es mehrere Ketten waren, wurde soviel Ladung „geslipt“, bis die Gefahr vorüber war. Bei diesem sogenannten „Seewurf“ bestand meist die Gefahr, dass man selbst mit der Ladung in die See gerissen wurde, besonders bei Vereisung und nachts. Eine andere unangenehme Gefahr bei Holzdecksladungen, die ich auch selbst erlebt habe, konnte dadurch entstehen, dass bei schwerer vorderlicher See die Decksladung nach vorne rutschte und den Eingang zu unserem Logis unter der Back blockierte. Man war dann vorne wie eine Ratte in der Falle gefangen, denn der Eingang war damit durch Tonnen von Holz versperrt, ein furchtbares Gefühl. Wir saßen nun stunden- oder tageweise vorne eingesperrt, bis uns bei Wetterbesserung die drei Mann von achtern mit Äxten, Brechstangen und Sägen befreiten. Selbst bei ruhigem Wetter und leichtem Seegang konnte die Deckslast gefährlich werden. Bei Vereisung konnte man trotz der vorgeschriebenen Stützen und Strecktaue ins Rutschen kommen und dabei außenbords gehen. Für mich als Kombüsen-Moses war es beim Transport der schweren „Backen“ bei Seegang und Glatteis besonders gefährlich, das Essen nach vorne zu bringen, denn ich hatte nur eine Hand zum Festhalten frei. Auch für die Wachablöser, die bei stockfinsterer Nacht über die Deckslast turnen mussten, war es immer wieder ein gefährliches Unternehmen, und mancher Seemann verschwand dabei für immer.
Unsere Holzladung aus Finnland ging nach Lübeck, wo wir an einem Freitagmorgen an der Holzkai von „Krages“ festmachten. Aus irgend einem Grunde sollte erst am Montag gelöscht werden. Der Alte und der Steuermann fuhren übers Wochenende zu ihren Familien nach Hamburg. Der Alte nahm Daisy mit und drohte uns mit fürchterlichen Strafen, falls in seiner Abwesenheit etwas passieren sollte. Da ich der jüngste Dienstgrad an Bord war und sowieso kein Geld hatte, wurde ich zur Hafenwache verdonnert. Der andere Moses wohnte in Lübeck und durfte nach Hause fahren. Günther und „Hundepint“ wollten, bevor sie am Samstagvormittag nach Hause fuhren, noch abends „an die Küste“ und in der „Kajüte“, einer beliebten und berüchtigten Seemannskaschemme, zwei Damen abschleppen. In der „Kajüte“ traf sich die ganze Küstenschifffahrt. Die dort tätigen Mädchen waren wandelnde Schifffahrtsregister, die über jedes Kümo und dessen Besatzung das Neueste wussten. Gleichzeitig waren sie trinkfest und hatten ein sehr weites Herz. Natürlich ließen sie sich für ihre Dienste bezahlen, aber wenn man ihr Typ war, spielte Geld nicht mehr immer eine Rolle.
Es war das erste Mal, dass ich mit meinen 16 Jahren, wenn auch nicht als Beteiligter, mit der Sexualität an Bord konfrontiert wurde. Natürlich war unser Hauptgesprächsstoff unter Kollegen immer das „Thema Nr. 1“, die Frauen und unser „Hundepint“ und auch Günther, der Leichtmatrose, waren wahre Experten, was Nutten und „leichte Damen“ betraf. Besonders „Hundepint“ war trotz seiner relativen Jugend an der Küste bei den Damen als großer „Bumser“ und feuriger Liebhaber berühmt. Gerade seine abnormale Männlichkeit war bei den Mädchen an der Küste als Attraktion bekannt und sehr gefragt. Außerdem war er groß, blond und blauäugig und sah gut aus. Wenn er einmal an der Back seine amorösen Abenteuer in allen Details schilderte, konnten wir beiden Mosese nur vor Neid erblassen. Gegen 2 Uhr morgens wurde ich durch lautes Singen und Frauengelächter aufgeweckt. „Hein Seemann“ kam von Land zurück! Die lustige Gesellschaft begab sich ins Logis, und Günther schob mir eine Flasche abgestandenen Sekt durch den Vorhang meiner Koje und rief: „Trink mal einen Schluck, „Seemann“, und begrüß unsere Damen. Die Damen waren eine 22jährige Brünette mit ansehnlicher Figur und schwesterlichen Gesichtszügen, die an der „Küste“ unter dem Namen „Erbse“ bekannt war, und eine ca. 24jährige gut proportionierte Blondine mit blauen Augen und überreifem Babygesicht, „Uschi“ genannt, beide erfahrene Dockschwalben. Hundepints „Erbse“ rief plötzlich: „Ist das der „Seemann“? Den muss ich sehen!“ und leuchtete mir mit unserer Petroleumlampe ins Gesicht. „Der ist aber wirklich süß,“ rief sie begeistert aus und fuhr mir mit der Hand routiniert zwischen die Beine. „Und einen süßen Schwanz hat er auch,“ bemerkte sie anerkennend. Anschließend kam man zur Sache und während „Hundepint“ mit „Erbse“ in der oberen Koje verschwand, zog sich Günther mit seiner Uschi in die untere zurück. „Hein Seemann“ kam auf seine Kosten, und die Damen unterhielten sich dabei ungeniert. Am späten Morgen stand eine ziemlich verkaterte Gesellschaft auf, und „Hein Seemann“ machte einen sehr erschöpften Eindruck. Ich brachte schnell eine große Kanne Bohnenkaffee, unsere Sonntagsration, nach vorne und nach ein paar Spiegeleiern, auch Sonntagsration, waren die Stimmung und die alte Kraft wieder hergestellt. „Erbse“ fand mich immer noch süß und versprach, mich am Abend zu besuchen. „Hundepint“ und Günther brachten ihre Damen, nachdem sie abgerechnet hatten, von Bord und fuhren anschließend nach Hause. „Erbse“ kam nicht und ich behielt meine „Unschuld“.
Nach zwei Monaten Küchendienst durfte ich an Deck arbeiten, was ich im Hafen sowieso schon teilweise getan hatte. Ich löste mich mit dem anderen Moses dann jede Woche ab, so dass jeder umschichtig eine Woche Kombüsen- und eine Woche Decksdienst hatte. Unser Kümo bekam ständig Ladung und so waren wir fast ununterbrochen unterwegs. Wir schipperten zwischen England, Holland, Belgien, Schweden, Dänemark, Polen, DDR, Irland, Westdeutschland und Finnland umher und kamen nicht zur Ruhe. Wir kannten fast alle großen Häfen, und manchmal liefen wir Plätze an, die auf keiner Karte verzeichnet waren. Auch luden wir alles, was transportiert werden konnte, von Kohle und Koks über Papier, Stückgut, Schrott, Holz, Kali, Getreide bis zu Granitsteinen aus Gotland, um nur einiges zu nennen. Hatten wir gerade eine Kohleladung aus Cardiff gelöscht und sollten Getreide laden, so wurde der Laderaum in Tag- und Nachtarbeit gewaschen, um nur ja pünktlich zum Ladebeginn bereit zu sein und den Transportauftrag nicht zu verlieren. Meistens erreichten wir den Ladehafen im letzten Moment, und unser Schiff wurde aus dem Stand sofort beladen.
Gefürchtet waren von uns Kohle- und Koksladungen, da wir sie im Hafen selbst im Laderaum trimmen mussten. War der Laderaum bis zum unteren Lukenschacht - ca. ein Meter bis zum Deck - mit Kohle oder Koks beladen, mussten wir auf dem Bauch in die letzten Ecken unter Deck kriechen und sie voll schaufeln. Man lag dann etwa 4 bis 5 Meter vom Lukenschacht entfernt auf dem Bauch unter Deck, ausgerüstet mit Schaufel, Trimmblech und Kabellampe. Nun wurde man von oben durch den Greifer des Krans mit Kohle zugeschüttet und musste unter Deck mit sehr wenig Luft zum Atmen bäuchlings den Freiraum, in dem man lag, zuschütten, indem man über das Trimmbrett hinweg tonnenweise Kohlen in die Freiräume schaufelte. Hatte man einen Berg weggeschaufelt, kam bereits der nächste Greifer voll. Aus lauter Angst vor dem Ersticken schaufelte man dann wieder, um Luft zu bekommen. Für Leute mit Platzangst war das eine furchtbare Tortur, und einige sollen dabei weiße Haare bekommen haben.
Für Jugendliche war das Trimmen strengstens verboten, aber wer kümmerte sich schon darum? Für das Trimmen gab es außer der Überstundenheuer extra Geld, aber nach heutigen Maßstäben war das minimal. Nach dem Trimmen waren wir so fertig, dass uns der Alte einen Schnaps einschenken musste. Auch ich bekam einen. Am liebsten fuhren wir nach Finnland zum Holzladen, da dort nur am Tage gearbeitet wurde und wir mindestens eine Woche Hafenliegezeit hatten. Da auch dort, wie in Schweden, Alkohol rationiert war, konnten wir unsere Flasche „Eau de Vin“ für umgerechnet 20 DM an den Mann bringen und hatten etwas Taschengeld, von dem wir uns Limonade und Eiskreme kaufen und mit den Mädchen schäkern konnten. Die finnischen Mädchen hatten ein sehr weites Herz und „Hein Seemann“ war zufrieden.
Auf diesen Reisen fuhr auch manchmal der Eigner als Kapitän mit, und so lernte ich zum erstenmal diesen eigenartigen Menschen kennen. Er war Mitte fünfzig, grauhaarig, groß und hatte einen ausgeprägten „Spitzkühler“. Günther sagte immer: „Wenn der seinen Schwanz sehen will, braucht er einen Spiegel.“ Unser Eigner besaß das „Große Kapitänspatent A6“ und soll vor dem Krieg als 1.Offizier auf einem großen Passagier gefahren haben. An seiner linken Hand trug er immer einen großen Diamantring, und unser „Giftzwerg“ und der Steuermann begegneten ihm mit großem Respekt. Er sprach immer sehr kultiviert, auch wenn er wütend war. Nur seine Augen wurden dann starr, wie bei einem Fisch und seine gewählte Stimme wurde etwas lauter. Manchmal kanzelte er unseren Alten und den Steuermann ab, und sie schlichen dann wie geprügelte Hunde übers Deck. Unser Arbeitgeber wohnte in einer besseren Gegend von Hamburg, wo er ein eigenes Haus besaß. Er hatte einen Sohn, der bei einer großen Reederei als Zweiter Offizier fuhr und eine 19jährige Tochter, die studierte. Seine Frau fuhr des öfteren mit und machte, so wie ich sie später kennen lernte, einen sehr arroganten und unbefriedigten Eindruck.
Fuhr unser Eigner mit, war sein Lieblingsplatz die Kombüse, und für uns alle an Bord brachen noch schlechtere Zeiten an. Er schnippelte an unseren schon mageren Rationen wie ein Chirurg herum und verwertete alles. Gott sei Dank, dass wir keine Apothekerwaage an Bord hatten. Reichten die Erbsen, Linsen oder Bohnen nicht mehr für eine Mahlzeit aus, wurde alles in einen Topf geworfen und mit übriggebliebenen Fleisch- und Wurstresten zu Mittag serviert. Seine Sparsamkeit nahm so groteske Züge an, dass sie auch den Alten und den Steuermann nicht verschonte. So musste ich nachmittags in der Kombüse den Kaffeesatz vom Morgenkaffee noch einmal aufbrühen. Unser Alte wurde daraufhin so fuchsteufelswild, dass er die Kaffeekanne in die Ecke schleuderte. Daraufhin gab es für ihn und den Steuermann wieder guten Bohnenkaffee. In Finnland, wenn am Sonntag nicht gearbeitet wurde, mussten wir im Sommer unser Rettungsboot aussetzen und alle zusammen auf eine der kleinen verlassenen Inseln rudern und Bickbeeren (Blaubeeren) sammeln. Wenn wir dann, von Mücken zerstochen, mit unseren vollen Eimern und Kreuzschmerzen gegen Abend wieder an Bord waren, gab es keinen von uns, der nicht den Tag herbeisehnte, an dem unser Eigner uns wieder verließ.
Als wir wieder einmal die Schleuse Holtenau in Kiel in Richtung Ostsee verließen und ich an Deck arbeitete, passierte mir ein nicht alltägliches Missgeschick. Es hätte für mich tragisch enden können. Nachdem wir bei sonnigem Wetter gegen Mittag bei Windstärke 3 bis 4 die Kieler Förde verlassen hatten, löste mich der Alte am Ruder ab. Er befahl mir, während die ablösende Wache aß, das Deck mit der „Schlagpütz“, Vorkante (Vorderseite) Brücke abzuspülen. Eine „Schlagpütz“ ist normalerweise ein kleiner, eigens dafür hergestellter Eimer mit einer langen Leine dran. Man wirft den Eimer mit einer gekonnten Bewegung über Bord ins Wasser und zieht ihn dann mit Wasser gefüllt an der Leine wieder hoch und wäscht damit das Deck. Dies wiederholt man so lange, bis das Deck sauber ist. Aus irgend einem Grund war die „Schlagpütz“ nicht aufzufinden und ich befestigte in meiner Unerfahrenheit unsere dünne Schmeißleine an einem normal großen Eimer. Als ich mich an Deck, Vorkante Brücke, zwischen zwei Pollern (zum Belegen der schweren Schiffsleinen) auf die Reling stellte und die provisorische Schlagpütz mit einem eleganten Schwung ins Wasser warf, wurde ich durch den Fahrtstrom über Bord gerissen. Da dies Vorkante der Brücke passierte und alle anderen unter Deck beim Essen waren, wurde der Unfall von niemandem bemerkt. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt mein bestes knallgelb-rotes Landgangshemd an, da die zwei Arbeitshemden zur Wäsche eingeweicht waren. Dieser Tatbestand rette mir wahrscheinlich das Leben. Während ich in der unruhigen See um mein Leben schwamm und das Heck meines Schiffes am Horizont immer kleiner wurde, bemerkte ein großer Zollkreuzer des Wasserzolls mein knalligfarbenes Hemd in der See und drehte sofort auf mich zu. Mir wurde ein Rettungsring zugeworfen, an dem ich mich mit letzter Kraft festhielt. Anschließend wurde ich an Bord gezogen. Da mein Schiff noch eben in der Ferne zu sehen war, brauste der Zollkreuzer mit mir mit äußerster Maschinenkraft hinterher, wobei wir gut eine halbe Stunde brauchten, bis wir längsseits waren.
Nach einigen Signalen mit dem Typhon bemerkte unser Alter, dass irgend etwas im Gange war und stoppte die Maschine. Ich werde nie sein entgeistertes Gesicht vergessen, als er mich mit offenem Mund anstarrte. Auch der Steuermann und die anderen an Bord, die durch den Lärm an Deck gelockt worden waren, starrten mich wie einen Geist an. Aber der Alte wäre nicht der Alte gewesen, hätte er nicht reagiert, wie er reagiert hat. Nachdem sich seine erste Verblüffung gelegt hatte, lächelte er zuerst und dann legte er los und schrie: „Wo kommst du denn her, du Wichskopf, du dummes Schwein. Zu dumm, eine Pütz aufzuschlagen. Dich hätte die Hebamme gleich bei der Geburt erwürgen sollen, du Wichskopf.“ Dieser Wutanfall verschlug selbst den Zollbeamten die Sprache, und der Kapitän des Zollkreuzers fuhr unseren Alten an: „Nun seien Sie aber mal ruhig, Kapitän, seien Sie froh, dass wir den Jungen überhaupt gefunden haben und nun schicken Sie ihn mal unter Deck, damit er sich trockene Klamotten anziehen kann.“ Der Alte war nicht zu bremsen und schrie mich an: „Verschwinde, du Wichskopf und ab in die Kombüse. Die Pütz zieh ich dir von der Heuer ab, die bezahlst du mir.“ Ich brauchte die Pütz nicht zu bezahlen, verbrachte aber wieder einige Zeit in der Kombüse.
Manchmal, wenn wir aus der Ostsee durch den Kiel-Kanal in die Elbe kamen, um in die Nordsee zu gehen, mussten wir in Cuxhaven „vor Wind gehen“. Dies geschah immer dann, wenn der Seewetterbericht für die Nordsee Sturmwarnung gegeben oder gar Orkan gemeldet hatte und deshalb mit Sturmschäden oder Gefahr des Untergangs zu rechnen war, denn jedes Jahr soffen einige Kümos bei Unwetter ab. Jetzt musste Sicherheit vor Zeit gehen und auf Wetterbesserung gewartet werden. Dann lagen Dutzende Kümos im Schutz des Hafens längsseits zusammen und es wurde ein regelrechtes Familientreffen. Die Kapitäne und Steuerleute, die sich untereinander kannten, besuchten sich gegenseitig, und es wurde furchtbar getratscht und gesoffen. Auch wir Mannschaftsleute besuchten uns gegenseitig unter der Back und zogen über unsere Vorgesetzten her. Wir verglichen die Verpflegung miteinander und endeten schließlich beim „Thema 1“, den Frauen. Dabei soffen wir je nach Jahreszeit Grog oder „Charly Peng“, billigen Schnaps, aus Tassen, denn Gläser gab es nicht unter der Back. Dazu sangen wir schmutzige und unanständige Lieder, bei denen sich die feinen Leute an Land bekreuzigt hätten. Die Kapitäne und Steuerleute sahen solche Besuche und Verbrüderungen nicht gerne, denn viele ihrer Schandtaten machten danach wie ein Lauffeuer an der Küste die Runde. Am nächsten Morgen hatten wir dann alle einen schweren Kopf und der Steuermann trieb uns, wenn nicht gerade Sonntag war, gnadenlos bei der Arbeit an. Aber auch der Alte und der Steuermann sahen sehr mitgenommen aus, was uns ein wenig mit Genugtuung erfüllte.
Dauerte der Sturm länger, gingen wir, die Bordwache ausgenommen, abends an Land, meistens in die „Kugelbake“. Ein anderes Ziel war das Lokal mit dem seriösen Namen „Stadt Hamburg“, das aber von anständigen Bürgern gemieden wurde und als berüchtigtes Seemannslokal keinen guten Ruf genoss. Es verkehrten dort hauptsächlich Fischmatrosen, leichte Mädchen, Abschaum der Küste und Besatzungen der Kümos. Abends wurde die Kaschemme von mehr als hundert Leuten frequentiert und es ging hoch her. Viele dort verkehrende Mädchen arbeiteten in den Fischfabriken und mussten am nächsten Morgen wieder zur Arbeit. Manche fanden sich auch morgens an Bord eines Schiffes wieder. Manchmal kam es in der „Stadt Hamburg“ zu wüsten Massenschlägereien und wer schlau war, machte sich rechtzeitig aus dem Staub. Auch Schlägereien unter Damen kamen vor und ich habe selbst gesehen, mit welcher Erbitterung und Hass sie aufeinander losgingen. Da war nichts Menschliches mehr, da wurde gekratzt, gebissen, getreten, die Haare gerauft. Dazu gesellten sich die anfeuernden Kommentare und Rufe der angetrunkenen Gäste. Die Nachtwachen an Bord mussten bei so vielen versammelten Kümos höllisch aufpassen, dass nicht die Schmeißleinen, Pützen etc. geklaut wurden, denn es galt nicht als unehrenhaft, dergleichen bei einem Nachbarschiff zu besorgen. Nur erwischen lassen durfte man sich dabei nicht, denn dann gab es eine Tracht Prügel durch die Besatzung des geschädigten Schiffes. War der Sturm vorbei, setzte sich die ganze Kümoflotte in Bewegung und lief in die Nordsee aus, was immer ein imposanter Anblick für die Landratten auf der Promenade war.
Für jeden gibt es ein erstes Mal, und auch ich verlor meine „Unschuld“ mit 16 Jahren an einem denkwürdigen Tag in Rotterdam. Wenn unser Schiff auch fast immer neue Ladung bekam, so kam es auch einmal vor, dass wir in Ballast nach Rotterdam gehen und dort auf Ladung warten mussten. Wir lagen an der Parkkaade und warteten auf Order von unserem Agenten. Während dieser Zeit durfte niemand das Schiff verlassen und die Maschine war immer klar zum Auslaufen. Denn, war unser Ladehafen bekannt, wurden sofort die Leinen losgeworfen und in See gegangen. Tagsüber waren wir meistens an Deck oder außenbords auf Stellagen mit Instandsetzungs- oder Malerarbeiten beschäftigt. Dabei beobachteten wir die vorbeipromenierenden Spaziergänger und besonders die jungen Mädchen. Die Leute blieben manchmal stehen und sahen uns bei der Arbeit zu oder fragten uns dies und jenes, und wir fühlten uns wie echte Stars. Kamen wir mit ein paar hübschen Mädchen ins Gespräch, vergaßen wir unsere Arbeit, bis uns der Steuermann wieder auf Vordermann brachte. War am Sonnabend bis 17.00 Uhr noch immer keine Order eingegangen, hatten wir, ausgenommen die Bordwache, bis Montag Landgang.
Abwechslung gab es in Rotterdam genug und wer sein Geld unbedingt durchbringen wollte, brauchte nur durch den Maastunnel auf die andere Seite der Maas nach Katendrecht zu gehen, das Pendant zur Reeperbahn in Hamburg-St.Pauli. War „Hein Seemann“ besonders leichtsinnig, versackte er in einer der berüchtigten Kaschemmen, etwa in „Walhalla“ und wurde mit einiger Wahrscheinlichkeit zusammengeschlagen und ausgeraubt. Ging er danach zur niederländische Polizei, hatte er doppeltes Pech, denn die war damals auf die Deutschen gar nicht gut zu sprechen und sperrte ihn erst einmal ein. Aber es gab auch gute Lokale, wie z.B. die „Victoria Bar“, wo „Hein Seemann“ auf seine Kosten kommen konnte. An einem solchen Sonntagnachmittag an der Parkkaade drückte mir der Alte in einem Anfall von Großmut 2 ½ Gulden in die Hand mit der Order, Daisy, unsere Hündin, ein wenig an Land spazieren zu führen.
Es war Spätsommer. Die Sonne schien. Mit einer Leine ausgerüstet gingen wir beide frohen Mutes an Land. Nachdem wir auf der Promenade hin- und hergelaufen waren, und Daisy sämtliche Laternenpfähle und Ecken nach Artgenossen beschnüffelt hatte, hielten wir Ausschau nach einem Eisstand, denn genau wie ich hatte Daisy eine sehr große Vorliebe für Eiscreme. Sie konnte Unmengen davon verschlingen. Die Portion kostete damals 50 Cent und wir mussten nur noch einen Stand finden. Da es mittlerweile langsam dunkel wurde und die Buden und Kioske geschlossen hatten, fiel mir nur noch das große Café im Park neben uns ein, welches bis Mitternacht geöffnet war. Dort gab es einen angeschlossenen Stand, der an Spaziergänger und Pärchen Limonade und Eiscreme verkaufte. Das Café war eines der besseren Etablissements mit einem großen Garten mit Tischen und Stühlen, wo die Gäste von schwarzgekleideten Kellnern bedient wurden. Aus dem Inneren tönte leise Tanzmusik und ich nahm an, dass dort auch getanzt wurde. In dem angeschlossenen Eisverkaufstand bediente eine große blonde junge Dame. Ab und zu kam ein Kellner zu ihr und holte eine Portion Eis für die Gäste im Inneren des Cafés. Ich bestellte bei ihr für Daisy und mich zu je 50 Cent eine Tüte Eis und nachdem Daisy auf zwei Beinen bei mir „Bitteschön“ gemacht hatte, fielen wir über unsere Portionen her. Ich weiß nicht, wer von uns beiden sein Eis zuerst verzehrt hatte. Jedenfalls bestellte ich uns eine zweite Portion, als die Bedienung mich in ziemlich gutem Deutsch fragte, ob ich Deutscher sei. Als ich dies bestätigte, wurde sie sehr erregt und erzählte mir, dass ihre Eltern während des 2. Weltkrieges bei dem großen Bombenangriff auf die Altstadt durch die Deutschen umgekommen seien.
Sie steigerte sich in solche Erregung und Erbitterung, dass ein Kellner angelaufen kam und fragte, was los sei. Der Kellner war schon ein älterer und grauhaariger Mann in den Fünfzigern, der ausgezeichnet deutsch sprach. Er fragte mich, wie alt ich sei und als er erfuhr, dass ich erst 16 Jahre zählte, machte er ihr klar, dass ich damals ein kleiner Junge von vier Jahren gewesen sei und gewiss nicht für den Tod ihrer Eltern verantwortlich zu machen sei. Als er mich nach meinen Eltern fragte und erfuhr, dass ich Vollwaise und meine Mutter schon ein Jahr nach meiner Geburt gestorben sei, mein Vater als Soldat gefallen war, schüttelte er den Kopf. „Weißt du was, „Meisje“, wandte er sich an die junge Dame, „im Grunde genommen seid ihr beide Opfer des Krieges. In einer Stunde wird die Bude sowieso dicht gemacht. Ich löse dich jetzt ab, und du und der Junge geht irgendwohin und trinkt eine Limonade oder esst ein Eis zusammen und erzählt euch was.“ Sie übergab diesem bemerkenswerten Mann die Kasse und wir machten uns auf den Weg in Richtung Jachthafen, wo noch einige Straßencafés und Lokale offen hatten und wo man draußen an den Tischen sitzen konnte. Sie fragte mich unterwegs, was ich denn in Rotterdam machen würde und ich erzählte ihr, dass ich Seemann sei und als Schiffsjunge auf einem Kümo fahre, das an der Parkkaade läge. Wir lägen dort auf Abruf und ich hätte die Order bekommen, unseren Bordhund auszuführen.
Unterwegs hatte ich Zeit, sie zu betrachten und so ist sie mir in Erinnerung geblieben: Ende zwanzig mit einer guten Figur, hübschem Gesicht und freundlichen blauen Augen, blond, schlank und sehr gebildet. Sie war etwas größer als ich und hatte alles, wovon ein junger Seemann nur träumen konnte. Als wir uns einem der gemütlichen Cafés näherten, kam ich in große Verlegenheit, denn ich hatte von den 2 ½ Gulden, die der Alte mir gegeben hatte, nur noch ½ Gulden, also 50 Cent übrig. Damit konnte ich keine Dame einladen. Daisy, die Eis witterte, zog nun ganz wild an der Leine und ich wurde noch verlegener, bis „Meisje“, das holländische Wort für Mädchen, mich fragte: „Was ist denn mit dir los, Seemann, stimmt etwas nicht?“ Ich druckste herum und gestand ihr schließlich verlegen, dass ich nur noch 50 Cent hätte und dies für uns drei doch wohl etwas zu wenig sei. Darüber musste sie herzlich lachen und sagte: „Da muss wohl die reiche Dame den armen Schiffsjungen und den armen Bordhund einladen.“ Ich berichtete ihr, wie ich bei meinen Großeltern und meiner Tante aufgewachsen war und wie es bei uns an Bord zuging. Sie erzählte mir, wie sie bei dem großen Bombenangriff auf Rotterdam, bei dem ihre Eltern ums Leben gekommen waren, bei ihrer Tante zu Besuch gewesen war und vom Tod ihrer Eltern später erfahren habe. Ihre Eltern wären bis zur Unkenntlichkeit verbrannt gewesen, und auch sie sei von ihrer Tante großgezogen worden.
Daisy und ich hatten jeder eine riesige Portion Eis gegessen, während „Meisje“ nur eine Limonade getrunken hatte. Die Zeit verging wie im Fluge. Als wir aufbrachen, war es schon um Mitternacht, aber wir hatten es nicht sehr weit zu ihr nach Hause. Es war eine eigenartige Situation, zwei Menschen und ein Hund in einer großen Stadt, die sich vorher nie gesehen hatten, die aber durch einen merkwürdigen Zufall an diesem Tag zusammengefunden hatten. Ich schildere dies alles so ausführlich, weil dieser Tag in meinem Leben einen bleibenden Wert in meinen Erinnerungen hat, den ich nie vergessen werde. „Meisje“ lebte in einer großen Wohnung mit hohen Fenstern. Sie hatte sie von ihrer Tante geerbt. Ehrfürchtig betrachtete ich das große Sofa, die antiken Möbel im Wohnzimmer, die alten Gemälde an der Wand, das große Bett im Schlafzimmer. Im Vergleich mit unserem winzigen Logis unter der Back kam ich mir in dieser Wohnung wie in einem Palast vor. Daisy, von dem vielen Eis ermattet, ließ sich auf einem der weichen Sessel nieder und war kurz darauf eingeschlafen. „Meisje“ kochte uns starken Tee und fragte mich, wie ich an Bord genannt werde. Ich erzählte ihr, dass Schiffsjungen an Bord nicht mit Namen gerufen werden, sondern allgemein Moses. Da wir aber schon einen solchen hätten, würden mich alle „Seemann“ nennen. Nur der Steuermann nannte mich aus einem mir unerklärlichen Grund „Edsche“.
Sie sagte mir, dass ihr Moses am besten gefiele und fragte mich, ob ich als Seemann schon viele Mädchen geküsst habe. Um meine Männlichkeit zu beweisen, gab ich natürlich furchtbar an, was für ein toller Kerl ich manchmal sei. Sie lachte mich an und sagte plötzlich: „Dann küss mich doch, Moses. Aber irgendwas machte ich dabei verkehrt, denn sie lachte entzückt und sagte wörtlich: „Aber doch nicht so, Moses. Das müssen wir erst richtig lernen.“ Sie war eine gute Lehrmeisterin und mir tat sich eine Welt auf, von der ich immer nur an unserer Back (Tisch) von den anderen beim „Thema 1“ gehört hatte, aber bislang nie selbst erleben durfte. „Meisje“ brauchte mich wegen meiner jugendlichen Unschuld und ich sie wegen ihrer fraulichen Reife und Erfahrung. Es war für mich wie ein Traum. Aber nach jedem Traum gibt es ein Erwachen und als ich irgendwann in der Nacht aufwachte, dachte ich mit Schrecken an den Alptraum, der mich an Bord erwartete. Der Gedanke an den Alten, der auf seinen Hund und mich wartete, machte mich ganz krank. Ich weckte Daisy, die ganz fest schlief, leinte sie an und „Meisje“, die inzwischen wach war, brachte mich zur Tür. Dort küsste sie mich und sagte: „Moses, wenn du morgen noch hier bist, komm bitte wieder. Ich brauche dich, ich brauche dich wirklich, versprich es mir. Wenn ihr auslaufen solltet, so versprich mir, dass du mich, wenn dein Schiff wieder nach Rotterdam kommt, sofort besuchst.“ Ich versprach es ihr, aber wie das Schicksal es wollte, kamen wir nicht wieder nach Rotterdam, und ich sollte sie nie wiedersehen.
Mit bangem Gefühl machte ich mich mit dem Hund auf den Weg zum Schiff und richtig, ich hatte die Gangway nicht ganz betreten, als der Alte wie ein böser Giftzwerg aus dem Ruderhaus geschossen kam und schrie: „Daisy, ist dir auch nichts passiert?“ Dann kam ich dran: „Wo kommst du denn her, du Wichskopf“, brüllte er mich an, „weißt du überhaupt, wie spät es ist? Ich erzählte ihm, dass wir uns in der Innenstadt verlaufen und erst jetzt den Weg zurückgefunden hätten. „Verlaufen“, schrie er, „Mensch, du stinkst wie eine indische Tempelhure. Du hast doch wohl nicht den Hund mit in den Puff genommen? Und dann mit entsetzter Stimme: „Du perverser Wichskopf, du hast doch den Hund beim Ficken zuschauen lassen. Mensch, der Hund stinkt ja nach Puff. Durch das Gebrüll des Alten fing Daisy furchtbar zu bellen an, und der Alte wurde immer wilder. Der Skipper einer britischen Jacht, die hinter uns lag, kam an Deck gestürzt, um zu sehen, was los war und schimpfte dann über den Alten wegen der nächtlichen Ruhestörung. Ich verzog mich, während der Alte mit dem Skipper diskutierte, unter die Back, wo die anderen noch alle wach waren. „Mensch Seemann, wo kommst du denn her?“, rief Günther. „Der Alte spielt schon die ganze Nacht verrückt. Alle Augenblicke kam er hereingestürzt und schrie: „Hoffentlich ist Daisy nichts passiert!“ Hundepint wollte von mir wissen, bei welcher Nutte ich geschlafen hätte, aber ich blieb bei meiner Darstellung, dass ich mich verlaufen hätte, was mir aber keiner abnahm. Am nächsten Morgen kam komischerweise nichts danach und der Alte schnitt das Thema nicht wieder an. Nur der Steuermann fragte mich lüstern: „Na Edsche, hast du einen weggesteckt? Hat sie wenigstens einen schönen Titt gehabt?“ Ich aber blieb bei meiner Geschichte, dass ich mich verlaufen hätte.
Gegen Mittag bekamen wir Order für einen neuen Ladehafen und liefen gleich danach aus. Ich sollte „Meisje“ also nicht wiedersehen. Waren wir bislang alle Augenblicke nach Rotterdam gekommen, fuhren wir, so wollte es das unabänderliche Schicksal, nie wieder hin. Es sollte für mich und „Meisje“ nur diese eine Nacht gegeben haben.
Die Zeit verging, und eines Tages musterte der befahrene Moses ab und ein neuer Schiffsjunge mit Namen Peter kam an Bord. Somit wurde ich dienstältester Moses, behielt aber meinen Spitznamen „Seemann“. Peter war unbefahren und musste nun die gleiche bittere Anfangszeit durchstehen wie ich zuvor. Auch unsere üblichen Neckereien musste er über sich ergehen lassen, etwa den Auftrag, den „Kompassschlüssel“ zu holen, den es natürlich nicht gab. Oder er musste nach einer ominösen „Postboje“ Ausschau halten. Peter war ein dunkelhaariger kräftiger Bursche von 17 Jahren, den nichts aus der Ruhe bringen konnte und der ein unwahrscheinlich dickes Fell hatte. Den konnten selbst der Alte und der Steuermann nicht erschüttern.
Ich lernte inzwischen alle seemännischen Arbeiten an Deck, konnte Segel nähen, Tauwerk und Draht spleißen und sogar die Hauptmaschine und die Motorwinden „anschmeißen“. Letzteres war im kalten Winter eine umständliche Arbeit, die wir alle hassten. Sollte etwa im frostigen Winter um 8 Uhr mit den Winschen, wie die Motorwinden seemännisch hießen, gearbeitet werden, mussten wir bereits um 6 Uhr aufstehen und kochendes Wasser in die Kühlwassertanks schütten. Durch besonders brennende Lunten, die wir „Zigaretten“ nannten, und langes Drehen mit der Handkurbel musste dann der Motor gestartet werden. Es konnte unter Umständen sehr lange dauern, bis der Motor in der Kälte endlich ansprang. Manchmal federte die Kurbel plötzlich zurück und man bekam einen heftigen Schlag, der, wenn man nicht aufpasste, einem den Arm brechen konnte. Als Moses waren wir mächtig stolz, wenn es uns entgegen den gesetzlichen Bestimmungen erlaubt wurde, die Winden zu bedienen. Diese Arbeit war in der Regel nur Vollgraden gestattet.
Wurde mit „eigenem Geschirr“, also den Ladebäumen des Schiffes gelöscht oder geladen, mussten zwei Mann an jeder Seite an den Geien (eine Art Flaschenzüge) stehen und den Ladebaum in die Mitte der Luke schwingen. Der Mann an der Winde fierte (senkte) das Stahlseil wie bei einem Kran mit dem Haken in den Laderaum. War die Last dort angeschlagen, wurde sie nach oben gehievt, bis sie frei über der Luke hing. Nun wurde der Ladebaum durch die Geien per Hand durch zwei Leute nach außenbords geschwenkt bzw. gezogen, wobei die Gei innenbords langsam gefiert (in diesem Fall vorsichtig nachgegeben) werden musste. Schwebte die Last außenbords, wurde sie mit der Winde gefiert und von den Hafenarbeitern an Land abgeschlagen. Der Ladebaum wurde dann ohne Last mittels der Geien wieder innenbords geschwenkt. Der Vorgang wiederholte sich solange, bis das Schiff gelöscht war. Für die Leute an den Geien war es harte Knochenarbeit, und meistens mussten wir Junggrade die Geien bedienen. Meistens stellte das Schiff beim Lade- und Löschbetrieb die Winden- und Geienbedienungen selber. Von den Leuten an den Motorwinden forderte es höchste Konzentration, die bis zu 1 ½ Tonnen schweren Lasten sicher an Land oder Schiff zu bringen.
Passte der Winchmann einmal nicht auf und die Last fiel herunter, konnte es, vom hohen Sachschaden einmal abgesehen, zu tragischen Folgen kommen und auch Menschenleben gefährden. Besonders im Winter bei eisiger Kälte hatte man nach acht oder zwölf Stunden Arbeit an den Winschen kein Gefühl mehr in den Fingern. Darum löste man den Windenmann alle zwei Stunden für zehn Minuten ab, wobei meistens der Alte oder der Steuermann solange einsprangen. Auch wir Schiffsjungen mussten, wenn wir an den Geien standen, höllisch aufpassen, dass der Ladebaum mit der Last nicht außer Kontrolle geriet und gegen den Mast schwang, denn daraus konnten sich böse Konsequenzen ergeben, von der körperlichen Anstrengung, die das Bedienen der Geien erforderte, ganz zu schweigen. Die meisten von uns hatten keine richtige Winterkleidung. Wir trugen fast alle Gummistiefel, die wir mit Papier und Lumpen ausgestopft hatten und froren furchtbar. Ging ich mit dem Alten im Winter bei Nebel Seewache, stand er am Ruder und ich sechs Stunden als Ausguck vorne auf der Back. Ich habe später in meinem Leben nie wieder so gefroren, wie in der Zeit als Moses. Erst später als Jungmann konnte ich mir einige gebrauchte Wintersachen kaufen.
Meine damalige Heuer betrug, alles inklusive, 60 Mark im Monat. Eine gute Hose kostete über 50 Mark. So kann man sich vorstellen, wie ich herumlief. Da der Eigner wegen meines abgerissenen Aussehens um seinen Ruf fürchtete, schenkte er mir ein paar abgetragene Kleidungsstücke und Schuhe. Der Alte behielt meine Heuer für mich ein und sorgte dafür, dass ich mir davon Arbeitskleidung (!) und andere wichtige Utensilien kaufte. Ich bekam dann mal 20 Mark für den „Putzbüttel“ (Friseur), für Zahnpasta, Socken etc. und musste ihm die gekauften Sachen vorzeigen. Manchmal, wenn er gute Laune hatte, gab er mir am Monatsende großzügig 10 Mark Taschengeld, die ich nach eigenem Belieben durchbringen durfte.
Einen Tag vor Heiligabend, wir lagen in Hamburg, musterten „Hundepint“ als Leichtmatrose und Günther als Matrose ab. Sie hatten ihre Zeit voll und wollten nach der Weihnachtszeit auf Große Fahrt gehen. Mir tat es leid, dass sie gingen, denn beide hatten sich als großartige Kameraden erwiesen, und vor Günther hatten selbst der Alte und der Steuermann einen gewissen Respekt, so dass sie sich ihm gegenüber nicht alles erlaubten. Ich habe beide nie wiedergesehen. Günther soll später das große Kapitänspatent gemacht haben und Lotse geworden sein. Von Manfred alias „Hundepint“ hieß es, er sei auf der Reeperbahn gestrandet. Da das Schiff über die Feiertage in Hamburg liegen bleiben sollte, gingen der Alte und der Steuermann die Zeit über zu ihren Familien nach Hause. Daisy sollte die Zeit bei unserem Eigner verbringen. Nur wir beiden Schiffsjungen mussten an Bord verbleiben. Der Eigner gab jedem von uns einen mickrigen bunten Teller und 10 Mark mit der Mahnung, ja gut auf das Schiff aufzupassen. Es war schon ein eigenartiges Gefühl, als wir zwei Mosese am Heiligen Abend mutterseelenallein vorne in unserem Logis unter der Back bei Petroleumlicht saßen. Wir dachten an die vielen „anständigen Leute“ an Land, die jetzt gewiss unter dem Christbaum ihre Geschenke auspacken und anschließend ihren Weihnachtsbraten verzehren würden. Auch hatten wir furchtbaren Kohldampf, denn außer Kommissbrot, Heizer-Jam, Margarine, etwas Käse und Dauerwurst, lag in der Kombüse nur noch ein vorgefertigter winziger „falscher Hase“, der für drei Mahlzeiten reichen musste.
Bis auf das Ruderhaus, den Maschinenraum und die Kombüse war achtern alles abgeschlossen, auch die Speisekammer an der Steuerbordseite. Peter und ich erinnerten uns an die etwa zwanzig schönen kleinen geräucherten, jeweils ca. 500 g schweren Speckseiten, die an der Decke der Speisekammer an Haken hingen und uns einmal im Monat zu Plum un Klüten lecker mundeten. Wir erinnerten uns aber auch an das Bullauge der Speisekammer, welches immer offen stand, aber durch zwei senkrechte Metallstäbe gesichert war. Da überkam uns trübselig Sinnenden am Heiligen Abend ein ganz unheiliger Gedanke: Es müsse doch möglich sein, von außen mit einer Stange oder ähnlichem Werkzeug die Speckseiten vom Haken zu liften und durch die Lücke zwischen die Gitterstäbe hindurch nach außen zu ziehen. Die Speckseiten hatten eine Dicke von 5 bis 6 cm und hingen mit ihren Bindfadenösen an den Haken, während die Lücke zwischen den Gitterstäben 10 cm betrug. Unser Hunger war inzwischen so groß geworden, dass wir unverzüglich zur Tat schritten.
Zunächst nahmen wir einen Besenstiel, schraubten einen Kleiderbügelhaken mit seinem Gewinde auf den Stiel und hatten so eine Angel. Der zweite Schritt war etwas schwieriger, da es stockdunkle Nacht war und unser Schiff außer den zwei vorgeschriebenen mit Petroleum betriebenen Hafenlampen am Steven und am Heck völlig im Dunkeln lag. Nur an der Gangway hing noch eine Petroleumfunzel, die man aber vergessen konnte. Wir hängten bei dieser Dunkelheit unsere große Malerstellage, die wir von Deck holen mussten, außenbords direkt unter das Bullauge der Speisekammer. Ausgerüstet mit unserer provisorischen Angel und unserer Brückentaschenlampe machten wir uns ans Werk. Es ging einfacher als wir dachten. Während ich auf der Stellage mit der Taschenlampe leuchtete, angelte Peter neben mir vier ansehnliche Speckstücke und eine große Rauchwurst vom Haken. Gott sei Dank, feierte auch die Wasserschutzpolizei, die sonst ihre Streife im Hafen fuhr, wahrscheinlich irgendwo das Weihnachtsfest. Wir zündeten unseren Kohleherd in der Kombüse an und nie wieder hat mir ein „Weihnachtsbraten“ besser geschmeckt, als an jenem Heiligen Abend des Jahres 1952. Unser Mundraub fiel nie auf, und wenn, so wurde niemals darüber gesprochen, denn auch der Eigner bediente sich manchmal im Hafen aus der Speisekammer.
Nach den Feiertagen kamen der Alte und der Steuermann wieder an Bord zurück, aber da wir erst im neuen Jahr eine Ladung bekommen sollten, verschwanden sie meist schon mittags. Der Steuermann sah ziemlich zahm und abgekämpft aus, was selbst dem Alten auffiel, denn er sagte einmal: „Mensch, seine Alte muss ihn ja jeden Abend ganz schön rannehmen. Wenn wir hier auslaufen, kann die nachher bestimmt 14 Tage lang kein klares Wasser mehr pissen.“
Auch der Eigner ließ sich ein paar mal an Bord sehen. Er brachte immer seinen Anhang oder einige Gäste mit, und Peter musste dann einen „guten Kaffee“ kochen. Einmal kamen auch seine Tochter und deren Freundin, die uns wie zwei exotische Tiere betrachteten. Auch Peter und ich bestaunten die beiden wie Lebewesen aus einer uns unbekannten fremden Welt. Sie waren beide sehr elegant gekleidet und hatten jenen Ausdruck in den Augen, mit denen früher vielleicht die adligen Feudalherren ihre Stallburschen oder Leibeigenen betrachtet haben mögen. Wir beide sahen aber auch sehr kurios aus. Ich trug eine total abgerissene schwarze speckige Hose, deren Schlitz mit einer Sicherheitsnadel zusammengehalten wurde, dazu einen blauen ausgefransten, von Motten zerfressenen Pullover mit Rollkragen, den Günther an Bord gelassen hatte, von meinen Schuhen, die an den Hacken mit Segelgarn repariert und mit Farbe beschmiert waren, gar nicht zu reden. Wir trugen unsere Schuhe an Deck bei der Arbeit, auch beim Malen und gingen damit ebenso beim Landgang in die Stadt. Aber was konnte man sich als Moses schon für 50 Mark Monatsheuer netto kaufen? Unser Anblick muss selbst den Eigner geschmerzt haben, denn am nächsten Tag kaufte er uns jedem eine Latzhose und vernünftiges Schuhwerk. Seine Tochter war eine große schlanke dunkelhaarige 19jährige Dame, die Freundin das blonde Gegenstück. Beide sprachen gewählt mit unterkühltem Ton und waren für uns unerreichbar.
Das Vergnügungsviertel von St. Pauli war damals, im Gegensatz zu heute, ein magnetischer Anziehungspunkt für Seeleute. Trifft man da heute nur noch selten einen Seemann, so verkehrten dort damals in vielen Bars und Kaschemmen in der Mehrzahl Seeleute. Natürlich gingen auch viele Hamburger und Touristen über die Reeperbahn, aber keine Berufsgruppe wurde so mit ihr identifiziert, wie die des Seemanns. Zahllose Lieder handeln vom Seemann und der Reeperbahn. Viele damalige Reedereibesatzungen hatten ihre Stammkneipen, wo sie bei den Wirten und Mädchen bekannt waren. Wenn sie dort „einen draufmachten“, wurden sie nicht ganz so skrupellos ausgenommen, wie es einem einzelnen und fremden Seemann auf St. Pauli durchaus passieren konnte. Etliche Seeleute schickten auch ihre Heuer an den Stammkneipenwirt, wo sie redlich verwahrt wurde. Ein mir bekannter Matrose sandte seine Heuer jahrelang an die Wirtin der „Bunten Kuh“, einer echten Seemannskaschemme mit leichten Damen und allem „drum und dran“. Musterte er ab, wohnte er auch dort, bis er alles durchgebracht hatte. Dann ging er wieder auf See. Auch eine Lebenseinstellung!
Auf St. Pauli bekam man für sein Geld etwas geboten und die Preise waren, je nach Anspruch und „Qualität“, gestaffelt, so dass ich mir dort auch als Moses ab und zu ein Bier leisten konnte. Die von mir bevorzugte Kneipe war damals der „Silbersack“, ein echt schräges Seemannslokal. Es war abends immer proppenvoll von Seeleuten, leichten Mädchen (letztere haben keine Zuhälter), Nutten, Hafenarbeitern, allerhand Spitzbuben und Ganoven. Auf einem kleinen Podium spielte meist eine Dreimannkapelle Seemannslieder und die letzten Ohrwürmer. Es wurde getanzt, gesoffen, geprügelt und gehurt. Der Türsteher war ca. zwei Meter groß und wog nicht weniger als 130 kg. Fing jemand Streit an, ging er meistens dazwischen, und der Störenfried landete auf der Straße. Blieb man nüchtern und benahm sich anständig, passierte einem selten etwas, und man konnte die Idylle dort genießen. Ein Glas Bier kostete im „Silbersack“ 40 Pfennig - im „normalen“ Lokal 28 Pf. - und die Musik gab’s gratis. Wer allerdings seine Heuer in bar bei sich trug, lebte auch dort gefährlich. Ließ er sich von einem Mädchen überreden, in eine andere Kneipe oder zu ihm nach Hause zu gehen, konnte es schon passieren, dass er später in den Ruinen, die es damals noch überall gab, ohne Geld und Seefahrtbuch aufwachte. Man hatte ihm „K.O.-Tropfen“ ins Getränk getan oder eins über den Schädel gezogen. Das Geld konnte man zur Not verschmerzen, der Verlust des Seefahrtbuches brachte jedoch allerlei Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten mit sich. In Unterweltkreisen waren Seefahrtbücher damals sehr gefragt und wurden mit bis zu 300 DM bezahlt. Viele Ganoven konnten mit einem deutschen Seefahrtbuch auf ausländischen Schiffen untertauchen. Da ich nur Moses war, war mein Seefahrtbuch für diese Kreise jedoch uninteressant.
Während unserer Liegezeit über die Weihnachtsfeiertage ging ich abends oft zur Reeperbahn, wo man mir trotz meiner Jugend immer ausschenkte. Ich brauchte nur zu sagen, ich sei Seemann und mein Seefahrtbuch vorzeigen. So kam ich meistens nachts ziemlich angeheitert an Bord, und am nächsten Tag ging alles wie gewohnt weiter. Nur in der „Kleinen Marienstraße“, einer Bordellstraße, durfte ich mich mit meinen 17 Jahren nicht aufhalten, da sich dort ständig die Streife sehen ließ und man des Platzes verwiesen wurde. Nachts kümmerte sich niemand um einen.
Im neuen Jahr bekamen wir einen neuen Leichtmatrosen, der Gerhard hieß. Er war 18 Jahre alt, blond und nicht besonders kräftig, aber ungemein zäh. Für einen Ostfriesen sprach er sehr viel und hatte einige Macken. Eine dieser Macken bestand darin, dass er seine Pudelmütze, außer beim Essen und Schlafen, ständig auf dem Kopf hatte. Er war nicht nur ein ausgezeichneter Seemann, sondern entsprach ganz dem Klischee, das sich die Leute an Land von einem Seemann machen. Dazu gehörten seine blaue Pudelmütze, Matrosenbluse und Seestiefel. Mit seinen blauen Augen war er der Schwarm vieler Mädchen, aber wie er uns erzählte, liebte er nur eine und der blieb er auch die ganze Zeit treu. Dies unterschied ihn wiederum von der Vorstellung der Landratten vom typischen „Hein Seemann“. Aber dafür war er äußerst trinkfest und ging keinem Streit aus dem Wege.
An einem kalten Morgen liefen wir bei Schneetreiben und kaltem Wind aus Hamburg aus. Wir sollten in Nordenham an der Weser, südwestlich von Bremerhaven, Koks laden. Wir mussten die Ladung also wieder selbst trimmen. Da Koks auch zusätzlich als Decksladung befördert wurde, musste vor dem Laden ein „Kokskäfig“ aus Maschendraht aufgebaut werden. Mit nur einem Leichtmatrosen und zwei Schiffsjungen total unterbesetzt, fingen wir gleich nach dem Auslaufen bei dichtem Schneetreiben und eisiger Kälte mit dem Käfigbau an. Zwei Mann mussten dazu auf jeder Seite des Schiffes ca. drei Meter hohe schwere Holzbalken als Stützen im Abstand von zwei Metern auf jeder Seite des Schiffes an der Reling aufstellen und sichern. Während Gerhard und ich auf der einen und der Steuermann mit Peter auf der anderen Seite arbeiteten, stand der Alte die ganze Zeit allein auf der Brücke am Ruder und navigierte das Schiff die Elbe hinunter. Er hätte sich einen Lotsen nehmen können, aber dann hätte er nicht die Hälfte des Lotsengeldes bekommen, welches ihm der Eigner bezahlte, damit er alleine fuhr. Unsere Arbeit an Deck war mühselig. Wir mussten mit zwei Mann die schweren Holzstützen mit dem unteren Ende in extra an Deck eingeschweißte Halter stecken und an der Reling mit einer Klammer sichern. Während der eine die Stütze in aufrechter Position in der Halterung hielt, sicherte sie der andere durch die erwähnte Klammer an der Reling.
Wir froren dabei jämmerlich an den Händen und hätten uns sehnlichst Arbeitshandschuhe gewünscht, wie sie auf Großer Fahrt üblich waren. Aber in der Küstenschifffahrt galten Arbeitshandschuhe als unseemännisch, weil damit angeblich bei der Arbeit das Gefühl verloren ging. Nur „matrosen“, wurde uns verächtlichmachend erklärt, trügen Handschuhe und diese seien keine echten Seeleute. Dass man sich aber ohne Arbeitshandschuhe an den Drähten durch „Fleischerhaken“ die Hände schwer verletzen oder an Holzplanken Splitter einreißen konnte, wurde völlig ignoriert und solche Verletzungen bewusst in Kauf genommen. Wir jedenfalls hätten in dieser eisigen Situation alles für ein Paar Handschuhe gegeben. Waren die Stützen gesetzt, wurde ein enger Maschendraht an beiden Seiten von vorne nach hinten über die ganze Länge an die Stützen genagelt. Das Ganze sah dann wie ein riesiger Käfig aus. Die Arbeit war während der Fahrt besonders gefährlich, da man dazu auf die Reling steigen musste, um den Draht so hoch wie möglich an die Stützen zu nageln. Da man ungesichert wie ein Artist auf der Reling stand und an den Stützen kaum Halt fand, bestand die große Gefahr, außenbords zu fallen. Bei der eisigen Temperatur des Wassers, der schlechten Sicht und dem umständlichen Rettungsmanöver hätte man im Ernstfall wohl kaum eine Überlebenschance gehabt. Spät am Abend wurden wir fertig. Die letzten Meter Draht hatten wir noch bei voller Dunkelheit an die Stützen genagelt.
Da wir bei Ankunft in Nordenham sofort laden sollten, hatten wir fast ohne Unterbrechung durchgearbeitet. Auch das Kochen fiel aus, da ja jeder Mann an Deck gebraucht wurde. Zu Mittag und am Abend gab es, wie in solchen Situationen üblich, pro Mann eine Dose Ölsardinen und etwas Corned Beef mit Brot. Als wir gerade fertig waren, befanden wir uns auch schon in der „Alten Weser“ und das Schiff fing bei aufbrisendem Nordwestwind und dem flachen Wasser unter dem Kiel furchtbar an zu schaukeln und legte sich teilweise bis zu 30 Grad über. Dadurch mussten wir vorne unter der Back unseren Kachelofen löschen. Todmüde und durchgefroren legten wir uns, so wie wir waren, in den warmen Maschinenraum auf die Flurplatten zum Schlafen nieder. Zwischendurch lösten wir uns am Ruder ab, bis wir bei Tagesanbruch Bremerhaven erreichten, wo das Schiff wieder ruhig lag. Sofort begannen wir mit dem Öffnen der Ladeluken. Wir hatten alle nicht mehr als zwei Stunden geschlafen, und auch der „Muckefuck“ machte uns nicht munter.
Da Nordenham nur etwa 1 ½ Stunden von Bremerhaven entfernt liegt, trieb uns der Steuermann erbarmungslos an. Wir mussten die Lukenkeile herausschlagen, die Schalklatten herausnehmen, die schweren Verschlussbügel wegräumen und die steifen Persenninge zusammenrollen, wobei auf jede Lage des Frostes wegen Salz gestreut wurde. Kaum war der letzte Lukendeckel abgehoben, als wir auch schon in Nordenham anlegten, einer kleinen Stadt in Niedersachsen mit einem riesigen Kohlehafen direkt an der Weser. Die gewaltigen Krananlagen konnten mit ihren großen Greifern ganze Eisenbahnwaggons auf einmal be- oder entladen. Theoretisch hätte ein Kran unser Schiff in zwei Stunden beladen können, wenn das Trimmen und Schließen der Luken nicht so zeitaufwendig gewesen wäre. Der Alte rechnete mit etwa sechs Stunden Liegezeit, bis wir wieder ablegen konnten. Kaum hatten wir die letzten Scherstöcke mit unseren Ladebäumen an Deck gehievt, als auch schon der erste Greifer seinen Inhalt in den Laderaum schüttete. Nach jeder Greiferfüllung konnte man sehen, wie das Schiff tiefer ins Wasser tauchte. Da die Kräne stationär waren, mussten wir das Schiff erforderlichenfalls mit unseren Leinen vor- und zurückziehen, damit der Kran die Ladung gleichmäßig verteilen konnte. Es dauerte dann auch nicht mehr lange, bis wir, mit Schaufel, Trimmblech und Kabellampe ausgerüstet zum Trimmen unter Deck verschwanden. Tauchten wir wieder an Deck auf, klopfte der Alte oder der Steuermann mit einem Besenstiel das Deck ab und wenn eine Stelle hohl klang, jagte er uns wieder hinunter.
Nach dem Trimmen mussten wir, so ausgelaugt und erschöpft wir auch waren, die Luken über dem vollen Laderaum wieder mit dem bekannten Aufwand seefest verschließen, um Platz für die Deckslast zu schaffen. Da wiederum Zeit Geld kostete, weil der Kran warten musste, trieben uns der Alte und der Steuermann weiterhin erbarmungslos an. Die ganze Zeit gab es für uns weder Pausen noch Essen, alles musste zurückstehen. Nach einigen Greiferinhalten war unser Schiff bis auf Winterlademarke voll beladen. Nachdem wir den Koks an Deck mit Schaufeln eben getrimmt und die Ladebäume heruntergedreht hatten, verließen wir auch schon den Ladeplatz in Richtung See via „Alte Weser“ und Elbe zum Nord-Ostsee-Kanal und bis auf den Mann der Wache, der das Schiff restseeklar machte, gingen wir übrigen Besatzungsmitglieder unter Deck, der Steuermann in seine warme Kammer und wir wieder in den warmen Maschinenraum, wo wir uns auf den Flurplattenboden fallen ließen und sofort einschliefen. Anlässlich des Wachwechsels gab es eine Kleinigkeit zu essen und ausnahmsweise eine Tasse echten Kaffee.
Irgendwie mussten wir eine günstige Tide erwischt haben, denn kurz vor Ende meiner Wache erreichten wir Brunsbüttelkoog und liefen auch gleich in die Schleuse ein. Dort erfuhren wir auch, dass unser Löschhafen Nykøbing in Dänemark sein sollte. Wir waren immer noch nicht gewaschen und müssen mit unseren schwarzen Gesichtern für die Leute an der Schleuse zum Fürchten ausgesehen haben. Der Alte nahm einen Kanallotsen und teilte sich mit dem Steuermann die achtstündige Durchfahrt, während Gerhard und ich uns alle zwei Stunden beim Steuern ablösten. Peter hatte vorne den Ofen angezündet und endlich konnte ich mich waschen. Ich nannte es „Russisches Bad“ und man hatte nur eine Möglichkeit, das Bad einigermaßen angenehm zu überstehen. Da wir nur kaltes Wasser hatten, brachte ich 1 ½ Eimer voll davon und einen kleinen leeren Topf nach vorne. Mit dem kleinen Topf - ein größerer passte nicht auf unseren Ofen - machte ich mir heißes Wasser und schüttete es in den halbvollen Eimer, so dass das Wasser nicht mehr ganz so kalt war. Anschließend wusch ich mir mit dem lauwarmen Wasser die Haare und seifte meinen Körper gründlich ein. War ich eingeseift und das Haar gewaschen, goss ich den Rest lauwarmen Wassers mit dem Eimer über den Kopf und anschließend den vollen Eimer mit dem kalten Wasser hinterher. Trocknete man sich sofort hart ab und rieb anschließend seinen Körper tüchtig mit einem zweiten Handtuch, empfand man eine wohlige Wärme. Gleichzeitig fühlte man sich erfrischt und sah einigermaßen gewaschen aus. Unsere tägliche Wasserration zum Waschen bestand normalerweise nur aus einem vollen Eimer, den halben extra gab es nur nach dem Trimmen.
Nach der Passage des Nord-Ostsee-Kanals fing in der Ostsee der normale Bordbetrieb wieder an. Der Alte war zufrieden und guter Laune, denn er hatte in Nordenham die Trimmer gespart und außerdem zweimal die halbe Lotsengebühr kassiert. Es gab zur Feier des Tages Plum un Klüten und wir konnten uns die Bäuche wieder einmal richtig vollschlagen.. Es war die erste warme Mahlzeit nach dem Auslaufen aus dem Hamburger Hafen. Wir machten noch viele Kohle/Koks- und Getreidereisen, bei denen wir selber trimmen mussten, wobei ich das Trimmen des Getreides am unangenehmsten fand, da einem noch mehrere Tage danach die Brust und die Atemwege schmerzten.
Ich war jetzt mit fast acht Monaten Fahrzeit „vorne“ am längsten an Bord und kam mir unendlich „befahren“ vor. Hatte ich bislang vor Günther und „Hundepint“ gehörigen Respekt gehabt, so ließ ich mir von unserem neuen Leichtmatrosen Gerhard nichts mehr sagen. Irgendwann kam es dann in einem Hafen zum offenen Streit und hätte Peter uns nicht getrennt, hätte ich von Gerhard eine tüchtige Tracht Prügel bezogen. Wie erwähnt, war der Bursche ungewöhnlich zäh. So war nun die Rangordnung wieder klar. Aber Gerhard war trotz allem nicht Günther und wenngleich Peter und ich ihn als höheren Dienstgrad respektierten, war dies beim Alten und dem Steuermann nicht der Fall. Der Steuermann wurde immer unbeherrschter und der Alte noch maßloser. Herrschte früher noch ein einigermaßen erträglicher Ton an Bord, wurde jetzt, da Günther weg war, nur noch gebrüllt und gedroht. Kamen wir auch nur zwei Minuten zu spät an Deck, drehte der Steuermann durch und tobte fürchterlich. Der Alte ließ uns jeden Sonntag im Hafen im „Schiffsinteresse“ zutörnen (arbeiten) und drohte andauernd mit dem „Sack“.
Das war selbst Gerhard eines Tages zu viel. Als wir wieder einmal an einem Sonntag im Hafen im „Schiffsinteresse“ an der Kai außenbords malen mussten und uns dabei mit einigen Sonntagsspaziergängern unterhielten, brüllte uns der Steuermann vor einem großen Publikum fürchterlich an. Ich kann mich nicht mehr an die einzelnen Worte erinnern, aber dem Sinne nach lautete der Tenor, wir faulen Schweine sollten keine Volksreden halten, sondern zusehen, dass wir fertig werden. Da drehte unser Leichtmatrose durch und schrie noch lauter zurück: „Nun halt mal deine Schnauze, du Neandertaler, oder ich stopf dir den Pinsel ins Maul! Für mich ist hier morgen Feierabend an Bord, ich fahr doch nicht mit Psychopathen!“ Er warf seinen Pinsel hin und verschwand an Bord unter Deck. Der Steuermann war so verblüfft, dass er seinen Mund zu schließen vergaß und keine Erwiderung fand. Die vielen Spaziergänger, die das Schauspiel verfolgten, konnten selbst erleben, wie es bei der deutschen „christlichen Seefahrt“ zuging. Ich glaube nicht, dass Eltern ihren Kindern nach diesem Schauspiel raten konnten zur See zu fahren. Gerhard musterte tatsächlich am nächsten Tag ab und der Alte bestand aus gutem Grund nicht auf Einhaltung der 48stündigen Kündigungsfrist.
Wir waren jetzt nur noch zu viert an Bord unterwegs zu unserem nächsten Hafen, Hamburg, wo die Wasserschutzpolizei uns wegen Unterbesetzung festhielt, bis wir einen Matrosen und einen Leichtmatrosen angemustert hatten. Nun waren wir das erste Mal seit meiner Anwesenheit an Bord personell vorschriftsmäßig besetzt. Der Matrose, der erste Vollgrad, mit dem ich zu tun hatte, war Anfang dreißig und will vor dem Kriege als Steuermann gefahren und dann zur Marine eingezogen worden sein. Zusammen mit anderen Teilhabern hatte er nach der Währungsreform wohl eine Fruchtimportfirma gegründet und bis vor zwei Monaten ein gutes Leben mit eigenem Fahrer und Villa geführt, bis seine Kompagnons feststellten, dass er lastwagenweise Ladung zu seinen Gunsten verschoben hatte. Sie erstatteten Anzeige gegen ihn und da alle seine Konten bis zum Prozessbeginn gesperrt waren, erinnerte er sich, einmal zur See gefahren zu sein. Nun war er hier bei uns an Bord, um sich im gelernten Handwerk die nötigen Brötchen zu verdienen. Er musste wirklich eine „Wirtschaftsgröße“ gewesen sein, denn er zeigte uns Fotos, die ihn bei festlichen Anlässen und Banketts zusammen mit prominenten Politikern und Filmgrößen Arm in Arm zeigten. Darunter war auch eine sehr bekannte junge Schauspielerin, deren Film gerade in allen Kinos lief. Er war schlank, mittelgroß, sah gut aus und regte sich nie auf.
Der Leichtmatrose war 26 Jahre alt, hellblond, auch mittelgroß und athletisch gebaut. Er stammte aus Ostpreußen und hatte sich mit 17 Jahren freiwillig zu den Fallschirmjägern gemeldet. Bis zum Zusammenbruch hatte er mit seiner Truppe noch in Ostpreußen gegen die Russen gekämpft und sich vor der Gefangenschaft in den Westen retten können. Mit seinen blauen Augen und markantem gebräunten Gesicht sah er sehr gut aus und hatte eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Filmschauspieler Hardy Krüger. Man hätte beide für Zwillingsbrüder halten können. Er war ruhig, sehr verschlossen und sprach wenig. Wir wussten kaum etwas über ihn, nur dass er seit 2 ½ Jahren zur See fuhr und nun hier bei uns an Bord Leichtmatrose war. Trotzdem war er ein guter Kamerad. Der Matrose tat sich am Anfang sehr schwer an Bord, verstand aber sein Handwerk und damit bewahrheitete sich die alte Volksweisheit, dass man, was man einmal gelernt hat, auch immer wieder verwerten kann. Auch unser Leichtmatrose war tüchtig in seinem Fach und immer ruhig und ausgeglichen. Beide tranken und hurten nicht und das „Thema 1“ war fortan an der Back tabu. Von den insgesamt 17 Monaten, die ich an Bord verbrachte, begann jetzt die angenehmste Zeit, die ich auf diesem Schiff erlebte. Der Steuermann hielt sich nach dem Vorfall mit Gerhard zurück, und auch der Alte wurde außergewöhnlich zahm. Wir machten Reisen nach England und Irland und es war das erste Mal, seit ich an Bord war, dass die Seefahrt mir Spaß machte.
Einmal lagen wir über das Wochenende bei Wexford in Irland an einer einsamen Kai, wo wir am Montag löschen und laden wollten. Kurz nach Mitternacht hörten wir an unserer Decke unter der Back in kurzen Zeitabständen klickende Geräusche, als ob jemand kleine Kiesel auf die Back warf. Der Leichtmatrose, Peter und ich stürzten an Deck und sahen im Mondschein drei junge Mädchen den einsamen Strand entlang davonlaufen. Wir drei sofort hinterher und wie bei der Lotterie griff sich jeder von uns eine. Meine war am weitesten gelaufen und als ich sie zu fassen bekam, stürzten wir beide in den weichen Sand. Ich sah im Mondschein ein weißes, blasses Gesicht mit großen Augen, roten Haaren und unter mir den hübschesten Mund. Wir schauten uns beide erstaunt an und lachten. Wahrscheinlich hatten wir beide das richtige Los der Lotterie gezogen. Auch meine beiden Kameraden mussten die richtige Wahl getroffen haben, denn als der Sonntagmorgen an diesem denkwürdigen Tag im Mai zu grauen begann, hatte jeder von uns seine Beute fest im Arm.
Als wir uns bei dem beginnenden Tageslicht alle zusammen betrachten konnten, mussten wir alle lachen, denn meine Kameraden und ich hatten außer unseren Unterhosen nichts weiter an. Wir waren so, wie wir in der Koje gelegen hatten, an Deck gestürzt. Meine Eroberung hieß Peggi, war 17 Jahre alt und für mich damals das schönste Mädchen der Welt. Der Leichtmatrose hatte die größte der drei Grazien erwischt. Sie war 18 Jahre alt, auch rothaarig, sommersprossig und ungemein gut proportioniert. Voller Bewunderung schaute sie immer wieder auf seine athletische Brust. Peter hatte die Kleinste der drei. Sie war 16 Jahre alt, schwarzhaarig und an allen Ecken rund. Als es schon hell wurde, bekamen die Mädchen plötzlich Angst, dass sie irgendwer sehen könnte, was damals in Irland für ihren Ruf fatale Folgen gehabt hätte. Sie erzählten uns, dass sie am Abend vorher zum Tanzen gewesen seien und da hier seit Jahren kein Schiff gelegen habe, hätten sie beschlossen, nach dem Tanzen unser Kümo anzusehen.
Wir verabredeten, uns am Abend bei einem alten Friedhof in der Nähe eines Dorfes wieder zu treffen. Dort würden sie an der alten Kapelle auf uns warten. Nachdem sie uns den Weg zum Treffpunkt noch einmal beschrieben hatten, verschwand unser Grazien-Tio in Richtung Dorf. Als wir drei frohen Mutes zu unserem Schiff zurückkehrten und - außer Peter, der ja bald seinen Küchendienst antreten musste - in unseren Kojen verschwanden, schlief unser Matrose noch tief und fest. Da am Sonntag nicht gearbeitet wurde, konnten wir - bis auf Peter - ausschlafen. Am Abend, kurz vor 21 Uhr, die Sonne ging schon langsam unter, machten wir drei uns auf den Weg zu unserem Rendezvous. Unser Matrose hatte freiwillig die Nachtwache übernommen, so dass diese Nacht uns gehörte. Wir hatten unsere schwarzen Nietenhosen mit den bunten Hosenaufschlägen an, die gerade große Mode waren und obgleich wir keinen Pfennig in der Tasche hatten, so waren wir doch jung, verwegen und strotzten nur so vor Selbstvertrauen. Die Straße von unserer abgelegenen Kai zum Dorf war mehr ein Feldweg, der nur benutzt wurde, wenn alle Jubeljahre ein Schiff dort anlegte und so begegneten wir keiner Menschenseele. Rechts und links des Weges standen einige Bäume, sonst wuchs überall nur Heide, garniert von großen Steinbrocken.
Nach ca. 45 Minuten konnten wir in der Ferne das Dorf sehen, welches malerisch in einer Senke lag. Etwa zwei Kilometer vor dem Dorf wurde das Gelände rechts der Straße buschig, und ein Feldweg bog zu einer kleinen Kapelle mit Friedhof rechts von unserer Straße ab. Es war inzwischen kurz nach 22 Uhr geworden, fast genau der Zeitpunkt, an dem wir uns treffen wollten. Als wir die Kapelle erreichten, war auch die Sonne hinter dem Horizont verschwunden und wir hielten vergeblich Ausschau nach unseren Mädchen. Es wurde immer dunkler und der Ort immer unheimlicher. Wir bedauerten schon, nicht unsere Finnendolche mitgenommen zu haben, die wir sonst immer bei der Arbeit trugen. Messer hatte man damals immer bei der Arbeit dabei und ein alter Seemannsspruch lautete: „Ein Seemann ohne Messer ist wie eine Frau ohne...“ - Kurz vor 23 Uhr, wir wollten schon zurück an Bord gehen, tauchten unsere Mädchen dann doch noch auf. Sie hatten so lange warten müssen, bis die Eltern von Peters Freundin schlafen gegangen waren und konnten erst danach unbemerkt das Haus verlassen.
Es war völlig dunkel und wir saßen zusammen auf der Treppe der kleinen Kapelle, deren Tür offen stand. Nur das Licht der „ewigen Lampe“ am Altar schien zu uns herüber. Die Mädchen erzählten uns, dass selten jemand hierher käme, da auf der anderen Seite des Dorfes ein neuer Friedhof angelegt worden sei. Nur ein Mesner würde jeden Abend mit dem Fahrrad herkommen, um nach der „ewigen Lampe“ zu sehen. Peters Freundin, die gehört hatte, dass Seeleute gerne einen Schluck trinken, hatte einen „Flachmann“ mit „Red Breast“ mitgebracht, den sie aus den Vorräten ihres Vaters ohne dessen Wissen hatte mitgehen lassen. Wir hatten von Bord genügend Zigaretten dabei, so dass es an diesem sonst so ruhigen und geheiligten Ort ziemlich lustig wurde. Es war übrigens das erste Mal in meinem Leben, dass ich Whisky trank. Peggi erzählte mir, sie arbeite in einer Bäckerei und müsse morgens immer sehr früh aufstehen. Das Mädchen unseres Leichtmatrosen war Näherin, und Peters Sechzehnjährige ging noch zur Schule. Gegen Mitternacht verteilten wir uns auf dem Friedhof und vielleicht haben wir den Toten ein wenig Abwechslung bei ihrer ewigen Ruhe geboten. Es fiel mir dabei ein lateinischer Spruch ein, den ich irgendwo einmal gelesen und aufgeschrieben hatte: „Taceant colloquis effugiatrius. His locus est ubi gaudet succuree vitae.“ Sinngemäß übersetzt: „Hier ist der Ort, an dem die Toten sich erfreuen, den Lebenden zu helfen.“
Im Morgengrauen schlichen wir uns, nachdem wir uns mit unseren Mädchen für den Abend wieder am gleichen Ort verabredet hatten, zurück an Bord. Um 6 Uhr früh warf der Steuermann uns aus den Kojen, denn um 8 Uhr musste das Schiff klar zum Löschen sein, da um diese Zeit auch die Hafenarbeiter mit ihrem Bus aus Wexford ankommen sollten. Wir drei machten an Bord nicht den frischesten Eindruck und irgendwie ahnte der Alte, dass wir die Nacht nicht auf dem Schiff verbracht hatten, denn bei einer passenden Gelegenheit bemerkte er: „Mensch, ihr seid wohl heute Nacht in der Kirche gewesen. Ihr seht ja alle ganz verorgelt aus. Die ganze Nacht wohl zentnerschwere Weiber gestemmt? Passt bloß auf, dass euch die Dorfjungs nicht zu fassen kriegen, die schneiden euch glatt die Eier ab.“
Nun, die Dorfjungen haben uns nicht zu fassen bekommen, aber nach über einer Woche kam der Tag, vor dem wir uns so gefürchtet hatten. Wir saßen ein letztes Mal auf der Treppe unserer Kapelle und die Tränen flossen fürchterlich. Peggi weinte an meiner Brust und auch mir war danach zumute. Am härtesten traf es die Freundin des Leichtmatrosen. Sie konnte sich überhaupt nicht beruhigen und wollte mit ihm an Bord durchbrennen. Auch ihn, den harten Fallschirmjäger, musste es hart erwischt haben, denn sie saßen beide da, wie zwei Häufchen Elend. Wir tauschten unsere Adressen aus, schworen uns ewige Treue und schlichen im Morgengrauen mit sehr gebrochenen Herzen an Bord. Wir hofften, dass wir diesen Liegeplatz bald wieder ansteuern würden, aber wie die Mädchen schon gesagt hatten, verirrte sich nur alle paar Jahre ein Schiff dorthin, und ich habe meine Peggi nie wiedergesehen. Auch unser Briefwechsel wurde mit der Zeit immer spärlicher. Nur unser Leichtmatrose bekam von seiner Liebsten lange Zeit treue Briefe. Aber das Leben ging weiter.