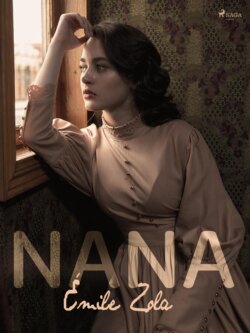Читать книгу Nana - Эмиль Золя, Emile Zola, Еміль Золя - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL II
ОглавлениеAm nächsten Morgen schlief Nana um zehn Uhr noch. Sie bewohnte am Boulevard Haussmann den zweiten Stock eines großen neuen Hauses, dessen Eigentümer an alleinstehende Damen vermietete, damit sie es trockenwohnten. Ein reicher Kaufmann aus Moskau, der nach Paris gekommen war, um hier einen Winter zu verbringen, hatte sie dort eingerichtet und ein halbes Jahr im voraus bezahlt. Die für sie viel zu geräumige Wohnung war niemals vollständig möbliert worden, und schreiender Luxus, vergoldete Konsolen und Stühle stießen darin an Trödelkram, runde, einfüßige Mahagonitische und Zinkkandelaber, die wie florentinische Bronze aussahen. Das roch nach einer Dirne, die zu früh von ihrem ersten wirklichen Herrn sitzengelassen worden und an zweifelhafte Liebhaber geraten war, ganz nach einem schwierigen Anfang, nach einem verunglückten Start, der von Kreditverweigerungen und Exmittierungsdrohungen gehemmt worden war.
Nana schlief auf dem Bauch, wobei sie ihr Kopfkissen, in das sie ihr vom Schlaf ganz blankes Gesicht vergrub, in ihre nackten Arme preßte. Das Schlafzimmer und das Ankleidezimmer waren die beiden einzigen Räume, die ein Möbelhändler aus dem Viertel sorgfältig eingerichtet hatte. Ein Lichtschimmer glitt unter einem Vorhang hervor; man konnte das Mobiliar aus Palisanderholz, die Tapetenbehänge und die Sessel aus durchwirktem Damast mit großen blauen Blumen auf grauem Grund unterscheiden. Aber in der matten Feuchtigkeit dieses verschlafenen Zimmers fuhr Nana plötzlich aus dem Schlaf auf, wie überrascht, neben sich eine Leere zu fühlen. Sie sah das zweite Kopfkissen an, das sich neben ihrem mit der noch lauen Einbuchtung eines Kopfes inmitten der Gipürestickereien ausbreitete. Und mit ihrer tastenden Hand drückte sie auf den Knopf einer elektrischen Klingel am Kopfende ihres Bettes.
„Er ist also gegangen?“ fragte sie die Zofe, die erschien.
„Ja, Madame, Herr Paul ist vor kaum zehn Minuten fortgegangen . . . Da Madame müde war, hat er sie nicht aufwecken wollen. Aber er hat mich beauftragt, Madame zu sagen, er käme morgen.“
Noch beim Sprechen öffnete Zoé. die Zofe, die Fensterläden. Das helle Tageslicht fiel herein. Zoé, die dunkelbraun war und deren Haar in kleinen, glatten Streifen herabfiel, hatte ein längliches, fahles und pockennarbiges Gesicht wie eine Hundeschnauze mit einer stumpfen Nase, dicken Lippen und schwarzen Augen, die unaufhörlich in Bewegung waren. „Morgen, morgen“, wiederholte Nana, noch nicht ganz munter, „ist das denn der Tag, morgen?“
„Ja, Madame, Herr Paul ist immer mittwochs gekommen.“ „Ach nein, da fällt mir ein!“ rief die junge Frau aus und setzte sich auf. „Es hat sich alles geändert. Ich wollte ihm das heute morgen sagen . . . Er würde auf den Mulatten stoßen. Das gäbe eine schöne Geschichte!“
„Madame hat mich nicht unterrichtet; das konnte ich nicht wissen“, murmelte Zoé. „Wenn Madame ihre Tage ändert, so würde sie gut daran tun, mich zu benachrichtigen, damit ich Bescheid weiß . . . Dann ist der alte Knauser nicht mehr dienstags dran?“
So — mit den Namen „alter Knauser“ und „Mulatte“ — bezeichneten sie unter sich, ohne zu lachen, die beiden Männer, die bezahlten, einen Großkaufmann aus dem Faubourg Saint-Denis von sparsamer Veranlagung, und einen Walachen, einen angeblichen Grafen, dessen Geld, das immer sehr unregelmäßig eintraf, einen sonderbaren Geruch hatte. Daguenet hatte sich die Tage nach dem alten Knauser geben lassen. Da der Großkaufmann schon um acht Uhr morgens zu Hause sein mußte, paßte der junge Mann von Zoés Küche aus sein Weggehen ab und nahm seinen noch ganz warmen Platz bis zehn Uhr ein; dann ging er selbst seinen Geschäften nach. Nana und er fanden das sehr bequem.
„Na wenn schon!“ sagte sie. „Ich werde ihm heute nachmittag schreiben . . . Und wenn er meinen Brief nicht erhält, so werden Sie morgen verhindern, daß er hereinkommt.“
Inzwischen ging Zoé langsam im Zimmer auf und ab. Sie sprach von dem großen Erfolg des gestrigen Abends. Madame habe so viel Talent gezeigt, sie sänge so gut! Oh, Madame könne jetzt beruhigt sein!
Den Ellbogen im Kopfkissen, antwortete Nana nur mit Kopfschütteln. Ihr Hemd war heruntergerutscht; ihr aufgelöstes, verwuscheltes Haar floß über ihre Schultern.
„Das schon“, murmelte sie, träumerisch geworden. „Aber wie soll man inzwischen auskommen? Heute werde ich alle möglichen Scherereien haben . . . Ist eigentlich der Concierge heute morgen schon wieder raufgekommen?“
Dann unterhielten sich beide ernsthaft. Man schuldete die Miete für ein dreiviertel Jahr,und der Hauswirt sprach von Pfändung. Außerdem brachen die Gläubiger über sie herein, ein Wagenvermieter, eine Wäschehändlerin, ein Damenschneider, ein Kohlenhändler und noch andere, die jeden Tag kamen und sich auf einer Bank im Vorzimmer niederließen. Besonders der Kohlenhändler führte sich furchtbar auf; er schrie auf der Treppe herum. Aber Nanas großer Kummer war ihr kleiner Louis, ein Kind, das sie mit sechzehn Jahren bekommen und bei seiner Amme auf einem Dorf in der Umgegend von Rambouillet gelassen hatte. Diese Frau verlangte dreihundert Francs für Louisets Rückgabe. Nana, die seit dem letzten Besuch bei dem Kind ein Anfall von Mutterliebe ergriffen hatte, war verzweifelt darüber, daß sie einen Plan, der zur fixen Idee geworden war, nicht verwirklichen konnte, nämlich die Amme zu bezahlen und das Kleine zu ihrer Tante, Frau Lerat, nach Les Batignolles zu bringen, wo sie es so oft, wie sie wollte, besuchen könnte. Indessen gab die Zofezu verstehen,Madame hätte ihre Nöte dem alten Knauser anvertrauen sollen.
„Ach, ich habe ihm ja alles gesagt“, rief Nana. „Er hat mir geantwortet, er habe zu große Verbindlichkeiten. Von seinen tausend Francs im Monat geht er nicht ab . . . Der Mulatte ist augenblicklich pleite: ich glaube, er hat beim Spiel verloren . . . Was den armen Mimi betrifft, so hätte er es dringend nötig, daß man ihm was borgt. Eine plötzliche Baisse hat ihn ausgeplündert; er kann mir nicht mal mehr Blumen mitbringen.“ Sie sprach von Daguenet. Im Sichgehenlassen des Erwachens hatte sie kein Geheimnis vor Zoé.
Diese, die ähnliche vertrauliche Mitteilungen gewohnt war, nahm sie mit ehrerbietiger Sympathie entgegen. Da Madame nun einmal geruhte, mit ihr über ihre Angelegenheiten zu sprechen, so würde sie sich erlauben zu sagen, was sie denke. Erstens habe sie Madame sehr gern, sie sei extra von Madame Blanche weggegangen, und Madame Blanche versuche weiß Gott alles nur Menschenmögliche, um sie wiederzukriegen! An Stellen sei kein Mangel, sie sei zur Genüge bekannt; doch sie sei bei Madame geblieben, selbst bei Geldverlegenheit, weil sie an Madames Zukunft glaube. Und schließlich sprach sie ihre Ratschläge deutlich aus. Wenn man jung sei, mache man Dummheiten. Diesmal müsse man die Augen aufhalten, denn die Männer dächten nur an das Vergnügen. Oh, man müsse zu Gelde kommen! Madame brauche nur ein Wort zu sagen, um ihre Gläubiger zu beruhigen und das Geld aufzutreiben, das sie benötigte.
„Das verschafft mir alles keine dreihundert Francs“, meinte Nana mehrmals und grub die Finger in die wilden Strähnen ihres Haarwulstes im Nacken. „Ich brauche dreihundert Francs, heute, sofort . . . Es ist dumm, daß man niemand kennt, der einem dreihundert Francs gibt.“ Sie forschte nach, sie hätte Frau Lerat, die sie gerade am Vormittag erwartete, nach Rambouillet geschickt. Ihre verdrossene Laune verdarb ihr den Triumph des gestrigen Abends. Wenn man bedachte, daß unter all diesen Männern, die ihr zugejubelt hatten, keiner zu finden sein sollte, der ihr fünfzehn Louisdors brachte! Zudem konnte man ja nicht so einfach Geld annehmen. Mein Gott, wie unglücklich war sie doch! Und sie kam immer wieder auf ihr Baby zurück; es habe blaue Cherubinoaugen, es lalle mit so drolliger Stimme „Mama“, daß es zum Totlachen sei.
Doch im gleichen Augenblick war die elektrische Klingel an der Eingangstür mit ihrem schnellen und bebenden Vibrieren zu hören. Zoé kam zurück und flüsterte mit vertraulicher Miene:
„Es ist eine Frau.“ Sie hatte diese Frau zwanzigmal gesehen, aber sie tat so, als erkenne sie sie nie wieder und als wisse sie nicht, welche Beziehungen sie zu den Damen hatte, die in Geldverlegenheit waren. „Sie hat mir ihren Namen gesagt . . . Madame Tricon.“
„Die Tricon!“ rief Nana aus. „Ach ja, es stimmt, ich hatte sie vergessen . . . Lassen Sie sie herein.“
Zoé führte eine alte Dame von hoher Gestalt herein, die Schmachtlocken trug und die Haltung einer Gräfin hatte, die von einem Rechtsanwalt zum anderen rennt. Dann trat sie bescheiden beiseite und verschwand lautlos mit einer natterngleich geschmeidigen Bewegung, mit der sie aus einem Zimmer ging, wenn ein Herr kam. Übrigens hätte sie dableiben können. Die Tricon setzte sich nicht einmal. Es fand nur ein Wechsel kurzer Worte statt.
„Ich habe jemand für Sie heute . . . Wollen Sie?“
„Ja . . . Wieviel?“
„Zwanzig Louisdors.“
„Und um welche Zeit?“
„Um drei Uhr . . . Also, abgemacht?“
„Abgemacht.“
Die Tricon sprach sogleich vom herrschenden Wetter, einem trockenen Wetter, bei dem es gut sei, zu Fuß zu gehen. Sie habe noch vier oder fünf Leute zu besuchen. Und sie ging, wobei sie in einem kleinen Notizbuch nachschlug.
Allein geblieben, schien Nana erleichtert. Ein leichter Schauer glitt über ihre Schultern; mit der Trägheit einer fröstelnden Katze kuschelte sie sich wieder weich in das warme Bett. Nach und nach schlossen sich ihre Augen. Sie lächelte bei dem Gedanken, Louiset am folgenden Tage nett anzuziehen, während in dem Schlummer, der sie wieder überkam, ihr Fiebertraum der ganzen Nacht, ein lang anhaltendes Donnern von Bravorufen, wie ein Generalbaß wiederkehrte und ihre Müdigkeit einwiegte.
Als Zoé Frau Lerat um elf Uhr ins Zimmer treten ließ, schlief Nana noch immer. Aber bei dem Geräusch erwachte sie und sagte sofort:
„Du bist es . . . Du fährst heute nach Rambouillet.“
„Deswegen komme ich ja“, sagte die Tante. „Es geht ein Zug um zwölf Uhr zwanzig. Ich habe Zeit, um ihn zu schaffen.“
„Nein, ich bekomme das Geld erst nachher“, erwiderte die junge Frau und dehnte sich, den Busen hochgereckt. „Du kannst gleich Mittag essen, dann werden wir weitersehen.“ Zoé brachte einen Morgenrock.
„Madame“, murmelte sie, „der Friseur ist da.“
Aber Nana wollte durchaus nicht ins Ankleidezimmer hinübergehen. Sie rief selber:
„Kommen Sie herein, Francis.“
Ein tadellos angezogener Herr stieß die Tür auf. Er grüßte. Nana stieg gerade mit nackten Beinen aus dem Bett. Sie hatte keine Eile und streckte die Hände aus, damit ihr Zoé die Ärmel des Morgenrocks überstreifen konnte. Und Francis wartete völlig ungezwungen mit würdiger Miene, ohne sich umzudrehen. Als sie sich dann hingesetzt hatte und er ihr einmal mit dem Kamm durchs Haar gefahren war, redete er.
„Madame hat vielleicht nicht die Zeitungen gesehen . . . Es steht ein sehr guter Artikel im ,Figaroʻ.“ Er hatte die Zeitung gekauft.
Frau Lerat setzte ihre Brille auf und las, vor dem Fenster stehend, den Artikel laut vor. Sie richtete ihre Dragonerfigur in die Höhe; wenn sie ein galantes Adjektiv herausschleuderte, zog sich ihre Nase zusammen. Es war eine Besprechung von Fauchery, die er nach Verlassen des Theaters geschrieben hatte, zwei sehr warmherzige Spalten von geistreicher Boshaftigkeit für die Künstlerin und brutaler Bewunderung für die Frau.
„Ausgezeichnet!“ wiederholte Francis.
Nana machte sich nicht schlecht darüber lustig, daß man sie wegen ihrer Stimme aufzog! Er war nett, dieser Fauchery; sie würde ihm seine gute Art vergelten. Nachdem Frau Lerat den Artikel noch einmal vorgelesen hatte, erklärte sie brüsk, die Männer hätten alle den Teufel in den Waden; und sie weigerte sich, sich deutlicher auszudrücken, befriedigt über diese zweideutige Anspielung, die nur sie allein verstand.
Doch Francis war gerade damit fertig, Nanas Haar aufzustecken und zu knoten. Er grüßte und sagte:
„Ich werde auf die Abendzeitungen achten . . . Wie gewöhnlich um halb sechs, nicht wahr?“
„Bringen Sie mir einen Topf Pomade und ein Pfund gebrannte Mandeln von Boissier mit!“ rief ihm Nana in dem Augenblick durch den Salon nach, als er die Tür wieder schloß.
Dann fiel den beiden allein gebliebenen Frauen ein, daß sie sich nicht geküßt hatten, und sie gaben sich schallende Küsse auf die Wangen. Der Artikel erwärmte sie. Nana, die bis dahin schläfrig gewesen, wurde wieder vom Fieber ihres Triumphes erfaßt. Na, Rose Mignon mußte ja einen schönen Morgen verbringen! Da ihre Tante nicht zum Theater hatte kommen wollen, weil ihr die Aufregung — wie sie sagte — auf den Magen schlug, begann sie, ihr den Abend zu erzählen, wobei sie sich an ihrem eigenen Bericht berauschte, als sei ganz Paris unter dem Beifall zusammengestürzt. Sich plötzlich unterbrechend, fragte sie dann mit einem Lachen, ob man das geglaubt hätte, als sie ihren Kleinmädchenhintern in der Rue de la Goutte-d’Or herumschleppte.
Frau Lerat schüttelte den Kopf. Nein, nein, niemals hätte man das voraussehen können. Jetzt war sie mit Reden dran, wobei sie eine ernste Miene aufsetzte und Nana ihre Tochter nannte. Sei sie denn nicht ihre zweite Mutter, da die richtige Papa und Großmutter ins Grab nachgefolgt war. Nana war sehr gerührt und nahe daran, zu weinen. Aber Frau Lerat wiederholte, Vergangenheit sei Vergangenheit, oh, eine dreckige Vergangenheit, Dinge, die man nicht alle Tage aufrühren solle. Lange habe sie die Besuche bei ihrer Nichte eingestellt, denn in der Familie beschuldigte man sie, sich mit der Kleinen zugrunde zu richten. Gott, als ob das möglich wäre! Sie frage sie nicht nach vertraulichen Dingen; sie glaube, sie habe immer anständig gelebt. Augenblicklich genüge es ihr, sie in schönen Verhältnissen wiederzufinden und bei ihr zärtliche Gefühle für ihren Sohn zu sehen. Noch gelte in dieser Welt lediglich Anständigkeit und Arbeit.
„Von wem ist dieses Baby eigentlich?“ fragte sie, sich unterbrechend, die Augen von heftiger Neugierde entflammt. Überrascht zögerte Nana eine Sekunde.
„Von einem Herrn“, antwortete sie.
„Soso“, erwiderte die Tante, „es wurde behauptet, du hättest es von einem Maurer gekriegt, der dich schlug . . . Na, schließlich wirst du mir das eines Tages erzählen; du weißt, wie verschwiegen ich bin! — Bestimmt, ich werde es pflegen, als wäre es der Sohn eines Fürsten.“
Sie hatte das Gewerbe einer Blumenhändlerin aufgegeben und lebte von ihren Ersparnissen, die sie Sou für Sou angesammelt hatte und die ihr sechshundert Francs Jahresrente brachten. Nana versprach, eine hübsche kleine Wohnung für sie zu mieten; außerdem würde sie ihr hundert Francs im Monat geben. Bei dieser Zahl vergaß sich die Tante und schrie der Nichte zu, sie solle ihnen — sie sprachen von den Männern — die Gurgel zudrücken, da sie sie ja in der Hand habe. Sie küßten sich nochmals. Aber als Nana das Gespräch wieder auf Louiset brachte, schien sie mitten in ihrer Freude bei einer jähen Erinnerung mißmutig zu werden.
„Ist das ärgerlich, ich muß um drei Uhr weggehen!“ murmelte sie. „Das ist doch eine Plackerei!“
Soeben hatte Zoé gemeldet, es sei angerichtet. Man ging ins Eßzimmer hinüber, wo schon eine ältere Dame am Tisch saß. Sie hatte ihren Hut nicht abgenommen und trug ein dunkles Kleid von unbestimmter Farbe zwischen flohbraun und gelbgrün. Nana schien nicht erstaunt, sie dort zu sehen. Sie fragte sie lediglich, warum sie nicht ins Schlafzimmer gekommen sei.
„Ich habe Stimmen gehört“, antwortete die Alte. „Ich dachte, Sie seien in Gesellschaft.“
Frau Maloir, die achtbar aussah und gute Manieren hatte, diente Nana als alte Freundin; sie leistete ihr Gesellschaft und begleitete sie. Frau Lerats Gegenwart schien sie zuerst zu beunruhigen. Als sie dann erfuhr, daß es eine Tante sei, betrachtete sie sie mit freundlicher Miene und einem blassen Lächeln. Währenddessen stürzte sich Nana, die sagte, ihr hinge der Magen in den Kniekehlen, auf Radieschen, die sie gierig ohne Brot knabberte. Frau Lerat, die förmlich geworden war, wollte keine Radieschen; das gäbe Verschleimung. Als dann Zoé Koteletts gebracht hatte, stocherte Nana an dem Fleisch herum und begnügte sich damit, den Knochen auszusaugen. Zuweilen musterte sie verstohlen den Hut ihrer alten Freundin.
„Ist das der neue Hut, den ich Ihnen geschenkt habe?“ fragte sie schließlich.
„Ja, ich habe ihn mir zurechtgemacht“, murmelte Frau Maloir mit vollem Mund. Der Hut war überspannt, an der Vorderseite ausgeweitet und mit einer hohen Feder geschmückt. Frau Maloir hatte die Manie, alle ihre Hüte umzuarbeiten; sie allein wußte, was ihr stand, und im Handumdrehen machte sie aus der elegantesten Kopfbedeckung eine Mütze.
Nana, die ihr gerade diesen Hut gekauft hatte, um nicht mehr ihretwegen zu erröten, wenn sie sie mitnahm, hätte sich beinahe geärgert. Sie rief:
„Nehmen Sie ihn wenigstens ab!“
„Nein, danke“, antwortete die Alte würdig, „er stört mich nicht; ich esse sehr gut mit Hut.“
Nach den Koteletts gab es Blumenkohl und den Rest eines kalten Hühnchens. Aber Nana zog bei jedem Gericht einen Flunsch, zögerte, schnupperte daran herum und ließ alles auf ihrem Teller. Sie beendete ihr Mittagsmahl mit Eingemachtem.
Der Nachtisch stand herum. Zoé räumte den Tisch nicht ab, um den Kaffee zu servieren. Die Damen hatten einfach ihre Teller zurückgeschoben. Es wurde immer noch über den schönen Abend des Vortages gesprochen. Nana drehte sich Zigaretten, die sie rauchte, während sie sich auf ihrem Stuhl hintenüberlehnte und schaukelte. Und da Zoé dageblieben war und, die Hände baumelnd, sich mit dem Rücken gegen das Büfett gelehnt hatte, kam es dazu, daß man sich ihre Geschichte anhörte. Sie war angeblich die Tochter einer Hebamme aus Bercy, die krumme Sachen gemacht hatte. Zuerst war sie bei einem Zahnarzt in Stellung gegangen, dann bei einem Versicherungsmakler; aber das paßte ihr nicht, und sodann zählte sie mit einem Anflug von Stolz die Damen auf, denen sie als Zofe gedient hatte. Zoé sprach von diesen Damen als ein Mensch, der ihr Glück in seiner Hand gehalten hatte. Zweifellos hätte mehr als eine ohne sie komische Geschichten erlebt. So eines Tages, als Madame Blanche mit Herrn Octave zusammen war, und plötzlich kommt der Alte. Was macht Zoé? Sie tut so, als falle sie beim Durchqueren des Salons hin; der Alte stürzt herbei, läuft in die Küche, um ihr ein Glas Wasser zu holen, und Herr Octave entwischt.
„Na, das ist ja eine schöne Geschichte! Donnerwetter!“ sagte Nana, die ihr mit zärtlicher Teilnahme, mit einer Art unterwürfiger Bewunderung zuhörte.
„Ich, ich habe allerhand Pech gehabt . . .“, begann Frau Lerat. Und, an Frau Maloir näher heranrückend, erzählte sie ihr vertrauliche Dinge.
Beide aßen in Kognak getauchte Zuckerstücke und klatschten. Doch Frau Maloir nahm die Geheimnisse anderer entgegen, ohne jemals etwas über sich verlauten zu lassen. Es hieß, sie lebe von einer geheimnisvollen Pension in einem Zimmer, in das niemand vordringe.
Mit einem Male ereiferte sich Nana.
„Tante, spiel doch nicht mit den Messern herum . . . Du weißt doch, das geht mir durch und durch.“
Ohne darauf zu achten, hatte Frau Lerat soeben zwei Messer über Kreuz auf den Tisch gelegt. Übrigens bestritt Nana, abergläubisch zu sein. So bedeutete verschüttetes Salz nichts, der Freitag auch nichts, aber die Messer — das war stärker als sie, das hatte niemals gelogen. Sicher würde ihr etwas Unangenehmes zustoßen.
Sie gähnte und sagte dannmit einer Miene tiefen Verdrusses: „Schon zwei Uhr . . . Ich muß gehen. Wie ärgerlich!“ Die beiden Alten sahen sich an. Alle drei schüttelten den Kopf, ohne zu sprechen. Sicher,das machte nicht immer Spaß. Nana hatte sich wieder hintenübergelehnt und zündete sich noch eine Zigarette an, während die anderen aus Rücksichtnahme voller Lebensklugheit die Lippen zusammenkniffen. „Bis Sie zurück sind, werden wir Bésigue spielen“, meinte Frau Maloir nach einem Schweigen. „Spielt Madame Bésigue?“
Gewiß, Frau Lerat spielte Bésigue, und zwar ausgezeichnet. Es sei überflüssig, Zoé, die verschwunden war, zu stören; eine Ecke des Tisches würde genügen. Und man schlug das Tischtuch über die schmutzigen Teller zurück. Aber als Frau Maloir selber die Karten aus einer Schublade des Büfetts holen wollte, sagte Nana, sie solle so nett sein und ihr einen Brief schreiben, bevor sie anfange zu spielen. Es verdroß sie zu schreiben, und dann war sie auch ihrer Rechtschreibung nicht sicher, während ihre alte Freundin gefühlvolle Briefe zu schreiben verstand. Sie holte schönes Papier aus ihrem Schlafzimmer. Ein Tintenfaß, eine Flasche Tinte zu drei Sous, stand mit einer rostverklebten Feder auf einem Möbelstück herum. Der Brief war für Daguenet bestimmt. Frau Maloir schrieb aus eigenem Antrieb in ihrer schönen englischen Schreibschrift:„Mein geliebter kleiner Mann…“ und verständigte ihn dann, am morgigen Tage nicht zu kommen, da „es nicht passe“, aber „in der Ferne wie in der Nähe, in jedem Augenblick sei sie in Gedanken bei ihm“.
„Und ich schließe mit ,tausend Küssenʻ “, murmelte sie.
Frau Lerat hatte jedem Satz mit einer Kopfbewegung zugestimmt. Ihre Blicke flammten; sie liebte es leidenschaftlich, bei Herzensangelegenheiten dabeizusein. Daher wollte sie auch ihr Teil beitragen und gurrte, eine zärtliche Miene aufsetzend:
„Tausend Küsse auf Deine schönen Augen.“
„Das ist richtig:,Tausend Küsse auf Deine schönen Augen!ʻ“ wiederholte Nana, während ein Ausdruck von Glückseligkeit über die Gesichter der beiden Alten glitt.
Man läutete nach Zoé, damit sie den Brief zu einem Dienstmann hinunterbringe. Sie plauderte gerade mit dem Theaterdiener, der Madame einen am Morgen vergessenen Probenplan brachte. Nana ließ diesen Mann hereinkommen und beauftragte ihn, den Brief zu Daguenet zu bringen, wenn er wieder zurückginge. Dann stellte sie ihm Fragen.
Oh, Herr Bordenave sei sehr zufrieden; der Vorverkauf finde schon für acht Tage statt, Madame könne sich nicht vorstellen, wie viele Leute seit heute morgen nach ihrer Adresse gefragt hätten.
Als der Diener gegangen war, sagte Nana, sie würde höchstens eine halbe Stunde wegbleiben. Falls Besucher kämen, so solle Zoé sie warten lassen. Während sie sprach, läutete die elektrische Klingel. Es war ein Gläubiger, der Wagenvermieter; er hatte sich auf der Bank im Vorzimmer niedergelassen.
Der konnte bis zum Abend Däumchen drehen; es hatte keine Eile.
„Los, nur Mut!“ sagte Nana, schlaff vor Trägheit, gähnend und sich von neuem rekelnd. „Ich müßte längst da sein.“ Aber sie rührte sich überhaupt nicht. Sie folgte dem Spiel ihrer Tante, die gerade hundert mit Assen angesagt hatte. Das Kinn in die Hand gestützt, versank sie in Nachdenken. Sie fuhr jedoch auf, als sie es drei Uhr schlagen hörte. „Verdammt!“ stieß sie roh hervor.
Jetzt ermutigte Frau Maloir, die die Asse zählte, sie mit ihrer weichen Stimme:
„Meine Kleine, es wäre besser, Sie erledigten Ihren Gang jetzt gleich.“
„Mach schnell“, sagte Frau Lerat, während sie die Karten mischte. „Ich werde den Zug um halb fünf nehmen, wenn du vor vier Uhr mit dem Geld hier bist.“
„Ach, das wird nicht lange dauern“, murmelte sie.
Zoé half ihr, in zehn Minuten ein Kleid überzustreifen und einen Hut aufzusetzen. Es war ihr einerlei, ob sie schlecht angezogen war. Als sie gerade hinuntergehen wollte, läutete die Klingel von neuem. Diesmal war es der Kohlenhändler. Na gut, er konnte dem Wagenvermieter Gesellschaft leisten; das würde sie zerstreuen, diese Leute.Da sie allerdings einen Auftritt befürchtete, ging sie durch die Küche und machte sich über die Dienstbotentreppe aus dem Staube. Sie benutzte sie oft; so ging sie allem aus dem Wege und brauchte dafür nur ihre Röcke zu raffen.
„Wenn man eine gute Mutter ist, so ist das alles zu entschuldigen“, meinte Frau Maloir sentenziös, die mit Frau Lerat allein geblieben war.
„Ich habe achtzig mit Königen“, antwortete diese, die das Spiel begeisterte.
Und beide vertieften sich in eine endlose Partie.
Der Tisch war nicht abgeräumt worden. Ein trüber Dunst, der Geruch des Mittagessens und der Rauch der Zigaretten, erfüllte den Raum. Die Damen hatten sich wieder daran gemacht, in Kognak getauchte Zuckerstückchen zu essen. Seit zwanzig Minuten spielten sie nun und schlürften dabei, als Zoé bei einem dritten Anschlagen der Klingel jäh eintrat und sie wie ihresgleichen anrempelte.
„Hören Sie, es klingelt schon wieder . . . Sie können nicht hierbleiben. Wenn viele Leute kommen, brauche ich die ganze Wohnung . . . Also, los, los!“
Frau Maloir wollte die Partie zu Ende spielen, doch da Zoé so ausgesehen hatte, als wolle sie sich auf die Karten stürzen, entschloß sie sich, das Spiel aufzunehmen, ohne etwas durcheinanderzubringen, während Frau Lerat die Flasche Kognak, die Gläser und den Zucker mitnahm. Und alle beide liefen in die Küche, wo sie sich an einem Tischende zwischen den Wischlappen, die dort trockneten, und dem Abwaschbecken, das noch voller Spülwasser war, niederließen.
„Wir haben dreihundertvierzig angesagt . . . Sie sind dran.“
„Ich spiele Herz.“
Als Zoé zurückkam, fand sie sie von neuem vertieft.
Nach einem Schweigen, als Frau Lerat gerade die Karten mischte, fragte Frau Maloir:
„Wer ist es?“
„Ach, niemand“, antwortete das Mädchen nachlässig, „ein kleiner junger Mann . . . Ich wollte ihn wegschicken, aber er ist so hübsch mit seinen blauen Augen und seinem Mädchengesicht ohne jedes Barthaar, daß ich ihm schließlich gesagt habe, er solle warten . . . Er hat einen riesigen Blumenstrauß in den Händen, den er auf keinen Fall weggeben wollte . . . Backpfeifen sollte man ihm eigentlich langen, eine Rotznase, die noch aufs Gymnasium gehört!“
Frau Lerat holte eine Karaffe Wasser, um einen Grog zu machen; die Zuckerstücke mit Kognak hatten sie durstig gemacht. Zoé murmelte, sie könne ja immerhin auch einen trinken. Sie habe einen gallebitteren Geschmack im Munde, sagte sie.
„Und verstaut haben Sie ihn . . .?“ fing Frau Maloir wieder an.
„Na, im Hinterzimmer, in dem kleinen Raum, der nicht möbliert ist . . . Es ist gerade ein Koffer von Madame und ein Tisch drin. Da quartiere ich die Lümmel ein.“ Und sie süßte ihren Grog stark, als die elektrische Klingel sie auffahren ließ. Verdammt noch mal! Würde man sie denn nicht mal in Ruhe trinken lassen? Das konnte ja heiter werden, wenn das Gebimmel schon losging. Trotzdem lief sie öffnen. Dann sagte sie bei ihrer Rückkehr, als sie sah, daß Frau Maloir sie fragend anblickte: „Nichts weiter, ein Blumenstrauß.“
Alle drei stärkten sich, indem sie sich mit einem Kopfnicken zuprosteten. Schlag auf Schlag klingelte es noch zweimal, während Zoé endlich den Tisch abräumte und die Teller einzeln in den Ausguß zurückbrachte. Aber das alles sei nichts Ernstes. Sie würde die Küche auf dem laufenden halten; zweimal wiederholte sie ihren herablassenden Satz: „Nichts weiter, ein Blumenstrauß.“
Unterdessen lachten die Damen zwischen zwei Kartenstichen auf, als sie sie erzählen hörten, was für Gesichter die Gläubiger im Vorzimmer gemacht hätten, wenn die Blumen eintrafen. Madame würde ihre Blumensträuße auf ihrem Toilettentisch vorfinden. Schade, daß das so teuer war und daß man nicht einmal zehn Sous dafür kriegen konnte. Schließlich sei das allerhand herausgeschmissenes Geld.
„Ich“, meinte Frau Maloir, „wäre mit dem zufrieden, was die Männer in Paris täglich an Blumen für die Frauen ausgeben.“
„Das glaube ich gern, Sie stellen ja keine großen Ansprüche“, murmelte Frau Lerat. „Man hätte wenigstens das Geld für den Rachenputzer . . . Meine Liebe, sechzig mit Damen.“
Es war zehn Minuten vor vier. Zoé wunderte sich, sie verstehe nicht, daß Madame so lange wegbleibe. Wenn sich Madame gezwungen sehe, nachmittags auszugehen, so beschleunige sie das gewöhnlich, und zwar nachdrücklichst.
Frau Maloir jedoch erklärte, man erledige die Dinge nicht immer, wie man wolle.
Allerdings, es gäbe Hindernisse im Leben, sagte Frau Lerat. Das beste sei,zu warten; falls sich ihre Nichte verspäte, dann wohl, weil ihre Besorgungen sie aufhielten, nicht wahr?
Sonst machte man sich kaum Sorgen. In der Küche war es angenehm. Und da Frau Lerat kein Herz mehr hatte, warf sie Karo ab.
Die Klingel fing von neuem an. Als Zoé wieder erschien, war sie ganz aufgeregt.
„Kinder, der dicke Steiner!“ sagte sie noch in der Tür und senkte die Stimme. „Den habe ich im kleinen Salon verstaut.“
Darauf sprach Frau Maloir mit Frau Lerat, die diese Herren nicht kannte, über den Bankier. War er etwa im Begriff, Rose Mignon den Laufpaß zu geben?
Zoé schüttelte den Kopf, sie wisse Dinge . . . Aber wieder mußte sie öffnen gehen.
„Also, so ein Pech!“ murmelte sie, als sie zurückkam. „Es ist der Mulatte! Umsonst habe ich ihm wiederholt, daß Madame ausgegangen ist; er hat sich im Schlafzimmer niedergelassen . . . Wir erwarteten ihn erst heute abend.“
Um Viertel fünf war Nana immer noch nicht da. Was konnte sie bloß machen? Das war ganz gegen jeden gesunden Menschenverstand. Es wurden zwei weitere Blumensträuße gebracht. Gelangweilt sah Zoé nach, ob noch Kaffee übrig war. Ja, die Damen könnten den Kaffee gern austrinken; das würde sie wieder munter machen. Auf ihren Stühlen zusammengesackt, waren sie am Einschlafen, wie sie ständig mit derselben Bewegung Karten vom Stamm aufnahmen. Es schlug halb. Bestimmt habe man Madame etwas angetan. Sie tuschelten untereinander.
Plötzlich vergaß sich Frau Maloir und verkündete mit schallender Stimme:
„Ich habe fünfhundert! — Quintmajor in Trumpf!“
„Seien Sie doch ruhig!“ sagte Zoé zornig. „Was sollen denn all diese Herren denken?“
Und in das herrschende Schweigen, in das unterdrückte Gemurmel der beiden alten, sich streitenden Frauen, drang das Geräusch schneller Schritte vom Dienstbotenaufgang nach oben. Es war endlich Nana. Bevor sie die Tür geöffnet hatte, hörte man ihr Keuchen. Hochrot kam sie mit brüsker Bewegung herein. Ihr Rock, dessen Aufschürzbänder gerissen sein mußten, wischte über die Stufen, und die Volants waren gerade in eine Pfütze, in irgend etwas Fauliges getaucht, das aus dem ersten Stock heruntergeflossen war, wo das Dienstmädchen ein richtiger Dreckfink war.
„Da bist du ja! So ein Glück!“ meinte Frau Lerat mit verkniffenen Lippen, immer noch verärgert über die Fünfhundert von Frau Maloir. „Du kannst dir was darauf einbilden, die Leute unnütz warten zu lassen!“ „Madame ist wirklich unvernünftig!“ fügte Zoé hinzu.
Nana, die schon mißmutig war, wurde durch diese Vorwürfe aufgebracht. So empfing man sie also nach dem Ärger, den sie gerade gehabt hatte!
„Ach was, laßt mich in Ruhe!“ schrie sie.
„Pst, Madame! Es ist Besuch da“, sagte das Mädchen.
Jetzt senkte die junge Frau die Stimme und stammelte, schwer atmend:
„Denkt ihr etwa, ich habe mich amüsiert? Das nahm ja gar kein Ende mehr. Ich hätte euch gern dabei sehen wollen . . . Ich kochte, ich hatte Lust, Maulschellen auszuteilen . . . Und keine Droschke für die Rückfahrt. Zum Glück ist es ganz in der Nähe. Trotzdem bin ich ganz schön gerannt.“ „Hast du das Geld?“ fragte die Tante.
„Hör mal! So eine Frage!“ antwortete Nana.
Sie hatte sich auf einen Stuhl an den Herd gesetzt, die Beine wund vom Laufen; und, ohne zu verschnaufen, zog sie einen Umschlag, in dem sich vier Hundertfrancsscheine befanden, aus ihrem Mieder. Die Scheine waren durch einen breiten Riß zu sehen, den sie mit rohem Finger hineingemacht hatte, um sich von dem Inhalt zu überzeugen. Die drei Frauen rings um sie blickten unverwandt auf den Umschlag aus grobem, zerknittertem und schmutzigem Papier zwischen ihren kleinen, behandschuhten Händen. Es war zu spät, Frau Lerat würde erst am folgenden Tage nach Rambouillet fahren. Nana ließ sich auf große Erklärungen ein.
„Madame, es sind Leute da, die warten“, sagte die Zofe mehrmals.
Aber sie ereiferte sich von neuem. Der Besuch könne warten. Nachher, wenn sie nicht mehr geschäftlich zu tun habe. Und als ihre Tante die Hand nach dem Geld ausstreckte, sagte sie:
„O nein, nicht alles. Dreihundert Francs für die Amme, fünfzig Francs für deine Reise und deine Auslagen, das macht dreihundertfünfzig . . . Ich behalte fünfzig Francs.“
Die große Schwierigkeit war, Kleingeld aufzutreiben. Es waren keine zehn Francs im Hause. Man wandte sich gar nicht erst an Frau Maloir, die mit unbeteiligter Miene zuhörte, weil sie stets nur die sechs Sous für den Omnibus bei sich hatte. Schließlich ging Zoé hinaus, wobei sie sagte, sie wolle in ihrem Koffer nachsehen, und brachte hundert Francs in Hundertsousstücken zurück. Man zählte sie auf einem Ende des Tisches. Frau Lerat brach sofort auf, nachdem sie versprochen hatte, Louiset am nächsten Tage mitzubringen.
„Sie sagen, es ist Besuch da?“ fuhr Nana fort, die immer noch saß und sich ausruhte.
„Ja, Madame, drei Personen.“ Und sie nannte den Bankier als ersten.
Nana zog einen Flunsch. Wenn dieser Steiner glaubte, sie ließe sich von ihm langweilen, weil er ihr gestern abend einen Blumenstrauß zugeworfen hatte . . .
„Übrigens reicht es mir“, erklärte sie. „Ich werde niemanden empfangen. Gehen Sie und sagen Sie, daß Sie mich nicht mehr erwarten.“
„Madame wird es sich überlegen, Madame wird Herrn Steiner empfangen“, flüsterte Zoé, ohne sich zu rühren, mit ernster Miene, ärgerlich, daß sie ihre Herrin im Begriff sah, noch eine Dummheit zu begehen. Dann sprach sie von dem Walachen, dem im Schlafzimmer allmählich die Zeit lang werden mußte. Da versteifte sich Nana wütend noch mehr. Niemand wolle sie sehen, niemand! Wer hatte ihr bloß einen Mann aufgehalst, der dermaßen an ihr klebte?
„Schmeißen Sie die alle raus! Ich werde eine Partie Bésigue mit Madame Maloir spielen. Das mache ich lieber.“
Die Klingel schnitt ihr das Wort ab. Das war der Gipfel. Schon wieder ein langweiliger Schwätzer! Sie verbot Zoé, öffnen zu gehen.
Diese war, ohne auf sie zu hören, aus der Küche gegangen. Als sie wieder erschien, überreichte sie zwei Karten und sagte mit gebieterischer Miene:
„Ich habegeantwortet,Madame würde empfangen . . . Diese Herren sind im Salon.“
Nana war wütend aufgestanden. Doch die Namen des Marquis de Chouard und des Grafen Muffat de Beuville auf den Karten besänftigten sie. Einen Augenblick blieb sie schweigend stehen.
„Wer ist es denn?“ fragte sie schließlich. „Kennen Sie die?“ „Ich kenne den Alten“, antwortete Zoé, den Mund auf diskrete Weise zusammenkneifend. Und als ihre Herrin sie weiterhin fragend anblickte, fügte sie lediglich hinzu: „Ich habe ihn irgendwo gesehen.“
Diese Bemerkung schien die junge Frau zu einem Entschluß zu bringen. Ungern verließ sie die Küche, diesen lauwarmen Zufluchtsort, wo man plaudern und sich dem Duft des Kaffees hingeben konnte, der auf einem Rest Glut warm gehalten wurde. Hinter sich ließ sie Frau Maloir zurück, die jetzt Karten legte. Ihren Hut hatte sie immer noch nicht abgenommen; nur die Bänder hatte sie, um es sich bequem zu machen, soeben aufgeknüpft und über ihre Schultern zurückgeworfen.
Im Ankleidezimmer, wo Zoé eifrig half, Nana einen Morgenrock überzustreifen, rächte sich diese über den Ärger, den man ihr bereitete, indem sie dumpfe Flüche gegen die Männer zerkaute.
Diese derben Wörter verdrossen die Zofe, denn zu ihrem Leidwesen sah sie, daß Madame den Schmutz ihrer ersten Anfänge nicht so schnell abstreifte. Sie wagte sogar,Madame inständig zu bitten, sich zu beruhigen.
„Ach was!“ entgegnete Nana grob. „Das sind Schweinekerle, die haben das gern.“ Dennoch setzte sie ihre Prinzessinnenmiene auf, wie sie sagte.
Zoé hatte sie zurückgehalten, als sie sich gerade nach dem Salon wandte; und ganz von selbst führte sie den Marquis de Chouard und Graf Muffat in das Ankleidezimmer herein. Das war viel besser.
„Meine Herren“, sagte die junge Frau mit einstudierter Höflichkeit, „es tut mir leid, daß ich Sie warten ließ.“ Die beiden Männer grüßten und setzten sich. Ein bestickter Tüllstore ließ Dämmerlicht im Zimmer herrschen. Es war der eleganteste Raum der Wohnung, mit hellem Stoff bespannt, einem großen, marmornen Toilettentisch, einem eingelegten Stehspiegel, einem Ruhebett und Sesseln aus blauem Atlas. Auf dem Toilettentisch bildeten die Sträuße — Rosen, Flieder und Hyazinthen—ein Blumendurcheinander von durchdringendem und starkem Wohlgeruch, während in der ein wenig feuchten Luft, in der Schalheit, die den Waschbecken entströmte, zeitweise ein schärferer Duft schwebte, ein paar Halme von trockenem Patschuli, die kleingebrochen auf dem Boden einer Schale lagen. Und wie sie sich zusammenkauerte und ihren schlechtgeschlossenen Morgenrock übereinanderschlug, schien Nana, die mit der noch feuchten Haut lächelnd inmitten ihrer Spitzen aufgescheucht war, bei ihrer Toilette überrascht worden zu sein. „Madame“, sagte Graf Muffat ernst, „Sie werden uns verzeihen, daß wir darauf bestanden haben . . . Wir kommen wegen einer Sammlung . . . Der Herr und ich, wir sind Mitglieder des Fürsorgeamtes des Arrondissements.“
Der Marquis de Chouard beeilte sich, mit galanter Miene hinzuzufügen:
„Als wir erfahren haben, daß eine große Künstlerin in diesem Hause wohnt, haben wir uns vorgenommen, ihr unsere Armen ganz besonders anzuempfehlen . . . Talent geht doch Hand in Hand mit Herz.“
Nana spielte die Bescheidene. Sie antwortete mit kleinen Bewegungen des Kopfes, wobei sie gleichzeitig rasche Überlegungen anstellte. Der Alte mußte den anderen mitgebracht haben, seine Augen waren allzu lüstern. Dennoch mußte man auch dem anderen mißtrauen, dessen Schläfen drollig anschwollen; er hätte auch ganz gut allein kommen können. So war es also, der Concierge hatte ihren Namen angegeben, und sie drängten sich, jeder auf eigene Rechnung, herbei.
„Zweifellos taten Sie recht daran, heraufzukommen, meine Herren“, sagte sie huldvoll. Doch die elektrische Klingel ließ sie zusammenfahren. Schon wieder ein Besuch und diese Zoé, die immerzu öffnete! Sie fuhr fort: „Man ist doch zu glücklich, geben zu können.“ Im Grunde fühlte sie sich geschmeichelt.
„Ach, Madame“, entgegnete der Marquis, „wenn Sie wüßten, was für Elend es gibt! Unser Arrondissement zählt mehr als dreitausend Arme, und dabei ist es noch eins der reichsten. Eine solche Not können Sie sich nicht vorstellen: Kinder ohne Brot, kranke Frauen, die, jeder Hilfe beraubt, vor Kälte umkommen . . .“
„Die armen Leute!“ rief Nana sehr gerührt. Ihr Mitleid war so groß, daß Tränen ihre schönen Augen überschwemmten. Mit einer Bewegung hatte sie sich vorgebeugt, wobei sie nicht mehr auf sich achtgab, und ihr geöffneter Morgenrock ließ ihren Hals sehen, während sich durch ihre vorgestreckten Knie die Rundung des Schenkels unter dem dünnen Stoff abzeichnete.
Ein wenig Blut erschien in den erdfarbenen Wangen des Marquis. Graf Muffat, der sprechen wollte, senkte die Augen. Es war zu heiß in diesem Zimmer, eine drückende und stickige Treibhaushitze. Die Rosen welkten, ein leichter Rausch stieg von dem Patschuli in der Schale auf.
,,Bei diesen Gelegenheitenmöchte man sehr reich sein“,fügte Nana hinzu. „Schließlich tut jeder, was er kann . . . Glauben Sie mir, meine Herren, wenn ich gewußt hätte, daß . . .“ Sie war im Begriff, in ihrer Rührung eine Dummheit fallen zu lassen. Daher beendete sie den Satz nicht. Einen Augenblick lang blieb sie verlegen, da sie sich nicht mehr erinnerte, wo sie soeben, als sie ihr Kleid auszog, ihre fünfzig Francs hingelegt hatte. Doch sie entsann sich, sie mußten auf der Ecke des Toilettentisches unter einem umgestülpten Topf Pomade liegen. Als sie aufstand, schlug die Klingel lange an. So was! Schon wieder einer! Das würde nicht auf hören.
Der Graf und der Marquis hatten sich ebenfalls erhoben, und der letztere spitzte seine Ohren, die sich geregt hatten, in Richtung der Tür; zweifellos kannte er diese Art zu klingeln. Muffat sah ihn an, dann wandten sie die Augen ab. Sie genierten sich, sie wurden wieder kühl, der eine vierschrötig und handfest mit seinem streng gescheitelten Haar, der andere seine hageren Schultern hochreckend, auf die sein Kranz spärlicher weißer Haare herabfiel.
„Meine Güte!“ sagte Nana, die die zehn großen Geldstücke herbeibrachte, wobei sie sich zu lachen entschloß. „Ich werde Sie beladen, meine Herren . . . Das ist für die Armen . . .“ Und das kleine liebenswürdige Grübchen an ihrem Kinn zeigte sich. Sie hatte ihre gutmütige Kindermiene ohne Ziererei aufgesetzt, hielt den Stapel Taler auf ihrer geöffneten Hand und bot ihn den beiden Männern an, wie um ihnen zu sagen: Nun, wer will etwas?
Der Graf war der flinkere, und er nahm die fünfzig Francs; doch ein Geldstück blieb zurück, und um seiner habhaft zu werden, mußte er es unmittelbar von der Haut der jungen Frau aufnehmen, einer lauen und geschmeidigen Haut, die ihm einen Schauer verursachte.
Sie lachte immer noch erheitert.
„So, meine Herren“, versetzte sie. „Ein anderes Mal hoffe ich mehr geben zu können.“
Sie hatten keinen Vorwand mehr; sie grüßten und wandten sich zur Tür. Aber als sie gerade hinausgehen wollten, ertönte die Klingel von neuem. Der Marquis konnte ein mattes Lächeln nicht verbergen, während der Graf noch einen Schatten ernster wurde. Nana hielt sie einige Sekunden zurück, um es Zoé zu ermöglichen, noch einen Winkel ausfindig zu machen. Sie hatte es nicht gern, wenn man sich bei ihr begegnete. Diesmal allerdings mußte es gerammelt voll sein. Daher war sie erleichtert, als sie den Salon leer sah. Zoé hatte sie wohl in die Schränke gestopft?
„Auf Wiedersehen, meine Herren“, sagte sie und blieb auf der Schwelle des Salons stehen. Sie umhüllte sie mit ihrem Lachen und ihrem klaren Blick.
Graf Muffat verneigte sich, trotz seiner großen Weltkenntnis verwirrt, er brauchte Luft, da er ein Schwindelgefühl aus diesem Ankleidezimmer mitnahm, einen Duft nach Blumen und Frau, der ihn erstickte. Und hinter ihm wagte es der Marquis de Chouard, der sicher war, nicht gesehen zu werden,mit urplötzlich entstelltem Gesicht, die Zunge am Rand der Lippen, Nana zuzuzwinkern.
Als die junge Frau in das Zimmer zurückkehrte, wo Zoé sie mit Briefen und Visitenkarten erwartete, rief sie, noch lauter lachend, aus: „Das sind vielleicht Gauner, die mir meine fünfzig Francs geklaut haben!“
Sie ärgerte sich überhaupt nicht; es kam ihr drollig vor, daß ihr Männer Geld weggenommen hatten. Trotzdem waren es Schweine, sie hatte keinen Sou mehr. Doch der Anblick der Karten und Briefe brachte ihr ihre schlechte Laune zurück. Die Briefe — das mochte noch hingehen; sie stammten von Herren, die ihr Liebeserklärungen machten,nachdem sie ihr am Vorabend Beifall geklatscht hatten. Was die Besucher anbetraf, so konnten sie sich zum Teufel scheren.
Zoé hatte überall welche verstaut, und sie machte darauf aufmerksam, daß die Wohnung sehr bequem sei, weil jedes Zimmer die Tür zum Korridor habe. Es sei nicht wie bei Madame Blanche, wo man durch den Salon gehen mußte. Daher habe Madame Blanche auch allerhand Ärger gehabt.
„Sie werden sie alle wegschicken“, versetzte Nana, die ihrem Einfall nachkommen wollte. „Fangen Sie mit dem Mulatten an.“
„Der,Madame! Den habe ich schon lange abgewiesen“, sagte Zoé mit einem Lächeln. „Er wollte Madame bloß sagen,daß er heute abend nicht kommen kann.“
Das gab eine große Freude. Nana klatschte in die Hände. Er kam nicht, welch ein Glück! Sie würde also frei sein! Und sie stieß Seufzer der Erleichterung aus, als habe man sie von der gräßlichsten aller Strafen begnadigt. Ihr erster Gedanke galt Daguenet. Der arme Junge, dem sie gerade geschrieben hatte, bis Donnerstag zu warten! Schnell, Madame Maloir solle einen zweiten Brief schreiben! Doch Zoé sagte, Madame Maloir sei verschwunden, ohne daß man es, wie üblich bei ihr, gemerkt habe. Nachdem Nana dann davon gesprochen hatte, jemand hinzuschicken, hielt sie zögernd inne. Sie war sehr müde. Eine ganze Nacht zum Schlafen, das würde so guttun! Der Gedanke an dieses Vergnügen behielt schließlich die Oberhand. Einmal konnte sie sich das leisten.
„Ich werde mich hinlegen, wenn ich aus dem Theater komme“, murmelte sie mit genießerischer Miene, „und Sie werden mich nicht vor zwölf Uhr mittags wecken.“ Dann sagte sie, die Stimme hebend: „Los! Und jetzt schmeißen Sie mir die anderen die Treppe runter!“
Zoé rührte sich nicht. Sie hätte sich nicht erlaubt, Madame offen Ratschläge zu erteilen; nur tat sie ihr Bestes, um Madame aus ihrer Erfahrung Nutzen ziehen zu lassen, wenn Madames Eigensinn mit ihr durchzugehen schien.
„Herrn Steiner auch?“ fragte sie kurz.
„Freilich“, antwortete Nana, „den vor allen anderen.“
Das Mädchen wartete noch, um Madame Zeit zum Überlegen zu lassen. Madame sei also nicht stolz darauf, ihrer Rivalin Rose Mignon einen so reichen, in allen Theatern bekannten Herrn wegzuschnappen?
„Beeilen Sie sich doch, meine Liebe“, entgegnete Nana, die vollkommen verstand, „und sagen Sie ihm, daß er mir auf die Nerven fällt.“ Doch jäh besann sie sich anders. Morgen konnte sie Verlangen nach ihm verspüren, und mit der Gebärde eines Gassenjungen rief sie lachend und mit den Augen blinzelnd: „Wenn ich ihn haben will, geht es schließlich immer noch am schnellsten, wenn ich ihn vor die Tür setze.“
Zoé schien sehr verblüfft zu sein. Von einer plötzlichen Bewunderung ergriffen, blickte sie Madame an, dann ging sie, ohne zu schwanken, Steiner vor die Tür setzen.
Inzwischen geduldete sich Nana einige Minuten,um ihr Zeit zu lassen, den Fußboden rein zu fegen,wie sie sagte.Von so einem Ansturm machte man sich gar keinen Begriff! Sie steckte den Kopf in den Salon: er war leer; das Eßzimmer ebenfalls leer. Als sie aber beruhigt ihre Besichtigung fortsetzte, sicher, daß niemand mehr da war, stieß sie mit einemmal auf einen kleinen jungen Mann, als sie die Tür eines Nebenraumes aufschlug. Ganz ruhig und mit sehr braver Miene saß er oben auf einem Koffer, mit einem riesigen Blumenstrauß auf den Knien.
„Ach, du lieber Gott!“ rief sie. „Da ist ja noch einer drin!“ Als der kleine junge Mann sie gewahrt hatte, war er heruntergesprungen, rot wie Klatschmohn. Und er wußte nicht, was er mit seinem Blumenstrauß anfangen sollte, den er von einer Hand in die andere nahm, weil ihm die Aufregung die Kehle zuschnürte. Seine Jugend, seine Verlegenheit und das drollige Aussehen, das er mit seinen Blumen bot, rührten Nana, die in schallendes Gelächter ausbrach.
Was, die Kinder auch? Kamen die Männer jetzt als Wickelkinder zu ihr? Vertraulich und mütterlich ließ sie sich gehen, schlug sich auf die Schenkel und fragte aus Ulk:
„Du willst wohl, daß man dir die Nase putzt, Baby?“
„Ja“, antwortete der Kleine mit leiser und flehender Stimme.
Diese Antwort erheiterte sie noch mehr.
Er sei siebzehn Jahre alt, er heiße Georges Hugon. Am gestrigen Abend sei er im Théâtre des Variétés gewesen. Und er komme sie besuchen.
„Sind die für mich, diese Blumen?“
„Ja.“
„Dann gib sie doch her, du Dummchen!“
Doch als sie den Blumenstrauß nahm, stürzte er sich mit der Gier seiner blühenden Jugend über ihre Hände. Sie mußte ihn schlagen, damit er seine Beute fahrenließ. Diese Rotznase ging aber schnurstracks ran! Während sie ihn noch ausschalt, war sie rosig geworden; sie lächelte. Und sie schickte ihn fort und erlaubte ihm, wiederzukommen.
Er wankte, er fand die Türen nicht mehr.
Nana kehrte in ihr Ankleidezimmer zurück, wo Francis fast augenblicklich erschien, um sie endgültig zu frisieren. Sie zog sich nur abends an. Vor dem Spiegel sitzend, den Kopf unter den flinken Händen des Friseurs senkend, verharrte sie stumm und träumerisch, als Zoé eintrat und sagte:
„Madame, es ist einer da, der nicht gehen will.“
„Na gut, dann muß man ihn da lassen“, antwortete sie ruhig.
„Trotzdem, es kommen immer noch welche.“
„Ach was! Sag ihnen, sie sollen warten. Wenn sie zu großen Hunger haben, werden sie schon weggehen.“
Ihre Stimmung war umgeschlagen. Es entzückte sie, die Männer warten zu lassen. Ein Gedanke belustigte sie vollends: sie entschlüpfte Francis’ Händen und lief hin, um eigenhändig die Riegel vorzuschieben; jetzt konnten sie sich nebenan aufstapeln, sie würden ja wohl nicht noch durch die Wand dringen. Zoé würde durch die kleine Tür hereinkommen, die in die Küche führte. Unterdessen ging die elektrische Klingel immer stärker. Alle fünf Minuten kehrte das lebhafte und helle Läuten mit der Regelmäßigkeit einer gut eingestellten Maschine wieder. Und um sich zu zerstreuen, zählte Nana das Klingeln. Aber plötzlich erinnerte sie sich an etwas.
„Sagen Sie mal, meine gebrannten Mandeln?“
Auch Francis hatte die gebrannten Mandeln vergessen. Mit der unauffälligen Handbewegung eines Mannes von Welt, der einer Freundin eine Geschenk überreicht, zog er einen Beutel aus einer Tasche seines Gehrocks; doch bei jeder Abrechnung setzte er die gebrannten Mandeln in Zahlung. Nana legte den Beutel zwischen ihre Knie und begann zu knabbern, wobei sie den Kopf unter dem leichten Druck des Friseurs drehte.
„Donnerwetter!“ murmelte sie nach einem Schweigen.
„Das ist ja eine ganze Schar.“
Dreimal, Schlag auf Schlag, hatte die Klingel geschellt. Die Aufforderungen des Bimmelns überstürzten sich. Es gab bescheidene Aufforderungen, die mit dem Beben eines ersten Geständnisses stammelten, kühne, die unter irgendeinem rohen Finger vibrierten, und eilige, die die Luft mit raschem Schauer durchfuhren. Ein regelrechtes Glockengeläute, wie Zoé sagte, ein Glockengeläute, das das ganze Viertel in Aufruhr versetzen konnte, ein ganzer Haufen Männer, die der Reihe nach auf den Elfenbeinknopf drückten. Dieser Spaßvogel, der Bordenave, hatte die Adresse wirklich allzu vielen Leuten gegeben, der ganze Zuschauerraum des gestrigen Abends kam ja hier vorbei.
„Übrigens, Francis“, sagte Nana, „haben Sie fünf Louisdors?“
Er trat zurück, prüfte die Frisur und sagte dann ruhig:
„Fünf Louisdors, das kommt drauf an.“
„Oh, wissen Sie“, entgegnete sie, „wenn Sie Bürgschaften brauchen . . .“ Und ohne den Satz zu vollenden, deutete sie mit einer weiten Handbewegung auf die Nachbarzimmer. Francis lieh die fünf Louisdors.
Zoé kam in den Augenblicken der Ruhe herein, um Madames Toilette herzurichten. Bald mußte sie sie ankleiden, während der Friseur wartete, weil er letzte Hand an die Frisur legen wollte. Doch ständig störte die Klingel die Zofe, die Madame halb geschnürt, mit nur einem Schuh an den Füßen, zurückließ. Trotz ihrer Erfahrung verlor sie den Kopf. Nachdem sie fast überall Männer verstaut hatte, wobei sie die kleinsten Winkel ausnutzte, war sie soeben gezwungen gewesen, bis zu drei und vier von ihnen zusammen unterzubringen, was all ihren Grundsätzen zuwiderlief. Nichts zu machen, wenn sie sich auffraßen; das würde Platz schaffen! Und Nana, die gut eingeriegelt und in Sicherheit war, machte sich über sie lustig und sagte, sie höre sie keuchen. Sie mußten ein schönes Gesicht ziehen, wie sie da alle mit heraushängender Zunge wie Wauwaus auf ihrem Hintern in der Runde saßen. Ihr Erfolg vom Vorabend dauerte an; diese Meute Männer war ihrer Spur gefolgt.
„Wenn sie bloß nichts zerschlagen“, murmelte sie. Unter den heißen Atemstößen, die durch die Ritzen drangen, begann sie unruhig zu werden.
Doch Zoé führte Labordette herein, und die junge Frau stieß einen Schrei der Erleichterung aus. Er wollte mit ihr über eine Rechnung sprechen, die er für sie auf dem Friedensgericht in Ordnung gebracht hatte. Sie hörte ihm nicht zu und sagte mehrmals:
„Ich nehme Sie mit . . . Wir essen zusammen . . . Von da aus begleiten Sie mich zum Théâtre des Variétés. Ich trete erst um halb zehn auf.“
Der gute Labordette! Der kam wie gerufen! Der verlangte niemals etwas. Er war nur der Freund der Frauen, deren kleine Geschäfte er erledigte. So hatte er soeben im Vorbeigehen die Gläubiger im Vorzimmer abgewiesen. Übrigens wollten diese braven Leute gar nicht ihr Geld haben, im Gegenteil; wenn sie so beharrlich dageblieben waren, so deshalb, um Madame zu beglückwünschen und ihr nach ihrem großen Erfolg vom Vorabend persönlich erneut ihre Dienste anzubieten.
„Machen wir uns aus dem Staube, machen wir uns aus dem Staube“, sagte Nana, die angekleidet war.
Gerade kam Zoé zurück und rief:
„Madame, ich gebe es auf zu öffnen . . . Auf der Treppe stehen sie Schlange.“
Eine Schlange auf der Treppe! Selbst Francis begann, trotz des englischen Phlegmas, das er zur Schau trug, zu lachen, während er die Kämme wegräumte. Nana, die Labordettes Arm genommen hatte, drängte ihn in die Küche. Und sie brachte sich in Sicherheit, endlich von den Männern befreit und glücklich, da sie wußte, daß man ihn allein bei sich haben konnte, ganz gleich wo, ohne Dummheiten befürchten zu müssen.
„Sie werden mich bis vor meine Tür zurückbringen“, sagte sie, während sie die Dienstbotentreppe hinunterstiegen. „Dann bin ich sicher . . . Stellen Sie sich vor, ich will eine ganze Nacht schlafen, eine ganze Nacht für mich. Eine tolle Schrulle, mein Lieber!“