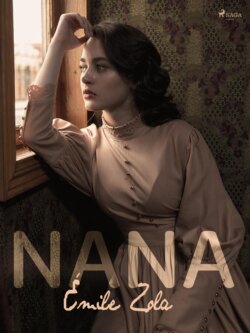Читать книгу Nana - Эмиль Золя, Emile Zola, Еміль Золя - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL III
ОглавлениеGräfin Sabine, wie man Frau Muffat de Beuville zu nennen sich angewöhnt hatte, um sie von der Mutter des Grafen zu unterscheiden, die im vergangenen Jahr gestorben war, empfing jeden Dienstag in ihrem Haus in der Rue Miromesnil an der Ecke der Rue de Penthièvre Gäste. Es war ein geräumiges, viereckiges Gebäude, das seit mehr als hundert Jahren von den Muffats bewohnt wurde. Nach der Straße zu schlief in klösterlicher Melancholie die hohe und schwarze Fassade mit riesigen Jalousien, die fast immer geschlossen blieben. Hinten waren in einem Stückchen feuchten Garten Bäume gewachsen, die nach der Sonne strebten und so lang und schmächtig waren, daß man ihre Zweige über dem Schieferdach sah.
An diesem Dienstag befand sich gegen zehn Uhr kaum ein Dutzend Leute im Salon. Da die Gräfin nur enge Freunde erwartete, öffnete sie weder den kleinen Salon noch den Speisesaal. Man war mehr unter sich, man plauderte beim Feuer. Der Salon war übrigens sehr groß und sehr hoch; vier Fenster gingen auf den Garten, dessen Feuchtigkeit man an diesem regnerischen Abend Ende April trotz der dicken Holzscheite spürte, die im Kamin brannten. Niemals drang die Sonne bis hier herunter; tagsüber erhellte ein grünliches Licht kaum das Zimmer, aber abends, wenn die Lampen und der Kronleuchter angezündet waren, war es nur noch ernst mit seinen Empiremöbeln aus massivem Mahagoni, seinen Wandbespannungen und seinen gelben Samtsesseln mit großen Atlasmustern. Man geriet in eine kalte Würde, in Sitten von einst, in ein verschwundenes Zeitalter, das einen Duft nach Frömmigkeit ausströmte.
Gegenüber dem Lehnstuhl, in dem die Mutter des Grafen gestorben war, einem viereckigen Lehnstuhl aus hartem Holz und festem Stoff, saß unterdessen auf der anderen Seite des Kamins Gräfin Sabine in einem tiefen Sessel, dessen rote Seidenpolsterung weich wie ein Daunenkissen war. Es war das einzige moderne Möbelstück, eine Ecke Phantasie, die in diese Strenge hereingebracht worden war und die dagegen abstach.
„Nun“, sagte die junge Frau, „wir werden den Schah von Persien hier haben . . .“
Man sprach von den Fürsten, die zur Ausstellung nach Paris kommen würden. Mehrere Damen bildeten einen Kreis vor dem Kamin. Frau du Joncquoy, deren Bruder, der Diplomat war, eine Mission im Orient erfüllt hatte, gab Einzelheiten über den Hof Nasr-ed-Dins zum besten.
„Sind Sie etwa leidend, meine Liebe?“ fragte Frau Chantereau, die Gattin eines Hüttenbesitzers, als sie sah, daß die Gräfin ein leichter Schauer ergriff, der sie erbleichen ließ. „O nein, durchaus nicht“, antwortete diese lächelnd. „Mir ist ein wenig kalt . . . Es dauert so lange, bis dieser Salon warm wird.“ Und sie ließ ihren düsteren Blick an den Wänden entlang bis nach oben zur Decke schweifen.
Estelle, ihre Tochter, ein dünnes und unbedeutendes junges Ding im undankbaren Alter von sechzehn Jahren, verließ den Hocker, auf dem sie saß, und richtete schweigend eines der Scheite wieder auf, das zur Seite gerollt war.
Doch Frau de Chezelles, eine Pensionatsfreundin Sabines, die fünf Jahre jünger als diese war, rief aus:
„Ach, ich möchte wirklich einen Salon wie deinen haben! Du kannst wenigstens Gäste empfangen . . . Heute baut man nur noch Kästen . . . Wenn ich an deiner Stelle wäre!“ Sie sprach ohne große Überlegung, mit lebhaften Gebärden und erklärte, sie würde die Wandbespannungen auswechseln, die Sessel, alles; dann würde sie Bälle geben, die ganz Paris herbeirennen ließen.
Hinter ihr hörte ihr Mann, ein Richter, mit ernster Miene zu. Es wurde erzählt, sie betrüge ihn, ohne ein Hehl daraus zu machen; aber man verzieh ihr; man empfing sie trotzdem, da sie verrückt sei, wie es hieß.
„Diese Léonide!“ begnügte sich Gräfin Sabine mit ihrem blassen Lächeln zu murmeln. Eine schlaffe Handbewegung ergänzte ihren Gedanken. Gewiß würde sie ihren Salon nicht verändern, nachdem sie nun siebzehn Jahre darin gelebt hatte. Jetzt würde er so bleiben, wie ihre Schwiegermutter ihn zu ihren Lebzeiten hatte erhalten wollen. Dann sagte sie, auf das Gespräch zurückkommend: „Man hat mir versichert, auch der König von Preußen und der Kaiser von Rußland würden herkommen.“
„Ja, es werden sehr schöne Feste angekündigt“, sagte Frau du Joncquoy.
Der Bankier Steiner, der seit kurzem von Léonide de Chezelles, die die ganze Pariser Gesellschaft kannte, in das Haus eingeführt worden war, plauderte auf einem Sofa, das zwischen zwei Fenstern stand; er fragte einen Abgeordneten aus, dem er geschickt Nachrichten hinsichtlich einer Börsenbewegung, die er witterte, zu entlocken versuchte, während Graf Muffat, der vor ihnen stand, ihnen schweigend mit noch saurerer Miene als gewöhnlich zuhörte. Vier oder fünf junge Leute bildeten eine andere Gruppe an der Tür, wo sie um Graf Xavier de Vandeuvres herumstanden, der ihnen halblaut eine zweifellos sehr schlüpfrige Geschichte erzählte, denn sie erstickten vor Lachen. Mitten im Zimmer saß ganz allein ein dicker Mann, ein Bürovorsteher im Innenministerium, schwerfällig in einem Lehnstuhl und schlief mit offenen Augen. Da aber einer der jungen Leute an der Geschichte Vandeuvres’ gezweifelt zu haben schien, erhob dieser die Stimme:
„Sie sind zu skeptisch, Foucarmont; Sie werden sich die Freude verderben.“ Und lachend ging er wieder zu den Damen hinüber. Als letzter eines vornehmen Geschlechts, weibisch und geistreich, brachte er jetzt mit rasenden Begierden, die nichts besänftigte, ein Vermögen durch. Sein Rennstall, einer der berühmtesten von Paris, kostete ihn wahnsinniges Geld, seine Verluste im Cercle Impérial beliefen sich jeden Monat auf eine beunruhigende Anzahl Louisdors, seine Mätressen verschlangen ihm jahraus, jahrein einen Pachthof und einige Morgen Land oder Wald, einen ganzen Teil seiner ausgedehnten Ländereien in der Picardie.
„Ich möchte Ihnen geraten haben, andere als Skeptiker zu behandeln, gerade Ihnen, der an nichts glaubt“, sagte Léonide und verschaffte ihm einen kleinen Platz neben sich. „Sie verderben sich die Freude.“
„Allerdings“, antwortete er. „Ich will die anderen aus meiner Erfahrung Nutzen ziehen lassen.“
Doch man gebot ihm Schweigen. Er errege Anstoß bei Herrn Venot. Als die Damen auseinandergegangen waren, bemerkte man, tief in ein Sofa zurückgelehnt, einen kleinen Mann von sechzig Jahren mit schlechten Zähnen und einem feinen Lächeln. Bequem saß er da wie bei sich zu Hause, hörte jedermann zu und ließ kein einziges Wort fallen. Mit einer Handbewegung sagte er, er nehme keinen Anstoß daran.
Vandeuvres hatte seine vornehme Miene wieder aufgesetzt und fügte ernst hinzu:
„Herr Venot weiß sehr wohl, daß ich glaube, was man glauben muß.“
Das war eine Bekundung religiösen Glaubens. Selbst Léonide schien befriedigt. Im Hintergrund des Zimmers lachten die jungen Leute nicht mehr. Der Salon war zugeknöpft, sie amüsierten sich hier schwerlich. Ein kalter Hauch war vorübergeweht. Inmitten des Schweigens hörte man die näselnde Stimme Steiners, den die Verschwiegenheit des Abgeordneten schließlich aufbrachte. Einen Augenblick sah Gräfin Sabine auf das Feuer, dann knüpfte sie die Unterhaltung wieder an.
„Letztes Jahr habe ich den König von Preußen in Baden gesehen. Für sein Alter ist er noch ziemlich rüstig.“ „Graf von Bismarck wird ihn begleiten“, sagte Frau du Joncquoy. „Kennen Sie den Grafen? Ich habe bei meinem Bruder mit ihm gespeist, oh, es ist schon lange her, als er Preußen in Paris vertrat . . . Also, das ist ein Mann, dessen letzte Erfolge ich kaum verstehe.“ „Wieso denn?“ fragte Frau Chantereau.
„Mein Gott! Wie soll ich Ihnen das erklären . . . Er gefällt mir nicht. Er sieht brutal und schlecht erzogen aus. Und außerdem finde ich ihn stupide.“
Darauf sprachen alle über Graf von Bismarck. Die Meinungen waren sehr geteilt. Vandeuvres kannte ihn und versicherte, er sei ein wackerer Zecher und ein wackerer Spieler. Aber mitten in der heftigsten Diskussion öffnete sich die Tür, und Hector de la Faloise erschien.
Fauchery, der ihm folgte, trat zu der Gräfin und sagte, sich verneigend:
„Madame, ich habe mich Ihrer freundlichen Einladung erinnert...“
Sie lächelte und machte eine liebenswürdige Bemerkung. Nachdem der Journalist den Grafen begrüßt hatte, blieb er einen Augenblick unschlüssig mitten im Salon stehen, wo er nur Steiner wiedererkannte. Vandeuvres, der sich umgedreht hatte, kam herbei und drückte ihm die Hand. Und sogleich zog ihn Fauchery, glücklich über das Zusammentreffen und von einem Mitteilsamkeitsbedürfnis ergriffen, zu sich heran und sagte leise:
„Auf morgen also, sind Sie dabei?“
„Weiß Gott!“
„Um Mitternacht bei ihr.“
„Ich weiß, ich weiß . . . Ich gehe mit Blanche hin.“ Er wollte entschlüpfen, um zu den Damen zurückzukehren und ein neues Argument zugunsten Herrn von Bismarcks anzuführen.
Doch Fauchery hielt ihn zurück.
„Sie würden nie erraten, mit was für einer Einladung sie mich beauftragt hat.“ Und mit einer leichten Kopfbewegung deutete er auf Graf Muffat, der gerade einen Punkt des Budgets mit dem Abgeordneten und Steiner erörterte.
„Nicht möglich!“ sagte Vandeuvres verblüfft und erheitert.
„Mein Wort! Ich habe schwören müssen, ihn zu ihr mitzubringen. Zum Teil komme ich deswegen her.“
Sie lachten beide still, und Vandeuvres, der eilends in den Kreis der Damen zurückkehrte, rief aus:
„Ich versichere Ihnen im Gegenteil, daß Herr von Bismarck sehr geistreich ist . . . Warten Sie, eines Abends hat er in meinem Beisein eine reizende Bemerkung gemacht . . .“ Inzwischen betrachtete La Faloise, der die wenigen schnellen, halblaut gewechselten Worte gehört hatte, Fauchery, weil er auf eine Erklärung hoffte, die nicht kam. Von wem wurde gesprochen? Was machte man morgen um Mitternacht? Er ließ seinen Vetter nicht mehr los.
Dieser hatte sich gesetzt. Gräfin Sabine interessierte ihn vor allem. Oft war ihr Name in seiner Gegenwart ausgesprochen worden; er wußte, daß sie vierunddreißig Jahre alt sein mußte, weil sie mit siebzehn geheiratet hatte, und daß sie seit ihrer Heirat ein klösterliches Leben zwischen ihrem Mann und ihrer Schwiegermutter führte. In der Gesellschaft sagten die einen, sie sei kühl wie eine Frömmlerin, die anderen bedauerten sie, wobei sie an ihr schönes Lachen, an ihre großen, flammenden Augen erinnerten, bevor sie in der Tiefe dieses alten Hauses eingeschlossen worden war. Fauchery musterte sie und war unschlüssig. Einer seiner Freunde, der vor kurzem als Hauptmann in Mexiko gestorben war, hatte ihm noch am Vorabend seiner Abreise beim Aufstehen vom Essen eine jener brutalen, vertraulichen Mitteilungen gemacht, die den verschwiegensten Männern in gewissen Augenblicken entschlüpfen. Doch seine Erinnerungen blieben unklar. An jenem Abend hatte man gut gegessen; und er war im Zweifel, als er die Gräfin, die schwarz gekleidet war und ruhig lächelte, mitten in diesem altertümlichen Salon sah. Eine hinter ihr stehende Lampe hob ihr feines Profil einer molligen Brünetten ab, in das allein der ein wenig dicke Mund eine Art gebieterischer Sinnlichkeit brachte.
„Was haben die bloß mit ihrem Bismarck?“ murmelte La Faloise, der sich den Anschein gab, als langweile er sich in der Gesellschaft. „Man kommt hier um. Ein schrulliger Einfall von dir, hierherkommen zu wollen!“
Fauchery fragte ihn unvermittelt:
„Sag mal, schläft die Gräfin mit niemandem?“
„O nein, o nein, mein Lieber“, stotterte er, sichtlich aus der Fassung gebracht, seine Pose vergessend. „Was glaubst du denn, wo du bist?“ Dann kam ihm zu Bewußtsein, daß seine Entrüstung es an Schick fehlen ließ. Sich tief in das Sofa flegelnd, fügte er hinzu: „Gott, ich sage nein, dabei weiß ich weiter nichts Näheres . . . Dahinten ist so ein Kleiner, dieser Foucarmont, der in allen Ecken zu finden ist. Man hat bestimmt schon was Tolleres gesehen als den. Mir ist das schnuppe . . . Sicher ist jedenfalls, daß die Gräfin, falls sie sich mit Seitensprüngen die Zeit vertreibt, bis jetzt ziemlich gerissen ist, denn nichts hat sich davon herumgesprochen, und niemand redet darüber.“
Dann sagte er Fauchery, ohne daß dieser sich die Mühe machte, ihn auszufragen, was er über Muffats wußte. Inmitten der Unterhaltung der Damen, die vor dem Kamin ihren Fortgang nahm, senkten sie beide die Stimme. Und wenn man sie mit ihrer weißen Halsbinde und ihren weißen Handschuhen sah, hätte man glauben können, sie erörterten in gewählten Sätzen irgendeinen ernsten Gegenstand. Also Mama Muffat, die La Faloise gut gekannt hatte, sei eine unausstehliche Alte gewesen, die dauernd mit den Pfaffen zusammensteckte; sonst ein großartiges Auftreten, ein gebieterisches Gebaren, das alles vor ihr niederzwang. Was Muffat angehe, den späten Sohn eines Generals, der von Napoleon I. zum Grafen gemacht worden war, so habe er natürlich nach dem 2. Dezember in Gunst gestanden. Auch ihm mangele es an Heiterkeit, doch gelte er für einen sehr ehrenhaften Mann mit rechtschaffenem Verstand. Dabei mit Ansichten aus einer anderen Welt und einer so hohen Auffassung von seinem Amt bei Hofe, von seinen Würden und Tugenden, daß er den Kopf wie ein heiliges Altarsakrament trage. Mama Muffat sei es gewesen, die ihm folgende schöne Erziehung habe zuteil werden lassen: alle Tage zur Beichte, keine Streiche, keine Jugend irgendwelcher Art. Er lebe streng nach den Vorschriften der Kirche, er habe Glaubenskrisen von sanguinischer Heftigkeit, die hitzigen Fieberanfällen glichen. Um ihn mit einer letzten Einzelheit zu kennzeichnen, flüsterte La Faloise schließlich seinem Vetter eine Bemerkung ins Ohr.
„Nicht möglich!“ sagte der letztere.
„Man hat es mir geschworen, Ehrenwort! — Er hatte noch nie, als er geheiratet hat.“
Fauchery lachte und betrachtete den Grafen, dessen schnurrbartloses, von einem Backenbart eingerahmtes Gesicht noch eckiger und strenger wirkte, seit er Steiner, der sich herumstritt, Zahlen angab.
„Wirklich, sein Kopf sieht danach aus“, murmelte er. „Ein hübsches Geschenk, das er seiner Frau gemacht hat. — Ach, die arme Kleine, hat er die langweilen müssen! Ich wette, sie hat nicht die geringste Ahnung!“ Soeben redete ihn Gräfin Sabine an.
Er hörte es nicht, so spaßig und außergewöhnlich fand er den Fall Muffat.
Sie wiederholte ihre Frage:
„Herr Fauchery, haben Sie nicht ein Charakterbild von Herrn von Bismarck veröffentlicht? — Sie haben mit ihm gesprochen?“
Er erhob sich lebhaft, trat an den Kreis der Damen heran, wobei er sich zu fassen suchte und übrigens mit völliger Leichtigkeit eine Antwort fand.
„Mein Gott, Madame, ich muß Ihnen gestehen, daß ich dieses Charakterbild nach in Deutschland erschienenen Biographien geschrieben habe . . . Ich habe Herrn von Bismarck niemals gesehen.“
Er blieb bei der Gräfin. Während er mit ihr plauderte, setzte er seine Überlegungen fort. Sie sah jünger aus, als sie war, man hätte sie für höchstens achtundzwanzig gehalten; vor allem ihre Augen hatten ein jugendliches Feuer bewahrt, das lange Lider in blauen Schatten ertränkten. In einem getrennten Haushalt aufgewachsen, wo sie einen Monat bei dem Marquis de Chouard und einen Monat bei der Marquise verbrachte, hatte sie sehr jung, beim Tode ihrer Mutter, geheiratet, zweifellos auf Betreiben ihres Vaters, dem sie lästig war. Ein schrecklicher Mensch, der Marquis, über den trotz seiner Frömmigkeit merkwürdige Geschichten zu kursieren begannen! Fauchery fragte, ob er nicht die Ehre haben würde, ihn zu begrüßen.
Gewiß, ihr Vater käme, aber sehr spät, er habe so viel Arbeit!
Der Journalist, der zu wissen glaubte, wo der Alte seine Abende verbrachte, blieb ernst. Doch ein Muttermal, das er auf der linken Wange der Gräfin in der Nähe des Mundes bemerkte, überraschte ihn. Nana hatte ganz genau das gleiche. Das war komisch. Auf dem Muttermal kräuselten sich Härchen; nur waren die Härchen bei Nanablond undbeider anderen pechschwarz. Einerlei, diese Frau schlief mit niemand.
„Ich habe immer das Verlangen gehabt, Königin Augusta kennenzulernen“, sagte sie. „Es wird behauptet, sie sei so gut, so fromm . . . Glauben Sie, daß sie den König begleiten wird?“ „Man nimmt es nicht an, Madame“, antwortete er.
Sie schlief mit niemand, das lag klar vor Augen. Es genügte, sie dort zu sehen, neben ihrer Tochter, die so nichtssagend und so geschraubt auf ihrem Hocker saß. Dieser grabesähnliche Salon, der einen Kirchengeruch ausströmte, besagte zur Genüge, unter welcher eisernen Hand und in welcher tiefen Erstarrung des Lebens sie gebeugt blieb. Sie hatte nichts von sich in diese altertümliche Wohnung mitgebracht, die schwarz vor Feuchtigkeit war. Muffat war es, der sich durchsetzte, der mit seiner frommen Erziehung, seinen Bußund Fastenübungen herrschte. Doch der Anblick des kleinen Greises mit den schlechten Zähnen und dem feinen Lächeln, den er ganz plötzlich in seinem Lehnstuhl hinter den Damen entdeckte, war ein noch entscheidenderes Argument für ihn. Er kannte den Mann, Théophile Venot, einen ehemaligen Anwalt, dessen Spezialität Kirchenprozesse gewesen waren; er hatte sich mit einem hübschen Vermögen zur Ruhe gesetzt und führte ein ziemlich mysteriöses Leben, wurde überall empfangen, sehr ehrerbietig gegrüßt, ja sogar ein wenig gefürchtet, als sei er der Vertreter einer großen Macht, einer dunklen Macht, die man hinter ihm spürte. Übrigens gab er sich sehr bescheiden. Er war Kirchenvorsteher an der Madeleine und hatte ganz einfach eine Stellung als Beigeordneter im Bürgermeisteramt des neunten Arrondissements angenommen, um seine Freizeit auszufüllen, wie er sagte. Zum Teufel! Die Gräfin war in guter Umgebung; nichts zu machen bei ihr.
„Du hast recht, man kommt hier um“, sagte Fauchery zu seinem Vetter, als er dem Kreis der Damen entronnen war. „Wir verschwinden gleich.“
Doch Steiner, den Graf Muffat und der Abgeordnete soeben verlassen hatten, kam wütend und schwitzend herbei und brummte halblaut:
„Verflucht! Dann sagen sie eben nichts, wenn sie nichts sagen wollen . . . Ich werde schon welche finden, die reden.“ Dann drängte er den Journalisten in eine Ecke, schlug einen anderen Ton an und sagte mit Siegermiene: „Also, auf morgen . . . Ich bin dabei, mein Bester!“
„Ah!“ machte Fauchery erstaunt.
„Sie wußten nicht Bescheid? — Na, ich habe große Mühe gehabt, sie zu Hause anzutreffen! Außerdem ließ mich Mignon nicht mehr aus den Augen.“ „Aber die Mignons sind doch dabei.“
„Ja, sie hat es mir gesagt . . . Schließlich hat sie mich doch empfangen und mich eingeladen . . . Punkt Mitternacht, nach dem Theater.“ Der Bankier strahlte. Er zwinkerte mit den Augen und fügte hinzu, wobei er seinen Worten eine besondere Bedeutung verlieh: „Haben Sie es geschafft?“
„Was denn?“ fragte Fauchery, der so tat, als verstehe er nicht. „Sie hat mir für meinen Artikel danken wollen. Und da ist sie zu mir gekommen.“
„Ja, ja . . . Sie haben Glück. Sie werden belohnt . . .Übrigens, wer zahlt eigentlich morgen?“
Der Journalist breitete die Arme aus, wie um zu erklären, daß das nie zu erfahren gewesen sei.
Doch Graf de Vandeuvres rief Steiner, der Herrn von Bismarck kannte.
Frau du Joncquoy war beinahe überzeugt. Sie schloß mit folgenden Worten.
„Er hat einen schlechten Eindruck auf mich gemacht. Ich finde, er hat ein bösartiges Gesicht . . . Aber ich will gerne glauben, daß er viel Geist hat. Das erklärt seine Erfolge.“
„Zweifellos“, sagte der Bankier, ein Jude aus Frankfurt, mit blassem Lächeln.
Indessen wagte es La Faloise, der seinem Vetter zusetzte, ihm diesmal die Frage vertraulich zuzuflüstern:
„Es wird also morgen abend bei einer Frau soupiert? — Bei wem eigentlich? Bei wem?“
Fauchery machte ihm ein Zeichen, daß man ihnen zuhöre; man müsse sich schicklich benehmen.
Von neuem hatte sich soeben die Tür geöffnet, und eine alte Dame trat ein; ihr folgte ein junger Mann, in dem der Journalist den Wildfang wiedererkannte, der bei der „Blonden Venus“ das berühmte „Fabelhaft!“, von dem man noch immer sprach, von sich gegeben hatte. Die Ankunft dieser Dame brachte Bewegung in den Salon. Eilfertig hatte sich Gräfin Sabine erhoben, um ihr entgegenzugehen; sie hatte ihre beiden Hände ergriffen und nannte sie ihre liebe Madame Hugon. Da La Faloise sah, daß sein Vetter diese Szene neugierig beobachtete, unterrichtete er ihn mit einigen kurzen Worten, um ihn zu erweichen: Madame Hugon, Witwe eines Notars, die sich nach Les Fondettes, einem alten Besitztum ihrer Familie bei Orleans, zurückgezogen habe, behalte in Paris in einem Haus, das sie in der Rue de Richelieu besitze, eine Stadtwohnung bei, verbringe dort augenblicklich einige Wochen, um ihren jüngsten Sohn unterzubringen, der sein erstes Jahr Jura studiere, sei früher eine enge Freundin der Marquise de Chouard gewesen und habe die Geburt der Gräfin miterlebt, die sie vor ihrer Heirat monatelang bei sich behalten hätte und die sie sogar noch duze. „Ich habe dir Georges mitgebracht“, sagte Frau Hugon zu Sabine. „Er ist groß geworden, hoffe ich!“
Der junge Mann mit seinen hellen Augen und seinem blonden Haar eines als Junge verkleideten Mädchens begrüßte die Gräfin zwanglos und erinnerte sie an eine Partie Federball, die sie vor zwei Jahren in Les Fondettes zusammen gespielt hatten.
„Philippe ist nicht in Paris?“ fragte Graf Muffat.
„O nein“, antwortete die alte Dame. „Er ist immer noch in Garnison in Bourges.“
Sie hatte sich gesetzt und sprach stolz von ihrem ältesten Sohn, einem großen Burschen, der eben, nachdem er sich aus einer Unüberlegtheit heraus zum Militär gemeldet hatte, sehr schnell den Rang eines Leutnants erreicht hatte. Alle diese Damen umringten sie mit ehrerbietiger Sympathie. Die Unterhaltung kam liebenswürdiger und feiner wieder in Gang. Und wie Fauchery diese ehrwürdige Frau Hugon dort sah, dieses mütterliche, von einem so gutmütigen Lächeln erhellte Gesicht zwischen den breiten Strähnen weißen Haares, fand er es lächerlich von sich, Gräfin Sabine einen Augenblick lang verdächtigt zu haben.
Doch eben hatte der große Sessel mit roter Seidenpolsterung, in den sich die Gräfin setzte, seine Aufmerksamkeit erregt. In diesem verräucherten Salon fand er seinen Farbton brutal und seine Extravaganz verwirrend. Der Graf hatte dieses Möbelstück von wollüstiger Trägheit bestimmt nicht hereingebracht. Man hätte es für einen Versuch halten können, für den Anfang eines Verlangens und Genießens. Dann vergaß er sich träumend und kam trotzdem auf jene unklare vertrauliche Mitteilung zurück, die man ihm eines Abends im Nebenzimmer eines Restaurants gemacht hatte. Von sinnlicher Neugierde getrieben, hatte er gewünscht, bei den Muffats eingeführt zu werden; da sein Freund nun in Mexiko geblieben war . . . Wer weiß? — Man mußte abwarten. Zweifellos war das eine Dummheit, doch der Gedanke quälte ihn; er fühlte sich angezogen, weil sein Laster geweckt worden war. Der große Sessel sah zerknittert aus, die Rückenlehne in Unordnung gebracht, was ihn jetzt belustigte.
,,Na, brechen wir auf?“ fragte La Faloise, wobei er hoffte, draußen den Namen der Frau zu erfahren, bei der soupiert werden sollte.
„Gleich“, antwortete Fauchery. Und er hatte keine Eile mehr; als Vorwand nahm er sich die Einladung, die auszusprechen man ihn beauftragt hatte und die nicht leicht anzubringen war.
Die Damen sprachen von einem Eintritt ins Kloster, einer sehr ergreifenden Zeremonie, über die die Pariser Gesellschaft seit drei Tagen tief bewegt war. Die älteste Tochter der Baronin de Fougeray war nämlich aus einer unwiderstehlichen Berufung heraus soeben bei den Karmeliterinnen eingetreten. Frau Chantereau, eine weitläufige Kusine der Fougerays, erzählte, die Baronin habe sich am folgenden Tage ins Bett legen müssen, so sehr hätten die Tränen sie erstickt.
„Ich habe jedenfalls einen sehr guten Platz gehabt“,, erklärte Léonide. „Ich fand das spannend.“
Frau Hugon jedoch bedauerte die arme Mutter. Welch ein Schmerz, so eine Tochter zu verlieren!
„Man beschuldigt mich, Frömmlerin zu sein“, sagte sie mit ihrer ruhigen Offenheit. „Das hindert mich nicht daran, die Kinder, die sich einen solchen Selbstmord in den Kopf setzen, sehr grausam zu finden.“
„Ja, es ist etwas Schreckliches“, murmelte die Gräfin mit einem leichten fröstelnden Zittern und kuschelte sich noch tiefer in ihren großen Sessel vor dem Feuer.
Darauf verfielen die Damen in eine eingehende Erörterung. Ihre Stimmen blieben jedoch zurückhaltend; zuweilen zerschnitt leichtes Lachen den Ernst der Unterhaltung. Die beiden Kaminlampen, die mit rosa Spitze bespannt waren, beleuchteten sie schwach; und auf weiter entfernt stehenden Möbeln waren lediglich noch drei Lampen, die den geräumigen Salon in sanftem Schatten ließen.
Steiner langweilte sich. Er erzählte Fauchery ein Abenteuer jener kleinen Frau de Chezelles, die er einfach kurz Léonide nannte; ein kleines Luder, sagte er, die Stimme senkend, hinter den Sesseln der Damen.
Fauchery betrachtete sie in ihrer großen Robe aus blaßblauem Atlas, wie sie drollig auf einer Ecke ihres Sessels saß, dünn und keck wie ein Junge, und am Ende war er überrascht, sie hier zu sehen; bei Caroline Héquet, deren Mutter das Haus seriös aufgezogen hatte, hatte man eine bessere Haltung. Das war ein richtiger Stoff für einen Artikel. Was für eine merkwürdige Welt war doch diese Pariser Gesellschaft! Die steifsten Salons wurden in Mitleidenschaft gezogen. Offensichtlich mußte dieser schweigsame Théophile Venot, der sich zu lächeln begnügte, wobei er seine schlechten Zähne zeigte, ein Vermächtnis der verstorbenen Gräfin sein, ebenso wie die Damen reifen Alters, Frau Chantereau, Frau du Joncquoy, und vier oder fünf Greise, die unbeweglich in den Ecken saßen. Graf Muffat brachte Beamte mit, die jene korrekte Haltung hatten, die man in den Tuilerien bei den Männern liebte; unter anderem den Bürovorsteher, der immer noch allein mitten im Zimmer saß mit glattrasiertem Gesicht und glanzlosen Blicken, so in seinen Frack eingeschnürt, daß er keine Bewegung wagen konnte. Fast alle jungen Leute und einige Persönlichkeiten mit vornehmem Benehmen hatte der Marquis de Chouard mitgebracht, der weiterhin Beziehungen zur legitimistischen Partei unterhielt, nachdem er sich bei seinem Eintritt in den Staatsrat mit dem Regime ausgesöhnt hatte. Übrig blieben Léonide de Chezelles, Steiner, eine ganz zweifelhafte Ecke, gegen die Frau Hugon mit ihrer Ruhe einer alten liebenswürdigen Frau abstach. Und Fauchery, der schon seinen Artikel vor sich sah, nannte das die Ecke der Gräfin Sabine.
„Ein anderes Mal“, fuhr Steiner leiser fort, „hat Léonide ihren Tenor nach Montauban kommen lassen. Sie bewohnte das Schloß Beaurecueil, zwei Meilen weiter weg, und kam alle Tage in einer zweispännigen Kalesche an, um ihn im ,Lion d’Orʻ, wo er abgestiegen war, zu besuchen . . . Der Wagen wartete vor der Tür, Léonide blieb stundenlang, während sich die Leute ansammelten und die Pferde betrachteten.“
Schweigen war eingetreten; einige feierliche Sekunden verstrichen in dem hohen Raum. Zwei junge Leute tuschelten, doch auch sie schwiegen, und man vernahm nur noch den gedämpften Schritt des Grafen Muffat, der das Zimmer durchquerte. Die Lampen schienen blasser geworden zu sein; das Feuer erlosch, und ein düsterer Schatten umhüllte die alten Freunde des Hauses in ihren Sesseln, die sie dort seit vierzig Jahren einnahmen. Es war, als hätten die Gäste zwischen dem Wechseln zweier Sätze den Geist der Mutter des Grafen mit ihrer vornehmen, eisigen Miene verspürt.
Doch schon begann Gräfin Sabine wieder:
„Schließlich war ein Gerücht darüber in Umlauf . . . Der junge Mann soll gestorben sein, und das würde den Eintritt dieses armen Kindes ins Kloster erklären. Übrigens heißt es, Herr de Fougeray hätte niemals in die Heirat eingewilligt.“
„Es werden noch allerhand andere Sachen erzählt“, rief Léonide unbesonnen aus. Sie begann zu lachen, weigerte sich jedoch, zu reden.
Sabine führte, von dieser Heiterkeit angesteckt, ihr Taschentuch an die Lippen. Und dieses Lachen in der Feierlichkeit des großen, weiten Raums nahm einen Klang an, der Fauchery in Erstaunen setzte. Es klang wie zerklirrendes Kristall. Sicher war da ein Sprung im Entstehen.
Sofort antworteten alle Stimmen; Frau du Joncquoy erhob Einspruch; Frau Chantereau wußte, es sei eine Heirat geplant gewesen, aus der Sache sei aber nichts geworden. Selbst die Männer wagten ihre Meinung zu äußern. Einige Minuten lang herrschte ein Durcheinander von Urteilen, in die sich die verschiedenen Elemente des Salons, Bonapartisten und Legitimisten, die mit den Skeptikern der Gesellschaft vermischt waren, auf einmal stürzten, wobei sie hart aneinandergerieten. Estelle hatte geläutet, damit Holz auf das Feuer gelegt würde. Der Diener schraubte die Lampen wieder hoch. Man hätte an ein Erwachen denken können. Fauchery lächelte gleichsam vor Behagen.
„Zum Teufel! Sie heiraten Gott, wenn sie ihren Vetter nicht haben heiraten können“, stieß Vandeuvres, den diese Frage langweilte und der eben wieder zu Fauchery getreten war, zwischen den Zähnen hervor. „Mein Lieber, haben Sie jemals erlebt, daß eine Frau, die geliebt wird, Nonne geworden ist?“ Er wartete die Antwort nicht ab, er hatte genug davon; und halblaut fragte er: „Sagen Sie, wie viele sind wir morgen? — Da sind die Mignons, Steiner, Sie, Blanche und ich . . . Wer noch?“
„Caroline, nehme ich an . . . Simonne . . . Gaga zweifellos . . . Genau weiß man das nie, nicht wahr? Man glaubt, es sind zwanzig bei diesen Anlässen, und dann sind es dreißig.“ Vandeuvres, der die Damen betrachtete, sprang jäh auf ein anderes Thema über.
„Vor fünfzehn Jahren muß sie sehr gut ausgesehen haben, diese Dame du Joncquoy . . . Die arme Estelle ist noch länger geworden. Das ist nun ein hübsches Plättbrett zum Ins-Bett-Legen!“ Doch er unterbrach sich und kam auf das morgige Souper zurück. „Das Langweilige bei diesen Dingern da ist, daß es immer dieselben Frauen sind . . . Man brauchte was Neues. Bemühen Sie sich doch mal, welche aufzutreiben . . . Halt! Ich habe eine Idee! Ich werde den dicken Mann da bitten, die Frau mitzubringen, die er neulich abends ins Théâtre des Variétés ausgeführt hat.“ Er sprach von dem Bürovorsteher, der in der Mitte des Salons eingeschlummert war.
Fauchery amüsierte sich von weitem damit, diese heikle Verhandlung zu verfolgen. Vandeuvres hatte sich neben den dicken Mann gesetzt, der sehr würdig blieb. Die beiden schienen einen Augenblick maßvoll die schwebende Frage zu erörtern, nämlich herauszubekommen, welches wirkliche Gefühl ein junges Mädchen dazu treibe, ins Kloster zu gehen. Dann kam der Graf zurück und sagte:
„Es ist nicht möglich. Er schwört, sie sei sittsam. Sie würde ablehnen . . . Dabei hätte ich gewettet, daß ich sie bei Laure gesehen habe.“
„Wie? Sie gehen zu Laure!“ murmelte Fauchery lachend. „Sie wagen sich an solche Orte! — Ich glaubte, da kämen nur wir hin, wir armen Teufel . . .“
„Oh, mein Lieber, man muß doch alles kennenlernen.“ Jetzt grinsten sie mit leuchtenden Augen und erzählten sich Einzelheiten über den Mittagstisch in der Rue des Martyrs, wo die dicke Laure Piédefer die kleinen Weiber, die in Geldverlegenheit waren, für drei Francs essen ließ. Ein schönes Loch! Alle kleinen Weiber küßten Laure auf den Mund. Und als Gräfin Sabine den Kopf wandte, da sie beim Vorbeigehen ein Wort verstanden hatte, zogen sie sich erheitert und rot geworden zurück, wobei sie einander anstießen. In ihrer Nähe hatten sie Georges Hugon nicht bemerkt, der ihnen zuhörte, wobei er so stark errötete, daß sich eine rosige Woge von seinen Ohren bis zu seinem Mädchenhals ergoß. Dieses Baby war schamerfüllt und hingerissen. Seit ihn seine Mutter im Salon losgelassen hatte, schlich er hinter Frau de Chezelles umher, der einzigen Frau, die er schick fand. Und doch übertraf Nana sie ganz gewaltig!
„Gestern abend“, sagte Frau Hugon, „hat mich Georges ins Theater geführt. Ja, ins Théâtre des Variétés, in das ich bestimmt seit zehn Jahren keinen Fuß mehr gesetzt habe. Der Junge schwärmt für Musik . . . Mir hat das kaum Spaß gemacht, aber er war so glücklich! — Merkwürdige Stücke macht man heute. Außerdem begeistert mich Musik wenig, muß ich gestehen.“
„Wie Madame? Sie mögen Musik nicht?“ rief Frau du Joncquoy und erhob die Augen zum Himmel. „Ist es möglich, daß man Musik nicht liebt?“
Das wurde zu einem allgemeinen Ausruf. Niemand erwähnte dieses Stück im Théâtre des Variétés, aus dem die gute Frau Hugon nicht klug geworden war; die Damen kannten es, aber sie redeten nicht darüber. Sofort stürzte man sich in Gefühlsseligkeit, in eine ausgeklügelte und verzückte Bewunderung der Meister. Frau du Joncquoy liebte nur Weber, Frau Chantereau hielt es mit den Italienern. Die Stimmen der Damen waren weich und schmachtend geworden. Man hätte meinen können, es sei eine kirchliche Andacht vor dem Kamin, der verschwiegene und vor Wonne vergehende Lobgesang in einer kleinen Kapelle.
„Nun“, murmelte Vandeuvres und führte Fauchery in die Mitte des Salons zurück, „wir müssen doch eine Frau für morgen finden. Wie wär’s, wenn wir Steiner fragen?“
„Ach, Steiner“, sagte der Journalist, „wenn der eine Frau hat, dann will sie Paris nicht mehr haben.“
Vandeuvres suchte jedoch seine Umgebung ab.
„Warten Sie“, versetzte er, „neulich habe ich Foucarmont mit einer reizenden Blondine getroffen. Ich werde ihm sagen, er soll sie mitbringen.“ Und er rief Foucarmont. Schnell wechselten sie einige Worte. Eine Komplikation mußte eingetreten sein, denn sie beide gingen, mit vorsichtigen Schritten über die Röcke der Damen hinwegschreitend; davon und suchten einen anderen jungen Mann auf, mit dem sie die Unterhaltung in der Nische eines Fensters fortsetzten.
Fauchery, der allein geblieben war, beschloß, an den Kamin heranzutreten, als Frau du Joncquoy gerade erklärte, sie könne nichts von Weber hören, ohne sogleich Seen, Wälder und Sonnenaufgänge auf taugetränkten Fluren zu sehen. Doch eine Hand berührte ihn an der Schulter, während eine Stimme hinter ihm sagte:
„Das ist nicht nett.“
„Was denn?“ fragte er, während er sich umdrehte und La Faloise erkannte.
„Dieses Souper morgen . . . Du hättest mir ruhig eine Einladung verschaffen können.“
Fauchery wollte gerade antworten, als Vandeuvres zurückkam und zu ihm sagte:
„Es scheint, als ob es keine von Foucarmonts Frauen ist; es ist das Verhältnis jenes Herrn dahinten . . . Sie wird nicht kommen können. So ein Pech! — Aber ich habe Foucarmont trotzdem eingespannt. Er wird versuchen, Louise vom Théâtre du Palais-Royal zu kriegen.“
„Herr de Vandeuvres“, fragte Frau Chantereau, die Stimme erhebend, „Wagner hat man am Sonntag doch ausgepfiffen, nicht wahr?“
„Oh, gräßlich, Madame“, antwortete er und trat mit seiner ausgesuchten Höflichkeit herzu. Da man ihn nicht zurückhielt, entfernte er sich dann wieder und flüsterte dem Journalisten weiter ins Ohr: „Ich werde noch welche einspannen . . . Diese jungen Leute müssen doch kleine Mädchen kennen.“
Dann sah man ihn liebenswürdig und lächelnd die Männer ansprechen und in allen vier Ecken des Salons plaudern. Er mischte sich unter die Gruppen, flüsterte jedem einen Satz zu und wandte sich mit Augenzwinkern und Zeichen des Einverständnisses wieder ab. Es war, als gebe er mit seinem ungezwungenen Benehmen eine Parole aus. Der Satz machte die Runde, und man verabredete sich, während die gefühlvollen Erörterungen der Damen über Musik den unmerklichen fieberhaften Lärm dieser Anwerbung übertönten.
„Nein, reden Sie nicht von Ihren Deutschen“, meinte Frau Chantereau mehrmals. „Gesang ist Fröhlichkeit, ist Licht . . . Haben Sie die Patti im ,Barbierʻ gehört?“
„Köstlich!“ murmelte Léonide, die nur Operettenmelodien auf ihrem Klavier klimperte.
Gräfin Sabine hatte unterdessen geläutet. Wenn die Besucher am Dienstag nicht zu zahlreich waren, wurde der Tee gleich im Salon serviert. Während die Gräfin einen einfüßigen Tisch von einem Diener wegräumen ließ, blickte sie Graf de Vandeuvres nach. Sie behielt jenes vage Lächeln bei, das ein wenig vom Weiß ihrer Zähne sehen ließ. Und als der Graf vorüberging, fragte sie ihn:
„Was verabreden Sie denn da so heimlich, Herr de Vandeuvres?“
„Ich, Madame?“ antwortete er gelassen. „Ich verabrede nichts.“
„Oh . . . ich sah Sie so geschäftig . . . Warten Sie, Sie können sich nützlich machen.“ Sie legte ihm ein Album in die Hände und bat ihn, es auf das Klavier zu legen.
Doch er fand Mittel und Wege, Fauchery ganz leise mitzuteilen, man würde Tatan Néué, den schönsten Busen des Winters, und Maria Blond, diejenige, die gerade im Théâtre des Folies-Dramatiques debütiert habe, kriegen. Unterdessen behinderte ihn La Faloise bei jedem Schritt, weil er auf eine Einladung wartete. Schließlich bot er sich geradezu an. Vandeuvres lud ihn sofort ein; nur ließ er ihn versprechen, Clarisse mitzubringen; und da La Faloise so tat, als habe er Bedenken, beschwichtigte er ihn, indem er sagte:
„Ich lade Sie doch ein! Das genügt.“
La Faloise hätte allerdings gern den Namen der Frau erfahren. Doch die Gräfin hatte Vandeuvres zurückgerufen und fragte ihn, auf welche Art die Engländer den Tee zubereiten.
Er fuhr oft nach England, wo seine Pferde bei Rennen liefen. Seiner Ansicht nach verstünden es nur die Russen, Tee zuzubereiten, und er erläuterte ihr deren Rezept. Als habe er, während er sprach, innerlich die ganze Bemühung fortgeführt, hielt er dann inne, um zu fragen:
„Da fällt mir übrigens der Marquis ein. Sollten wir ihn denn nicht sehen?“
„Gewiß, mein Vater hatte es mir ausdrücklich versprochen“, antwortete die Gräfin. „Ich beginne unruhig zu werden . . . Seine Arbeiten werden ihn abgehalten haben.“ Vandeuvres lächelte diskret. Auch er schien zu ahnen, welcher Art die Arbeit des Marquis de Chouard war. Er hatte an eine schöne Frau gedacht, die der Marquis manchmal aufs Land mitnahm. Vielleicht könnte man sie bekommen.
Unterdessen hielt Fauchery den Augenblick für gekommen, zu wagen, Graf Muffat einzuladen. Der Abend war schon vorgerückt.
„Im Ernst?“ fragte Vandeuvres, der an einen Scherz glaubte.
„Ganz im Ernst . . . Wenn ich meinen Auftrag nicht erledige, kratzt sie mir die Augen aus. Ein verrückter Einfall, Sie wissen ja.“
„Na, dann werde ich Ihnen helfen, mein Lieber.“
Es schlug elf Uhr. Von ihrer Tochter unterstützt, reichte die Gräfin den Tee. Da fast nur enge Freunde gekommen waren, gingen die Tassen und die Teller mit kleinen Kuchen ungezwungen herum. Selbst die Damen verließen ihre Sessel vor dem Feuer nicht, tranken in kleinen Schlückchen und knabberten, die Kuchen mit den Fingerspitzen haltend. Von der Musik war man auf die Lieferanten zu sprechen gekommen. Nur Boissier käme für Fondants in Frage und Catherine für Eis; Frau Chantereau jedoch verteidigte Latinville. Die Worte wurden träger, Müdigkeit schläferte den Salon ein. Steiner hatte sich wieder daran gemacht, den Abgeordneten, den er in der Ecke eines kleinen Sofas blockiert hatte, unerbittlich zu bearbeiten. Herr Venot, dem die Süßigkeiten die Zähne verdorben haben mußten, aß Schlag auf Schlag mit leisem Mäusegeräusch trockene Kuchen, während der Bürovorsteher, die Nase in einer Tasse, kein Ende mehr fand. Und die Gräfin ging ohne Eile von einem zum anderen, nötigte keinen, blieb einige Sekunden dort stehen und betrachtete die Männer mit einem Ausdruck stummen Fragens, lächelte dann und ging weiter. Das hohe Feuer hatte sie ganz rosig gemacht; sie schien die Schwester ihrer Tochter zu sein, die so dürr und linkisch in ihrer Nähe saß. Als sie sich Fauchery näherte, der mit ihrem Mann und Vandeuvres plauderte, fiel es ihr auf, daß man schwieg; und sie blieb nicht stehen, sondern gab etwas weiter weg Georges Hugon die Tasse Tee, die sie anbot.
„Eine Dame hätte Sie gern zum Souper“, begann der Journalist aufgeräumt und wandte sich an Graf Muffat.
Graf Muffat, dessen Gesicht den ganzen Abend über düster geblieben war, schien sehr überrascht:
„Was für eine Dame?“
„Nun, Nana!“ sagte Vandeuvres, um die Einladung kurz entschlossen anzubringen.
Der Graf wurde ernster. Seine Lider zuckten unmerklich, während ein Unbehagen wie ein Anflug von Migräne über seine Stirn glitt.
„Aber ich kenne diese Dame ja gar nicht“, murmelte er.
„Hören Sie, Sie sind doch zu ihr gegangen“, bemerkte Vandeuvres.
„Wie! Ich bin zu ihr gegangen . . . Ach ja, neulich, für das Fürsorgeamt. Ich dachte nicht mehr daran . . . Aber trotzdem, ich kenne sie nicht; ich kann nicht annehmen.“ Er hatte eine eisige Miene aufgesetzt, um ihnen zu verstehen zu geben, daß ihm dieser Scherz geschmacklos vorkäme. Ein Mann von seinem Rang gehöre nicht an den Tisch eines dieser Weiber.
Vandeuvres erhob laut Einspruch: es handle sich um ein Künstlersouper; Talent entschuldige alles.
Aber ohne den Argumenten Faucherys noch weiter zuzuhören, der von einem Diner erzählte, auf dem der Prinz von Schottland, ein Sohn der Königin, sich an die Seite einer ehemaligen Tingeltangelsängerin gesetzt habe, betonte der Graf seine Ablehnung. Trotz seiner großen Höflichkeit entschlüpfte ihm sogar eine gereizte Gebärde.
Georges und La Faloise, die sich gegenüberstanden und dabei waren, ihre Tasse Tee zu trinken, hatten die wenigen in ihrer Nähe gewechselten Worte gehört.
„Aha! Bei Nana ist es also“, murmelte La Faloise. „Das hätte ich ahnen müssen.“
Georges sagte nichts, doch er flammte, seine blonden Haare waren wirr, seine blauen Augen leuchteten wie Kerzen, so sehr entzündete und erregte ihn das Laster, in dem er sich seit einigen Tagen bewegte. Endlich hatte er also Zugang zu allem, wovon er geträumt hatte!
„Aber ich kenne ja ihre Adresse gar nicht“, meinte La Faloise.
„Boulevard Haussmann, zwischen der Rue de lʻArcade und der Rue Pasquier, im dritten Stock“, sagte Georges in einem Zug. Und da ihn der andere erstaunt ansah, fügte er, ganz rot, von Einbildung und Verlegenheit berstend, hinzu: „Ich bin dabei, sie hat mich heute morgen eingeladen.“ Doch im Salon war eine starke Bewegung zu spüren. Vandeuvres und Fauchery konnten nicht weiter in den Grafen dringen. Soeben war der Marquis de Chouard eingetreten, und alle bemühten sich um ihn. Mühselig war er mit schwachen Beinen näher getreten; und er blieb in der Mitte des Zimmers stehen, bleich, mit blinzelnden Augen, als komme er aus irgendeiner düsteren Gasse und sei von der Helligkeit der Lampen geblendet.
„Ich erwartete nicht mehr, Sie zu sehen, Vater“, sagte die Gräfin. „Ich wäre bis morgen in Unruhe gewesen.“
Mit der Miene eines Menschen, der nicht versteht, sah er sie an, ohne zu antworten. Seine in dem glattrasierten Gesicht sehr dicke Nase sah aus wie die Geschwulst eines Karbunkels, während seine Unterlippe herabhing.
Als ihn Frau Hugon so übermüdet sah, bedauerte sie ihn voller Mitleid.
„Sie arbeiten zuviel. Sie sollten sich ausruhen . . . In unserem Alter muß man die Arbeit den jungen Leuten überlassen.“
„Die Arbeit, ach ja, die Arbeit“, stammelte er schließlich. „Immer viel Arbeit . . .“ Er faßte sich wieder, richtete seine gebeugte Gestalt auf und fuhr mit der Hand — einer Bewegung, die häufig bei ihm war — über seine weißen Haare, deren spärliche Locken hinter seinen Ohren flatterten. „Woran arbeiten Sie denn so spät?“ fragte Frau du Joncquoy. „Ich glaubte Sie auf dem Empfang des Finanzministers.“
Doch die Gräfin schaltete sich ein:
„Mein Vater hatte einen Gesetzesentwurf zu studieren.“ „Ja, einen Gesetzesentwurf“, sagte er, „einen Gesetzesentwurf, ganz recht . . . Ich hatte mich eingeschlossen . . . Es handelt sich um die Fabriken; ich möchte, daß die Sonntagsruhe eingehalten wird. Es ist wirklich eine Schande, daß die Regierung nicht mit Nachdruck handeln will. Die Kirchen werden leer; wir gehen Katastrophen entgegen.“ Vandeuvres hatte Fauchery angesehen. Die beiden standen hinter dem Marquis und beschnupperten ihn.
Als ihn Vandeuvres beiseite nehmen konnte, um mit ihm über jene schöne Frau zu sprechen, die er aufs Land mitnahm, heuchelte der Greis großes Erstaunen. Vielleicht habe man ihn mit Baronin Decker gesehen, bei der er manchmal einige Tage in Viroflay verbringe.
Als einzige Rache fragte ihn Vandeuvres brüsk:
„Sagen Sie, wo sind Sie denn vorbeigegangen? Ihr Ellbogen ist ja voller Spinnweben und Gips.“
„Mein Ellbogen“, murmelte er leicht verwirrt. „Ach ja, es ist wahr . . . Ein bißchen Schmutz . . . Das werde ich mir geholt haben, als ich bei mir zu Hause die Treppe hinunterging.“
Mehrere Leute gingen. Es war kurz vor Mitternacht. Zwei Diener räumten geräuschlos die leeren Tassen und die Kuchenteller ab. Vor dem Kamin hatten die Damen ihren Kreis neu gebildet und verengert und plauderten mit größerer Ungezwungenheit in der Mattigkeit dieses zu Ende gehenden Abends. Der Salon selber schlummerte ein; träge Schatten sanken von den Wänden herab. Jetzt sprach Fauchery davon, sich zurückzuziehen. Doch erneut vergaß er die Zeit, als er Gräfin Sabine betrachtete. Sie erholte sich von ihren Hausfrauenpflichten auf ihrem gewohnten Platz, stumm, die Augen auf ein Holzscheit geheftet, das glühend verbrannte, das Gesicht so weiß und so verschlossen, daß ihn wieder Zweifel ergriffen. Im Schein des Feuers schimmerten die schwarzen Härchen des Muttermals, das sie am Mundwinkel hatte, blond. Ganz und gar das Muttermal Nanas, sogar die Farbe. Er konnte sich nicht enthalten, Vandeuvres ein paar Worte darüber ins Ohr zu sagen. Tatsächlich, das sei wahr, niemals habe dieser das bemerkt.
Und die beiden setzten den Vergleich zwischen Nana und der Gräfin fort. Sie fanden, sie hätten eine unbestimmte Ähnlichkeit um Kinn und Mund, jedoch die Augen seien keineswegs gleich. Außerdem sehe Nana wie ein gutmütiges Mädchen aus, während man bei der Gräfin nicht genau wisse; man hätte an eine Katze denken können, die mit eingezogenen Krallen schlief, die Pfötchen kaum von einem nervösen Schauer bewegt.
„Immerhin würde man mit ihr schlafen“, erklärte Fauchery. Vandeuvres entkleidete sie mit Blicken.
„Ja, immerhin“, sagte er. „Aber, wissen Sie, ich traue den Schenkeln nicht. Sie hat keine Schenkel, wollen Sie wetten?“ Er schwieg.
Fauchery stieß ihn lebhaftam Ellbogen,wobei er mit einem Wink auf Estelle deutete, die vor ihnen auf ihrem Hocker saß. Ohne sie zu bemerken, hatten sie soeben lauter gesprochen, und sie mußte es gehört haben. Doch sie blieb steif und unbeweglich, und auf ihrem mageren Hals eines zu schnell gewachsenen jungen Mädchens hatte sich kein Härchen gerührt. Darauf gingen sie drei oder vier Schritte weiter. Vandeuvres schwor, die Gräfin sei eine hochanständige Frau.
In diesem Augenblick erhoben sich die Stimmen vor dem Kamin. Frau du Joncquoy sagte:
„Ich habe Ihnen zugestanden, daß Herr von Bismarck vielleicht ein Mann von Geist ist . . . Nur, wenn Sie bis zum Genie gehen . . .“
Die Damen waren auf ihren ersten Gesprächsgegenstand zurückgekommen.
„Wie! Schon wieder Herr von Bismarck“, murmelte Fauchery. „Diesmal flüchte ich aber wirklich.“
„Warten Sie“, sagte Vandeuvres. „Wir brauchen ein endgültiges Nein vom Grafen.“
Graf Muffat unterhielt sich mit seinem Schwiegervater und einigen ernsten Männern. Vandeuvres führte ihn beiseite und erneuerte die Einladung, indem er in ihn drang und sagte, er seIbst sei bei dem Souper anwesend. Ein Mann könne überall hingehen, niemand würde daran denken, etwas Schlechtes dabei zu sehen, wo doch höchstens Neugier vorhanden sei. Der Graf hörte sich diese Argumente mit gesenkten Augen und stummem Gesicht an. Vandeuvres spürte ein Zögern in ihm, als der Marquis de Chouard mit fragender Miene näher trat. Und als der letztere erfuhr, worum es sich handelte, als Fauchery in seinerseits einlud, blickte er verstohlen auf seinen Schwiegersohn. Es entstand ein Schweigen, eine Verlegenheit; doch die beiden ermutigten sich, zweifellos hätten sie schließlich angenommen, wenn Graf Muffat nicht Herrn Venot bemerkt hätte, der ihn unverwandt ansah. Der kleine Greis lächelte nicht mehr; er hatte ein erdfahles Gesicht, stählerne, klare und stechende Augen.
„Nein“, antwortete der Graf sofort in so bestimmtem Ton, daß man nicht weiter zu fragen brauchte.
Darauf lehnte der Marquis mit noch mehr Schärfe ab. Er sprach von Moral. Die oberen Stände müßten ein Beispiel geben.
Fauchery lächelte und drückte Vandeuvres die Hand. Er wartete nicht auf ihn; er ging sofort weg, denn er mußte bei seiner Zeitung vorbeigehen.
„Bei Nana um Mitternacht, nicht wahr?“
La Faloise zog sich ebenfalls zurück. Steiner hatte sich eben vor der Gräfin verneigt. Andere Männer folgten ihnen. Und dieselben Worte liefen um, jeder wiederholte, während er seinen Mantel im Vorzimmer nahm: „Um Mitternacht bei Nana.“ Georges, der erst mit seiner Mutter aufzubrechen beabsichtigte, hatte auf der Schwelle Aufstellung genommen, wo er die genaue Adresse angab, dritter Stock, die Tür links. Inzwischen warf Fauchery vor dem Hinausgehen einen letzten Blick um sich. Vandeuvres hatte seinen Platz inmitten der Damen wieder eingenommen und scherzte mit Léonide de Chezelles. Graf Muffat und der Marquis de Chouard mischten sich in die Unterhaltung, während die gute Frau Hugon mit offenen Augen einschlief. Hinter den Röcken verloren, hatte Herr Venot, der wieder ganz klein geworden war, sein Lächeln wiedergefunden. Es schlug langsam Mitternacht in dem geräumigen, feierlichen Raum.
„Wie! Wie!“ fing Frau du Joncquoy wieder an. „Sie nehmen an, Herr von Bismarck wird Krieg gegen uns führen und uns schlagen . . . Oh, das übersteigt ja alles!“
In der Tat, rings um Frau Chantereau wurde gelacht, die diese Äußerung soeben wiederholt hatte, die sie im Elsaß gehört hatte, wo ihr Mann eine Fabrik besaß.
„Zum Glück ist der Kaiser da“, sagte Graf Muffat mit seinem offiziellen Ernst.
Das war das letzte Wort, das Fauchery hören konnte. Er schloß die Tür wieder, nachdem er noch einmal Gräfin Sabine betrachtet hatte. Sie plauderte bedächtig mit dem Bürovorsteher und schien an der Unterhaltung dieses dicken Mannes regen Anteil zu nehmen. Bestimmt mußte er sich getäuscht haben, es war gar kein Sprung vorhanden. Das war schade.
„Na, kommst du nicht herunter?“ rief ihm La Faloise aus dem Vestibül zu.
Und als man sich auf dem Bürgersteig trennte, wiederholte man noch einmal:
„Auf morgen bei Nana.“