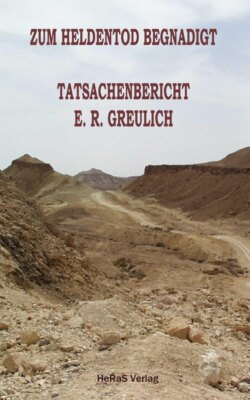Читать книгу Zum Heldentod begnadigt - E.R. Greulich - Страница 5
2
ОглавлениеOb die anderen Einheiten unseres Regiments nicht so guten Unterricht über Fahnenflucht erhalten haben?
Nicht lange nach dieser Instruktionsstunde geht grauengeladenes Wispern durch die Stuben. "Einer ist erschossen worden wegen Fahnenflucht" Das Wispern bestätigt sich. Der Spieß verliest einen Regimentsbefehl, der folgendermaßen schließt: "… Des Morgens um sieben Uhr wurde das Urteil vollstreckt."'
Vielen armen Teufeln scheint das nicht so schön klargemacht worden zu sein, denn ähnliche Regimentsbefehle werden uns noch des Öfteren vor Weihnachten vorgelesen. Von unserem Haufen versucht keiner auszureißen.
Ist auch gar nicht mehr nötig. Jetzt, wo wir mit "Lockerungen" bedacht sind. Diese Lockerungen bestehen in Sonntagnachmittagsurlaub, alle vierzehn Tage einmal. Wir Funker unter Aufsicht Feldwebel Tarstags und der Funkunteroffiziere Schmott und Mirat. Tarstag ist für jeden Einzelnen von uns verantwortlich. Er weiß genau, dass seine Berufssoldatenlaufbahn hin ist, wenn er mit einem weniger zurückkommt.
Das erste Mal marschieren wir in ein benachbartes Nest und kehren in die Dorfkneipe ein. Es gibt nichts weiter als dünnes Bier.
Wir sitzen vor unserem Dünnbier und sind sooo lustig.
Wer austreten will, muss sich bei Tarstag abmelden. Unruhe flackert auf in seinen Augen, wenn einer etwas länger bleibt. Es ist eine Viecherei, für ihn und für uns. Als wir endlich ein wenig warm geworden sind vom Tabaksrauch und vom lauten Leben in der Kneipe, müssen wir wieder aufbrechen. Leicht aufgelöst in kleine Trupps trotten wir nach Hause. Wo kein Unteroffizier dabei ist, wird gespöttelt. Einige fluchen.
"Uff solch een Ausjang vazichte ick", räsoniert Necke, "da leje ick ma lang uffs Bette, denn weeß ick, wat ick von'n Sonntach zu halten habe und brauch die Komödje nich mitzumachen:'
"Vergiss nicht", sage ich, "dass das Hinlegen auf die Betten am Tage verboten ist."
"Denn mach ick ehmd krank", murrt er weiter, "wenn man uns Klamauk macht, kann ick det ooch mal umjekehrt uffziehn."
"Und was das Schlimmste ist", empört sich Paul Lewenz, "im ganzen Lokal nicht ein einziges Mädchen, keine Frau, kein weibliches Wesen. "
"Oho", provoziere ich, "war denn die Dame hinter dem Schanktisch nichts?"
"Seit wann sind denn sechzigjährige Muhmen weibliche Wesen?", entrüstet sich Paul, "es ist nicht nur schlimm gewesen, sondern auch verdächtig." Er bohrt sich richtig in den Gedanken hinein. "Die Leute im Ort guckten alle so dumm."
"Du merkst aba ooch allet", stichelt Necke, "meinste, det hat sich hia noch nich rumjesprochen, det uffn Heuberg Zuchthäusla ausjebildet werden?"
"Ja", sagt Paul, "das ist mir auch aufgefallen. Soldaten sind sonst das Zauberwort für alle Weiberröcke. Uns fliehen sie. Für diese Volksgenossen sollen wir nun begeistert in den Krieg ziehen. Es macht keinen Spaß."
Polz lacht brutal: "Mensch, du Dussel bist doch nich hier, damit et dia Spaß macht. Kriech is übahaupt keen Spaß. Kriech is großa Rotz. Det merk dia, dass de uffhörst zu spinnen."
"Recht hast du", sinniert Paul, "man muss viel abgebrühter werden. Schließlich beurteilen mich ja diese Menschen ganz falsch. Die wissen gar nicht, dass ich wegen meiner Gesinnung im Zuchthaus gesessen habe. Die sehen in jedem Zuchthäusler den Mörder, Totschläger oder Räuber."
"Det sind doch heute die wenichsten", murrt Pelz, "Schleichhandel, Schwarzschlachten und allet die Sachen haben sich die Herren janz alleene uff'n Hals jeladen. Hättense keen Kriech machen soll'n. Jetzt sind Zuchthäusa und Konzertlaga proppevoll. Und wenn man's ehrlich bekiekt, steht heutzutare jeda Deutsche mit een Been ins Zuchthaus. Wenn du zum Beispiel mit hundert Mark Wochenlohn uff deine schmalen Karten Kohldampf schiebst und dir bietet ena ne fette Jans an foa zehnfachet Jeld, denn kofst se. Weil eenmal sattjefressen mehr wert is als det janze Papierjeld. Kricht man dia nu dabei, denn wirste vaknackt und kommst als Volksschädling hinta Stacheldraht und Jitta. Haste dia jenuch abjehungert dahinta, wirste mit vorläufija Wehrwürdichkeit betraut und darfst for die Dussels den Heldentod sterben, die alle detselbe bejehn, dia aba trotzdem schief ankieken, weil se bis jetzt noch nich jeschnappt wurden." Polz ist ordentlich in Fahrt, und es ist gut, dass wir nur zu viert sind, denn es gibt Leute, die glauben, ihre Scharte dadurch auswetzen zu können, dass sie sich als Hundertfünfzigprozentige gebärden.
Meine Vermutung verdichtet sich verdichtet sich, dass Polz wegen Schwarzschlachtens 'gesessen hat.
Wir sind angelangt vor dem Schlagbaum des Truppenübungsplatzes. In Marschordnung geht es zur Baracke. Tarstag ist zufrieden, es fehlt niemand. Ausgehungert von dem erhebenden Ausgang fallen wir über unsere bescheidene Abendration her.
Einmal komme ich noch zu einem Ausgang in meiner Ausbildungszeit in Deutschland. Erst habe ich Lust abzublasen, aber die Kameraden drängeln. Sie möchten jemand dabei haben, der Klampfe spielt. Sie wollen nach Winterlingen marschieren, eine Strecke weg vom Heuberq, wo man uns angeblich noch nicht kennt, wo also die Aussicht besteht, mit holder Weiblichkeit in Berührung zu kommen. Außerdem könnte man einen unzensurierten Brief in Winterlingen im Briefkasten verschwinden lassen. Das Letztere gibt den Ausschlag, und ich gehe mit. Unser Funkunteroffizier hat uns telefonisch angemeldet, und so platzen wir nicht ganz unerwartet in die Wirtschaft. Das hat den Vorteil, dass jeder von uns außer dem Dünnbier einen Schnaps bestellen darf. Auf mehrmaliges Anstoßen später noch einen. Die Atmosphäre ist tatsächlich bedeutend wärmer als beim letzten Mal. Wir werden zwar nicht von Weiblichkeit erdrückt, aber es sind ein paar nette Mädchen anwesend, die unsere berüchtigte Einheit nicht zu kennen scheinen. Unteroffizier Schmott setzt sich ans Klavier, ich stelle mich mit der Gitarre dazu.. Wir werden langsam aufgeräumt. Doch wir sind noch lange nicht aufgetaut, da bläst Tarstag zum Aufbruch. Wir haben eine Wut. Noch fünf Minuten werden Tarstag abgerungen, aber dann ist der Aufbruch so plötzlich, dass es beinah wie Flucht aussieht. Tarstag hat beobachtet, wie einige Augenpaare schon zu tief ineinander schauten. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Frau Anlass zur Fahnenflucht ist.
Draußen herrscht Stockfinsternis, trotzdem finden sich alle ein. Wir marschieren wie die Besessenen, getrieben von der Ungeduld Tarstags.
Drei Kilometer vorm Heuberg liegt eine Schenke am Ausgang eines kleinen Dorfes. Unteroffizier Schmott schaut auf die Uhr.
"Donnerwetter, sind wir geklotzt."
Eine kurze Besprechung mit Tarstag verläuft positiv. Wir kehren ein, denn wir haben praktisch noch anderthalb Stunden Zeit. Tarstag wollte uns bloß von den Fahnenfluchtanlässen forthaben.
Als wir in die Kneipe kommen, wollen grad zwei Fräulein aufbrechen. Unter Hallo werden sie genötigt dazubleiben. Es sind die einzigen weiblichen Wesen ohne "Begleitung". Anfangs fühlen sie sich wohl als Mittelpunkt so vielen Mannsvolkes. Aber eine halbe Stunde nach unserer Ankunft rüsten sie unaufhaltsam zum Aufbruch. Ein ganzes Rudel möchte sie "vor die Tür" bringen.
Es werden Blickgefechte ausgefochten. Die besten Chancen bei der kleinen Schwarzen scheint Spockermann zu haben. Er bleibt auch am längsten draußen. Tarstag wird unruhig und geht selbst nachsehen. Vor dem Schanklokal herrscht Dunkelheit und Stille. Nichts von einem abschied nehmenden Pärchen, nichts von Spockermann.
Unruhig geworden, gehen wir alle suchen. Ergebnis: Spockermann ist fort. Tarstag sitzt mit mahlenden Backenknochen und geballten Fäusten. Alle sind wütend, sitzen und warten. Warten und hoffen, dass er noch kommen wird. Der Uhrzeiger rast erbarmungslos. Bis zur letztmöglichen Sekunde wird gewartet. Dann geht's im Eiltempo über schneeverharschte Felder. Ab und zu prasselt ein schlimmer Fluch.
"Det hat uns noch jefehlt, schimpft Polz, "jetzt könn' wa vielleicht 'ne Suppe auslöffeln."
Ein Stück vorm Schlagbaum steht an einem Chausseestein Spockermann. Tarstag erkennt ihn. Keines Wortes würdigt er den Mann, der ihm eine solch angstgehetzte Stunde bereitet hat. Schweigend schließt sich Spockermann an. Wie ein Verfemter trottet er hinter uns her, unserm Bau entgegen.
Zu Haus setzt es ein schweres Donnerwetter auf der Schreibstube, dessen sehr lauter Kontrahent sich im Spieß verkörpert, während den um so stilleren Spockermann abgibt.
Er wird verurteilt zu vier Wochen Stubendienst. Für uns fallen noch allerhand neckische Verschärfungen dabei ab, mit der deutlichen Absicht, uns zu einem Nachtbesuch bei Spockermann anzuregen, bei ihm den "heiligen Geist" erscheinen zu lassen.
Da das nicht gelingt, haben wir beim Spieß mächtig eingebüßt. Sein vorher gar nicht so unangenehmer Sarkasmus geht über in offenen Hohn und hässliche Redewendungen. Er macht aus seiner Meinung keinen Hehl, dass er uns allesamt als Verbrecher betrachtet. Spockermann wird von uns zwar nicht des Nachts verhauen, aber von allen gemieden.
Lange Zeit nachdem, wir lagen bei Tebourba, und Spockermann hatte sich durch kameradschaftliche Haltung rehabilitiert, frage ich ihn eines Nachts, als wir Wache stehen, wie er sich zu dem Leichtsinn hatte hinreißen lassen können, der ihn unter ungünstigen Umständen den Kopf kosten konnte.
Freimütig platzt er heraus:
"Weißt du, wenn ich lange Zeit keine Frau gehabt habe und mir gerät dann eine in die Hände, ist alle Vernunft zum Teufel. Ich muss, und koste es Kopf und Kragen."
"Hast du denn wenigstens an jenem Abend?"
"Ach woher", schnaubt Spockermann erbost, "das war ja das Hundsgemeine. Ich bringe diese raffinierte Hexe nach Hause, und wie ich vor ihrer Hoftür kühn werden will, will sie nicht und antwortet auf mein Drängen, wenn ich ein ordentlicher Soldat wäre, würde sie eventuell, aber bei einem Schützen von unserem Haufen käme das gar nicht infrage."
Wir starren beide ins Dunkel.
"Wieso lange keine Frau gehabt?" komme ich auf Spockermanns anfängliche Behauptung zurück, "du warst doch zu der Zeit erst ein paar Wochen beim Barras."
"Und vorher?" fragt er, "eineinhalb Jahr Gefängnis ist ja schließlich kein Pappenstiel. Auf die Dauer kann man sich seine Manneskraft auch nicht durch die Rippen schwitzen, nicht?"
"Wie lange hättest du denn noch abzumachen gehabt?"
"Ein halbes Jahr", seufzt Spockermann.
Es wird still zwischen uns.
Unsere Division 999 ist ein trauriges Kuriosum der Weltgeschichte. Wie will man das einmal ins Lot bringen? Ich habe gegen den Mann nichts, der schweigend neben mir läuft und in den tunesischen Nachthimmel starrt. Aber warum wird er vom Gesetz besser behandelt? Der größere Teil musste seine Strafe abbüßen, einer ganzen Anzahl aber schenkte man Monate, einigen Jahre. Man mag die Sache besehen wie man will, es bleibt ein Rechtsbruch. Recht ist nie so willkürlich gehandhabt worden wie jetzt in Deutschland.
Eines Nachmittags will ich eben unsere Stube verlassen, da rennt mich unser Koch, der Sepp, fast um. Stieren Auges fragt er: "Der Spieß, wo ist der Spieß oder Feldwebel Tarstag?" Schon ist er wieder in der gegenüberliegenden Stube verschwunden. Einen Moment später taucht er zusammen mit Tarstag auf, und beide rasen nach oben. Die Tür zum Materialboden knallt. Der Oberarzt des Bataillons wird geholt.
Kurz nachdem er gegangen ist, wird ein schwerer Körper vom Boden nach unten getragen. Langsam sickert es durch: Der Fourier und Küchenunteroffizier hat sich erhängt.
Wenn sich ein Verpflegungsunteroffizier und langjähriger Berufssoldat erhängt, kann man in 99 Prozent aller Fälle darauf schwören, dass in dem Ressort etwas nicht stimmte. Oder besser gesagt, vieles nicht stimmte. Also erklärt der Herr Oberarzt: Der Unteroffizier Reichert hat sich in einem Anfall geistiger Umnachtung erhängt. Und so lautet dann auch der entsprechende Tagesbefehl. Es wird darin noch erklärt, dass dem Unteroffizier Reichert keinerlei Verfehlungen nachzuweisen seien. Er sei als untadeliger Soldat aus dem Leben geschieden. Reichert wird mit militärischen Ehren bestattet.
Stubenwache wird eingerichtet. Immer reihum muss jeder des Nachts zwei Stunden Wache sitzen. Achtgeben soll er auf alles Mögliche. In erster Linie, dass nicht an die Hauswand uriniert wird. Von dem wasserhaltigen Essen und dem Besuch des kältestarrenden Klosetts haben viele schwache Blasen bekommen. Einige müssen des Nachts vier bis fünf Mal hinaus. Klar, dass da mancher die fünfzig Meter bis zu dem unmöglichen Abort scheut und sich in der Dunkelheit einfach an die Hauswand stellt.
Auch wegen eventuellen Fliegeralarms ist die Wache da. Eines späten Abends bekommen wir einen. In Marschordnung geht es zu den Splittergräben und Unterständen. Gebückt stehen wir zwei Stunden im Stockfinstern. Die Atmosphäre ist erfüllt mit Tabakrauch und Galgenhumor. Zotige Lieder werden gesungen und deftige Witze erzählt.
Ganz in der Ferne hören wir Grollen und Rumoren. Am nächsten Morgen heißt es, der Tommy hat Stuttgart zur Sau gemacht.
Einen Vorteil hat die Stubenwache. Es ist die einzige Möglichkeit, in Ruhe einen Brief zu schreiben. Es soll zwar nicht sein, aber was an Erleichterung soll beim' Barras überhaupt sein? Jedenfalls ist noch niemand beim Briefschreiben überrascht worden. Ganz einfach deswegen nicht, weil der Spieß oder der betreffende Unteroffizier vom Dienst keine Lust haben, ihre Nachtruhe zu unterbrechen.
Paul Lewenz sitzt eines Nachts und schreibt emsig. Draußen hört man ein verhaltenes Poltern. Die Stubentür öffnet sich, und Schütze Lajack schiebt sich in den Raum. Nett bepackt kommt er vom Extradienst. Als gelernter Bäcker ist er kommandiert zum Backen von Weihnachtsstollen für unser Bataillon.
"Hast du Hunger?" fragt er Paul.
"Selbstverständlich", antwortet der.
"Hier, iss!", einen weißen Kipfel schmeißt er Paul auf den Tisch. Dann fragt er weiter: "Hast du ein paar Zigaretten übrig?" Paul bejaht. Zehn Overstolz rutschen über den Tisch zu Lajack hin. Zu Paul Lewenz schiebt sich eine zuckrige Weihnachtsstolle. Darauf beginnt ein eifriges Geflüster. Vonseiten Lajacks Zureden, vonseiten Lewenz Stirnrunzeln und Bedenken.
Unteroffizier Gotze ist schon eine ganze Weile wach. Er rührt sich nicht und lauscht. Das Geflüster wird abgebrochen. Die Verhandlungen führten scheinbar zu keinem Ergebnis. Missmutig wirft sich Lajack auf sein Bett. Wie ein Grandseigneur zündet er sich eine Zigarette an.
"Lajack?" Gotzes hohe Stimme schrillt durch den Raum.
"Herr Unteroffizier?"
"Sie wissen, dass das Rauchen auf der Stube nach neun Uhr abends verboten ist!"
"Jawohl, Herr Unteroffizier!"
"Lajack, eine Runde um den Hof, marsch, marsch!"
Lajack tut, als binde er an seinen Schuhen.
Jetzt steht Gotze vor ihm.
"Lajack, haben Sie meinen Befehl gehört?"
"Jawohl, Herr Unteroffizier!"
Gotze geht zu Lewenz. "Was haben Sie da liegen, Lewenz?"
"Eine Stolle, Herr Unteroffizier!"
"Von Lajack?"
"Jawohl, Herr Unteroffizier."
"Lewenz?"
"Ja, Herr Unteroffizier?"
"Es ist bedeutend besser für sie, wenn sie den Handel sofort rückgängig machen."
"Sofort, Herr Unteroffizier."
Lajack kommt keuchend und meldet: "Befehl ausgeführt, von der Hofrunde zurück!"
"Morgen sprechen wir uns weiter, Lajack", knurrt Gotze und zieht sich in seine Falle zurück.
"Hier, Lajack", sagt Lewenz und schiebt die Stolle wieder zurück über den Tisch, "ich will die Stolle nicht, habe keinen Appetit darauf."
Lajack bekommt einen roten Kopf. Geringschätzig zuckt er die Achseln, greift die Stolle und sagt: "Scheißkerl!"
Am nächsten Morgen muss ich dem Spieß die Stiefel putzen, deswegen gehe ich in die Schreibstube, die Knobelbecher holen. Auf dem Bett des Spießes türmt sich ein ansehnlicher Berg Stollen, Weißbrote und Butterpakete. Lajack. steht in der einen Ecke der Schreibstube, das Gesicht zur Wand, ein Schütze als Wache neben ihm.
Zu dem Bewachten gesellen sich bald noch Künschmann und Wacker, die beide ebenfalls in die Bäckerei kommandiert waren. Eine Untersuchung ihrer Schränke lässt den leckeren Berg in der Schreibstube um ein Erkleckliches anwachsen.
Die Ansprache des Spießes beim Morgenappell ist die schlimmste, die bisher auf uns niedergehagelt ist:
"Meine Herren, jetzt ist Schluss mit allen Sentimentalitäten. Beklagt euch bei euern Kameraden Lajack, Künschmann und Wacker. Diese Subjekte bekommen vom Bataillon einen Vertrauensposten. Dort kaum warm geworden, fangen sie an zu klauen und die Sachen pfundweise fortzutragen. Das ist schäbig. Kameradendiebstahl ist in meinen Augen das gemeinste Delikt. Es liegt hier Kameradendiebstahl vor. Denn alles, was dort gebacken wurde, solltet ihr ja zu Weihnachten bekommen. Obendrein behaupten die Drei, sie hätten vom verantwortlichen Unteroffizier die Erlaubnis gehabt. Die Verhandlung wird uns schon Klarheit bringen. Was den Dreien blüht, könnt ihr euch denken. Bei Lajack ist es noch dazu Rückfall.
Ich warne euch aufs Schärfste und will zum Schluss gleich noch mal auf die Anrede gegenüber Vorgesetzten zu sprechen kommen. Es wird grundsätzlich in der dritten Person angeredet. Also: Haben Herr Leutnant oder wollen Herr Feldwebel und so weiter."
"Und zu uns", feixt mir Polz ins Ohr, "sagense du, wo wir bald zehn Jahre älter sind als sie."
"Nun zum Schluss, meine Herren", meckert Steinback, "ich bestrafe jeden, der sich jetzt nicht zusammennimmt und die Dienstgrade nicht in der dritten Person anredet. Über dem Fall Lajack wird selbstverständlich Stillschweigen bewahrt und kein Wort mehr verloren. Wegtreten!"
Das ist zu viel verlangt. Es wird noch so manches Wort über Lajack verloren. Ganz besonders über die für ihn zu erwartende Strafe. Die meisten tippen auf Todesstrafe. Die wenigsten auf zehn bis fünfzehn Jahre Zuchthaus.
Die Sensationen in dieser Angelegenheit kommen noch.
Am nächsten Tag nach der Entdeckung wird der verantwortliche Unteroffizier erschossen am Schießstand aufgefunden. Der zweite Selbstmord in drei Wochen, von Leuten, die uns Vorbilder sein sollten.
Es kommen hochnotpeinliche Verhandlungstage. Rade und Lewenz müssen auch aussagen, kommen aber mit einem Verweis davon. Dem Rade hatte Lajack noch in der Nacht ein paar Pakete Butter zugeschoben, er möchte sie für ihn verstecken. Rade hatte es des Morgens gemeldet.
Lewenz war durch Gotze vor Unangenehmerem bewahrt worden. Da er den Tausch rückgängig gemacht hatte, konnte ihm nichts weiter passieren.
Der arme Paul ist vollkommen fertig. Alle bemühen sich, ihn zu trösten.
"Hantier dir nich", sagt Polz, "im ersten Augenblick hätte jeda von uns so jehandelt. Denn Kohldampf ham wa imma, und Kuchen ham wa schon lange nicht mehr jejessen. Det die Stolle jeklaut is, war ihr nich anzusehn und im ersten Augenblick ooch nich zu übablicken. Dia könnse nischt. Um den Lajack seine Kohlrübe seh' ick ville schwärza."
Der nächste Morgen bringt die Verlesung. Wir warten voller Spannung. Steinback macht ein Gesicht, als wisse er von nichts. Hundert Nichtigkeiten verliest er und spannt uns auf die Folter. Endlich kommt er auf den Regimentsbefehl. Ungerührt entfaltet er das Blatt Durchschlagpapier.
Das ganze Vorgesäusel kennen wir, wollen wir gar nicht wissen. Das Letzte, das Letzte ist wichtig. Und jetzt kommt's: "… der Schütze Lajack wird darum verurteilt zu sechs Wochen verschärftem Arrest, ebenfalls der Schütze Künschmann und der Schütze Wacker."
So dumm hat selten unser Haufen geguckt wie in diesem Augenblick. Der Spieß macht, als merke er nichts, und faltet den Regimentsbefehl wieder zusammen.
"Wegtreten!"
"Siehste" , flüstert mir Polz ins Ohr, "wenn man solche Dinga dreht, muss man imma 'n paar Vorjesetzte dran beteilijen, denn kann een' nie viel passiern."
Bei einem regelrechten Prozess vor dem Kriegsgericht wären Schuldige belastet worden, die nicht belastet werden durften. Darum fand der Kriegsgerichtsprozess nicht statt.
Wir bekommen Ohrenklappen. Das ist erfreulich, denn eine teuflische Kälte zwickt uns morgens in die Ohren. Stolz binde ich mir die Apparate um. Meinem Beispiel folgen noch mehrere kurz vorm Antreten beim Morgenappell.
"Stillgestanden!" schnarrt der UvD, "richt euch! Augen geradeaus!" Dann erfolgt seine Meldung an den Spieß. Steinback steht wie ein Fürst auf den Stufen unserer Unterkunft und mustert mit Späheraugen.
"Erge!"
"Herr Feldwebel?"
"Was haben Sie da für komische Dinger um den Kopf?"
"Ohrenklappen, Herr Feldwebel!"
"Wer hat Ihnen befohlen, die umzutun?"
"Meine Ohren frieren, Herr Feldwebel!"
"Wer Ihnen befohlen hat, dass Ihre Ohren frieren, will ich wissen."
"Niemand, Herr Feldwebel!"
"Aha! - Wagner", wendet er sich zum UvD, "Sie notieren mir den Mann, verstanden? Der hat, scheint's, lange nicht Stiefel für seinen Spieß geputzt. Außerdem, Erge, nennen Sie das einen Soldatenhaarschnitt, den Sie tragen? Das ist ja eine Höhlenmenschenfrisur, eine Apachen-, eine Anarchistentolle. Wagner! Sie schneiden dem Mann nachher die Haare. Und allen anderen lang bezopften ebenfalls. Ich sehe ihrer viele. Wagner, Sie sind mir dafür verantwortlich. Morgen früh sehe ich keinen mehr von dieser Sorte."
Unteroffizier Wagner weiß genau, dass der Lagerfriseur die Hochflut langer Haare bis morgen früh normalerweise niemals bewältigen kann. In Blitzkriegsmanier organisiert er eine Haarschneidemaschine, lässt uns Langbehaarte antreten und wüstet in unseren Tollen wie die SA in Arbeitervierteln. So schnell sind mir nie vorher Haare geschnitten worden, aber nie vorher zierte auch mein Haupt ein so ulkiger Kopfputz, genannt "Militärschnitt".
Leicht tragikomisch ist unser erstes Baden. Natürlich wird erst angetreten. Ohne Antreten wird beim Kommiss überhaupt nichts gemacht. Nicht einmal gegessen.
In militärischer Ordnung geht's bis zum Badehaus. "Abteilung halt, linksum, ausrichten!"
Eben verlässt eine Einheit die "Stätte körperlichen Behagens".
Wir dürfen hinein. Das geschieht selbstverständlich im Gänsemarsch.
Eine Art flaches Becken ist der Baderaum. Von oben strahlen etwa zehn Brausen ihr kostbares warmes Nass, und darunter drängeln sich über fünfzig Mann. Wenn es einem endlich gelungen ist, soviel Wasser zu erhaschen, dass ein bescheidenes Einseifen gewährleistet ist, wird das Brausewasser langsam kalt, als stummes, aber überzeugendes Signal, dass die Schwelgerei mit Wasser ihrem Ende zugeht.
Mit Zuhilfenahme des Wassers im Becken, das uns bis an die Waden reicht, gelingt es gerade, die Seife herunterzuspülen, dauernd behindert vom Vorder-, Hinter-, Neben-, Über- oder Untermann.
Dann raus und im Nebenraum a tempo die Sachen an, die nächste Einheit wartet bereits.
Draußen wird wieder angetreten. Plötzlich wird der Herr Regimentschef sichtbar.
"Stillgestanden! Die Augen links!" brüllt der führende Obergefreite.
Der Herr Oberstleutnant fragt wie ein besorgter Landesvater: "Sie haben gebadet?"
"Jawohl, Herr Oberstleutnant!"
"War'·s schön?"
"Jawohl, Herr Oberstleutnant!"
"Na sehnse. Weitermachen!"
Vollkommen befriedigt von der überaus erschöpfenden Auskunft begibt sich unser leutseliger Chef weiter.
Wie er sich als Führer des Regiments im Felde erweisen wird, weiß ich nicht. Aber eine Fähigkeit besitzt er in hervorragendem Maße, sich ein zufriedenes Gewissen zu verschaffen.
Oh, er stöbert viel herum, und er taucht mal hier auf und mal da. Im Esssaal zum Beispiel. Mit erstaunlicher Sicherheit findet er den Dicksten heraus und fragt teilnahmsvoll: "Na, wie schmeckt's? Werden Sie satt?"
Nun gibt es keinen dicken Menschen, der nicht wüsste, dass er dick ist und der darum genau fühlt, wie grotesk es klingt, wenn er behauptet, er werde nie satt und leide dauernd Hunger.
In neunhundertneunundneunzig Fällen von tausend wird also besagter Dicker auf die Frage, ob er satt wird, immer mit einem schmetternden "Jawohl, Herr Oberstleutnant" antworten. Jedenfalls habe ich nie den tausendsten Fall erlebt. Ganz abgesehen davon, dass man auch als spindeldürre Hungergestalt dem Herrn Oberstleutnant die Wahrheit nicht sagt. Denn die Wahrheit klingt meist unhöflich, und zu seinem Oberstleutnant und Regimentschef hat man höflich zu sein.
Diese Zwischenfälle sind eben sehr selten, wo ein Statist auf die Bühne kommt und ruft: "Was hier gespielt wird, ist ja alles nicht wahr, ist ja nur Theater!" Es liegt halt im Wesen des Theaters, dass es ernst genommen wird. Meist ernster als das Leben. Von Zuschauern so gut wie von Akteuren. Und daher die Möglichkeit für unseren verehrten Herrn Regimentschef, immer zufrieden zu sein.
Denn das ist wichtig. Viel wichtiger, als dass die Soldaten immer zufrieden sind.
Zum Beispiel waren wir Funkbabys der unmaßgeblichen Meinung, es wäre das Allerwichtigste gewesen, Geben und Hören zu üben. Wir taten es zwar, aber viel mehr Zeit wurde damit vertan, alle Vorschriften zu pauken, die man für den Funkbetrieb im deutschen Heer geschaffen hat.
Funker zu sein, ist eine der undankbarsten Aufgaben. Nicht, weil auch der Funker in den unteren Einheiten ebenso in Dreck und Feuer liegt wie der Infanterist, trotzdem aber nicht als Soldat gewertet wird; nicht, weil die über ihm stehenden Kommandostellen keine Ahnung vom Funkbetrieb haben und darum oft Unmögliches von ihnen verlangen; nicht weil ein Funkgerät seiner Kompliziertheit wegen, am häufigsten ausfällt und der Funker dann Dienste verrichten muss, für die er nicht geschult wurde, sondern weil es über die Vorschriften im Funkbetrieb allein ein ganzes Buch gibt, welches man gezwungen ist, im Kopf zu haben, um sich vor hohen Strafen zu schützen. Der Funker im deutschen Heer ist der Mann, der dauernd auf der Kippe steht, mit einem Bein im Zuchthaus und mit dem anderen im Grabe.
Diese beiden ungemütlichen Chancen wollen unsere verehrlichen Ausbilder weitgehendst herabmildern und pauken mit uns Vorschriften auf Kosten des praktischen Funkens. Hätte man lieber auf die Vorschriften verzichtet, dann wären wir wenigstens brauchbare Funker geworden. Wir werden es nicht, aber auch keine Kenner der Vorschriften, denn dazu braucht man Jahre.
Der Dienst im Gelände ist gefürchtet. Wenn man sich ein paar Stunden im knöcheltiefen Schnee gesuhlt hat, sind die Klamotten nass und bis zum andern Tag nicht trocken zu bekommen. Dreißig bis vierzig Mann wollen ihre Handschuhe und Stiefel an einem einzigen Ofen trocknen. Das Holz ist so knapp, dass sich die Stuben gegenseitig beklauen. An diese Zustände denkend, ist einem der Rückmarsch aus dem Gelände keine reine Freude.
"Ein Lied!" kommandiert Tarstag. Einer guckt den andern an. Unsere Gesichter mögen an eine Reihe Hühner erinnern, die man mitten in der Nacht auffordert, schnell ein Ei zu legen.
"Na, wird's bald?" stökert Tarstag.
Einer zählt missmutig: "Drrrei -. - - vierrr!"
Heiseres Gekrächze hebt an, als hätte man besagte Hühner von der Stange gescheucht, weil sie nicht sofort legten.
"Aufhören'" brüllt Tarstag, "Jetzt wird gesungen, oder es geht noch mal rund. Verstanden? Durchsagen nach hinten: Es ist so schön, Soldat zu sein, ich zähle ein - zwei - drei - vier-!"
Um ein weniges ist das Gekrächze melodischer. Aber nicht viel,
"Aufhören'" brüllt Tarstag wieder, "Panzer von vorn, volle Deckung!"
Hinein geht's in Chausseegräben und Schützenlöcher, hinter Büschel und Büsche in den weichen, nassen Schnee.
"Bis zum Graben vorarbeiten, robben!" kommandiert Tarstag, und wir schieben uns wie Lurche durchs Gefilde, Grimm, Hunger und Kälte im Wanst. "In Schützenkette angreifen, marsch, marsch!"
Wir springen hoch und stolpern weiter.
"Fliegerbombe, volle Deckung!" Tarstag ahmt das Geräusch einer fallenden und krepierenden Bombe nach. Wer beim "Wumm" nicht platt liegt wie eine zertretene Padde, der wird unerbittlich festgenagelt.
"Polz, soll das volle Deckung sein? Polz, marsch, marsch bis zu der allein stehenden Tanne und zurück! Polz, hinlegen! Auf! Hinlegen! Auf!"
Das bedeutet für uns einen Augenblick verschnaufen.
Polz kommt zurück, weiß wie ein Schneemann.
"In Marschordnung auf der Straße angetreten, marsch, marsch!"
Im Sauseschritt wetzen wir auf die Straße. Japsend formieren wir uns.
"Det soll nu Ausbildung for Afrika sein", schnauft mir Polz leise ins Ohr, "die woll'n uns woll als Schneefeja inne Wüste Sahara vawenden?"
"Abteilung marsch!" sagt Tarstag ruhig, als kämen wir eben aus einer Konditorei.
"Linnnks - ,linnnks - ,links, zwei, drei, vier, rühren - , ein Lied!"
Man sollte es nicht für möglich halten. Es wird gesungen. Laut ertönt: "Es ist so schön Soldat zu sein."
Da läuft eine Abteilung Mensch mit einer Stinkwut im Leibe, die nur den einen Wunsch hat, der Welt ins Angesicht zu spucken. Zu deren Seelenstimmung nichts konträrer ist als Singen.
Und doch singen sie. Wer ihnen begegnet, wird unwillkürlich froher gestimmt, schwenkt ein im Gleichschritt und denkt: "Ei der Daus, sind das aufgeräumte Leutchen."
In Wirklichkeit ist es eine Rotte knurrender Hunde, die eine Dressurmeisterleistung vorführen. Ganz im Sinne unseres Spießes, der mir einmal bei einer passenden Gelegenheit in unüberbietbarem Zynismus sagte:
"Mit Rekruten verhält es sich ebenso wie mit Pferden. Wenn man sie einmal richtig gebrochen hat, kann man mit ihnen machen, was man will."
Steinback versteht sich auf Pferde, er hat bei der Kavallerie gedient.
Oh, man lernt so schön heucheln. Es gibt Tage, wo wir noch mehr Wut haben und noch lauter grölen.
Wir lernen schnell, auf Anhieb singen. Je größer unser Ärger, um so lauter brüllen wir.
Ich habe beim Barras eine mir vollkommen neue Charakterentspannung gelernt: Singen vor Wut.
Man sage nicht, dass uns das nichts nützte. Wir ersparten uns viel Hinschmeißen in Dreck und Schnee, viel Anranzer und standen außerdem im Ruf, gute Sänger zu sein, allerdings im Ruf ausgesprochener Kommissknochen. In Wahrheit werden marodierende Landsknechte nicht toller gegrölt haben.
Leider können wir nicht immer unsere Wut hinaussingen. Sonst hätten wir ewige Sänger werden müssen. Zum Beispiel könnte ich brüllen vor Wut, weil mir langsam, aber sicher die Ohrenränder erfrieren. Wir werden zwar ausgerüstet mit Ohrenklappen, dürfen sie aber nur auf Befehl umtun. Dieser Befehl wird ein einziges Mal gegeben in einem Winter auf der rauen Alb, den man wahrlich nicht als milde bezeichnen kann. So dienstlich sind nun meine Ohren nicht, dass sie deswegen an den anderen Tagen das Frieren unterlassen.
Der Zufall, der sooft beim Kommiss über Tod und Leben entscheidet, wirkt für mich einmal im angenehmen Sinne. In meinen Papieren steht, dass ich den Zivilführerschein eins besitze, darum werde ich den Kradfahrern des Stabes zugeteilt.
Drei Jahre habe ich meine Beiwagenmaschine ohne nennenswerten Unfall geführt und bilde mir ein, ein guter Fahrer zu sein. Der Barras beweist mir das Gegenteil. Ich muss noch einmal fahren lernen. Vor allen Dingen lernen, mit dem berüchtigten Zwischengas zu schalten. Unser Fahrfeldwebel ist ein vernünftiger Kerl. Ich gebe mir ehrliche Mühe, auch nach Heeresvorschrift ein guter Fahrer zu sein, und er erkennt das an. So komme ich manchmal zu Fahrten, die genau betrachtet nichts mehr mit reiner Prüfungsvorbereitung zu tun haben. Wir würden noch viel mehr und ausgiebiger trainieren, wenn der Kampf um das Benzin nicht wäre.
Dieser Kampf wäre besser mit "Krampf" zu bezeichnen und nimmt manchmal idiotische Formen an. Es geht so weit, dass sogar die Prüfungsfahrten auf eine beängstigende Kürze beknappst werden. Abgenommen werden sie von einem Kriegsingenieur. Der Herr ist sehr nervös, launisch und sprunghaft. Ich überzeuge ihn aber doch und bestehe die Prüfung. Nach einigen Tagen wird mir der Heeresführerschein ausgehändigt.
Die Benzinknappheit existiert nur bei offiziellen Heeresangelegenheiten. Bei allen privaten Dingen der Offiziere existiert sie nicht.
Der eine Sonntagmorgen ist plastischer Beweis dafür. Wir sind eben zurück von einer Trainingsfahrt. Der Schirrmeister hat die Lkw-Prüflinge entlassen. Ich stehe noch mit ihm am Krad, technische Einzelheiten durchsprechend, da kommt ein Unteroffizier mit einem Handköfferchen. "Fahrt ihr weg, Kamerad?" fragt er den Schirrmeister, "ich muss zum Bahnhof Thiergarten zum Zehnuhrdreißig-Zug, und da hätte ich euch gebeten, mich mitzunehmen."
"Und wenn wir nun nicht zum Bahnhof Thiergarten fahren?"
"Dann hätte ich Pech gehabt."
"So ist es nämlich", der Schirrmeister grinst schadenfroh, "wir fahren überhaupt nicht."
Enttäuscht will sich der Unteroffizier von dannen heben. Da kommt ein Oberfeldwebel. Wie ein Befehl klingt seine Frage: "Wo fahren Sie jetzt hin, Schirrmeister Burkhardt?"
"Nirgends, Herr Oberfeld, wir sind heute fertig mit Prüfungsfahrten."
"Fein, Burkhardt, warten Sie hier. Herr Leutnant Wetzke und Herr Oberleutnant Rohr kommen gleich mit Gepäck. Die wollen zum Zehnuhrdreißig-Zug nach Thiergarten."
"Hm, hm, Herr Oberfeld, äh, wir - wir - das Benzin ist sehr knapp und Privatfahrten sollen doch nicht - - -"
"Gebense nich so an, Burkhardt. Immer dieselben Menkenke. Ihr habt immer kein Benzin, und wenn man euch auf die Zehen tritt, habt ihr doch welches. Juckelt nicht soviel mit diesen ulkigen Fahrschülern umher!"
"Machen wir auch nicht, Herr Oberfeld, wir haben diese Fahrten schon auf ein Mindestmaß be - - -"
"Also säuselnse nich, Burkhardt, Sie fahren. Sehnse, der Herr Leutnant kommt schon."
In der Tat, Herr Leutnant Wetzke rückt eben an mit seinem Putzer, einem Obergefreiten. Beide bepackt mit Koffern und Paketen, die alle zur kargen Reiseausrüstung eines preußischen Offiziers zu gehören scheinen.
Unser Schirrmeister macht eine saure Miene. Inzwischen erscheint voll beladen der Putzer des Herrn Oberleutnant Rohr. Er verstaut und verschwindet wieder. Nervös ruft ihm Wetzke nach: "Kommt Herr Oberleutnant nicht? Wir müssen uns ranhalten, sonst verpassen wir den Zehnuhrdreißig-Zug."
Der Putzer erscheint zum zweiten Mal. Noch bepackter. Hinter ihm Oberleutnant Rohr auch 'nicht ohne Pakete. Denn was ein richtiger Oberleutnant ist, der lässt sich nicht lumpen. Rohr hat fast das doppelte Gepäck wie Wetzke.
"Gott sei Dank", sagt dieser, "dann kann's ja losgehen. Wir verpassen sonst den Zug."
"Einen Moment, Verehrtester", schnarrt Rohr, "Oberleutnant Stern will auch noch mit."
Wetzke tritt von einem Bein aufs andere. Stern scheint viel Vertrauen in die Geschwindigkeit deutscher Heereslastwagen zu setzen. Wahrscheinlich ist er auch dienstälter als Rohr und lässt sich wiederum von dem nicht in der Gepäckmenge lumpen. Meine Vermutung ist nicht so unrecht, denn eben erscheint sein Putzer mit Kisten, Koffern und Paketen.
Oberleutnant Stern selbst kommt noch nicht. Besorgt blickt unser Schirrmeister auf die Uhr. Es ist Glatteis. An manchen Stellen der Straße leichte Taunässe. Der Nachtfrost und darauf die klare Morgensonne haben zwar ideale Trainingsverhältnisse geschaffen, aber zu Wettfahrten mit nicht wartenden Zügen sind die Chausseen weniger geeignet.
Stern kommt nicht. Jetzt wird auch Rohr nervös.
"Gehen Sie Herrn Oberleutnant Bescheid sagen", raunzt er dessen Putzer an, "er müsse sich beeilen, sonst verpassen wir den Zehnuhrdreißig-Zug."
Der Putzer enteilt.
Schnaufend kommt er wieder: "Herr Oberleutnant kommt gleich."
Sollte Herr Oberleutnant Stern auch in Kampfangelegenheiten die gleiche Auffassung vom Begriff "gleich" haben, ist er ein miserabler Stratege.
Nach fünf Minuten macht unser Schirrmeister einen Vorstoß: "Herr Oberleutnant, wenn wir jetzt nicht fahren, ist es unmöglich zu schaffen."
Rohr sieht auf seine Armbanduhr. "Gut, Burkhardt, fahren Sie. Sie, Herr Feldwebel", ruft er meinem Fahrmeister zu, "bringen Herrn Oberleutnant Stern nach, mit dem Krad schaffen Sie's immer noch."
Mein Fahrfeldwebel knallt mit den Hacken und brüllt: "Jawohl, Herr Oberleutnant."
Es ist ausgeprägt das Jawohl, von dem unser Spieß immer behauptet, es könnte genau so gut heißen: "Leck mich am Arsch!"
Der Lastwagen rasselt durchs Tor und in dem Moment taucht Oberleutnant Stern auf.
Wir sausen ihm entgegen.
Ich muss fahren, Prenke, mein Fahrlehrer, sitzt hinter mir auf dem Soziussitz. Er raunt mir zu: "Wehe, fahren Sie unvernünftig. Ich verlange ein sicheres, überlegtes Fahren in jeder Situation von Ihnen, das ist wichtiger als ein verpasster Zug."
Wir halten, und Oberleutnant Stern klettert schimpfend in den Beiwagen. Warum man nicht gewartet habe. Nun müsse er seine frischrasierte Haut der scharfen Zugluft im Beiwagen aussetzen.
Als wir aus dem Tor preschen, verschwindet unser Lkw hinter der nächsten Wegkreuzung in einem Tempo, das nichts mehr mit der vorgeschriebenen 40-km-Geschwindigkeit zu tun hat.
"Los, Mensch", brüllt Stern, "drücken se auf die Tube, die müssen wir überholen!"
Nein, Herr Oberleutnant, denke ich schadenfroh, wir müssen nicht, unterstützt von einem heimlichen Knuff meines Feldwebels.
Ich fahre nicht gerade langsam, aber unser Abstand vom Lastwagen verringert sich kaum.
Wenn ich, gepiesackt von den dauernden Anfeuerungen Sterns, etwas heftig Gas gebe, ernte ich sofort heimliche Püffe Prenkes.
Nachdem wir den nörgelnden Herrn mit Ach und Krach doch noch im Zehnuhrdreißig-Zug verstaut haben, sagt Prenke: "Heute haben Sie Ihre wirkliche Fahrprüfung bestanden. Das hat mich gefreut. Dieser nervöse Herr hätte manchen guten Fahrer zur Sau gemacht."
Weihnachten naht, und die Frage erhebt sich immer lauter, was nun mit dem versprochenen Besuch der Frauen sei.
Es kommt eine interessante Kompaniebelehrung. Stab und Kompanie zusammen im großen Esssaal. Leutnant Prenz, ein junger Kerl, leitet sie. Er bespricht eingehend technische Einzelheiten für die Unterbringung der zu Besuch kommenden Frauen.
Ob die Sache nun zu Weihnachten durchgeführt werden solle, fragt einer. Zu Weihnachten ginge es leider noch nicht, sagt Prenz sichtlich bedrückt, weil da die vor uns einberufene Einheit dran wäre. Aber die Nächsten wären wir.
Diesen Saal voller enttäuschter Gesichter werde ich so leicht nicht vergessen.
Wer denn die Fahrkosten tragen werde, fragt nach einer Pause bedrückender Stille ein Schütze.
Prenz ist entrüstet.
"Wenn die Wehrmacht Ihnen schon gestattet, Ihre Frau empfangen zu dürfen, können Sie nicht noch die Bezahlung der Bahnfahrt verlangen."
"Dann kann meine Frau sowieso nicht kommen", sagt der Schütze, "bei ihr reicht's kaum zum Leben, wo soll sie da noch das Fahrgeld hernehmen?"
"Das sind Einzelfragen, mit denen wir uns hier nicht befassen können", erwidert Prenz ungeduldig, "befragen Sie den Kompaniechef deswegen."
Ein anderer meldet sich: "Hier wird immer von Frauenbesuch gesprochen, Herr Leutnant. Ich bin leider kein glücklicher Besitzer einer Rosine im Kuchen des Lebens, sondern will erst einer werden. Die ich dazu auserkoren, meine Braut sozusagen, hat doch dasselbe Recht, mich zu besuchen, wie eine verheiratete Frau. Jedenfalls - - jedenfalls wäre das doch bestimmt im Sinne der von unserer Regierung eingeschlagenen Bevölkerungspolitik."
Gelächter füllt den Saal. Leutnant Prenz lacht mit: "Ihre einleuchtende Darlegung ist ein neues Moment für mich, welchem ich eine gewisse Berechtigung nicht absprechen kann. Ich werde mich umgehend erkundigen. Sie bekommen dann Bescheid."
Auf diesen Bescheid warten die Landser vom Heuberg heute noch.
Einige Tage nach dieser Enttäuschung bekomme ich einen Eilbrief von Bella. Wir verstehen uns jetzt brieflich besser als bei unserm letzten Beisammensein. Sie schreibt, bei ihr sei alles perfekt. Sozusagen marschfertig. Es bedürfe nur eines Telegramms meinerseits, und sie setze sich auf die Bahn, um in meine Arme zu eilen.
Arme Bella, wenn du wüsstest, was hier los ist. Wie unmöglich es ist, ein Telegramm von hier zu senden, geschweige, dich selbst zu empfangen.
So setze ich mich hin und schreibe eine resignierende Karte.
Sie müsse sich gedulden. Wir wären mit Frauenbesuch noch nicht dran, und wenn wir dran wären, würden erst die Ehefrauen berücksichtigt, dann eventuell die Bräute und dann eventuell vielleicht die Freundinnen.
Noch heute könnte ich mich backpfeifen ob dieser blöden Karte.
Hätte ich gar nicht geschrieben, wäre Bella in den nächsten Tagen da gewesen. Todsicher und mit der ihr eigenen Unbekümmertheit um Vorschriften und Verbote.