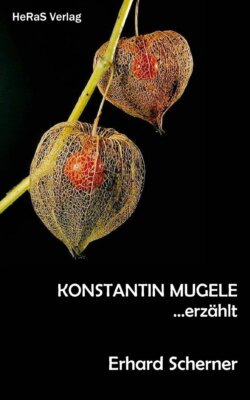Читать книгу Konstantin Mugele erzählt - Erhard Scherner - Страница 4
ОглавлениеDie Juden-Zigarre
Vom Vater, denk’ ich mal, ist nur Gewöhnliches zu erzählen. Er war klein, unauffällig, mit rundem freundlichen, manchmal auch erschrockenem Gesicht. Ein Oberschlesier, also Katholik, aber nicht besonders katholisch, jedenfalls weniger als Mutter. Sie, immerhin, strich mit dem Messer dreimal ein Kreuz über den Laib Brot, ehe sie ihn anschnitt. Später, im zweiten Krieg, ließ sie davon ab.
Auf der Suche nach Arbeit hatte es die Eltern, Vater vornan, aus Leobschütz nach Berlin verschlagen, gegen Ende der zwanziger Jahre. Leobschütz heißt heute Glubczyce und liegt in Polen. Ein Städtchen, nicht abgelegen genug, dass es der letzte Krieg verschont hätte. Anders als manches Gehöft, manche Straßenzeile, hat die ehrwürdige Stadtmauer überdauert, der beachtliche Rest. Die Kirchen sind neu erstanden und die Brauerei, vormals Weberbauer gehörig. Guttfreunds Kurzwaren-Großhandlung am Ring gibt es längst nicht mehr. Geisterte viele Jahre als jüdisches Kaufhaus durch das häusliche Gespräch. Weil: Mutter war Lehrmädchen bei Guttfreund, in jenem Weltkrieg, den niemand bezifferte, weil eine Wiederholung nicht vorstellbar schien. War anstellig und konnte gut rechnen, eine hübsche Dunkelblonde mit großen Augen, dreizehn Jahre wohlgelitten von Brotgeber und Kunden. Aber was half ihr ein gutes Zeugnis in der Tasche, wenn es für sie in der fernen Hauptstadt, dem Liebsten hinterher gereist, keine Arbeit gab. Dann die drei Kinder, geboren im Abstand je zweier Jahre, ich das mittlere. Musste nun alles Vater packen: Arbeit suchen, Arbeit suchen und, wenn er sie gefunden hatte, auch behalten. Bei Kürschnergesellen schwierig – sie leben mit der Saison, dann darben sie. Schlimm, wenn die Frühlingssonne heraufzieht und die Leute keine Pelze mehr tragen, wenn es keinen Mantel zu füttern gibt, kein Kaninchenfell auf einen Kragen muss. Lausige Zeiten in einer ziemlich lausigen Gegend, Lothringer Straße. Schwerer hatten es die Juden nebenan im Scheunenviertel, die wie Vater und Mutter hoffnungsvoll aus dem Osten zugereist waren. Auch bei uns im Hinterhaus gab es die eine oder andere jüdische Familie. Blieben mal kürzer, mal länger. Berlin war ein schwieriges Tor in die reichere Welt.
Umsichtig suchten die Eltern, uns Not nicht spüren zu lassen. War Leberwurst auf die Schrippe nicht zu haben, wurde Marmelade auf die Stulle gekratzt oder Zucker drauf gestreut. Krämer und Bäcker schrieben an, bis Vater sein Stempelgeld ausgezahlt bekam. Der wusste sich zu bescheiden. Zahlte unsere Schulden, kaufte eine Schachtel Zigaretten. Ging mit Mutter Skat spielen um Zehntel Pfennige zu einer befreundeten Familie am Wasserturm.
Die Feste kamen wie sie fielen. Gab es keinen Kuchen, gab es Kuchenkrümel, für einen Sechser eine ganze Tüte voll. Wenn im Frühling das Passahfest heran war, reichte Frau Urtel uns Kindern Matze aus, ungesäuertes Fladenbrot. Daran hatten die neuen Volksbeglücker nichts ändern können, jedenfalls in der Lothringer 17 nicht. Matze war köstlich. Und es war was zu essen.
Nur das Ungewöhnliche brachte alles durcheinander. Vaters Anstellung am Flughafen Tempelhof, Arbeit fürs ganze Jahr. Er durfte Fliegermonturen passgerecht machen, einen Pelzkragen reparieren, ehe der mit dem Piloten in die Lüfte abhob. Oben ist es immer kalt. Hat ihm einmal ein Flugkapitän, dem Vater fix geholfen hatte, als Dank eine Flasche „Lacrima Christi“ mitgebracht, Wein vom Fuße des Vesuvs. Vater war nicht gewohnt, Wein zu trinken, und wir wussten auch niemanden, dem wir die Flasche hätten schenken können. Fiel uns schließlich mein Klassenlehrer ein, Lehrer Feßler, nur so, ich hatte nichts ausgefressen und versetzungsgefährdet war ich auch nicht. Lehrer Feßler lehnte erst ab, dankte schließlich, als er wohl spürte, dass wir keinen Ausweg wussten, und übersetzte den Namen des Weines: Christusträne. Das berührte mich doch, den frisch gebackenen Ministranten von der Herz-Jesu-Kirche am Teutoburger Platz.
*
Für eine Zigarre aber, die Vater gelegentlich nach getaner Arbeit erhielt, hatte er Verwendung: die hob er sich für den Sonntagmorgen auf. Lächelte, löste genüsslich die Bauchbinde, ja, eine gute Zigarre, schnitt mit scharfem Messerchen die Spitze an, griff feierlich zum Streichholz, zog Luft, suchte mit rundem Mund einen Kreis aus Rauch über den Küchentisch zu zaubern, verschluckte sich regelmäßig, hüstelte, immer noch glücklich. Welch ein Duft, traulicher als Weihrauch. In solchem Augenblick bewunderte ich den Vater, dessen Pelzkragen auf einer Pilotenmontur bis nach Rom durch die Lüfte sauste, vielleicht in dieser Sonntagmorgenstunde.
Am 9. November 1938 – ich war neun und überhaupt schlief ich noch – tobten sich in unserem Kiez Eiferer an den jüdischen Läden aus. Fanatiker in Zivil probten Volkszorn, zeitig am Morgen. Der Horst-Wessel-Sturm?
Das aber weiß ich genau: Mein ganzer Schulweg, vom Bäcker in der Lothringer, die lange Schönhauser hinauf bis zur Katholischen Volksschule in der Oderberger – wie viele Läden, die Fenster zerschlagen, Auslagen verwüstet, beschmiert. Allenthalben, und mein Schulweg war lang: „Kauft nicht beim Juden!“ Auch: „Juda verrecke!“ Das Klirren der Scherben beim Kehren höre ich noch immer.
An einem Laden mit Tabakwaren räumten ein paar Leute geschäftig und unaufgeregt einfach ab. Im Schwung hüpfte eine Zigarre aus ihrer Holzschachtel und rollte mir vor die Füße. Die braucht keiner mehr, dachte ich, und griff zu. Vater soll sich freuen.
Als ich dem Vater mein Geschenk überbrachte, wurde er traurig. Böse sein war nicht seine Sache. Aber er verlangte, die Zigarre sofort zurückzutragen. Wie ungerecht, dachte ich, dem Heulen nahe. Aber: deutsche Jungen weinen nicht!
»Wohin denn?« rief ich.
»Dorthin, wo du sie hergeholt hast!«
Das war ein schlimmer Gang. Es dunkelte schon. Die wenigen Passanten starrten, schien es mir, auf die Juden-Zigarre in meiner klammen Hand. Ich schob sie hastig durch den Bretterverschlag, der nun die Scheibe des Tabakladens ersetzte. Dass ich mich schämte, brauchte es noch sieben Jahr.