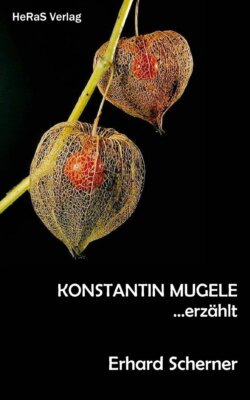Читать книгу Konstantin Mugele erzählt - Erhard Scherner - Страница 5
ОглавлениеHier ist alles still
Ein Jahr war, da sind die Würfel gerollt, wie kaum je. Und ich, Konstantin, merkte es, einen schrecklichen Blitzstrahl lang. Und vorbei. Die andere Zeit drängt sich in meinen Tag, mal vage, mal konturenklar.
Damals war ich elf, ein spilleriges, blasses Großstadtkind. Vater hatte den Einberufungsbefehl erhalten, pünktlich zum Kriegsbeginn, Schwester und Bruder waren inzwischen kinderlandverschickt ins Mährische. Mit einem Brief aus Oberschlesien kam auf mich zu, was ich nicht ermessen konnte.
Liebe Anna,
schick uns den Konstantin. Wir füttern ihn wieder auf. Soll er mit unserm Ottchen herumstromern. Ein Gymnasium hat Krappitz auch. Hier ist alles still. Deine getreue Schwester
Olga.
Die Tante, wie sie leibt und lebt. Und der Onkel? Von Otto Dürr erwarteten wir wenig. Eine pommersche Beamtenseele und Zwölfender. Hatte wohl zugestimmt, obwohl er die Sippschaft seiner Frau nicht verknusen konnte – alle schlesisch, alle katholisch. Das wußten wir schon. »Ein Stubben», so Vaters Meinung.
Tantes Angebot war verlockend. Auch Berlin war inzwischen Ziel für Fliegerangriffe geworden. Aber Mutter würde allein bleiben in der Stadt, dienstverpflichtet für die Rüstungsbude Siemens-Plania in Lichtenberg. Mir machte sie Mut zur Reise. Auf Otto junior, Ottchen gerufen, freute ich mich. Nachzügler bei den Dürrs und genauso alt wie ich. Seinen älteren Bruder würde ich wohl nicht treffen. Der war schon Offizier, im Süden irgendwo.
*
Krappitz liegt dort, wo die Hotzenplotz in die Oder mündet. Dort soll ich heimisch werden einen Krieg lang, oder einen halben. Soll zu futtern haben und mein Abenteuer. So war’s ausgemacht im Spätherbst 40.
Mit Abschiedstränen am Schlesischen Bahnhof trat ich meine Reise an. Bis nach Oppeln war zu fahren, dann mit dem Bus. Kam nun ins Haus von Otto Dürr. Ein vierschrötiger Graukopf mit sorgfältig gepflegtem Lippenbärtchen. Den trugen damals viele.
Der Onkel, als er mich begrüßte, spielte den Milden und den Gestrengen: »Sollst es gut bei uns haben, Konstantin, willkommen am Ring 1. Aber Zucht und Ordnung müssen sein, sind wichtiger denn je.« Mit einem Seitenblick zu meinem Cousin gesagt: »Das gilt auch für Ottchen«. Fragte dann: »Jungvolk?«
Ich nickte. Schon will der Onkel etwas von den Luftangriffen auf die Reichshauptstadt wissen.
»Wir sammeln Granatsplitter«, sage ich. »Die tauschen wir gegen Bombensplitter, wenn’s in unserer Gegend gekracht hat. Die sind mehr silbern. Oder verkloppen sie gegen einen kupfernen Führungsring. Den gibt’s selten.«
»Habt ihr nichts Besseres zu tun? Nun gut. Wie geht’s Schwägerin Anna?«
»Geht schon«, sag ich.
»Jeder muss jetzt Pflichten übernehmen«, sagt der Onkel. »Und ihr? Einmal die Woche könntet ihr die Schuhe putzen, sagen wir am Sonnabend, alle Schuhe im Haus, und blitzblank. Wolln es erstmal dabei belassen.«
»Zu Befehl!«, ruft Ottchen, mein lieber guter Vetter, kräftig schon wie ein junger Bär, auch ein ganzes Ende größer als ich. Was jetzt kommen muss, weiß er. Wider Erwarten reicht uns der Onkel erst ein Taschengeld aus, beteuert dann aber: »Als ich Hufschmied lernte, was habe ich mich schinden müssen … «
Ich schiele andächtig zur Wand, wo die Innungsurkunde von Onkels Prüfung hängt, darunter, angeschrägt, eine Art Gesellenstück: Pferdehuf mit Eisen, in Silber gefasst. Der Onkel greift nach einem Priem, den steckt er sich hinter die angeschwärzten Zähne. Ende der Audienz.
*
Tante Olga, rundlich und viel kleiner als der Onkel, ist das ganze Gegenstück. Sie schloss mich in die Arme und sagte: »Jetzt gehen wir erst mal wiegen«.
Bin ich in Hänsel und Gretels Wald? – Wohl doch nicht. Die Tante ist eine Frau, die man vom ersten Augenblick an lieb haben muss. Das merke ich doch.
Auf dem Ring und in den Seitenstraßen – immer wieder wird Tante Olga gegrüßt oder zu einem kleinen Schwatz aufgehalten. Sie genießt das. Manchen stellt sie mich vor: »Das ist der Große von Schwester Anna, Konstantin, eine schlesische Lerge aus Berlin.« Sie steuert auf den Gemüseladen zu. Kolonialwaren steht über der Tür, aber drinnen gibt es nur Kartoffeln, Mohrrüben, Sauerkraut. »Was mag’s denn wiegen, das Bürschlein?« fragt die Tante, »Schwester Anna will’s bestimmt wissen …«
Ich muss auf die Kartoffelwaage steigen und kriege einen Apfel geschenkt. Tante Olga schreibt sich alles auf. Nun jeden Monat die Prozedur. Das weiß ich noch nicht. Im Fleischerladen wird Tante mit »Guten Tag, Frau Postmeister» begrüßt. Sie variiert ihren Spruch: »Ein bisschen mager das Berliner Bürschlein.« Reicht die Fleischmarken über den Ladentisch und fragt, für Bohnen und Stampfkartoffeln bestimmt, nach einem Pfund Kassler. Die Meisterin schneidet einen Zippel Brühpolnische ab und drückt ihn mir in die Hand. Ich beginne zu ahnen, was für ein mächtiger Patriarch ein Postinspektor ist, dort, wo sich die Hotzenplotz in die Oder wirft.
*
Rasch habe ich mir abgewöhnt, Krappitz ein rückständiges Nest zu nennen. Freilich, Onkel und Tante wohnen im schönsten Haus am Ring. Es hat ein hohes spitzes Türmchen. Ich, der Hauptstädter, bewundere beim Onkel den ersten elektrischen Kühlschrank, den ich zu sehen kriege. Der weiß von alleine, wenn er zu kalt wird! So bleibt die Butter frisch, die Tante Olga vorrätig hat.
Wie viele Einwohner Krappitz haben mag? 15 000? 18 000? Seit 700 Jahren schmiegt sich der Ort an die Oder, bangt, wenn sie über die Ufer tritt. Das alte Rathaus, ein hölzernes, soll vor mehr als 90 Jahren niedergebrannt sein. Auf dem Dach des neuen Rathauses steht eine mächtige Sirene. Die schweigt tags, schweigt nachts. Schweigt und wartet. Es ist eine schläfrige Stadt. Morgens kommt ein bisschen Tempo in die Leute. Sie gehen, Geld zu verdienen, ins Zementwerk, oder produzieren Papier, auch Pappe. Sie radeln über die Oderbrücke nach Ottmuth zur BATA-Schuhfabrik.
Ich gehe zur Schule, genauer in die „Städtische Mittelschule mit Zubringeeinrichtung, OS.“ In Klasse II b bin ich der Neue. Niemand hänselt mich. Eifersüchtig beschützt Ottchen seinen Cousin. Mit ihm legt sich niemand an. Fast alles, was kommt, ereilt uns gemeinsam. Wenn von der Schulleitung alle Schüler einen Schrieb für Zuhause in die Hand gedrückt bekommen, kriegen wir beide je einen. Zum Beispiel:
An die Eltern. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind auch daheim nur Deutsch spricht. Vergessen Sie nie: Deutsche sprechen deutsch! Polen sprechen polackisch!
Ob das gutes Deutsch ist, bin ich mir nicht sicher, aber Onkel und Tante kriegen ihren Zettel, einen von Ottchen, einen von mir. Und sind es zufrieden.
Dabei ist es eine respektable Schule, beinahe ehrwürdig. Sie hat sogar einen Karzer, mit Gitter und Schiebefenster. Auch in Krappitz quäle ich mich mit Rechnen herum, es bleibt bei schriftlich 5, mündlich 4 – mein Schicksal.
Mir gefällt die Deutschstunde. Wir lernen Gedichte, Balladen, auch ganz lange. Mit Schillers „Glocke“ fange ich mir eine Eins. Ich kriege das Amt des Vorbeters. Das hatten wir in Berlin, in der Blücherschule, nicht. Mit kräftiger Stimme bete ich am Morgen vor, es sind nur vier Zeilen, das ist keine Kunst:
Schütze, Gott, mit starker Hand,
unser Volk und Vaterland.
Wende unsres Volkes Not.
Arbeit gib und jedem Brot.
Die Klasse sagt: »Amen!« Der Lehrer sagt: »Setzen!«
*
Je öfter ich das Gebet spreche, umso mehr Fragen tauchen in mir auf. Warum soll ER, Herr der Heerscharen, grad uns Deutsche schützen? Die Engländer beten auch! – Den Polen, und die sind fromm, hat er nicht geholfen. Polen, die schon immer hier leben, kehren in Krappitz den Rinnstein. Sie tragen ein viereckiges Karo auf der Jacke mit einem dicken P drauf. Schütze, Gott, mit starker Hand – jeden Morgen.
*
Onkels Tagesablauf ist Gesetz, seine Prinzipien schlagen durch bis in die Backröhre. Mittags klappt das auch. Pünktlich ein Uhr tritt Onkel Otto aus der stattlichen Post. Ein Uhr zehn ist er bei uns am Ring, stellt den Stock an die Wand, auf den er sich beim Gehen stützt. Die Tante tischt auf. Egal wie, das Essen muss herzhaft sein. Ein Schlag aus der Gulaschkanone wäre ihm am liebsten. Aber wie im zweiten Kriegsjahr ein anspruchsvolles Mahl auf den Tisch gelangt, interessiert ihn nicht. Auch nicht, woher die Butter stammt, die bei Dürrs nicht alle wird. Tante Olgas Geschäfte mit den tuschelnden Landfrauen in der Küche ignoriert er. Im Speiseplan taucht schon mal ein Täubchen auf. Tante Olga rupft es. Kaninchen oder Hase gibt es bei Dürrs nie. »Eine Ratte kommt mir nicht in die Pfanne« hat der Onkel verordnet. Tante gehorcht.
Nichts geht dem Onkel über den täglichen Wehrmachtsbericht, über Sondermeldungen zumal. Damit sind wir 1941 verwöhnt. Kostbar ist ihm eine Rede von Dr. Goebbels oder von Fritzsche. Sieg und immer Sieg. Ich will wissen, ob Berlin bombardiert wurde. Und wo. »Es ist schlimm, was da zerschlagen wird, in Köln, auch in Berlin«, sagt der Onkel. »Aber das lässt sich ersetzen. Wirkliche Erneuerung kommt nicht von den Städten, Konstantin, die kommt vom Lande her aus der Bauernschaft. An das Bauernblut kommen sie nicht ran.- Ich grübele: Olga und Anna, als Schwestern, sind blutsverwandt, ob sie nun in Krappitz oder in Berlin leben. Der Onkel kann halt die Großstädter nicht leiden.
Onkel Otto blättert im „Völkischen Beobachter“. Manchmal wirft er uns daraus einen Brocken hin. Was heißt uns? Tante Olga räumt den Tisch ab. Ottchen döst.
Den Papst lehnt der Onkel ab. Er schimpft auf die Zentrumspartei. »Eure Sippschaft hat die Brüder immer gewählt«, ereifert er sich. Aber an den Jesuiten gefällt ihm, dass sie diszipliniert sind und straff organisiert. Onkel Otto wettert gegen viele Feinde, Kommune und Sozis. Unsere Erzfeinde kennt er alle. Das sind die Länder, die uns beraubt, geplündert und die Kolonien weggenommen haben. Besonders hat er es mit Frankreich. Da geht er bis auf Kardinal Richelieu zurück. Er vergisst nicht die Brandschatzungen in der Pfalz, auch nicht Napoleon und die Schande von Versailles.
»Nun, Frankreich ist besiegt. Nie wieder wird ein Franzose …« »Fußball spielen!« platzt Ottchen in Onkel Ottos Rede. Das hätte uns beinahe verraten, zumal wir bis über die Ohren rot werden. War doch erst drei Tage her: Wir schlendern am Sportplatz entlang. Ein Trupp französischer Kriegsgefangener, sie werden von einem ziemlich schläfrigen Heimatsoldaten begleitet, ballert ein bisschen aufs Tor. Unversehens rollt ihr Fußball zu uns. Ottchen pfeffert zurück – fast ein Tor. Nun spielen die Franzosen uns den Ball zu. Es macht ihnen Spaß mit uns zu bolzen. Uns macht es ja auch Spaß. Der Wachsoldat döst. Als wir Abschied nehmen – »Salut!“ – weist uns ein Gefangener auf ein Eichhörnchen, das grad einen Baum hinaufklettert. Der Franzose ruft: »Armes Deutschland – kleiner Fuchs!« Ein bisschen merkwürdig sind sie schon.
Unvermittelt kommt der Onkel auf das Weltjudentum zu sprechen. »Das ist die größte Gefahr“, sagt er. »In Berlin tut sich wenig. War doch alles in Nürnberg beschlossen, längst schon.«
Ottchen gähnt. Für einen Augenblick denke ich: Tante Olga braucht einen Jungen zum Auffüttern. Der Onkel braucht einen neuen Sohn.
*
Tranig ist Ottchen nur, wenn Onkel Otto auftaucht. Sie haben sich nichts zu sagen, so sehr die Tante zu vermitteln sucht. Er braucht Vaters Tiraden nicht. Will, sehr zu dessen Kummer, heute nicht Pimpf sein, morgen gewiss nicht Offizier. Mir sagt er: »Wenn mein großer Bruder so tapfer ist, das reicht.« Ich muss aufpassen, dass Ottchen und ich nicht gegeneinander ausgespielt werden. Natürlich sind wir zwei verschieden. Aber unsre Lieder, die wir in die Welt schmettern, sind gleich, Gassenhauer mit vielen Strophen:
Schorsch, du musst jetzt nach Amerika,
sprach der Vater einst zu mir,
denn du liebst die dicke Lina, Pause,
und das ist nicht
und das ist nicht
recht von dir.
Darum Jüngling, lass dir sagen,
eh du eine Jungfrau küsst,
frag sie ob sie evingelisch, Pause,
oder kata-
oder kata-
launisch ist.
Mit Ottchen macht sogar das Schuheputzen Spaß.
Unten an den Oderwiesen, auch im Lindenwäldchen sind wir ganz andere. »Warte mich!«, ruft er, wenn ich zu flink davonlaufe, »du kriegst Schnicke!« Aber er will mich nicht peikern. Es wäre unfair. Ich rede bald schon die Sprache unseres Indianerstamms. Die besten Flüche sind ohnehin die polnischen. Psiakrew pierunie!
An der Oder ist es schön, auch bei Eistreiben, Hochwasser, zu jeder Jahreszeit. Und wie gut der Fluss riecht, wie er murmelt, und bei jedem Wetter anders. In der Stadt hingegen ist nicht viel los. Da muß man sich behelfen. Aber es gibt ein Kino in Krappitz. Onkel und Tante kommen aus dem neuen Spielfilm über Schiller. Der Onkel empfiehlt ihn uns, sagt aber noch nicht, warum. Wir gehen in die Nachmittagsvorstellung, erleben: geisttötend den Drill, der auf den jungen Schiller hereinbricht, selbst das Zöpfeflechten der Kadetten erfolgt im Kommandorhythmus. Am Abend hält der Onkel mit seiner Begeisterung nicht zurück. »Eine militärische Erziehung der Jugend, das ist es, was wir brauchen. Morgen, das Beispiel der Karlsschule habt ihr gesehen, wird sie in ganz Deutschland Wirklichkeit.« – Der Onkel hat den Film nicht verstanden.
Ein Besuch im SA-Lokal ist nicht besonders lustig. »Schön, dass Sie uns besuchen, Parteigenosse Dürr«, sagt der Gruppenführer. »Heute haben wir nur einen Kameradschaftsabend. Sollen wir …«
»Weitermachen!«, sagt der Onkel, weist auf mich: »Das ist aus Berlin mein Neffe Konstantin, soll nur mal reinriechen …«
»Schwarzbraun ist die Haselnuss …«, wird angestimmt. Sechzehn Mannen singen kräftig »ha, ha, ha.«
Onkel spendiert eine Runde Bier. Beim Gläserklirren ein Sprechchor: »Und zieht der Arsch auch Falten, / wir bleiben doch die Alten.« Dann, ich wundere mich, denn alle sind erwachsen, werden einem der Männer die Augen verbunden, und sie spielen Schinkenklopfen. Der Onkel erhebt sich. Ich erinnere mich an verschwitzte Gesichter.
Das Obertorhaus von Krappitz sieht richtig gut aus. Es ist der letzte Rest der Stadtmauer, die es vierhundert Jahre lang gab. Wir haben die prächtige Pfarrkirche, dem Heiligen Nikolaus geweiht, und in Ottmuth drüben die Kirche Mariä Himmelfahrt. Gern hätte ich mir das Barockschloss angeschaut, das einmal den Grafen von Redern und später denen von Haugwitz gehörte. Mein Schulkamerad Bernd, Bernd von Stein, wohnt dort. Mit dem bin ich ein bisschen befreundet: er schenkte mir aus dem Schlosspark die blauweiße Feder des Eichelhähers – ich gab ihm einen Kiesel.
Krappitz besitzt kein Museum. Krappitz hat keinen Zoo, wo man sich wilde Tiere ansehen kann.
*
Als Ausflugsziel für den Sonntagnachmittag schlägt der Onkel Ottmuth vor. Ottchen hat sich schon aus dem Staub gemacht. Für Tante Olga ist der Weg zu weit. Zu zweit passieren wir die Oderbrücke, halten uns, wenn ich mich recht erinnere, in Richtung der BATA-Werke. Der Onkel schwenkt zu einigen Baracken ab. Das Gelände ist mit kräftigem Zaun und Stacheldraht eingegrenzt. Wir sind nicht die Einzigen dorthin unterwegs. Ein Torflügel zum Lager steht offen, ein Wachmann lässt sich den Ausweis zeigen. Auch die Türen der Baracken stehen auf. Besuchszeit. Männer, stoppelbärtig, in grober Arbeitskleidung, sind herausgetreten. Einige Gefangene stützen sich auf eine Brüstung, schauen, wer heut zu Besuch kommt. Das Lager liegt ein bisschen höher als der Ort. Trotz der Nachmittagssonne ist es kühl. »Das ist das Judenlager«, sagt Onkel Otto unbewegt, verbessert sich: »Das sind Halbjuden aus Krappitz. Morgens werden sie ins Schuhwerk geführt oder sonstwie ausgeliehen, meist zum Bau der Reichsautobahn.“ Derweil treten Besucher an die Barriere. Frauen wechseln ein paar Worte mit den Eingesperrten, holen ein Päckchen hervor, um es rasch zu übergeben. Brot? Gefangene, die niemand besucht, stehen und warten. Ich will fort. Große Augen prägen sich mir ein, Gesichter spitz und schmal.
*
Strahlende Sonne zweier Maientage hat den Frühling in die Stadt geholt. Blüten überall. Der Flieder springt auf, rote und weiße Kerzen schmücken die Kastanien, allen zur Freude und sehnsuchtsvoll erwartet. Eine Division Soldaten rückt in Krappitz ein, unerwartet, mit Waffen und Gerät, bezieht Quartier. Die Mädchen der Stadt freuen sich – sie sind blass, wenn man sie mit den braungebrannten Gesichtern der Rekruten vergleicht. Auch wir Jungen haben unsern Spaß: schulfrei. Plötzlich ist unsere Schule Mittelpunkt eines wirbelnden Heerlagers, das die Stadt verändert.
Woher sie kommen – das sagen Soldaten nicht. Wohin sie gehen werden – das wissen sie nicht.
Onkel Otto spricht von Umgruppierung. »Wir können uns nicht auf Dauer von England her malträtieren lassen.« Tante Olga denkt mehr praktisch. Am Schulhof werden Kommissbrote abgeladen. Wen schicken? Es darf kein Dummerle sein. »Lauf, Konstantin, du bist klein«, sagt sie, »lass dir eins geben.« Ich weiß schon, diplomatische Aufgaben erbe ich. Und am Ende ist es gar nicht so schwer: Ich stelle mich neben den Lastwagen, von dem die Furiere die Brote an die Kompanien abwerfen. Und eins fliegt zu mir.
Plötzlich sehe ich: Es muss einer im Karzer einsitzen. Zuvor hatte ich hinter dem vergitterten Fenster nie jemanden bemerkt. Ich laufe nach Hause, liefere das Brot ab, nehme mir aber vor, abends am Karzer mal nachzuschauen. Für alle Fälle wickele ich eine mit Butter und Marmelade bestrichene Schnitte ein. »Hallo, Soldat, hörst du mich?«
»Wer bist du?«
»Ich bin Konstantin. Hast du Hunger? Ich hab was zu essen mitgebracht.«
»Nun ja, danke. Kannst du ein paar Zigaretten besorgen? Und Feuer?«
Da kommt ein Wachposten ums Haus und ich sause davon. Zigaretten, Zigaretten, wie komme ich an Zigaretten bei einem Onkel, der sich mit Kautabak die Zähne versaut?
Unserm Haus schräg gegenüber wohnt Christian. Er ist der Sohn des Friseurs, mein Banknachbar in der II b. Ich locke ihn mit einem Steinchen ans Fenster und nenne meinen Wunsch. Der nickt, schließt das Fenster. Nach einer Weile schleicht er sich aus der Haustür und hält eine Schachtel in der Hand. Ach lieber Christian, gut, dass du mitkommst. Wie wir uns an den Karzer anschleichen, es dämmert bereits, und die Zigarettenschachtel ist schon im Bogen durch das Gitter gepurzelt, werden wir von einer Streife erwischt. Stracks geht’s ab ins Rektorzimmer, wo sonst Dr. Sommer amtiert. »Nichts zugeben«, zischelt Christian. Aber da kommt schon ein Unteroffizier vom Karzer und legt das Corpus delicti auf den Direktortisch. »Was habt ihr euch dabei gedacht?«, fragt ein junger, nicht unsympathischer Leutnant. – Wir drucksen herum, es fällt uns nichts Gescheites ein.
»Wisst ihr überhaupt, wer da für sechs Tage einsitzt? Wisst ihr, was er auf dem Kerbholz hat?«
Wir beteuern: »Nein, das wissen wir nicht.«
»Dieser Grenadier hat auf Wache geschlafen, einfach gepennt, und das in Griechenland, wo es Banditenanschläge gibt.«
Griechenland, ach deshalb sind sie so braungebrannt, denke ich. »Die Wache verpennen, das ist hochgefährlich im Krieg«, sagt der Leutnant, »oder soll der Krieg verloren gehen?«
»Nein! Nein!« versichert Christian. »Vae victis!« füge ich an.
»Wie alt seid ihr denn?«, fragt der Leutnant?
»Elf«, sagt Christian, »Zwölf«, sage ich.
„Macht, dass ihr nach Hause kommt. Und um den Karzer herum will ich euch nie wieder sehen, verstanden?«
*
Die Soldaten kommen – sie haben geflickt, geputzt, die Waffen geölt, sie haben geschmust. Die Soldaten gehen wieder. Ein paar Feldpostbriefe flattern ihnen hinterher. Wohin genau, das weiß niemand. Jedenfalls nicht nach England.
In meinen Augen ist Onkel Otto als Postinspektor und Weltkriegshauptfeldwebel ein Ass in Erdkunde und Strategie. Wenn eine neue Operation der Wehrmacht vermeldet wird, holt er seinen ledergebundenen Atlas vom Bücherschrank und macht sich kundig. Dann ruft er uns alle um den Tisch: An kleinen Karten erläutert er kleine Kriege, prophezeit, wie lange der neue Feldzug dauern mag. So war es unlängst, im April, als unsere Truppen in Jugoslawien einmarschierten und in Griechenland. Und er hatte recht.
*
Es kommt ein Sonntag, den ich nicht vergesse: 22. Juni 1941. Leuchtend der Himmel, viel Sonne. Aus dem Radio Militärmusik, dann die Nachricht: Seit den Morgenstunden, dem feindlichen Angriff zuvorkommend, Krieg mit Sowjetrussland. Wie gewohnt greift Onkel Otto nach dem Atlas. Er blättert, sucht die Russlandkarte. Diesmal muss er zusätzlich noch zwei Faltblätter herausklappen: von Brest bis Wladiwostok – ein Riesenreich! Ich spüre es wie Blitzschlag: Der Krieg ist verloren. Weiß es für einen winzigen Augenblick. Schon schmettern die Siegesfanfaren. Den ganzen Tag über schmettern sie.
*
Gottlob, die Sirene auf dem Rathaus der Stadt bleibt still. Die Krappitzer, scheint mir, sind in sich gekehrt. Sieben Wochen sind vergangen seit dem Mai mit den jungen Soldaten. Feldpostbriefe kommen zurück … Wo mag der Mann aus dem Karzer sein?
Ein paar Wochen später hat Onkel was zu bereden. Die Regierung habe festgelegt, alle aus Berlin und aus den Großstädten Evakuierten, Frauen und Kinder, sollen dort verweilen, wo sie inzwischen Wohnsitz genommen haben. Ich bin hellwach. Wenn du dich jetzt nicht aufmachst, schießt es mir durch den Kopf, kommst du hier nicht mehr weg. »Nun, Konstantin«, sagt der Onkel, »du hast dich bei uns eingewöhnt. Und in der Schule auch. Das freut mich. Also bleib. Lange wird es ohnehin nicht dauern, und der Führer gewinnt den Krieg.«
»Ottchen und du, ihr zwei vertragt euch gut«, lobt Tante Olga. Und verschweigt dabei, dass ihr Ziel schon erreicht ist: Ich bin schwerer, auch viel kräftiger als ich kam.
»Was auch passiert«, sag ich, „ich will, ich muss nach Hause. – Grüble auch, was ich dem Onkel schenken könnte, wenn es zum Abschied kommt und dass er sich freut: einen getuschten grünen Lindwurm für die Schalterhalle der Post, oder eine knorrige Eiche? Jedenfalls was Deutsches. Für Tante Olga fällt mir kein deutsches Geschenk ein. Und dann ist die Stunde viel eher heran, als uns allen lieb sein konnte. Die Tante hat geweint. Der Onkel hat sich geschnäuzt. Ottchen hob die Hand und bot den Gruß unseres Indianerstamms.
*
Nur ihm, Otto junior, bin ich noch einmal begegnet, viele Jahrzehnte später. Auch nur für ein Stündlein. Die Tante, der Onkel sind lang schon gestorben, einige Jahre nach der Flucht aus Oberschlesien nach Nürnberg. Krappitz heißt Krapkowice. Der Onkel starb verbittert. Ottchen hat Werkzeugmacher gelernt, ist in den Fünfziger Jahren von Bayern nach Kalifornien gesiedelt, hat eine Familie gegründet.
Überraschend rief er eines Tages aus Berlin an, vom Kempinski. »Ich hole dich!« rief ich überfroh. »Oder steig in die S-Bahn, so geht es am schnellsten …«
»Er besteht darauf, in unser Dorf mit dem Auto einzufahren, immer ostwärts. Eine Landkarte habe er nicht, sagt er. Verfährt sich, saust mit seinem Wagen um den ganzen Müggelsee. Ich harre an der vereinbarten Straßenkreuzung aus.
Als der amerikanische Schlitten endlich erscheint, als Otto junior stoppt und aussteigt, fallen wir uns in die Arme, lachen und weinen. Weiß ist sein Haar, tief seine Stimme. Er spricht mit rollendem R. Ich spüre: das ist mein Vetter, besonnen und leis wie eh.
»Warum bist du von Nürnberg ausgewandert?«; frag ich.
»War mir zu viel Marschmusik«, sagt er.
»Wirst du«, frag ich, »nach Deutschland zurückkehren?«
»Ist mir zu viel Marschmusik«, sagt Ottchen, der in unserem Stamm der Klügste war.