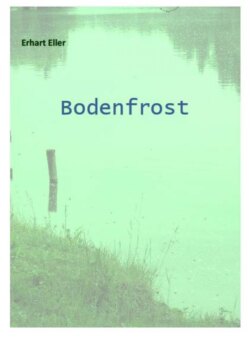Читать книгу Bodenfrost - Erhart Eller - Страница 4
ОглавлениеDer dreißigste des April Zweitausendundsieben
Morgenstund ohne Gold im Mund
Wilfried Schaffer war ein besitzloser, erwerbsloser Mensch, dessen Dasein sich weitgehend unbemerkt vollzog, obschon er das Licht nicht scheute.
An jenem Montag-Morgen erwachte dieser einsame Wolf, dem die Einsamkeit nicht behagte, bereits vor Sechs. Er hatte leidlich geschlafen, doch wirres Zeug geträumt. Zielstrebiges Träumen wäre ihm lieber gewesen. Gut hätte er einen Traum gefunden, der ihm offenbarte, wie er seine Lage bessern könnte. Doch solchen Traum konnte er nicht erzwingen. Das war beklagenswert, doch jetzt war nicht die Zeit zu klagen. Eine Frage galt es zu bedenken: „Wie bewältige ich den heutigen Tag?“ Die nächstliegende Antwort hieß: „Liegen bleiben, um Energie zu sparen.“ Dieses Nächstliegende kam für ihn nicht in Betracht. In ihm steckte der unbezwingliche Drang, tätig zu sein, obschon sein Tun absehbar nichts bewirken würde.
Punkt Sechs, mit dem Klingeln des Weckers, erhob er sich von seiner knarrenden Liege zur schnörkellosen Körper-Reinigung. Dabei ging ihm Düsteres durch den Kopf. Der sogenannte Arbeitsmarkt war ihm fest verschlossen. Die nicht mehr zu zählenden Besuche bei Ämtern und Agenturen sind vergeblich gewesen. Verachtung war ihm oft begegnet, kaum verhohlen oder ganz ungeschminkt. Zugegeben, er hatte auch mit anständigen Ämtlern zu tun gehabt; eine durchaus Anständige war die für ihn zuständige „Fall-Managerin“. Die ging mit ihm wie mit einem Menschen um, wollte ehrlich helfen, doch konnte nicht. Er war nun einmal ziemlich lange heraus aus dem Berufsleben, Fünfundvierzig alt inzwischen, somit, nach vorherrschender Ansicht, eine Ware jenseits des Verfalls-Datums. In früheren Jahren hatte man ihn gelegentlich mit „Arbeits-Beschaffungs-Maßnahmen“ abgespeist, die bescheiden entlohnt wurden, doch immerhin. Er, der mit Geld umgehen konnte, war einigermaßen zurecht gekommen. In der Vergangenheit hatte er manchmal Kurzzeitiges ergattert, zuletzt im vergangenen Jahr, als er bei einem Gebäude-Abriss Schrott aufklaubte, unter großer Verletzungsgefahr, die ihm, dem Eifrigen, erst hinterher klar geworden war. Am Ende hatte man ihn um seinen erbärmlichen Lohn betrügen wollen. Ja, für einen wie ihn war in diesem Landstrich sogar eine befristete, schlecht bezahlte, Teilzeitstelle, wie eine Wasserstelle in der Wüste…
Seine Lage, seit Jahren angespannt, erschien ihm eben an diesem Morgen unerträglich und er sagte sich, es müsse heute etwas Umkrempelndes geschehen, sonst stünde er für nichts mehr ein.
Er setzte sich zum dürftigen Frühstück, das aus einem Kanten Brot mit Marmelade und einem Glas Milch bestand. Während er lustlos kaute und schluckte, überlegte er, wie er es angehen könnte. Die hundert und erste Bewerbung schreiben? Zu den nutzlosen Bewerbungen war er verpflichtet. Versäumte er, die geforderte Anzahl je Monat zu schreiben, würde ihm die erbärmliche Stütze, das Hartzgeld, gekürzt, im Wiederholungsfall gestrichen. Heute allerdings mochte er sich diese Zumutung nicht antun. Eine anständige Arbeit, war, wenn überhaupt, nicht über die Bürokratie, sondern nur durch Beziehungen zu bekommen. Sein Pech, dass es ihm daran mangelte. Wäre er in ein Netzwerk eingebunden, wäre er nie in die jetzige Lage, die er nicht verschuldet hatte, gekommen. Beinahe mit Wehmut dachte er an die einstige kleine Republik zurück, wo viele begehrte Dinge nur durch Beziehungen zu erlangen waren, jedoch Arbeits-Angebote anstelligen Menschen sozusagen nachgeworfen wurden. Einst hatte er zwar kein Vermögen, doch sonst so manches besessen: eine erträgliche Arbeit, Frau, Kind, ein sicheres, wenn auch nicht üppiges, Einkommen, die Achtung der Mitmenschen. Geblieben war ihm nur die Selbstachtung und tapfer kämpfte er darum, dieses Letzte nicht zu verlieren. Ausgegrenzte neigten dazu, sich hängen zu lassen. Nicht so der Langzeit-Arbeitslose Wilfried Schaffer. Er hielt seine kleine Wohnung peinlich sauber, obwohl er keinen Besuch bekam. Den armseligen Haushalt hielt er in Schuss. Er betätigte sich täglich am Schreibtisch. Das alte Stück hatte er vor kurzem ergattert und aufwändig aufgemöbelt. Er, der Nicht-Fachmann, hatte es ganz gut hinbekommen und hatte nunmehr einen anständigen Arbeitsplatz für die geistige Tätigkeit. Er hatte sich angewöhnt, Texte aus dem Englischen zu übersetzen, das ihm geläufig war. Dieses Hirnfutter fand er auf ausgefransten Hüllen seiner alten Plattensammlung und in Zeitungen, die er ab und zu in die Hand bekam. Weil das allein ihn nicht befriedigte, versuchte er sich auch im Spanischen, da er an eine Broschüre in dieser Sprache gekommen war. Er bediente sich dazu eines Wörterbuchs, das er sich einst angeschafft hatte, wegen einer in Aussicht stehenden Reise nach Cuba. Die hatte sich damals zerschlagen, das Buch hatte viele Jahre hinten und unten gelegen, nun hatte er es ans Licht geholt. Er übersetzte einige Zeilen, spürte allerdings bald, dass ihn heute diese brotlose Kunst nicht befriedigen konnte. Was aber stattdessen? Nebenher stellte er bitter fest, dass es ihm nichts bringen würde, zehn Sprachen in Wort und Schrift zu beherrschen – ihm, dem Abgestempelten, bliebe der „erste Arbeitsmarkt“ gleichwohl verschlossen. Trotz alledem – er musste tätig sein!
Wie, wenn er sich als Schreiber versuchte? In jungen Jahren ist ihm die Fähigkeit zum Erzählen bescheinigt worden. Gelegentlich, nach der Arbeit, hatte er einst in geselliger Runde, sprühend von Einfällen, für Kurzweil gesorgt. Er hatte nichts aufgeschrieben. Er hätte aufschreiben sollen. Überhaupt, fand er, sei es an der Zeit, diese seine Fähigkeit zu hegen und zu pflegen, obschon er nicht die Aussicht hatte, in Zeitungen und Zeitschriften etwas zu veröffentlichen. Denn auch dafür brauchte es Beziehungen, das war ihm klar. Immerhin, bei den Machern der Heimatzeitschrift, die vierteljährlich erschien, sollte er gelegentlich anklopfen…
Nachdem er eine halbe Stunde fruchtlos am Schreibtisch verbracht hatte, fand er, es habe keinen Zweck. Ein andermal lief es vielleicht besser. Hoffentlich. Jetzt hieß die Losung: „Hinaus!“ Er sollte Wohnung und Haus verlassen, bevor ihn die Wände erdrückten. Er schaute in seine Börse. Etwas Klimpergeld lag darin. Er konnte einkaufen, wenn auch nur das Allernötigste. Mochte sein, das erbärmliche Hartzgeld für den Mai lag bereits auf seinem Konto. Doch es war ihm eisernes Gesetz, nichts von dem, das für später bestimmt war, in der Gegenwart zu verbrauchen. Woraus folgte, entweder er kaufte etwas zum beißen oder zum trinken; beides zusammen ging nicht.
Nach innerem Kampf gab er dem Beißbaren den Vorzug und bewies sich damit: „Ich bin kein Süchtling.“ Er zog seine abgetragene Jacke über, trat in die schief getretenen Schuhe, verließ sein Heim, in dem er sich, trotz seiner Mühen, es wohnlich zu gestalten, nicht heimisch fühlte. Sein Grundgefühl hatte er im Gepäck, den stillen Groll über seine missliche Lage. Jedoch war in ihm nun die durch nichts begründete Hoffnung aufgekeimt, dass sich heute, gerade heute, seine Lage erheblich ändern könnte.
Leichtfüßig strebte Wilfried Schaffer hinweg von seinem Wohnblock, den man, in den Achtziger Jahren des Zwanzigsten Jahrhunderts, aus Betonplatten gefertigt hatte und in dem alleinstehende, vereinzelte, einsame, Menschen wohnten. Er ließ die Bus-Haltestelle hinter sich, ging stadteinwärts, den Hohlweg, „Im Kruge“ benannt, hinab. Auf dem Hang rechts des Wegs befanden sich Kleingärten, links das Gelände eines Kindergartens, anschließend ein Parkplatz, eine Wiese mit Kirschbäumen, Blocks mit Balkonen darüber. Vielstimmiges Vogelgezwitscher erfüllte die Luft. Neidvoll dachte er: „Die haben gut singen, leben fröhlich in den Tag hinein.“ Dann aber sagte er sich; dass die Tierchen nicht aus reiner Freude trällerten. Sie standen in hartem Wettbewerb; nur die besten Sänger wurden zur Paarung zugelassen. Ja im Tierreich sich zu behaupten, war auch nicht leicht. Der nächste Winter kam bestimmt. So manches Vögelchen, das jetzt zwitscherte, würde die kalte Jahreszeit nicht überleben. Ob Wilfried Schaffer den Winter überleben würde, wusste er nicht, doch nicht nur deshalb war ihm nicht nach zwitschern zumute. Er traf die Feststellung, dass den Menschen die Möglichkeit offen stand, sich Vernunft anzueignen, doch viele Menschen nicht das Bedürfnis hatten, sich über das Tierreich zu erheben.
Links gab es weitere Kleingärten, einige davon verwildert. Er erinnerte sich gut, dass seinerzeit, als es die kleine Republik noch gab, solche Gärten als Juwelen galten. In der Gegenwart, das wusste er, wurden sie angeboten wie Sauerbier und wie dieses meistens vergeblich.
Er erreichte die Naumburger Straße. Es waren keine lieblichen Gedanken, die seinen Weg begleiteten. Was für ein abstoßendes Bild! Der von den einst schmucken Häuserzeilen übrig gebliebene, graue, von Ruß gedunkelte, lückenhafte Rest, schrie danach, gleichfalls abgerissen zu werden. Ihn stießen die von Abgasen gebeizten Ziegelmauern, mit ihrem löcherigen Kleid von zerbröselndem Putz ab, nicht weniger die hässlichen Fensterhöhlen. Wo noch Scheiben vorhanden waren, starrten sie von Schmutz. Kaum glaublich und doch wahr – hinter einigen der Fenster hausten Menschen. Er sah schäbige Gardinen hängen und die schmuddelige Flagge eines Münchner Fußballclubs – arme Leute als Fans des Klubs der ganz Reichen – das war abartig, fand Wilfried Schaffer. Hatten diese Zeitgenossen denn kein Schamgefühl?
Abscheulich war ihm die stinkende Lawine des Kraftverkehrs, der die Wände erzittern ließ und die Lungen ätzte. Er traf die bittere Feststellung: „Eine Lebensader ist diese Fernstraße, freilich nicht für die Stadt Weißenfels.“ Bergan, bergab, rollten Unmengen von Gütern, die anderswo den Wohlstand mehren mochten - hier hatte man nur den Dreck, den Gestank. Was für ein Irrsinn – die Stadtbewohner wurden weniger und weniger, doch der Verkehr nahm unablässig zu.
Immerhin gab es selbst hier Natur, die ihn erfreute. Hinter schadhafter Mauer ragten Linden und Kastanien, deren grünes Gezweig den Fußweg überdachte. Freilich trat Schaffer nicht unter dieses Blätterdach; sondern, als vorsichtiger Mensch, dem die Reinlichkeit viel bedeutete, wechselte er die Straßenseite. Denn im Geäst nisteten Krähen in großer Zahl. Die dunklen Vögel fraßen und verdauten insbesondere zu dieser Jahreszeit ausgiebig; der Fußweg war dick gekalkt. Hinter Mauer und Bäumen konnte er verfallene Backstein-Gebäude ausmachen. Er wusste: Einst hat es hier eine Brauerei gegeben, die, wie alte Leute berichteten, ein schmackhaftes Bier erzeugte, bis die Strategen der Planwirtschaft darauf verfielen, den Getränkequell umzuwidmen; statt brauen nun schustern. Die Schuhfertigung wurde allerdings keine Erfolgsgeschichte und war inzwischen eine so ferne Vergangenheit, dass die jungen Leute nichts davon wussten. Betrübt vermerkte er: „Ringsumher wird Null Komma nichts noch hergestellt, nur Krämerei gibt es in Hülle und Fülle.“ Dass man in der Nähe des Krähenparadieses die mürbe Begrenzungsmauer abgerissen und eine Tankstelle hingestellt hatte, behagte ihm nicht. Und ihm missfiel, dass die Kraftstoffe schon wieder teurer geworden waren. Die Preistreiberei der Ölkonzerne musste ihn zwar nicht jucken. Sein Wägelchen hatte er vor Jahren verkaufen müssen, weil er es nicht mehr unterhalten konnte.
Hinter der nächsten Bresche befand sich nunmehr eine Kaufhalle, zur Erleichterung Wilfried Schaffers, wie überhaupt der armen Leute der Umgebung, die, gleich ihm nicht motorisiert, Mühe hatten, zu den riesigen Einkaufsflächen am Stadtrand zu gelangen. In dieser Halle wollte er die Kleinigkeit an Lebensmitteln kaufen, die er sich leisten konnte. Er querte die Straße und bekam etwas zu sehen, das er zur Genüge kannte, das ihn gleichwohl eben jetzt sehr ärgerte: Vor der Halle standen zweifelhafte Gestalten beisammen, die sich nicht um das Schild scherten, welches den Alkoholgenuss auf dem Gelände untersagte. Sie standen als eine geklumpte Masse, gossen Flaschenbier in sich, bliesen Zigarettenqualm in die Umgebung, schwatzten lautstark, so, als ob es sich um lauter Schwerhörige handelte.
Er sollte, meinte er, diese da links links liegen lassen, den Einkauf erledigen, verschwinden. Doch er blieb zögernd stehen. Denn eben jetzt schmerzte ihn die Tatsache ganz besonders, dass der anrüchige Berufsstand der Blatt- und Sendungsmacher ihn und seinesgleichen mit diesen verkommenen Menschen in einen Topf warf. Nahezu einstimmig wurden er und seinesgleichen gleich denen da als Schmarotzer verlästert. Die gut geschmierte Volksverdummungs-Maschine trötete unablässig: „Ihr, die ihr hart arbeitet, sollt mit Fug und Recht das Geschmeiß verachten, das sich faul in der sozialen Hängematte wälzt und alle Fleißigen auslacht. Leicht könnte sich dieses schlaffe Pack am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen (Wer Arbeit ernsthaft sucht, wird sie finden). Doch lieber ergibt sich das Pack dem Trunke und anderen Lastern und lässt sich durchfüttern.“
Ja, man verdummte die Masse erfolgreich und besonders schlimm war, fand Wilfried Schaffer, dass so manche Schreibtischtäter in den Ämtern, ganz besonders die in der Arge, der für ihn zuständigen Unterdrückungs-Dienststelle, diese Sichtweise blindlings teilten. Das alles erfüllte ihn seit langem mit Groll, riss ihn, den Umgänglichen, jedoch nicht zu Zornes-Ausbruch hin.
Doch just in dieser Minute, da er unschlüssig stand, ging durch den Langzeit-Arbeitslosen Wilfried Schaffer ein Ruck. Klar erkannte er: übel war seine Lebenslage, übel war die Lage derer da. Er sollte sie nicht verachten, sondern brüderlich sein. Er sollte nicht Duckmäuser, sondern Aufsteher sein. Es war doch, zum Teufel, an der Zeit, die Verhältnisse zu ändern. Die Volksverdummer verunglimpften die gesamte Unterschicht als eine formlose, gärende, zerstörungswillige Masse, die niedergehalten werden müsse, sollte das Abendland nicht untergehen… Schlussfolgerung zog er. Ja, zu zerstören galt es einiges. Allerdings nicht blindwütig, sondern gezielt. Dazu war nötig, fand er, dass sich die Unteren, die Enterbten, die Ausgestoßenen, zu einem mächtigen Marschblock formten. Die Verachtung der Verachteten untereinander, das war ihm nun glasklar, nutzte nur den herrschenden Herrschaften. Die war das Schmiermittel, welches die Höllenmaschine am Laufen hielt…
So dachte plötzlich der von Wesen friedsame Wilfried Schaffer. Und er warf seine Abneigung seitwärts, wollte jetzt und hier zur Einigkeit den ersten Schritt tun, indem er den Graben, der ihn von denen da trennte, übersprang. Er schritt voran und ihm kam ihm ein kühner Gedanke, der nämlich, dass er mit der Tat, die er vorhatte eine Initialzündung auslösen könne, aus welcher bald eine mächtige Bewegung erwüchse, die durch ihre schiere Größe die herrschenden Herrschaften und deren willige Gehilfen niederwalzte…
Er steuerte die verkommene Truppe an, summte dabei eine Melodie, die aus tiefsten Tiefen seines Gedächtnisses emportauchte, jenen einst in Frankreich entstandenen Kampfgesang: „Auf, auf, Verdammte dieser Erde...“
Sein Vormarsch stockte. Diese Geruchswolke! Dieses Geschwafel! Dieses feindselige Glotzen! Der fröhliche Gruß, mit dem er hinzu treten wollte, kam nicht über seine Lippen. Denn er wurde prompt angebrüllt: „Glotz nicht so blöd, Brettermaul! Hol ne Bierrunde, zackig, sonst gibt’s auf die Fresse!“
Die Ernüchterung hätte nicht größer sein können. Um den drohenden Zusammenstoß zu vermeiden, setzte er, der Verträgliche, sich eilig ab. Beleidigungen aus schmutzigen Mündern flogen ihm hinterher. Der Funke der revolutionären Begeisterung verglimmte. Er stand wieder auf dem Boden der Tatsachen. Mit diesen Tagedieben war keine Verständigung möglich. Bitter war ihm die Erkenntnis: Eine festgefügte Unterklasse, die vereint mit der ganzen arbeitenden Bevölkerung, die unguten Verhältnisse umstürzte, lag in nebliger Ferne… Seine erste Maßnahme an diesem Tag war, da gab es nichts zu beschönigen, bevor sie stattfand, gründlich gescheitert.
Er ließ sich nicht beirren. Nichts und niemand sollte ihm den hoffnungsvollen Tag verderben. Er marschierte drauflos, stadteinwärts. Ein bestimmtes Ziel hatte er nicht vor Augen. Die großen Menschheitsfragen waren ihm jetzt und bis auf weiteres nicht wichtig. Das eigene Glück hatte Vorrang. Ob ihm dieses winken würde? Wenn nicht, durfte er doch wenigstens auf erfreulichere Begegnungen hoffen als die grad eben. Den Einkauf wollte er irgendwann irgendwo nebenbei erledigen. Träfe er Bekannte, mit denen sich gute Gespräche führen ließen, wäre das schon einmal ein kleines Glück. Denn die Einsamkeit drückte ihm augenblicklich schwer aufs Gemüt.
Er beschritt die ebenso verkehrsreiche wie menschenarme Friedrichstraße, die vormals nach Rudolf Breitscheid, einem Opfer des Faschismus, geheißen hatte. Dann nahm er die Jüdenstraße unter die Füße. Deren voriger Name, Friedrich-Engels-Straße, ist den nach Neunzehnhundertneunundachtzig maßgebenden Leuten ebenfalls unleidlich gewesen. Diese Straße, eigentlich den Fußgängern vorbehalten, von Radfahrern unberechtigt und gefahrbringend genutzt, war von Geschäften gesäumt; neben einigen Bäcker-, Fleischer-, Gemüse- Blumenläden, war die Abteilung Ramsch stark vertreten. Außerdem gab es viel Leerstand. Der Kleinhandel erlebte ja eine Dauerkrise. Schaffer fand es beklemmend, dass er auf dieser Straße so viele Rentner und so wenige Jüngere erblickte. Die Floskel vom „sterbenden Land“ kam ihm ein. Grüppchen von bejahrten Menschen standen schwatzend beisammen, saßen vor den Bäckerläden auf Klappstühlen an Klapptischen in der Sonne, bei Kaffee und Kuchen, Flachsinniges redend, so den Lebensabend genießend. Den Langzeit-Arbeitslosen beschlich ein kleiner hässlicher Neid. Weil er einschätzte, dass diese Alten den Geldmangel nicht kannten, jedenfalls nicht solch heftigen, mit dem er ständig zu kämpfen hatte. Er rief sich zur Ordnung. Er sollte diesen Leutchen ihren kleinen Wohlstand gönnen. Ihnen war schließlich nicht anzulasten, dass ein Großteil der Jüngeren zur Untätigkeit verdammt war, dass die Löhne derer, die ihre Haut zum Arbeitsmarkt tragen durften, sanken und sanken, sodass die Arbeitsfähigen, wenn sie beweglich genug waren, ihr Heil in weniger unwirtlichen Landstrichen oder gleich im Ausland suchten. Die Rentner waren nicht schuld, dass Ihresgleichen das Bild dieser Straße bestimmte. Was Schaffer an jüngeren Menschen erblickte, taugte als Futter für die Meinungsmach-Maschine. Alsda: verkommene Mannspersonen, schlampige Frauen mit verwahrlosten Kindern, gehüllt in Alkoholdunst und Tabakrauch. An zotenreißenden Schwaflern schritt er verdrossen vorüber. Schaffer war es unbegreiflich, wie man so leben konnte, vor allem, wieso diese Leute sich ein solches Lotterleben leisten konnten. Er trank auch gern einen Schluck, doch da ihm nicht einkam, zu stehlen, zu rauben, waren ihm in dieser Hinsicht Grenzen gesetzt. Die wichtigste Grenze war allerdings der gefestigte Charakter, den er sich zubilligte. Er versicherte sich, seine Rechtschaffenheit sei der Grund, dass er nicht süchtig werden könne. Was Wunder, dass er diese schmuddeligen Zeitgenossen, welche die Gesamtheit der Langzeit-Arbeitslosen in Verruf brachten, verwünschte. Er tat es still; laut zu werden, kam ihm nicht ein. Schaffer war einer, der ganz selten aus der Haut fuhr. Und übrigens kam ihm die kürzlich getroffene Feststellung wiederum ein, dass die Feindschaft der Unterklassigen untereinander nur den Herrschenden nützte. Es wäre doch Unfug, sich an diesen armseligen Nichtstuern festzubeißen. Der Schaden für die Gesellschaft, den sie stifteten, ging gegen Null. Der war verkraftbar. Es waren Schädlinge von anderem Kaliber, welche die Erde verwüsteten. Das sollte er sich stets vor Augen halten.
Ärmlich gekleidet, doch blitzsauber war eine junge Frau, auf die nun sein Auge fiel. Er durfte annehmen, dass sie von den gegenwärtigen Verhältnissen noch härter als er betroffen war. „Ein besonders unschuldiges Opfer“, meinte er. Diese Frau, die sich rührend um das kleine Kind kümmerte, das sie im Wagen schob , war sicherlich keine, die darauf erpicht war, in einer Hängematte abzuschlaffen. Doch wurden Mütter mit Kleinkindern in dieser Gesellschaft erbarmungslos vom „Arbeitsmarkt“ abgeschnitten. Er schätzte ein: „Tatkraft hat sie, beweglich ist sie, in Gegenden, wo bessere Umstände herrschen, würde sie eine anständige Arbeit finden. Doch was würde dann aus dem Kind?“ Schaffer vermerkte, wie übel es doch um ein Land bestellt war, in der das Wichtigste, die Kinder, oft genug zu einem wirtschaftlichen Unglücksfall wurden. Er erwog, der Frau Mut zuzusprechen. Allein - was konnte ihr das bringen? Womöglich würde sie glauben, dass er sie verspotten wolle, beziehungsweise sich eine dümmliche Anbaggerei erlaube. Also ließ er es bleiben.
Doch bedachte er auf seinem weiteren Weg, dass man grad im Hinblick auf solche Menschen einen Umbruch erzwingen müsste. Man müsste… und wie?
Seine Erwägungen endeten jäh, da er bemerkte: „Gefahr im Anmarsch!“ Eine Dame von der Arge, jener Behörde, die Befugnis hatte, ihm das Leben schwer zu machen, kam bedrohlich nahe. Flugs huschte er ums Eck. Wenigstens dieses kleine Glück widerfuhr ihm, dass er den Zusammenstoß mit der ihm widerwärtigen Person vermeiden konnte. Er seufzte erleichtert. Doch kam ihm unwillkürlich üble Erinnerung hoch, wie Säure aus überreiztem Magen:
Vor Tagen hatte er die Arge aufgesucht, obschon man ihn nicht einbestellt hatte. Ein Kobold musste ihn dazu verleitet und ihm die alberne Frage eingetrichtert haben, ob nicht eine Stelle, wenigstens für einige Tage... Er hatte erwartet, dass er mit „seiner“ Betreuerin würde sprechen können, die zwar keine Wunder vollbringen konnte, doch mit der immerhin gut zu reden war. Leider hatte man ihn stattdessen zu jener Beamtin gelotst. Bereits beim ersten Augenschein hatte er sie so eingeordnet: „Die ist bedrohlich wie ein Schlachtschiff.“
Er hatte den Namen seiner Zuständigen genannt, war ins Stottern gekommen „… hat sie Urlaub …ist sie krank …“ Die Entgegnung lautete: „Das geht Sie nichts an.“ Dann hatte ihn das Schlachtschiff mit einer Breitseite beschossen: „Eure Sorte, die stellt immer bloß Forderungen. Eine Vollzeit-Arbeit, wenns geht fürstlich bezahlt. Sie sind ein Problemfall, Mensch! Sie sind nachrangig. Erst kommen die Arbeitslosengeldempfänger, dann lange, lange nichts und dann erst eure Sorte.“
Er, der von Natur Ruhige, hatte sich durch tiefes Durchatmen abkühlen müssen, hatte dann die Bemerkung gewagt, mit etwas Befristetem wäre er zunächst zufrieden, nur sollte der Lohn nicht sittenwidrig niedrig... Notfalls eine Arbeits-Beschaffungs… Da war er aber an der Falschen. „ABM? Sie sind wohl größenwahnsinnig! Belästigen Sie mich nicht länger!“ Er war zwar nicht brüllend an die Decke gesprungen, doch gefährlich fauchend hatte er entgegnet: „Für Sie bin ich Müll, was!“ Da hat die Abgebrühte frech gehöhnt: „Leute wie Sie würden, wenn Sie so was wie sie Ehre im Leib hätten, für ihr sozialverträgliches Ableben sorgen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Aber nein - sowas untersteht sich, uns hart arbeitenden Arbeitsvermittlern zur Last zu fallen. Ohne Zeugen darf ich das schon mal sagen.“ Er ist sprachlos gewesen. Die Hexe hatte nachgeschoben. „Demnächst werden wir Ihre persönlichen Verhältnisse durchleuchten. Ihre Erreichbarkeit werden wir auch überprüfen.“ Er hatte der Person dann, in für ihn unüblicher Lautstärke, geraten, sie solle, anstatt ihre Nase in Sachen zu stecken, die sie nichts angingen, endlich ihre Aufgabe erledigen, nämlich anständige Arbeit für Arbeitslose besorgen. Worauf sie gekräht hatte, wenn er nicht augenblicklich verschwände, werde sie ihn, den Gemeingefährlichen, einsperren lassen. Im Abgang war ihm, dem Friedsamen, der unfromme Gedanke gekommen: „Ich hätte ihr aufs Schandmaul hauen sollen.“ Einer solchen Gewalttat stand freilich neben seiner Friedfertigkeit auch die Vernunft entgegen. Es hätte keinen Zeugen gegeben, nur Aussage gegen Aussage. Es gab keinen Zweifel, wem man geglaubt hätte und wem nicht.
Das große Glück begegnete ihm weiterhin nicht. Nicht einmal ein kleines, das in die Hosentasche passte. Er erreichte den Marktplatz, bemerkte dort einen alten, nicht aber guten, Bekannten. Die Bekanntschaft wollte er möglichst nicht aufwärmen. Leider war heute nicht Markttag; es gab keine Buden, zwischen denen er hätte abtauchen können. Es gab kein Entrinnen; der Unerfreuliche hatte ihn erspäht und steuerte ihn zielstrebig an. Schaffer fügte sich ins Unvermeidliche und tröstete sich damit, dass dieser Mensch, gemessen an dem „Schlachtschiff“, das kleinere Übel war.
Einst, bevor er, damals noch mit Familie, in die gemäß dem „sozialistischen Wohnungsbau-Programm“ hastig errichtete Südstadt gezogen war, sind sie Nachbarn gewesen. Seit je hat ihn der Drang dieses Menschen gestört, über alle alles wissen zu wollen. Und natürlich hatte er sich nicht verändert. Ohne Vorrede fragte er in der Art eines Untersuchungsrichters nach Schaffers Befinden, den Eltern, Frau, Kindern. Schaffer argwöhnte, der Fragesteller hoffe auf Lustgewinn durch Schadenfreude, indem er in offene Wunden stach. Er gab sich zugeknöpft: „Selber: will nicht klagen. Eltern: unter der Erde. Frau: im Guten getrennt. Kind: hängt an mir.“
„Hast du noch Arbeit?“
Da war sie wieder, die geschmacklose Frage. Geradezu lügen wollte er nicht. Er entgegnete, die Aussichten seien gut, er habe vielversprechende Bewerbungen laufen, es könnte gut sein, dass er zwischen mehreren Angeboten eine Auswahl würde treffen müssen. Ein unausgegorener Gedankensplitter wurde wörtliche Rede. „Ich werde nebenher in der Redaktion der Heimat-Zeitschrift mitarbeiten. Ich kenne mich in der Heimatgeschichte aus, in der Schulzeit bin ich ein hervorragender Aufsatz-Schreiber gewesen.“ Gewichtig erklärte er: „Ich denke, ich werde dort mitbestimmen, wo’s langgeht.“
Da hatte er etwas angerichtet mit dieser ihm wesensfremden Großspurigkeit. Der Mensch lachte lauthals, fragte, wer ihm diesen Floh ins Ohr gesetzt habe. Die Blattmacher – ehemalige Lehrer, Referenten und dergleichen, Ruheständler jedenfalls - seien ein geschlossener Kreis, in den sie keinen Fremden eindringen ließen. „Die machen es aus Spaß, ihr Zeug wird gedruckt und gut ist. Denen geht es nicht um Geld; sind alle gut versorgt.“
Schaffer schätzte ein: „so wird es wohl sein“. Doch dumm dastehen wollte er nicht, darum flunkerte er: „Man hat schon bei mir angefragt. Klasse setzt sich durch.“ Der einstige Nachbar blickte ihn schräg an. Schaffer gab zur Kenntnis, gleich habe er Termin in dieser Angelegenheit, Den wolle er nicht versäumen. Er empfahl sich mit knappem Gruß.
Da er es für wahrscheinlich hielt, dass der taktlose Zeitgenosse recht hatte, verwarf er den Einfall, an die Bürotür der Blattmacher zu klopfen. Eine Arbeit ganz ohne Lohn konnte und wollte er sich nicht leisten.
Wilfried Schaffer würde leidlich zufrieden sein, wenn es wenigstens Gelegenheit für gute Gespräche gäbe. Immerhin – es gab eine Begegnung, die seine Stimmung nicht weiter eintrübte. Er traf einen Bekannten, der kein schlechter Kerl, doch ein Schwätzer war. Der ließ sich wortreich darüber aus, wie sehr ihn das Zusammentreffen beglücke, setzte an, sich über Leute und Dinge, die Schaffer gleichgültig waren, weitschweifig zu verbreiten. Schaffer war nicht in Eile, gleichwohl schmeckte ihm diese Art von Unterhaltung nicht. Er eiste sich wieder mit der Ausflucht los, dass er wegen einer wichtigen Besorgung in Eile sei. Leutselig war der Schwätzer, gab ihm ein Taschenfläschchen Kräuterlikör „Erichs Rache“ mit auf den Weg, erklärte dazu: „Der Kerl ist uns damals auf den Magen geschlagen. Nun, wo er tot ist, nützt er gegen Magendrücken, das von ganz anderen Sachen kommt, als damals.“
Der Beschenkte kämpfte gegen die Versuchung, sich den Magentrost auf der Stelle einzuverleiben. Dabei war das Bild auf dem Schildchen hilfreich - ein Zerrbild, doch unverkennbar der trunksüchtige, verbohrte, einstige Generalsekretär, der ihm seinerzeit unausstehlich gewesen ist.
Es ging auf Mittag. Gab Schaffer den Tag verloren? Nein, noch lange nicht. In seine Wohnung, die er für unwohnlich hielt, wollte er so bald nicht zurückkehren. Er hielt es für besser, Stadtstreicher zu bleiben. Nicht zuletzt hatte er einzukaufen. Ihn beschäftigte stark das Fläschchen in seiner Tasche, gemeinhin Spaßmacher, Taschenwärmer und anderswie liebevoll, in früherer Zeit auch Sputnik geheißen. Wie es ihm die Tasche beschwerte! Er bekämpfte die Versuchung, sich den Magentrost einzufüllen, indem er sich mittels Geschichts-Betrachtung ablenkte. In der Klosterstraße, an der Rückwand des einstigen Gasthofs „Zu den dreyen Schwanen“, hing eine gusseiserne Tafel, die darauf hinwies, dass sich in diesem Haus im Jahr Siebzehnhundertvierundneunzig die Herren Friedrich Schiller, Christian Gottfried Körner und Jakob Grimm getroffen hatten. Er stellte fest: „Weißenfels ist einst nicht ohne Bedeutung gewesen.“ Unweit, auf der anderen Straßenseite, gab es eine weitere Tafel mit dem Vermerk, dass der einst geschätzte, inzwischen vergessene, Dramatiker Adolph Müllner, dort gewohnt hatte. Der dichtende Anwalt, kein großes Genie, war in wirtschaftlicher Hinsicht freilich das genaue Gegenteil des Langzeit-Arbeitslosen Wilfried Schaffer. Ein mit Geld und Gut wohl versehener Rappelkopf; vielleicht war sein hitziges Wesen Ursache, dass er kein langes Leben hatte. Immerhin, er ist weit älter geworden, als sein ruhmreicher Kollege Hardenberg, der sich Novalis nannte, auch in dieser Straße wohnte und starb. Sich dem Novalishaus nähernd, erinnerte sich Schaffer, dass es in diesem Haus, außer der städtischen Leihbücherei und einigen Büros der Stadtverwaltung, eine kleine Gedenkstätte gab, wo der Literatur-Verein mit dem Namen des Dichters seinen Sitz hatte. Wie, wenn er dort anklopfte, sich als einen Geschichts- und Literatur-Begeisterten vorstellte, willens und in der Lage, für den Verein zu arbeiten? Er trat auf den Hof, dann durch die Hintertür des Vorderhauses, setzte den Fuß auf die Treppe, da nahmen die Zweifel überhand. Falls das Vereinsbüro überhaupt besetzt war – wie würde man ihn empfangen? Üblicherweise schaute man ihn an, wie man Leute anschaut, denen ihre Nachrangigkeit auf die Stirn geschrieben ist. Nein, grad jetzt hatte er kein Verlangen, sich der Verachtung der Bessergestellten preiszugeben.
Glücks-Schimmer zur Mittagszeit
Wilfried Schaffer kam darauf, das Grabmal des Namensgebers von Verein und Haus aufzusuchen, das sich in der Nähe, am Rand des Stadtparks, in einem mit Gitterwerk aus Schmiede-Eisen eingezäunten Bereich befand. Grad nebenan lag das Grab des verloschenen Sterns Müllner. Schaffer schätzte ein, dass der Novalis sich diese Nachbarschaft verbeten hätte, wäre ihm Einspruch möglich gewesen. Es gab im Hag, an einem Rest der einstigen Stadtmauer befestigt, eine riesige Steinplatte mit den Lebensdaten der Familie des Novalis, den Hardenbergs, einer adligen, wohlhabenden, gleichwohl unglücklichen, Sippe. Novalis und seinen Geschwistern war gemeinsam, dass sie jung starben. Der Dichter, mit seinen Siebenundzwanzig, ist vergleichsweise langlebig gewesen. Mit der ewigen Ruhe war es auch nichts. Man hatte den einstigen Totenacker im Stadtgraben im Lauf der Zeit um und umgestaltet, Gebeine umgebettet; ob das Skelett des Dichters unter seiner steinernen Büste lag oder woanders, war nicht gewiss.
Der unermüdliche Fußgänger fühlte Schwäche, die ihn zum Niedersetzen zwang. Sein Magen ließ ein Knurren vernehmen. Er hatte nichts Essbares dabei, nur ein Getränk, das Fläschchen. Sollte er oder besser nicht? Er rang nicht lange mit sich, gab der Versuchung nach. Wozu das Zeug noch länger spazieren tragen. Hinein!
Das Knurren hörte auf. Ein wohliges Gefühl durchrann ihn. Leider hielt es nicht vor. Müde fühlte er sich und mutlos. Wieder wurde ihm scharf bewusst, dass er in einer Sackgasse war, in die eine feindselige Gesellschaft ihn abgeschoben hatte. Im Augenblick fühlte er sich so schwach, dass er meinte, sich von der Parkbank nie wieder erheben zu können.
Plötzlich blitzte ein sonnenheller Funke auf. Unten, auf der Nikolaistraße, schritt, sehr weiblich, eine Kellnerin namens Birgit Frey, seine heimliche Flamme. Ihr Anblick verjagte seine Schwäche. Sollte er ihr nachgehen? Er unterließ das. Nicht Schüchternheit hemmte ihn, sondern Taktgefühl. Ihm, in seiner Lage, so meinte er, stand nicht an, von Liebe zu träumen. Gesetzt den Fall, Birgit erhörte ihn, würde sich mit ihm verbandeln – was könnte anderes daraus entstehen, als dass er sie mit sich ins Verderben zog? Sie war gewiss eine achtbare Frau, die ein unglückliches Leben mit einem Langzeit-Arbeitslosen namens Wilfried Schaffer nicht verdiente. Ja, wenn er besser dastünde, dann… Leider war die Wahrscheinlichkeit dieser Besserung so gering wie die, dass der Kriegsverbrecher Bush guten Endes vor ein Gericht gestellt würde. Er grollte. Unhaltbar war doch dieser Zustand, der ihm Enthaltsamkeit aufzwang. Keine Liebe möglich, aber auch nicht der Notbehelf, Verkehr gegen Geld. Leistete er sich diesen, müsste er tagelang hungern. Wie aber war der Zustand zu ändern?
Da war nichts als ein großes Fragezeichen.
Ein alter, hinfällig ausschauender, Mann, dem der linke Arm fehlte, nahm neben ihm Platz. Warum? Leere Bänke gab es genug. Der Mann kam ihm irgendwie bekannt vor; er kramte in seinem Gedächtnis, doch dieser Alte steckte in keiner Schublade. Der Einarmige überfiel ihn mit einer Frage: „Sind Sie für den Frieden?“ Was sollte das? „Selbstverständlich“ antwortete Schaffer mürrisch. Der Einarmige belehrte ihn: „Der Frieden ist das Wichtigste.“ Das wollte Schaffer durchaus nicht bestreiten. Doch das Nachfolgende fand er zweifelhaft. „Der Frieden muss um jeden Preis erkämpft werden.“
Das einst gängige Gerede vom Friedenskampf hatte ihn immer gestört. Kampf und Frieden, wie passte denn das zusammen? Dazu um jeden Preis! Der friedfertige Schaffer hatte Lust auf Widerspruch. Pazifismus in Reinkultur bedeutete doch, im Fall des Falls ließ man sich widerstandslos abschlachten. Gleichwohl schwieg er, aus Ehrfurcht vor dem Alter. Der Einarmige hingegen gab sich redselig wie zu einem guten alten Bekannten. Man hatte ihn im Zweiten Weltkrieg, kurz vor dem Zusammenbruch, zur Wehrmacht eingezogen. Er hatte Glück, geriet unversehrt in Gefangenschaft. Die ist ihm unerträglich gewesen. Darum war er in die französische Fremdenlegion eingetreten. Die Legion als Ersatzmutter. Er hatte wieder Krieg spielen müssen. Auf einem Flugzeugträger wurde er über die Weltmeere geschippert. Die Wechsel zwischen den Klima- und Zeitzonen hatten ihn zermürbt. Auf der Insel Madagaskar wurde die Truppe angelandet, mit dem Auftrag, den Aufruhr in dieser Kolonie zu bekämpfen. Dort hatte er seinen linken Arm eingebüßt.
In Wilfried Schaffers Kopf klickte es. Ja, klar, vor vielen Jahren hatte er die Geschichte schon einmal gehört. Man hatte beim Bier zusammengesessen. Er hatte eine Arbeit und einigermaßen guten Verdienst gehabt, das Bier ist billig gewesen, wenn auch nicht schmackhaft. Die Erzählung dieses bemerkenswerten, nicht beneidenswerten, Schicksals hatte ihn beeindruckt. Und er hatte damals den nicht Beneidenswerten beneidet, weil der vom französischen Staat eine monatliche Rente erhielt. Die war nicht hoch, doch wurde in Franc gezahlt. Wie gern hätte auch der junge Werktätige „frei konvertierbare Währung“ in Händen gehabt. Ein blödsinniger Neid ist das gewesen. Blut und Körperteil gegen Geld, in welcher Währung auch immer – was für ein schlechtes Geschäft!
Der Alte sprach, seinen Kernsatz bekräftigend: „Ihr Jungen solltet das Glück schätzen, euer Lebtag in Frieden zu verbringen. Der Friede muss erhalten bleiben, koste es, was es wolle.“ Schaffer hielt nun doch Widerspruch für nötig. Er merkte an: „Von Frieden kann man eigentlich nicht reden. Denken Sie an Afghanistan, zum Beispiel. Auch unsere Landsleute sind dort zugange, freiwillig zwar, für auskömmliche Bezahlung …“ Der Einarmige fiel ihm erzürnt ins Wort: „Die sich dafür hergeben, sind Verbrecher. Diejenigen, die die jungen Männer dorthin schicken, sind Erzverbrecher.“ Schaffer nickte, obwohl er den ersten Teil der Aussage übertrieben fand. Er hatte Weiteres zu sagen: „Mit dem Frieden im Land ist es nicht weit her. Die Schikanen der Behörden gegen die Arbeitslosen – recht bedacht ist es ein Krieg der Reichen gegen die Armen. Unter solchen Bedingungen kann man doch nicht Pazifist sein. Dagegen muss man doch kämpfen. Nicht Amboss, sondern Hammer sein.“ Schaffer, der Friedfertige, wunderte sich nicht wenig über sich selbst, dass er sich so kämpferisch gab, dass ihm ein abgedroschener Spruch aus der Zeit des real existierenden Sozialismus über die Lippen kam. Er setzte sogar eins drauf: „Wir haben nichts zu verlieren, als unsere Ketten. Wir fürchten den Tod, aber noch mehr fürchten wir unser elendes Leben.“ Das kam nicht aus seinem Inneren. Das hatte er irgendwo aufgeschnappt. Überhaupt war es, das wusste er selber, nur leeres Gerede, aus Widerspenstigkeit gegen diesen Oberlehrer, der meinte, die Wahrheit gepachtet zu haben.
Der Alte schüttelte seinen fast kahlen Kopf. „Ihr jungen Leute habt kein Recht, euch zu beklagen. Ihr habt es doch gut getroffen, auch wenn ihr nicht in Saus und Braus lebt. Wir Alten haben das Kriegs-Elend bis zur Neige ausgekostet.“ Wilfried Schaffer verkniff sich weiteren Widerspruch. Zu seiner Erleichterung kam ein Mensch heran, ungefähr seines Alters, an dem die große Hornbrille sowie das in Wirbeln stehende Kopfhaar auffiel. Der führte den Alten hinweg.
Gedanklich noch mit dem Vorkommnis beschäftigt, bekam Schaffer neue Gesellschaft. Einen Mann, den er auf Mitte Fünfzig schätzte. Ihm schien Misstrauen angebracht, denn dieser Mensch sah nach „Besserverdiener“ aus und roch auch so. Wahrscheinlich war er vom Westen. Der Mann sprach ihn an, wollte wissen, ob er in dieser Stadt wohne. Die Frage beantwortete er einsilbig. Der Besserverdiener nickte erfreut. Er kam sogleich mit einem Anliegen, das immerhin verriet, dass er sich für keinen Besserwisser hielt: „Ich tät gern dies und jenes über meine frühere Heimatstadt und das Drum und Dran erfahren. Bin fremd geworden mittlerweile. Meine Familie ist, kurz vor dem Mauerbau, nach Westen geflüchtet.“ Schaffer erwiderte: „Da waren Sie in zahlreicher Gesellschaft.“ Der Westler nickte. Er schlug vor: „Wenn es Ihnen nichts ausmacht, könnten Sie mich herumführen, bissel was zeigen, erklären. Sie schauen mir aus, als ob Sie Bescheid wüssten.“
Das konnte Lob sein oder Spott. Dass Schaffer schwieg, deutete der Westler offenbar als Geldfrage. Er kündigte an: „Es soll Ihr Schaden nicht sein.“ Schaffer, der kein Blender war, gab zu bedenken: „Ein geprüfter Fremdenführer bin ich nicht.“
Der Fremde winkte ab. „Wichtig ist nicht das Diplom, sondern der gesunde Menschenverstand. Also, wie ist es. Zeit werden Sie wohl über haben.“ Zeit über, so, so. Das war wohl Spott und hieß: „Wär ich nicht gekommen, tätst du dich den ganzen Tag in der sozialen Hängematte suhlen.“ Ein so verziertes Angebot misshagte ihm. Rundweg abschlagen wollte er es gleichwohl nicht. Argwöhnisch erkundigte er sich: „Wie viel Zeit haben Sie mitgebracht und an welches Geld dachten Sie?“ – „Würd sagen, eine halbe Stunde, zwanzig Euro – Leider bin ich etwas unter Zeitdruck.“
Das war Musik für den gebeutelten Arbeitslosen. Mit einem Nicken besiegelte er den Vertrag. Der Fremde sagte munter: „Na dann, frisch fromm fröhlich frei. Lage, Aussichten, Geschichtliches und so.“
Schaffer hielt einen kleinen Seitenhieb für nötig. Er streckte die Hand aus und sagte: „Einen Fünfer als Vorschuss bitte. Man hat seine Erfahrungen.“
Der Westler schien Misstrauen gewohnt zu sein. Er lachte: „Sie sind ein Schlitzohr“ und reichte den kleinen Schein. Der Langzeit-Arbeitslose Wilfried Schaffer stellte froh fest, dass nun also ein kleines Glück über ihn gekommen war. Er konnte mit jemand reden. Und er war ein Wichtiger geworden, wenigstens für kurze Zeit. Er setzte eine Zielvorgabe: „Machen wir also einen Rundgang entlang der einstigen Stadtmauer.“ Los ging‘s, zunächst durch den leicht ansteigenden Park, der einst Stadtgraben war, mit den Resten der Stadtmauer zur Linken, entlang dieser bog man links ab. Der Führer verwies auf die beiden Türme, die von der einstigen Befestigung übrig waren, ließ wissen, dass deren einer „Pulverturm“ hieß. Dann lotste er seinen Mann ein Stück die Zeitzer Straße aufwärts, sagte dies und jenes zum links aufragenden Schloss, auf welche Weisen man es in der Vergangenheit genutzt hatte, über den gegenwärtigen Zustand und die Pläne, es aufzuhübschen. Anschließend schritt er ums Eck, die steile Schlossgasse abwärts, das Schloss zur Linken. Der einstige Verlauf der Stadtmauer war hier gut sichtbar. Obwohl der Führer, innerlich grinsend, immerzu zügig ausschritt, hielt der Geführte Schritt, mühelos, wie es schien, jedenfalls maulte er nicht. Schaffer fühlte sich frisch, trotz seines leeren Magens. Das Gefühl, eine Aufgabe zu haben, stärkte ihn. Er breitete unentwegt Tatsachen aus, gab Erklärungen, teilte auch Strittiges mit, Ungeklärtes, das er als ernsthafter Geleitsmann auch als unklar benannte. Das Zweifelhafte gab er nicht für unbestreitbar aus. Er, der in der heimatlichen Geschichte Belesene, haspelte vieles ab, auf die Gefahr hin, dass dem Geführten der Kopf brummte, beispielsweise: „Stadtgründung beglaubigt Elfhundertfünfundachtzig, es muss das Nest gleichwohl lange vorher gegeben haben. In früherer Zeit von einiger Bedeutung, da an der wichtigen Handelsstraße Via Regia gelegen. Die gute Verkehrs-Anbindung war in Kriegszeiten ein Unglück, so beim großen Hussitenzug Vierzehnhundertdreißig, dem die Vorstädte zum Opfer fielen; laut einem Nazi-Artikel im Heimatblatt sollen die Juden den Böhmern die Tore geöffnet haben. Dürfte Hetze gewesen sein.“ Und: „Im Zweiten Weltkrieg war hier für ein paar Stunden Kriegsgebiet, April Fünfundvierzig, als der Faschisten-Spuk schon so gut wie vorbei war. Letzte Zuckungen des Lindwurms, sozusagen.“ Weiterhin: „Die Stadt war in Kriegen immer mal wieder Brennpunkt, es gab Schlachten im Umkreis, auch entscheidende, alsda: Hohenmölsen Tausendachtzig, Lützen Sechzehn Zwounddreißig, Rossbach Siebzehn Siebenundfünfzig, Jena, Auerstädt Achtzehn Null Sechs, Großgörschen sowie Leipzig Achtzehn Dreizehn.“ Auch bemerkte er: „Die Weißenfelser hätten auf die geballte Kriegsgeschichte im näheren Umkreis bestimmt gern verzichtet.“ Der Geführte, staunend, lobte: „Sie sind ja ein historisch Beschlagener.“
Die sogenannte Promenade schritt man entlang, wo sich die Bus-Haltestellen aneinander reihten. Schaffer wusste zu berichten, dass es vor der großen Krise Ende der Zwanzigerjahre des Zwanzigsten Jahrhunderts in der Stadt an hundertdreißig Schuhfabriken gegeben hatte, dass nachher, im sogenannten Realsozialismus, ein riesiges Kombinat mit Tausenden Beschäftigten die städtische Schuhfertigung vereinte, dass aber seit etlichen Jahren hier gar keine Schuhe mehr gefertigt wurden, wie denn überhaupt die Industrie der Stadt fast abgestorben war. Der Geführte, dem letztere Feststellung sichtlich unangenehm war (fühlte er sich mitschuldig?) äußerte: „Der Realsozialismus musste auf dem Schutthaufen der Geschichte landen, zwangsläufig. Gleichwohl hätte man manches vernünftiger regeln können.“
Diese Äußerung hätte Schaffer unterschreiben können, doch aus diesem Mund gefiel sie ihm nicht. Er ließ sich aber nicht darüber aus, sondern schilderte die Entwicklung der städtischen Bevölkerung. „Zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts wohnten hier reichlich zweitausend Menschen, der Dreißigjährige Krieg wirkte immer noch nach, Tiefpunkt war Sechzehn Neununddreißig mit neunhundertsechzig Bewohnern, dann, mit Unterbrechung durch den Siebenjährigen Krieg, stetiger Anstieg, Zehntausender-Marke geknackt Mitte Neunzehntes Jahrhundert, Neunzehn Neunundzwanzig Vierzigtausend, Höchstmarke Neunzehn Sechsundvierzig infolge Zustroms von Ausgebombten und Vertriebenen: über Zweiundfünfzigtausend. Seitdem bevölkerungsmäßig Abwärtsbewegung, Flucht vieler Enttäuschter nach dem Westen, als es die „Mauer“ noch nicht gab. Mitte der Sechziger: Wohnungsbau eingestellt bis Mitte der Achtziger, Wegzug vieler Leute nach der „Chemie-Arbeiter-Stadt“ Ha-Neu, wo Betonblöcke aus dem Boden gestampft wurden.“ Der Geführte warf erstaunt ein: „Wie denn, Leute aus Weißenfels sind nach Vietnam gezogen?“ – Schaffer griente überlegen. „Ha-Neu war die Abkürzung für Halle-Neustadt, genannt Heimstatt der Chemie-Arbeiter, Stadt der Zukunft. Die Wohnungen waren begehrt, trotz der hellhörigen Wände und der öden Umgebung. Fernheizung und so. - Ab Neunundachtzig dann Massenflucht, dort wie hier. Inzwischen hat Weißenfels die Dreißigtausender-Marke nach unten durchbrochen. Um das zu vertuschen, sollen die Dörfer ringsum eingemeindet werden.“ Er äußerte sich über auffällige Gebäude: Das Schloss, auf unsicherem Grund gebaut, deshalb gefährdet von Anfang an, das Haus, in dem der Tonsetzer Heinrich Schütz seine letzten Jahre verbringen wollte, doch sein Herr, der sächsische Kurfürst, scheuchte ihn hoch aus der Altersruhe. Das Geleitshaus, in dem der berühmteste der Könige Schwedens ausgeweidet wurde, das Novalis-Haus, in dem der romantische Dichter sein Ende fand.
Der Geführte begehrte zu wissen, wie die Stadtmauer verlief. Schaffer erklärte: „Die halbe Strecke haben wir bereits bewältigt. Dann von dieser Promenade links weg zwischen Kaland- und Dammstraße, also ein Stück abseits der Saale, wohl wegen der Überschwemmungs- Gefahr, nachher zwischen Saal- und Friedrichstraße, über die Nikolaistraße, wo nahe der Fußgänger-Ampel das Nikolai-Tor stand, zum Stadtgraben beziehungsweise Stadtpark, womit der Ausgangspunkt wieder erreicht wäre.“ Er merkte noch an: „Dort vorn, bei der Fußgängerbrücke, die es in früheren Zeiten nicht gab, war ein Durchgang in der Mauer, Kuttelpforte genannt. Durch diese Pforte gingen die Fleischer mit ihren Schlacht-Abfällen, Gedärm und so weiter, um das Zeug dann in die Saale zu kippen. Die Umwelt-Verschmutzung hat also eine lange Geschichte.“
Der Westler sprach: „Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen. Mich hindern leider dringende Geschäfte, den Rundgang zu vollenden. Ich würde auch ganz gern kreuz und quer durch die Stadt gehen, mit Ihnen als Führer, aber leider… Es hat sich viel verändert.“ „Na“, dachte Schaffer, „wird jetzt kommen: halbe Leistung, halbes Geld?“
Die Sorge war unberechtigt. Der Mann zahlte prompt den vereinbarten Lohn. Und gab von sich preis: „Plattner ist mein Name. Ich wohne im Hotel Jägerhof.“ Schaffer stellte sich ebenfalls knapp vor. Herr Plattner nannte ihre Bekanntschaft angenehm und erklärte: „Eine ausführliche Führung wäre mir lieb gewesen. Da es sich nicht ergeben hat, schlage ich vor...“ Er stockte, fragte: „Sie haben doch im Schriftlichen Übung oder?“
Schaffer fragte sich, „hat auch er das Vorurteil, Ostler gleich Analfabet?“ Er antwortete: „Ich habe in der Schule nicht gefehlt, als das Schreiben dran war. Gelegentlich nutze ich diese Fähigkeit.“
Der Herr Plattner bemerkte den Spott nicht oder ging darüber hinweg. Er verkündete: „Ich schlage vor, dass Sie, in aller Ruhe, ein paar Sachen aufschreiben, was Ihre Stadt betrifft, die einst auch meine gewesen ist. Alles, was Sie für bemerkenswert halten. Ich setze Vertrauen in Sie. Ihre Redeweise sagt mir zu, daraus schließe ich auf Ihre Schreibweise.“
Schaffer wusste nicht, was er von dem Vorschlag halten sollte. Plattner ergänzte: „Es soll Ihr Schaden nicht sein. Ich dachte, Pi mal Daumen gepeilt – je nach Umfang der Arbeit, ich sag mal, bei hundert Din-A-4-Seiten, etwa...“ Es war keine astronomische Zahl, doch dem armen Schaffer wurde fast schwindlig davon. Plattner meinte dann noch: „Den Dichter Novalis sollten Sie mit ein paar Seiten würdigen. Der kommt wieder in Mode, scheint mir.“ Ferner ließ er durchblicken, dass, wenn der Text es hergäbe, ein Buch gedruckt würde, was dem Verfasser ein zusätzliches Einkommen, dazu eine gewisse Bekanntheit, einbringen würde. „Ich bin nicht ganz ohne Einfluss. – So nun muss ich aber, die Termine….“ Er überreichte dem Stadtführer eine Visitenkarte und wünschte seine Rufnummer zu erfahren. Wilfried Schaffer merkte gallig an, dass er mit einer Visitenkarte leider nicht dienen könne und kritzelte seine Nummer auf ein Stück Papier. Der Westler nickte leutselig. Schaffer argwöhnte, der Mann könnte denken: „Dem Kerl hat man den Anschluss gekappt, wegen nicht bezahlter Rechnungen...“ Wie nun, hatte er Grund, sich zu freuen? War es ein ernst gemeintes Angebot? Ob oder ob nicht, fest stand, es war der unglaubliche Fall eingetreten, dass er am Monatsletzten einen Zwanziger in der Hand hatte, mit eigener Hand verdientes Geld. Er berichtigte sich: „Mit eigenem Mund verdient.“
Erst als Plattner gegangen war, fiel ihm ein, dass er nichts Schriftliches in der Hand hatte. Also, ihn anrufen, es nachfordern? Es wäre ein Treppenwitz.
Es war also doch nicht ein Tag wie jeder andere. Einen kleinen Erfolg hatte er errungen. In der schäbigen Kaufhalle hinter den Bushaltestellen, die einst, in den Achtzigern, das Aushängeschild des „sozialistischen Einzelhandels“ gewesen war, holte er, wie geplant, Brot, etwas abgepackte Wurst und ebensolchen Schnittkäse. Und - schließlich durfte er sich nach getaner Arbeit etwas Vergnügen gönnen - eine Flasche Rotwein und zwei Flaschen Bier. Sein Hunger war nicht gering, doch knall und fall fasste er den Vorsatz, an diesem Tag nichts mehr zu essen. Denn er meinte, Fasten kläre die Gedanken. Was die Getränke betraf - warum sollte er denen entsagen, da er sich doch einen tüchtigen Schluck verdient hatte. Freilich, das Trinken konnte, zumal auf leeren Magen, die Gedanken vernebeln, vielleicht aber auch beflügeln, die Einbildungskraft stärken. Diese Art Stärkung dürfte ihm nützlich sein, könnte ihm, ja warum denn nicht, vielleicht doch einen Ausweg aus der Notlage zeigen. Das Angebot des Westlers Plattner konnte keine wirkliche Rettung sein, doch immerhin. Er sollte die Sache gründlich bedenken. Wenn er sich entschlösse, für Plattner zu arbeiten, dann gewissenhaft, wie es seine Art war. Ob er tatsächlich angemessen entlohnt würde? Dieser Mensch schien gut betucht zu sein. Den Eindruck eines windigen Burschen machte er nicht. Jedenfalls war eine Schrift über die Stadt Weißenfels eine Aufgabe, die ihn reizte. Es wäre eine ausfüllende Tätigkeit, die Aktenstudium erforderte, sollte das Geschreibsel Hand und Fuß bekommen. Zum Beispiel würde er das Stadt-Archiv aufsuchen müssen. Ihm kam unangenehme Erinnerung. Vor einiger Zeit hatte er, wissbegierig in Sachen Heimatgeschichte, dort hinein gehen wollen, mit Hinblick auf die Macher des Heimatblatts, denen er sich vielleicht als Mitmacher anbieten wollte. Schon dass er Gebühr entrichten musste, war ärgerlich. Noch ärgerlicher war, dass die Angestellte, welche die Gebühr einzog, ihn über den Grund seines Kommens bohrend ausfragte. Er hatte sie daraufhin mir schwülstigen, wissenschaftlich klingenden Redensarten abgefertigt, sie hatte den darin liegenden Spott nicht verstanden. Und ernüchternd war, dass man ihm nur einen Teil der gewünschten Dokumente auf den Tisch geklatscht hatte, darunter immerhin das Tagebuch eines Goldschmieds namens Brembach. Man tat es mit großer Herablassung, mit unmissverständlicher Geste und Miene: Einer wie du darf hier eigentlich nicht studieren, nur aus unermesslicher Gnade… Als er fortging, hatte er einen erleichterten Seufzer zu hören gemeint.
Gespenstisches, Walpurgis-gemäß
Wilfried Schaffer leerte eine Bierflasche. Nun war er fest entschlossen, das Wagnis Schreiben für Plattner einzugehen. Also ran! Zwar nicht sofort. Er hatte an diesem Nachmittag nicht Lust, sich an den Schreibtisch in seiner trostarmen Wohnung zu setzen. Vielmehr sollte er den Rest des Tags weiter nach Glück suchen. In seiner Lage eine Gelegenheit, die sich womöglich bot zu versäumen, wäre sträflich…
Unterwegs kamen ihm Gedankensplitter in Sachen Schreiberei ein. Er riss von der Papiertüte, in der das Brot steckte, einen Fetzen, kritzelte darauf Stichpunkte, während er die Leipziger Straße unter die Füße nahm. In Marktnähe gab es einige prächtig aufgefrischte Barockhäuser, weiter draußen herrschte Trostlosigkeit: schmucklose Altbauten, zwischen denen Lücken klafften. Nachher war da nur noch Lücke und weiter gar nichts. Einst ist die Straße von kleinen Häusern dicht gesäumt, sind die Häuser stark bevölkert gewesen. Nun war das Gelände Parkplatz und nichts sonst. Im zweiten Weltkrieg hatte die Stadt zwar ihre Brücken, doch kaum Gebäude eingebüßt. Doch danach hatte sich der Verfall rasch und rascher vollzogen. Abriss war billiger als Instandsetzung. Am Ende der riesigen Brache, dicht an der Saale, gab es ein beliebtes Gasthaus, letzter Rest der einst langen Zeile kleiner Fischer-, Handwerker- und Krämer-Häuser. Das Gasthaus war wie eine Oase in der Wüste.
Da ihm die Ödnis hierorts missfiel, erstieg Schaffer die Anhöhe, die das Saaletal begrenzte, Klemmberg genannt. Er nutzte die Treppe aus zweihundert Stufen, die, vordem ganz verfallen, inzwischen im Rahmen einer „Arbeits-Beschaffungs-Maßnahme“ aufs Feinste erneuert worden war. Obwohl die Menschen, die als Teilnehmer von „Arbeits-Beschaffungs-Maßnahmen“ von den „Besserverdienern“ und auch von vielen Geringverdienern des „ersten Arbeitsmarkts“ herzlich verachtet wurden, hätte Schaffer dabei gern mitgetan, allein - er war nicht „zugangsberechtigt“.
Die zweihundert Stufen strengten den Ermatteten an; oben musste er tief durchatmen. Seinen Hunger nahm er kaum wahr, doch Durst plagte ihn. Während er vom nahen Aussichtspunkt Blicke auf die Dächer der inneren Stadt warf, leerte er die zweite Bierflasche.
Dabei bescheinigte er der Gebäude-Anhäufung namens Weißenfels nochmals, dass diese nicht immer grau und unbedeutend gewesen ist. In der Mitte Mitteldeutschlands gelegen, hatte das Städtchen lange Zeit etwas Geltung besessen. Immerhin war es über Jahrzehnte Residenzstadt eines nachrangigen sächsischen Herzogtums gewesen, hatte zuvor gelegentlich den Hof des sächsischen Kurfürsten beherbergt. Mit der Zeit war die Stadt aus den Nähten geplatzt; im neunzehnten Jahrhundert hatte man die Stadtmauer abgerissen, die Tore geschleift. Der wachsende Verkehr auf den wichtigen Straßen, die durch die Stadt führten, hatte deren Erweiterung erfordert. Industrie war gediehen, Menschen waren in die Stadt gezogen; wildes Bauen hatte die lieblichen Hügel des Umlands überwuchert. Im zweiten Weltkrieg hatte Weißenfels nur wenige Gebäude durch Luft-Angriffe verloren, doch ist die Stadt kurz vor dem Ende noch Kampfplatz gewesen, wusste Schaffer. Da den Soldaten der Wehrmacht längst klar war, das „tausendjährige Reich“ war unrettbar verloren, hielt sich ihr Heldenmut in Grenzen; es gab nur wenig Schießerei, ein paar Häuser fielen in Schutt. Allerdings wurden, wie in den Kriegen der Vergangenheit, die Brücken zerstört. Weil der Verlust an Wohnraum gering war, wurde die Stadt von den Oberen der „Arbeiter-und-Bauern-Macht“ als Notheimat für Tausende Entwurzelte aus dem verlorenen Osten und den zerstörten Großstädten bestimmt. Nach und nach waren, gemäß den Planvorgaben, am Stadtrand Wohngebiete aus vorgefertigten Bauteilen entstanden, wodurch die Stadt sich immer weiter ins Umland geschoben hatte, während ihr Inneres verwahrloste. Heiß begehrt sind die Wohnungen in den kantigen Blöcken gewesen, wegen der besseren Zufuhr von Licht und Luft im Vergleich mit den alten kleinfenstrigen Häusern. Wenn man Glück hatte, war der Block, in dem man nun wohnte, zentral beheizt. In der Altstadt fielen Baudenkmäler reihenweise der Abrisswut zum Opfer. In den letzten Jahren der kleinen Republik hatte, wegen der beschleunigten Entvölkerung, der Verfall auf die Vorstädte übergegriffen. Dieser hatte sich nach ihrem Untergang noch verstärkt, da die Industrie verschwand. Der Betrachter Schaffer fand, Weißenfels sei eine sterbende Stadt.
Weiter marschierte er, talwärts, stadtauswärts, unterquerte die mächtige Brücke der Umgehungsstraße. Das Dorf Burgwerben am anderen Ufer wirkte gefällig mit den roten und dunkelgrau glänzenden Dächern. Der Lärm der Fahrzeuge auf der Brücke hingegen störte ihn sehr. Als er sich so weit entfernt hatte, dass ihm der Geräusch-Anprall erträglich war, setzte er sich ins Gras, nahm einen großen Schluck aus der Rotweinflasche und schlief ein.
Als Schaffer erwachte, glaubte er zunächst an einen absonderlichen Traum. Er gewahrte lächerlich gekleidete, Grimassen schneidende, Kinder, die ihn umtanzten. Eins hatte eine goldgelbe Pappkrone auf und einen mit Goldbronze überzogenen Stock in der Hand. „Ich bin der König“ krähte es. Ein anderes trug einen mit Silberbronze gefärbten Pappharnisch, von Bindfäden zusammengehalten, dazu einen Helm aus demselben Werkstoff und einen Holzsäbel. Diese beiden Gestalten, als Wirklichkeit erkannt, belustigten ihn. Der Anblick der dritten vertrieb die Lachlust. Dieses Kind ging in einem löcherigen Kittel, wirkte, obschon dicklich, abgehärmt und schaute bekümmert drein. Das Kind mit der Krone blaffte ihn an, „unterwirf dich, Unwürdiger, ich bin der Herr der Welt.“ Schaffer tippte sich an die Stirn, worauf der kleine Frechling das Kind mit dem Pappharnisch aufforderte: „Töte den frechen Untertanen!“ Tatsächlich ging ihn der mickrige Pappkamerad mit seinem Holzsäbel an. Schaffer schlug ihm das Ding aus der Hand, setzte seinen Weg fort, wobei ihm die beiden Kinder lästig waren, denn sie hampelten vor seinen Füßen. Dazu belegten sie ihn mit nicht kindgemäßen Schimpfworten. Mit derben Schubsen räumte er sie zur Seite. Das dritte, zerlumpte, Kind, zeterte: „Das darfst du nicht machen. Man muss der Obrigkeit gehorchen.“ Schaffer, kopfschüttelnd, sagte: „Ihr seid bescheuert, alle drei.“ Er schritt aus, drehte sich nach kurzem um. Tatsächlich, das Gör mit dem Säbel schlug auf das lumpige Balg ein, weil es ohne Genehmigung des Herrschers den Mund aufgetan hatte. Das Gör mit der Krone feuerte es an. Das Lumpenkind wehrte sich nicht. Schaffer drohte: „Wenn ihr ihn nicht in Ruhe lasst, mach ich euch einen Einlauf.“ Er wurde ausgelacht. Der Kronenwicht krähte: „Wir kriegen dich, du Aufrührer. Du bist des Todes.“ Das lumpige Kind schlug dem Fass den Boden aus: „Du darfst dich nicht einmischen. Es sind meine Freunde, die dürfen mich hauen.“
Schaffer stellte fest: „Du bist von euch dreien am meisten beknackt.“ Er hinterließ eine Drohung: „Hört auf mit dem Scheißspiel, sonst geht es euch schlecht“. Er war aber sicher, das würde weitergehen, spätestens, wenn er nicht mehr zu sehen war. Ihm kam der merkwürdige Gedanke, er und das Lumpenbalg hätten eine gewisse Ähnlichkeit. Er wies sich zurecht: „Das ist glatter Unfug“.
Die Hässlichkeit der Darbietung wurde nun durch ein viertes Kind auf die Spitze getrieben. Es war in Schwarz gekleidet. Dieses unkleidsame Kleid wurde durch grellweiße Streifen noch abstoßender. Vor dem Gesicht hatte es eine Totenkopf-Maske. Er fuhr es an: „Wie kann ein ganz junger Mensch sich so verunstalten. Geh mir aus dem Weg, sonst werde ich ungemütlich. Das Kind nahm die Drohung ernst, entfernte sich ein Stück, krächzte aus sicherem Abstand: „Ich bin Gevatter Tod, Herrscher über alles Lebendige. Gib zu, aus Angst vor mir machst du dich ein!“
Er war sprachlos, setzte zum Sprung an, holte zu einer gewaltigen Backpfeife aus. Da flüchtete Gevatter Tod zu den anderen drei Gören. Das im Pappharnisch verjagte ihn, Gevatter krächzte: „Ich bin der Herr der Welt. Ich kriege euch alle.“
Die anderen drei Kinder waren dem Wanderer Schaffer verdrießlich, dieses vierte jedoch fand er abscheulich, da es ihm die Binsenweisheit in Erinnerung brachte, dass der Mensch meist früher stirbt, als ihm lieb ist. Ihn verdross sein erbärmliches Leben, dennoch fürchtete er das Ende. Er erfasste, dass diese Furcht womöglich der Hauptgrund seiner Friedfertigkeit war. Um auf andere Gedanken zu kommen, überlegte er, in welchen Verhältnissen die vier verhunzten Kinder leben mochten. Er schätzte ein: Gevatter Tods Eltern: Gruftis. Die des Kronenbürschleins: gehobener Mittelstand, Ärzte vielleicht. Erzeuger des Pappkameraden: Lkw-Kutscher, Scheuerfrau. Des Lumpenkinds: Hartzer wie er, dennoch nicht seinesgleichen. Hündisch die Alten, hündisch das Junge. Wurde denn die Sklavenseele immer weiter vererbt? Jedenfalls: die Kinder ahmten mit diesem üblen Spiel die Welt der Erwachsenen nach.
Wilfried Schaffer stieg den Hang des Tschirnhügels hinauf, von dem er wusste, dass dort einst eine Kultstätte der Sorben gewesen ist. Abergläubigen Menschen mochten hier und jetzt, an der Schwelle zur Walpurgisnacht, Schauder über den Rücken laufen. Ihm nicht. Er hatte nunmehr einen brennenden Durst. Bedächtig leerte er die Weinflasche. Er versicherte sich, dass er es nicht um des Trinkens Willen tat, sondern um seinen Geist zu beflügeln. Er war weiterhin für Wegweisendes aufgeschlossen. Klarheit hoffte er zu erlangen. Zunächst aber kam Müdigkeit. Er legte sich und fiel zweitmalig in Schlaf.
Der letzte Kaiser, der ewige Soldat, das Lumpenmännchen und der Tod
Erwacht, blickte Wilfried Schaffer zur Uhr. Es war kurz vor Mitternacht. Er fühlte sich wohlig beschwingt, grad, als ob er, wenn er seine Flügel ausbreitete, losfliegen könnte. Ein Satz kam ihm in den Sinn: „Erst das sichere Wissen von etwas macht es zur Materie.“ Der Satz war, zumal ohne Bezug zur unmittelbaren Gegenwart, unsinnig, gleichwohl gefiel er ihm. Sein Blick schweifte über die Siedlung im Vordergrund. Die Häuschen hatte man Ende der Vierzigerjahre des vorigen Jahrhunderts gebaut, für Menschen, die durch den Krieg ihre Heimat verloren hatten. Denen hatte man im Zug der Bodenreform Land zugeteilt, auf dem sie sich, notgedrungen, als Landwirte versuchten.
Schaffer erhob sich nicht ohne Mühe –und schon zerstörten bellende Hunde die Stille. Ein Ruf schallte – sofort endete das Gebell. Er bemerkte den rötlichen Schein eines Lagerfeuers, ging hin, obwohl er einschätzte: eine Erscheinung, erzeugt von: Alk im leeren Magen, Zeitpunkt, Geist des Orts. Dem Feuer näher kommend, gewahrte er drei Gestalten. Wissen wollten die, ob er gekommen sei, um Walpurgis mit ihnen zu feiern. Schaffer lachte lautlos. Er wurde belehrt: „Hexen gibt‘s hier nicht. Musst dich auf den Brocken bemühen.“ Worauf er erklärte: „Mir steht nicht der Sinn nach Hexensabbat.“
Die Gestalten waren sozusagen vergrößerte Ausgaben der Kinder von vorhin. Ihre Anzüge waren allerdings aus haltbarerem Stoff. Eine trug eine verbeulte Krone aus vergoldetem Blech, einen von Motten zerfressenen Mantel, der vor dem Ausbleichen, wohl purpurn gewesen war. Die zweite trug bunte Pluderhosen, Pluderwams, einen rostigen Brustharnisch, hatte ein großes schartiges Schwert, das, wie er wusste, Bidenhänder genannt wurde. Ein Landsknecht, wie einem Holzschnitt des Sechzehnten Jahrhunderts entsprungen. Die Gestalt wurde von zahlreichen Narben verunziert. Die dritte, spindeldürre, war in einen groben, durchlöcherten Kittel gehüllt. Die drei Kerle stanken, der im Kittel besonders schlimm. Der Ankömmling bekam dummes Zeug zu hören: „Ich, der Gekrönte, herrsche von Gottes Gnaden von Ewigkeit zu Ewigkeit. - Ich, der ewige Soldat, verhackstücke dich, wenn du es an der schuldigen Ehrfurcht fehlen lässt.“ Schaffer war sicher, dass er es mit Luftgebilden zu tun hatte, gleichwohl erschrak er ein wenig. Das gab sich und er schimpfte drauflos. „Ihr Mumien, fehl am Platz seid ihr, eure Uhr ist längst abgelaufen. Packt euch!“
Der Kronenkerl atmete schwer, griff sich ans Herz, als erlitte er einen Infarkt. Der Landsknecht hieb drauflos. Schaffer zuckte zusammen, als ihn das Luftschwert durchfuhr. Der Zerlumpte tadelte ihn. Untertanen hätten zu kuschen und Maul zu halten. Das und nichts sonst sei Untertanen-Bestimmung. Schaffer fauchte ihn an: „Ich bin niemands Untertan, merk dir das, Knechtsseele.“ Der Landsknecht ging den Lumpigen an: „Zwar stimmt, was du sagst, aber du hast nichts zu sagen.“ Er schlug den Dürren mit der flachen Klinge. Dem luftigen Kerl schien die luftige Waffe echte Pein zu bereiten. Er heulte auf, fiel um, stand sogleich wieder auf den Beinen, erklärte frohgemut: „Man zwickt, zwackt, prügelt mich, doch ich bin unverwüstlich. Man haut mich um, doch stehe ich immer wieder auf. Ich bin nicht totzukriegen, ein richtiges Stehaufmännchen. Drauf bin ich stolz.“ Schaffer erboste sich. „Solltest dich was schämen. Anstatt wirklich aufzustehen, nämlich gegen diese beiden Menschheitsfeinde da, machst du den krummen Hund.“ Schief grinsend sprach der Zerlumpte: „Du hast’s grad nötig, eine dicke Lippe zu wagen. Bist doch ganz wie ich, du Feigling.“ Die behauptete Verwandtschaft bestritt Schaffer entschieden. Trotzig schmetterte er den aus Frankreich stammenden Kampfgesang: „Es rettet uns kein höh‘res Wesen, nicht Gott, noch Kaiser…“
Am Morgen war Wilfried Schaffer aufgebrochen mit der Hoffnung, den Ausweg aus seiner Lage zu finden. Die Hoffnung hatte sich nicht erfüllt. Er war enttäuscht, allerdings nicht sehr. Die Hoffnung ist ja nur vag gewesen. Ein Gaukelspiel erlebte er, das so gar nicht zielführend war. Ja hatte er denn besseres erwarten dürfen als zum Beispiel dieses unsägliche Geschwätz der Figur mit der verbeulten Krone? Der Kerl schwafelte, er, der Kaiser, Herr der Welt nach göttlichem Gesetz, sei aus seiner Welt schnöde verjagt worden, nur eine lächerliche Verkörperung seiner gebe es noch, den Tenno, diese machtlose Gliederpuppe auf dem japanischen Tron. Ansonsten maßten sich allüberall unwürdige Leute die Macht an, befleckt mit dem Makel niederer Herkunft. Ach und Weh und Weh und Ach!
Der in der Landsknechtskluft höhnte, der Kronenkerl sei immer nur eine Kostümpuppe und also auf ihn, den Mann des Schwerts, angewiesen gewesen. „Herrscher von Gottes Gnaden? Von meinen Gnaden, du Sack. Ich bin der eigentliche Welten-Herrscher, das war so, das ist so, das wird immer so sein.“ Er grinste den Zuschauer selbstgefällig an. „Zuweilen, in Sternstunden, hab ich den da in den Dreck geschmissen und mich selber auf den Tron gesetzt.“ Sein grobes Gesicht leuchtete auf. „Ich bin der, der zeigt wo’s langgeht. Ich bin unverzichtbar, denn Kriege wird es immer geben.“ Erbärmlich zeterte der mit der verbeulten Krone. Wie anmaßend sein Waffenknecht doch allzu oft sei. Des Waffenknechts Bestimmung sei, die Feinde seines Herrn in Schach zu halten und nicht, nach dem Tron zu gieren; nur ein Übermensch von edelstem Blut dürfe darauf sitzen, sonst sei der Tron entweiht. „Den da sollst du niederhalten, dass er nicht aufmuckt gegen mich, das ist deine Haupt-Aufgabe.“ Der da, das war der Zerlumpte. Der Geharnischte kitzelte den Kronenkerl mit dem Schwert an der Nase und stellte fest: „Edles Blut? Sieh an, es ist nicht blau, sondern auch bloß rot.“ Der Zerlumpte freute sich. „Das hast du gut gemacht, ja, zeig ihm seine Grenzen. „Da prügelte ihn der Söldner derb und brüllte dazu: „Was mischst du dich ein! Halts Maul!“ Der Zerlumpte stürzte heulend nieder, erhob sich hurtig, aus Wunden blutend. Zuschauer Schaffer wetterte: „Schämst du dich nicht, als Schwerbewaffneter einen Waffenlosen niederzuhauen!“ Der Geharnischte winkte ab: „Der braucht das immer mal, sonst wird er zu üppig. Dem macht das auch nichts aus. Der rappelt sich immer wieder hoch. Ein Stehaufmännchen, sagt er ja selber.“ Er musterte Schaffern verächtlich. „Was hast du überhaupt reinzureden, du Sack. Fünfundvierzig Jahre, Kerl und niemals im Kampfgetümmel gestanden und kein bisschen Kriegs-Erfahrung. Das ist ja abartig.“ Schaffer sprach. „Eins will ich klarstellen: Wären alle Menschen wie ich, gäbs keinen Krieg und wenig Zank und Streit.“ Im Stillen gab er zu: „Es gäbe keinen Krieg, aber auch keinen Widerstand.“ Weiter sprach er: „Was seid ihr doch alle drei für abscheuliche Zerrbilder. Du da mit der Schrottkrone nennst dich gottbegnadet und stinkst nach Verwesung, weil du schon lange auf dem Müllhaufen der Geschichte liegst. Und du da, lumpiges Stehaufmännchen, in milliardenfacher Ausführung vorhanden, könntest deine Unterdrücker erdrücken allein durch deine ungeheure Zahl, wenn du nur etwas Kampfgeist hättest. – Nun zu dir, du Säbelrassler. Du bist von euch Widerlingen der widerlichste. Man muss dich unschädlich machen, sonst hat die Menschheit keine Zukunft.“ Der Geharnischte grinste unverdrossen. Schaffer drehte sich weg und nahm Abstand. Der Grinser höhnte ihm hinterher: „Abtun? Mich? Ein unerfüllbarer Wunsch. Ich bin der ewige Soldat, mich wird es geben, solange die Welt besteht.“ Schaffer antwortete darauf nicht. Er hatte gesagt, was zu sagen war. Rasch entfernte er sich von dem Feuer, das nicht wärmte. Doch war die Walpurgis-Gaukelei natürlich nicht zuende. Plötzlich stand eine vierte Gestalt vor ihm. Er erschrak nicht sehr, da er sie längst erwartet hatte. Die Gestalt krächzte: „Das sind mir schöne Witzgebilde da drüben, besonders der eine. Von wegen ewiger Soldat und solange die Welt besteht. Es gibt nur eine unumstößliche Tatsache, die bin ich.“ Die tiefschwarze Gestalt hob sich gegen den nicht völlig dunklen Himmel ab wie ein Scherenschnitt. Sie öffnete ihre Hülle und zum Vorschein kam das übliche grell weiße Gerippe. Auch sie grinste, natürlich. Das breite Grinsen, welches seit je ihr Markenzeichen war. Das alles fand der unwillige Betrachter ganz unerotisch. Er stellte unwirsch fest: „Die drei da sind begrifflich, wurzeln in der Wirklichkeit. Du aber wurzelst in gar nichts. Du bist nicht vorhanden.“
„Oha, für ein Nichts habe ich aber eine gewaltige Macht. Gib doch zu, auch du zitterst vor mir. Gewaltig schlottern wirst du spätestens dann, wenn ich dich ergreife.“
Schaffer gab sich, wie er nicht war: ganz kühl. „Du schreckst mich nicht, du lächerliche Vogelscheuche. Immer im selben Kostüm, kriegst du das nicht satt?“
„Aber nicht doch. Gestaltwechsel ist eine meiner leichtesten Übungen.“ Flugs verwandelte sich das Gerippe in ein dralles Kind mit rosigem Gesichtchen, dann in eine blonde Frau mit lockenden Augen, Kussmund, Lockenpracht. Schaffer winkte ab. „Zugegeben, du verstehst es, tam-tam zu machen um deine Nichtigkeit. Gleichwohl bist und bleibst du nichts als eine Gedankenkrücke, womit ein schwer fasslicher Zustand anschaulich gemacht werden soll.“
Flugs wieder als Knochenmann gestaltet, plusterte sich die Gedankenkrücke auf. „Ich bin die einzige ewige Tatsache.“ Schaffer motzte: „Du bist eine größenwahnsinnige Null.“ Mit starkem Verwesungsgeruch tat die Gestalt kund, dass sie schwer beleidigt war. Schaffer sammelte seinen Willen, auf dass die Gestalt sich auflöse. Das tat sie nicht. Vielmehr gab sie eine Erklärung ab. „Du meinst, die Sonne geht jeden Morgen auf, jeden Abend unter? Falsch! Irgendwann wird es keine Sonne, keinen Morgen, keinen Abend noch geben. Hingegen ist unwandelbare Tatsache: Alles Lebendige muss sterben.“ Schaffer, mit tiefgehendem Unwillen, legte fest: „ Ich erkläre ich deinen Auftritt für beendet. Abflug!“
Der mit geballtem Willen unterfütterten Abneigung konnte die Gestalt nicht länger widerstehen. Sie zappelte, verschwand dann mit einem unanständigen Geräusch, eine Wolke von übelstem Arom hinterlassend. „Erledigt!“ stellte Wilfried Schaffer fest, war gleichwohl nicht zufrieden, sondern fühlte sich unbehaglich, denn er ahnte: der letzte Auftritt der Gedankenkrücke war das nicht. Überhaupt argwöhnte er, dass die Akte „Walpurgis-Gestalten“ noch nicht geschlossen war.
Tages-Abrechnung
Der Tag war gelaufen, nicht wie gewünscht, gleichwohl nicht ganz erfolglos. Schaffers Magen knurrte vernehmlich. Da nun ein neues Datum galt, aß er Brot, Wurst, Käse. Zu trinken hatte er nichts mehr, brauchte auch nichts, denn er versicherte sich: „Ich bin kein Trinker.“ Es war schließlich nicht zu bestreiten, dass es Tage ohne Alkohol gab und nicht nur, wenn Geldmangel ihn zur Enthaltsamkeit zwang.
Einen Wegweiser ins bessere Leben hatte er nicht gefunden, nur eine seltsame Vorspiegelung war ihm widerfahren, von der er nicht, noch nicht, wusste, was davon zu halten sei. Zugeben musste er, ganz verloren ist der vergangene Tag nicht gewesen; immerhin hatte er etwas Geld erarbeitet. Doch dieser unsinnige Abschluss! Der womöglich noch nicht erledigt war. Insbesondere traute er Nummer vier, der Gedankenkrücke, der Nichtgestalt, eine erhebliche Belästigungs-Fähigkeit zu. Er bat sich aus: „Dergleichen Ungesundes bitte nicht mehr. Wenn Vorspiegelung, dann nutzbringend, bitte sehr.“
Seine Blase drückte. Er erleichterte sich an einen Pfahl des angrenzenden Weidezauns. Dann machte er sich auf den Heimweg. Er marschierte, von Hunden angekläfft, rund um die Siedlung. Das war leichtsinnig. Die Bewohner mochten den Schluss ziehen: „Wer zu solcher Zeit hier entlang streift, hat ein Verbrechen vor.“ Zum Glück schliefen sie alle fest genug. Nein, nicht alle. Ein Fenster eines etwas verkommenen Häuschens war erleuchtet. Da keine Gardine vorhanden war, hatte Schaffer vollen Einblick. Die dürftige Einrichtung, die er sah, legte den Schluss nahe, dass da ein Abgehängter der „Globalisierung“ wohnte. Einen Bildschirm gab es natürlich, auf dem ein Hartporno lief. Eine Gestalt hockte davor und stöhnte. Der Beobachter sah nur den Umriss, konnte sich gleichwohl ausmalen, welche Leibesübung da ablief. Schaffer schüttelte und fragte sich: „Wie kann man, Armut hin und her, so ein Leben führen. Aber so sind sie, die Lumpenmännchen.“ Und versicherte sich: „Ich bin nicht so und will nicht so sein. Wer erbärmlich lebt, hat nicht Grund, vor dem Ende zu zittern. Mir wird schon noch Kampfgeist erwachsen.“
Nachher, in seiner dürftigen Wohnung, setzte er sein altes Tonbandgerät in Betrieb, lauschte alten Liedern der verstorbenen Sänger Ernst Busch und Gerhard Gundermann, die er schätzte und die in den Programmen der Dudelsender nicht vorkamen. „Es ist Sonntag in Schwarze Pumpe…Pumpe…Pumpe“, sang der einstige Braunkohle-Kumpel, immer noch, beinahe zehn Jahre nach seinem Ende. Von den Bergleuten, hohläugig und zerfetzt, Leich und Totengräber zugleich, sang der Ältere, den seinerzeit die faschistische Mordmaschine eingesaugt hatte und die er mit Glück fünfunddreißig Jahre überlebt hat. Auch er war eine Unperson im gegenwärtigen Kulturbetrieb, der, nach Wilfried Schaffers Ansicht, besser Unkultur-Betrieb heißen sollte. Und doch sang er, der Barrikaden-Tauber, noch siebenunddreißig Jahre nach seinem Tod, für ihn und sicherlich eine Anzahl anderer Menschen, die sich nicht vom Dudelfunk hatten verblöden lassen.
Beim Klang der kämpferischen Weisen zog Wilfried Schaffer den Schluss-Strich unter den dreißigsten April. Ganz alltäglich ist der also nicht gewesen. Ein Herr Plattner war ihm begegnet, der ihm einen Arbeits-Auftrag erteilt hatte. Eine zweifelhafte Sache, doch immerhin eine, in die er sich knien konnte. Und er hatte Birgit erblickt, die Erstrebenswerte. Leider, bekräftigte er, wäre es nicht anständig, ihr nachzustellen. Sie hatte Besseres verdient, als ihn, den Besitz- und Arbeitslosen. Er stellte Mutmaßungen betreffs der Zukunft an. Vom kommenden Tag durfte er auch keine Wunder erwarten. Und dann? Die Aussicht war trüb.
Andere Menschen in dieser Nacht
In Weißenfels, dieser Kleinstadt in der Mitte Mitteldeutschlands, lag zur selben Zeit die Serviererin Birgit Frey schlaflos in ihrem Bett, ihre Einsamkeit bedauernd. Auch sie hörte Musik. Schmusimusi. Sie versuchte, ihre drängenden Alltagssorgen, vor allem die um den Arbeitsplatz, wegzuschieben. In dieser sagenumwobenen Nacht hätte sie nichts dagegen gehabt, eine Hexe zu sein, nur mal so auf gesalbtem Besen wie ein geölter Blitz hinauf zum Brocken zu fahren. Mit einem Teufel sich zu vereinen war indessen nicht ihr Verlangen. Sondern nach einem Menschenmann stand ihr der Sinn. Nicht irgendeinem. Einem namens Wilfried. Sie hatte vor, ihn anzulocken. Zwar nicht heute, nicht morgen, gut Ding musste Weile haben. Sie seufzte. Ein Kind von Traurigkeit ist sie nie gewesen, sondern, in jungen Jahren, ein Feger. Längst vorbei das, doch natürlich war noch Feuer drinnen. Tja, der Wilfried. Man hatte bislang nur ein paar Worte gewechselt. Grad am vergangenen Tag hatte sie ihn von fern erblickt. Und sie wusste, er hatte ihr sehnsuchtsvoll nachgeschaut. Sie kannte ihn kaum, doch sie, die Erfahrene, hatte beschlossen: „Dieser soll es sein.“ Er war spröde, ziemlich albern war das, in seinem Alter. Er war ein bisschen spinnert; einmal, als sie ihn heimlich gemustert hatte, hatte sie den Eindruck gehabt, er stünde neben sich. Das fand sie eher lustig als befremdlich. Das Wichtigste: ein Liederjan war der Willi nicht. Er war arbeitslos und schämte sich deswegen. Es war vielleicht das Bewusstsein, ganz unten zu sein, das ihn abhielt, sich ihr zu nähern. Ein blödsinniges Verhalten. Er ganz unten, sie nicht weit drüber - der Unterschied war winzig. Mochte sein, ruck zuck käme es anders herum. Sie saß auf einem Schleudersitz. Wenn der Alte mal in übler Laune war, ein paar Stammgäste wegblieben, dann – „…wünsche viel Erfolg auf dem weiteren Lebensweg.“
Grade in der Armut musste man doch zusammenstehen. Man konnte sich zu zweit besser vor der Kälte schützen, der körperlichen wie der gesellschaftlichen. In diesem Land würde es wohl in absehbarer Zeit nicht gemütlicher werden. Sie beschwor: „Junge, mach es uns nicht so schwierig. Sei ein Mann, der weiß, was er will.“
Die Kellnerin Birgit gestand sich einen tüchtigen Schluck aus der Likörflasche zu, als Einschlafhilfe. Bald spürte sie Bettschwere, drehte die Schmusimusi ab und sich auf die Seite.
Am späten Abend saß der Geschäftsmann Erwin Plattner im „Café Centra“ am Markt. Er, kein Kirchgänger, doch christlich erzogen, spürte kein Gelüst, die sogenannte Walpurgisnacht gespenstisch zu begehen. Besser war, sich nach dem guten Essen bei gutem Getränk gedanklich zu sammeln. Er war fast fünfzig Jahre nicht in seiner Geburtsstadt gewesen. Als die kleine Ostrepublik noch bestanden hatte, war ihm grässliches über die Grenzkontrollen zu Ohren gekommen. In diesen Polizeistaat hatte er nicht einreisen wollen. Als die Grenze wegfiel, hatte er, in sein Unternehmen eingespannt, keine Zeit für Reisen in die einstige Heimat gehabt. Nun lief die Firma reibungslos auch ohne seine Anwesenheit, sodass er sich einen solchen Abstecher erlauben konnte.
Verändert hatte sich die Stadt durch und durch. Damals hatten alte Häuser dicht bei dicht gestanden, Bombenschäden aus dem zweiten Weltkrieg hatte es so gut wie keine gegeben. Eng war es damals zugegangen; es war, jedenfalls in seiner Erinnerung, stets dichtes Gedränge und Lärm gewesen. Massen von Kindern hatten die Straßen und Spielplätze bevölkert. Gemessen an der früheren erschien ihm die heutige Stadt menschenleer. Viele der damaligen Häuser waren nicht mehr vorhanden. Es gab hässliche Brachgebiete. Zudem verschandelten immer noch Ruinen das Stadtbild. Immerhin, man hatte einige alte Prachtbauten aufwändig instand gesetzt. Ungesund sei das Ganze, fand er, einfach ungesund. Dabei war die Stadt, verkehrstechnisch gesehen, günstig gelegen. In der Mitte der Gegend, die Mitteldeutschland noch immer hieß, obschon sie seit dem zweiten Weltkrieg an den Rand gerückt war, geografisch wie politisch, lag sie an wichtigen Verbindungs-Strecken. Touristisch gesehen, war die Stadt, soweit er das einschätzen konnte, auch Brache, obwohl die Landschaft ansehnlich war, wenn auch nicht Spitzenlage. Obwohl Weißenfels gleichsam Mittelpunkt einstiger Kriegs-Ereignisse war, welche die Geschichte Deutschlands, ja Europas, geprägt haben. Das war ihm klar vorhin aufgeleuchtet, auf dem Stadtrundgang, für den er einen etwas herunter gekommenen Arbeitslosen angeheuert hatte, der untypisch, nämlich weder träge noch dumm, war und in der örtlichen Geschichte beschlagen. Erwin Plattner glaubte zu wissen, dass jeder, der Arbeit wollte, auch Arbeit fand. Wieso dieser gescheite Mensch also nicht? Es war müßig, darüber zu rätseln, was für eine Leiche der Merkwürdige im Keller haben mochte. Er kam auf für einen Geschäftsmann näher Liegendes. Es war nicht alles schlecht hier herum, es gab Vorzüge, die man nur ins Licht rücken musste. Man konnte ein Hotel bauen, nicht erstklassig, nicht schäbig, gediegene untere Mittelklasse, um Kurzurlauber unterzubringen, die gewillt waren, für historische Bildung Geld locker zu machen. Von diesem Hotel aus konnten Sternfahrten zu den Schlachtfeldern des Umkreises, Lützen, Roßbach, Großgörschen, Leipzig, Jena, Auerstädt, Hohenmölsen, unternommen werden. Man konnte Arbeitslose vom Schlag seines Stadtführers, wie hieß er doch gleich, ach ja, Schaffer, zu Fremdenführern umschulen. Kundige Fremdenführer, die gescheite Vorträge hielten, gewürzt mit Anekdoten, wären das A und O. Verkauf von Andenken verspräche Ertrag. Und, natürlich, Ereignis-Abende im Hotel... „Ich würd’s machen, wenn ich nicht ausgelastet wäre...“
Das ging Herrn Plattner durch den Kopf, obwohl er ja nicht auf Geschäftsfahrt war, sondern auf Erinnerungs-Reise, mit dem Hauptziel, sich zu entspannen. Nachher kam er gedanklich auf den stadtgeschichtlichen Abriss, den er, einem Augenblicks-Einfall folgend, bei diesem, äh, Schaffer, in Auftrag gegeben hatte. Mal sehen, ob, dieser Spross der Unterklasse Brauchbares zu gestalten in der Lage war. Wenn ja, würde sich Erwin Plattner nicht lumpen lassen. Er hatte guten Draht zu Leuten vom Werbefach. Wenn so welche das Ding anschoben, sollten abertausende gedruckte Hefte zu verkaufen sein…
Erwin Plattner war rechtschaffen müde und freute sich auf sein Hotelbett. Doch verschob er seinen Abgang, denn ein Mensch betrat den Raum, den er kannte, wenn auch nicht besonders gut. Der rief sogleich raumfüllend: „Plattner, jo mei, du hier, alter Freund. Eine echte Überraschung.“
Als Freund dieses Menschen betrachtete Plattner sich nicht. Obwohl der Ankömmling gleichfalls Geschäftsmann war, fand er auch die Bezeichnung „Kollege“ nicht passend, denn man beackerte ganz verschiedene Felder. Er, der Mann aus dem Rheinischen, hatte jenen, am Ufer der Isar heimisch, gelegentlich getroffen, das war alles. Einmal hatte der Bayer nebenbei erwähnt, in den rückständigen Ostländern wolle er nicht einmal begraben sein. Wieso befand er sich also an diesem Ort?
„Grüß Gott“ bellte der Bayer, dessen Namen Plattner entfallen war und gesellte sich zu ihm. Neugierig war er. „Sie in diesem Kaff, Plattner, warum, wie lange?“ Plattner, dem die Aufdringlichkeit missfiel, war gleichwohl froh, mit jemandem reden zu können und erklärte: „Anhänglichkeit an den Ort der Kindheit, Neugier, was ist beim alten, was ist anders.“ Worauf der andere, ein wenig von oben herab, erklärte, Rührseligkeit kenne er nicht, er habe die Fahrt von A nach B für einen Abstecher in dieses gottverlassene Nest unterbrochen, weil ihm seine Geschäftsnase sagte, hier könnte etwas zu holen sein.
Plattner dachte: „Es scheint, dass der Pleitegeier über ihm kreist. Dieses gezwungene Sieger-Grinsen…“ Er kam auf den Namen: Schwertfeger. Und ihm fiel ein, er hatte raunen gehört, dieser Mensch sei in Ungesetzliches verstrickt. Also Vorsicht, kein Wort über Geschäfte! Stattdessen stellte er, nun auch etwas von oben herab, seine Geburtsstadt in günstiges Licht: bemerkenswerte Gebäude, eine Umgebung, die, wenn auch nicht mit weißen Stränden, klaren Bergseen, rauschenden Wäldern gesegnet, immerhin anmutige Hügel-Landschaft und ein liebliches Flusstal aufwies. Schlösser und Burgen, teils zwar verfallen, gab es so einige im Umkreis. Über Pläne und Vorhaben mochte Plattner nicht reden; die sollten Geschäftsgeheimnis bleiben. Doch, von den genossenen Getränken angeregt, drängte es ihn, über Unverfängliches zu schwatzen. Lehrerhaft wiederholte er einiges, das er bei der Stadtführung gehört hatte. Für besonders bemerkenswert hielt er die stattliche Anzahl von Schlachten, die hier herum geschlagen worden waren. Hohenmölsen… und so weiter. Damit traf er einen Nerv. Schwertfeger horchte auf. Er kippte sein Getränk, Weinbrand und Kaffee, eilig hinter, bestellte Nachschub, verlangte außerdem eine Gebietskarte und einen Zirkel. Die Kellnerin, von seinem barschen Ton verunsichert, teilte weinerlich mit, diese Dinge seien leider nicht im Angebot. Worauf Schwertfeger sie anfuhr: „Ich will das Zeug nicht verschlingen, sondern mal kurz leihen. Sie können mir ja eine Gebühr berechnen, wenn es Ihnen Spaß macht.“
Eingeschüchtert zog sich die Bedienerin zur Theke zurück, wo nun eine kurze Beratung stattfand. Im Ergebnis kam der Thekenmann an den Tisch, erklärte, man wolle dem Wunsch des verehrten Gasts gern entsprechen, doch müsse man um etwas Geduld bitten.
Schwertfeger knurrte, dass seine Geduld nicht endlos sei, bestellte aber neue Getränke, für sich und Plattner. „Als Dank für den hilfreichen Hinweis“, ließ er wissen. Plattner fragte sich, was es bedeuten sollte. Die verlangten Dinge kamen, Schwertfeger faltete die Karte auf und maß mit dem Zirkel. Seine Miene hellte sich auf. Er sagte leise: Rossbach, knapp zehn Kilometer Luftlinie, Hohenmölsen reichlich zehn, Großgörschen fünfzehn, Jena 30, Auerstedt knapp 40, und, Knall-Effekt: 25 Kilometer bis zum Leipziger Rand. Wo ist der Macher, der diese Schlachten ausschlachten wird? Er sitzt vor Ihnen, Plattner. Und Sie dürfen mitmachen.“ Er legte eine bedeutungsvolle Pause ein, nur das Glucksen seiner Kehle war hörbar. Dann verkündete er: „Ich habe eine Geschäftsnase, Plattner. Immer. Der kleine Umweg nach hier wird sich lohnen. Infrastrukturmäßig gibts nichts zu maulen. Vierspurige Umgehungsstraße, zwei Autobahnen, drei Bundesstraßen...“ Na Plattner, wie schaut‘s aus. Mit, ich sag mal, hunderttausend, bist du dabei.“
„Ja, wie denn, wo denn, was denn?“
„Ich werde den Tourismus aufmischen. Erlebnisreisen in die Kriegsgeschichte.“ Plattner dachte, „bin vor dir drauf gekommen, du Wichtigtuer. Wenn ich‘s wollte, würde ich‘s selber machen, allerdings ohne dich.“
Es stellte sich jedoch heraus, der Wichtigtuer wollte es ziemlich anders angehen, als er selbst sich‘s vorgestellt hatte… „Das Aufregende wird im Vordergrund stehen. Mit Bildungsreisen habe ich nichts am Hut. Die Leute wollen ihre echten Bedürfnisse befriedigt haben." Er nahm einen großen Schluck, ließ ihn genüsslich hinabrollen, offenbarte dann: „Die Kriege schreien nach Vermarktung. Da es in echt hier herum keine gibt, werde ich die von früher nachmachen. Naturgetreu. Etwa so: Arbeitslose werden in originale Uniformen gesteckt, werden gedrillt, zwei Kampftruppen werden gebildet und dann auf ins Gefecht! Knallen muss es und es muss Blut spritzen.“ Plattner bemühte sich nicht, sein Befremden zu verbergen. Schwertfeger kam noch mehr in Schwung. „Ganz zu Anfang reichen Böller und Platzpatronen. Nachher aber werden echte Schlachten geschlagen. Es wird nicht mehr Tomatenmark oder Filmblut eingesetzt, echtes wird fließen. Erst werden kleine Rotten kämpfen, dann richtig große Truppenteile.“ Er leuchtete auf. „Das Geschäft wird brummen.“
Plattner, entsetzt, sagte sich: „Nur nicht widersprechen. Bei Verrückten ist Vorsicht geboten.“ Er sprach: „Kommendes Wochenende wird es ein Schlachtspiel bei dem Dorf Großgörschen geben. Das veranstaltet man jedes Jahr zum Gedenken an die Schlacht von Achtzehnhundertdreizehn. Schauen Sie es sich an, Sie werden bestimmt Anregungen bekommen.“ Schwertfeger meinte verächtlich: „Ist bestimmt nur ein altbackenener Abklatsch. –Wenn ich überhaupt etwas dabei lernen kann, dann, wie ich es nicht machen soll.“
Plattner dachte sich sein Teil, während Schwertfeger auf die Kapitalfrage kam. „Ich werde es ganz groß aufziehen. Das kann ich natürlich nicht voll und ganz alleine stemmen. Mitmacher sind gefragt. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, will heißen, hat bessere Karten, als solche, die hinterher traben. Guter Rat in alter Freundschaft: Plattner, steig ein. Trommle für die Sache. Mach den Geldleuten, die du kennst, das Maul wässrig. Das Wichtigste ist allerdings: an Fördertöpfe kommen. Na, damit kenne ich mich aus.“ Er lächelte ziemlich schmutzig. Plattner schwieg. Aus Vorsicht wollte er diesem Schwertfeger nicht gleich aufs Brot schmieren, dass er sich an so etwas Verrücktem keinesfalls beteiligen werde. Ganz und gar entgleist war doch dieser Mensch. Von wegen alte Freundschaft. Da war nur Bekanntschaft, ziemlich flüchtig. Gleichwohl war ihm Schwertfegers übergroßes Selbstbewusstsein schon damals aufgefallen. Solchen Wahnwitz allerdings hatte er an dem Mann seinerzeit nicht wahrgenommen. Wahrscheinlich waren ihm zweifelhafte Geschäfte schief gelaufen und er musste nach jedem Strohhalm greifen, um sich vielleicht über Wasser zu halten. Der Strohhalm-Greifer tönte prahlerisch: „Ich werde dieses elende Nest aufblühen lassen. Man wird mir die Hände küssen, denn durch meine Innovation wird das Hotel- und Gaststättengewerbe brummen. Ich sorge für höheres Steueraufkommen. Dank meiner Tatkraft wird man die bröckelnden Ruinen aufmotzen können. Wenn die Stadt durch meine Aktivität dann etwas hermacht, werden sich namhafte Firmen niederlassen und nicht bloß Billligheimer.“ Plötzlich wurde er nachdenklich und seufzte: „Die Bürokratie ist der Hemmschuh für alle Innovation. Anfang der Neunziger war hierherum das Eldorado für unsereinen. Alles war jetzt und sofort machbar, ohne Genehmigungen, Planfeststellungsverfahren und solchen Kram. Ein paar markige Sprüche, mit dem Scheckbuch gewedelt und das Ding war gegessen. Inzwischen ist es hier schlimmer wie im richtigen Deutschland. Krankhaft ist doch dieses Misstrauen gegen Macher. Man muss immer mehr tricksen, um voran zu kommen.“
Plattner dachte: „Du wirst wohl einen erklecklichen Anteil daran haben, dass das Misstrauen großgewachsen ist. Ich schätze, im Tricksen bist du seit jeher ein As gewesen.“
Schwertfeger schwafelte weiter, ohne Punkt und Komma: „Mitmachen darf wer will und genügend besattelt ist aber das Sagen kann nur einer haben sonst geht’s unweigerlich schief ich kenne paar Leute hier herum, die Einfluss haben aber geistig träge sind. Die müssen wir ködern, Plattner Freundschaftsgeschenke und so, na du kennst es ja von daheim.“ Endlich gab es eine Pause, da Schwertfeger Getränk in seine glucksende Kehle goss. Dann: „Einen Vorteil hat der wilde Osten noch: Die Entscheidungsträger sind noch nicht ganz so versaut, man kommt mit etwas weniger Schmiermittel aus. Aber die Nachteile! Tief verwurzelt ist die Feindschaft gegen das freie Unternehmertum. Da wirkt der Kommunismus nach. Dabei ist doch logisch, dass nur ein schrankenlos freies Unternehmertum aus einer wüsten Landschaft eine blühende erschaffen kann. Wie sieht‘s denn aus hier - in der Wirtschaftsleistung ganz unten, in der Arbeitslosen-Statistik oben dran. Wenn die matten Beamtenseelen nicht so begriffsstutzig wären, würden sie mir einen roten Teppich ausrollen. Eine nennenswerte Industrie wird es hier nie wieder geben. Und dass sich Behörden mit kaufkräftigen Beamten ausgerechnet in diesem Kaff ansiedeln, kann man vergessen. Also heißt das Zauberwort: Dienstleistungs-Gesellschaft. Das müsste einleuchten, ohne dass man Scheine rüberschieben muss.“ Nach einer kleinen Denkpause stellte er fest: „Es ist ja so, dass sich in einem Krisengebiet billiger was aufbauen lässt, als, beispielsweise, im überfütterten Baden-Baden. Die Schleuderlöhne sind ein großer Standort-Vorteil oder etwa nicht, Plattner? – Wie hoch steigen Sie ein?“
Plattner, dem nicht wohl in seiner Haut war, bemerkte ausweichend: „Sicher, bestimmt, es ist einen Versuch wert. Wenn es gelingt, maßgebende Leute zu überzeugen...“ Schon platzte Schwertfeger heraus: „Welche hast du auf dem Schirm?“
Plattner, dem mulmig war, sagte sich, dass es gefährlich wäre, den Irren vor den Kopf zu stoßen. Ihm fiel ein, dass er, bevor er zurückfahrem würde, auf jeden Fall das Stadtoberhaupt aufsuchen wollte, um werbewirksam eine nicht ganz unbedeutende Spende für die Stadt zu übergeben. Er sagte: „Auf jeden Fall werde ich den Oberbürgermeister sprechen.“
Schwertfeger hob den Daumen. „Gut. Es heißt zwar, der Mann ist von Humanitätsduselei angekränkelt, hat was gegen alles, das irgendwie nach Gewalt aussieht. Stoßen Sie ihn tüchtig an, dass aus den Fördertöpfen ordentlich was rausschwappt.“
Plattner dachte: „So ist er, zupackend und selbstverständlich der Befehlsgeber.“
Wenigstens nervte er nicht mit Ansinnen, wie: „Plattner, zähl auf, wen du sonst noch bearbeiten wirst.“ Sondern er offenbarte seinen strategischen Plan. „Für den Anfang werde ich zwanzig Kampf-Roboter brauchen. Gleich morgen werde ich die Amtsschimmel in der Arbeits-Agentur für meine gute Sache auf Trab bringen. Die zwanzig müssen willig und billig und sofort verfügbar sein.“
Plattner dachte: „Ein ganz forscher Verrückter. Hat ja noch nicht einmal eine Gewerbe-Anmeldung.“
Schwertfeger trieb die Forschheit noch weiter. Er rief die Kellnerin: „Besorgen Sie mir doch mal eben die Nummer vom Chef Ihrer Arbeits-Agentur.“ Plattnern erläuterte er: Morgen um Neun stehe ich dort auf der Matte, da möchte die Sache bereits angelaufen sein.“
Plattner erinnerte ihn behutsam, dass morgen Feiertag war, Tag der Arbeit. Schwertfeger motzte: „Was denn, diesen Unfug gibts noch? Im dritten Jahrtausend, wo der Markt alles regelt? Die Blockierer versuchen mit allen Mitteln, die Macher auszubremsen. Wann endlich wird die ganze Sozialromantik auf den Müllhaufen der Geschichte geschmissen!“ Anrufen wolle er gleichwohl. „Mal sehen, was dem Herrn wichtiger ist, die Proletenfete oder der Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt.“
Plattner schätzte ein: „Wenn du den Maßgebenden so kommst, kannst du gleich einpacken. So etwas können sich höchstens Leute wie der Beckenbauer erlauben.“
Er fand, es sei nun höchste Zeit, erhob sich, tönte, so leid es ihm tue, obschon er den richtungweisenden Ausführungen gern länger gelauscht hätte - nun müsse er, unwiderruflich. „Man sieht sich." Schwertfeger hielt ihn fest, bestand auf seiner Rufnummer. Plattner wagte nicht, sie ihm zu verweigern. Nachher schlief er unruhig.
Und der Langzeit-Arbeitslose Wilfried Schaffer, an der Schwelle des Schlafs, stellte noch dieses fest: „Ein gewöhnlicher Tag wars und doch, dämmert mir, von Bedeutung für spätere Tage. Irgendwie.“