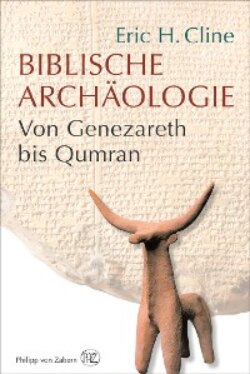Читать книгу Biblische Archäologie - Eric H. Cline - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
|36|Kapitel 2 Vor dem Ersten Weltkrieg: Von der Theologie zur Stratigraphie
ОглавлениеEdward Robinson und Charles Warren waren Pioniere im Bereich der Biblischen Archäologie, aber sie waren von ihrer Ausbildung her keine Archäologen. Auch George Adam Smith war kein Archäologe, sondern vielmehr Theologe, Geograph und Historiker, während Charles Clermont-Ganneau im Laufe seines Berufslebens immer wieder zwischen diplomatischen Posten und der Erforschung der Altertümer hin und her wechselte. Wenn man den ersten »echten« Biblischen Archäologen sucht, stößt man früher oder später auf Sir William Matthew Flinders Petrie. Vor allem durch seine Leistungen entwickelte sich die Biblische Archäologie zu einer strengen Wissenschaft.
Petrie wurde 1853, nur ein Jahr nach Robinsons zweiter Reise nach Palästina, in England geboren und erprobte seine archäologischen Techniken anfangs in Ägypten. Er war fast vierzig Jahre alt, als er 1890 vom Palestine Exploration Fund angestellt wurde und anfing, Tell el-Hesi im einstigen Südreich Juda freizulegen. Dort |37|grub Petrie zum ersten Mal in Palästina nach der Methode der Stratigraphie – einem wohldurchdachten Konzept, das doch eigentlich auf der Hand lag und seine Ursprünge dem geologischen Prinzip der Schichtenfolge verdankte.
Anders als Robinson vor ihm erkannte Petrie, dass einander nachfolgende Städte, die direkt übereinander errichtet werden, mit der Zeit einen Hügel oder tell bilden – eben jene Tells, die man überall im Heiligen Land verstreut findet. Und ihm wurde klar, dass innerhalb der Tells die weiter unten oder tiefer liegenden Städte immer die zeitlich früheren sind. Wenn sich Petrie also von der Spitze eines Hügels aus nach unten grub, arbeitete er sich in der Zeit zurück, enthüllte die Geschichte des Tell und die vielen Siedlungsphasen der Stadt, die sich in seinem Inneren verbarg, und legte manchmal mehrere Jahrtausende und zahlreiche Zerstörungen und Wiederaufbauten frei.
Petrie führte auch die Konzepte der Keramiktypisierung und der Keramikseriation ein. Mit Hilfe der vielen tausend Tonscherben, die er fand, legte er die Chronologie der verschiedenen Schichten und der Städte fest, die innerhalb des Hügels, den er gerade ausgrub, übereinanderlagen. Im Grunde erkannte Petrie, dass Keramiktypen in Mode kamen und wieder verschwanden, genau wie die Kleidermoden heutzutage, und deshalb zur Datierung der Städte und Schichten in einem Tell herangezogen werden können.
Er erweiterte dieses Konzept auf Städte und Schichten in anderen antiken Hügeln in der Nachbarschaft wie auch in anderen Ländern und kam zu dem Schluss, dass, wenn ähnliche Keramiktypen an verschiedenen Stätten gefunden werden, die Schichten, in denen sie gefunden werden, wohl gleich alt sein müssen. Dieser Punkt |38|ist besonders wichtig für die Zeit vor Beginn der Münzprägung, die erst um 700 v. Chr. in Lydien in der heutigen Türkei einsetzte.
Die Ergebnisse von Petries Ausgrabungen in Tell el-Hesi veröffentlichte er zusammen mit seinem amerikanischen Arbeitspartner Frederick J. Bliss in einem Buch mit dem Titel A Mound of Many Cities (1894). Petries Methoden und die Veröffentlichung seiner Entdeckungen revolutionierten das junge Fach der Biblischen Archäologie und untermauerten seinen Ruf als Gründervater dieser Wissenschaft.
Zwei Jahre später, im Februar 1896, grub Petrie im Totentempel des Pharaos Merenptah in Ägypten in der Nähe des Tals der Könige, auf dem anderen Nilufer gegenüber der Stadt Luxor. Dort stieß er auf eine Inschrift aus dem fünften Jahr der Regierungszeit des Pharao (1207 v. Chr.). Diese Inschrift, heute als Israel-Stele bekannt, veröffentlichte er ein Jahr später. Sie ist die früheste Erwähnung Israels außerhalb der Bibel und damit eine der wichtigsten Entdeckungen der Biblischen Archäologie überhaupt. Hier ein Ausschnitt:
Die Großen werfen sich nieder und rufen »Frieden«. Keiner von den Neun Bögen hebt sein Haupt. Geplündert ist Tjehenu. Hatti ist befriedet. Kanaan ist mit allem Übel erbeutet. Aschkelon ist erobert. Geser ist gepackt. Yano’am ist zunichte gemacht. Israel ist verwüstet, seine Saat ist nicht mehr. Charu ist zur Witwe geworden wegen Ägypten. Alle Länder insgesamt sind in Frieden. Wer umherzog, ist bezwungen …
Die Inschrift und ihre Deutung haben jahrzehntelang die wissenschaftlichen Debatten angeheizt. Ganz sicher zeigt sie, dass der Exodus |39| (wenn es ihn tatsächlich gab) vor 1207 v. Chr. stattfand, denn seit damals gab es eine Gruppe (oder ein Volk) namens »Israel« im Lande Kanaan.
Während Petrie grub, wurden weitere Expeditionen zur Erforschung des Heiligen Landes organisiert, allerdings nicht von Museen wie dem Louvre oder dem British Museum, die Grabungen an anderen Orten im Nahen Osten, etwa im heutigen Irak, finanzierten. An ihre Stelle traten quasi-nationale wissenschaftliche Vereinigungen wie der PEF oder der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas (kurz Deutscher Palästina-Verein, DPV). Sie waren Anhängsel imperialistischer politischer Bewegungen in den europäischen Nationen, die auf das Ende der Herrschaft des Osmanischen Reiches in der Region spekulierten. Das Konzept war einfach, die Briten hatten es sich schon länger zu eigen gemacht: Wenn das Osmanische Reich zusammenbrach, hatten diejenigen europäischen Länder, die schon in Palästina waren oder Interessen dort hatten, den größten Anspruch auf das Territorium. »Biblische Erkundungen« mit Vermessungskampagnen und vorbereitenden Grabungen lieferten den besten Vorwand – und Deckmantel –, um sich in diesem Gebiet festzusetzen.
Eine groß angelegte Grabung – höchstwahrscheinlich mit solchen imperialistischen Hintergedanken – leitete zwischen 1903 und 1905 der in Amerika geborene württembergische Archäologe Gottlieb Schumacher in Megiddo. Die Stätte, heute als das biblische Armageddon bekannt, als der Ort also, an dem laut Neuem Testament die vorletzte Schlacht zwischen Gut und Böse stattfinden soll (Offb 16,16), wurde von vier verschiedenen Expeditionen ausgegraben. Schumacher und sein Team waren die ersten.
|40|Er arbeitete dort im Auftrag des DPV und finanziert von Kaiser Wilhelm II., der Jerusalem und das Heilige Land 1898 besucht hatte. Leider ließen Schumachers Methoden aus technischer Sicht sehr zu wünschen übrig, obwohl er einige wichtige Entdeckungen machte, darunter mutmaßliche Königsgräber aus dem 2. Jahrtausend v. Chr. und ein beschriftetes Siegel, das einem Diener des Jerobeam, König des Nordreichs Israel, gehört hatte.
Wie Heinrich Schliemann, der nur ein paar Jahrzehnte zuvor (1870–1890) in Troja in der Nordwesttürkei gegraben hatte, beschloss Schumacher, der zwanzig Meter hohe Schutthügel von Megiddo sei wohl am besten in den Griff zu bekommen, indem man hunderte einheimische Arbeiter einen riesigen Graben anlegen ließ, der quer durch und tief in den ganzen Hügel hineinschnitt. Teile dieses großen Grabens sieht man noch heute. Und genau wie Schliemann durch die Schicht des Königs Priamos in Troja, die er eigentlich gesucht hatte, glatt hindurchgrub, übersah auch Schumacher in Megiddo vieles, so etwa das Bruchstück einer Inschrift, die der Pharao Scheschonk (der biblische Schischak) dort nach der Einnahme der Stadt um 925 v. Chr. hatte aufstellen lassen. Schumachers Arbeiter warfen das beschriftete Fragment auf den Schutthaufen, wo es zwischen anderen Steinen aus den abgebrochenen Mauern lag, bis es 1925 vom nächsten Ausgräberteam, diesmal aus Chicago, gefunden und geborgen wurde.
Trotz seiner brutalen Ausgrabungsmethoden war Schumacher ein fähiger Zeichner mit einem guten Auge für die Stratigraphie, der nützliche Pläne von den Resten anfertigte, die er in Megiddo freilegte. Er veröffentlichte seine architektonischen und stratigraphischen Entdeckungen sehr zügig, schon im Jahr 1908. Es sollte |41|allerdings noch einmal zwanzig Jahre dauern, bis die kleinen Funde aus Schumachers Grabungen von einem anderen deutschen Archäologen, Carl Watzinger, publiziert wurden, der vielleicht besser bekannt ist als Ko-Direktor der Grabungen in Jericho zwischen 1907 und 1909 und noch einmal im Jahr 1911.
Im Auftrag des PEF arbeitete der irische Archäologe Robert Alexander Stewart Macalister zwischen 1898 und 1909 am verschiedenen Stätten; seine Grabung im biblischen Geser 1902 bis 1905 und 1907 bis 1909 war damals eine der größten in Palästina. Leider war Macalister der einzige Archäologe, der an der Fundstätte arbeitete, zusammen mit vierhundert Arbeitern und einem ägyptischen Vorarbeiter. Er grub schnell und nachlässig, ohne die genauen Fundorte der meisten entdeckten Gegenstände zu dokumentieren. Offenbar kannte er die Methode der Stratigraphie, die Petrie erst ein Jahrzehnt zuvor eingeführt hatte, aber ihn interessierte eher das antike Alltagsleben als eine genaue chronologische Ordnung. Keramik und Stratigraphie waren ihm längst nicht so wichtig wie Petrie, und die nachfolgende Arbeit späterer Archäologen zeigte, dass er sehr viel übersehen hatte – unter anderem verschätzte er sich bei der Datierung des eisenzeitlichen Eingangstors um fast tausend Jahre.
Es überrascht nicht, dass Macalisters Veröffentlichungen zu seiner Arbeit in Geser zu wünschen übrig ließen – obwohl er drei dicke Bände innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Grabungen herausbrachte. Erfolgreich war allerdings seine Freilegung einer kanaanitischen »Kulthöhe« in Geser, die auf die Mittlere Bronzezeit IIB um 1600 v. Chr. zurückgeht und aus zehn aufrecht stehenden Steinen mit möglichen Hinweisen auf Tieropfer |42|besteht. Macalister fand dort 1908 außerdem den sogenannten Geser-Kalender, eine Inschrift auf Paläohebräisch (der frühesten bekannten Form des Hebräischen) oder vielleicht auf Phönizisch, die wahrscheinlich auf das 10. Jahrhundert v. Chr. zu datieren ist. Der Kalender beschreibt die wichtigsten bäuerlichen Tätigkeiten im Jahreslauf und liefert damit Einblicke in das Alltagsleben in biblischer Zeit. Der Text lautet: »Zwei Monate (davon sind) Obsternte, zwei Monate (davon sind) Saat/zwei Monate (davon sind) Spätsaat/ein Monat Flachsschnitt/ein Monat Gerstenernte/ein Monat Getreideernte und Abmessen/zwei Monate (davon sind) Beschneiden/ein Monat Sommerobsternte.«
George Reisner von der Harvard University war zwar praktisch zur selben Zeit als Ausgräber tätig, arbeitete jedoch ganz anders als Macalister, der ihn angeblich hasste. Reisner hatte seine archäologische Laufbahn 1902 mit Grabungen in Ägypten und im Sudan begonnen, vor allem in den Königsfriedhöfen von Gise, doch für die Jahre 1908 bis 1910 war er zum Leiter der Grabung von Samaria in Palästina ernannt worden. Die Stadt hatte dem Nordreich Israel als Hauptstadt gedient, nachdem das von David und Salomo regierte Territorium nach Salomos Tod um 930 v. Chr. in zwei Teile zerfallen war.
Da Reisner 1908 noch andere Verpflichtungen hatte, leitete Schumacher, der noch ein paar Jahre zuvor in Megiddo gearbeitet hatte, in der ersten Kampagne das Grabungsteam. In den nächsten drei Kampagnen allerdings konnte Reisner die Arbeit persönlich leiten und tat dies sehr viel besser als Schumacher. In Samaria waren fast ebenso viele Arbeiter im Einsatz wie bei Macalister in Geser – normalerweise um die zweihundert, doch gelegentlich auch |43|bis zu vierhundertfünfzig Mann. Den Unterschied jedoch machten die Mitarbeiter. Reisner hatte ein gutes Team um sich versammelt, darunter Clarence Fisher, einen Architekten, der später in Bet Schean und Megiddo arbeitete; sie konnten die Arbeiter überwachen und methodisch alle Kleinfunde wie auch die Architektur aufnehmen.
Reisner kannte die Prozesse, die die künstlichen Hügel, etwa in Megiddo, und die Überreste ganz oben auf Felshügeln wie in Samaria hatten entstehen lassen. Er sah seine Arbeit an der Grabungsstätte als einen Versuch, die menschliche Geschichte, die da unter seinen Füßen lag, zu entwirren, und ließ schon sehr früh einen Schnitt als Sondage bis hinunter auf den gewachsenen Fels ausheben. So gewann man eine Vorstellung von der Komplexität der Stätte und der verschiedenen Schichten, mit denen man zu rechnen hatte, wenn man an anderen Stellen ebensolche Schnitte anlegte.
Reisners Dokumentation seiner archäologischen Grabungen und Entdeckungen war noch akribischer als die von Petrie und weitaus genauer als die Notizen von Macalister. Als einer der ersten Archäologen betonte er, dass man eine Stätte auch zerstört, wenn man sie ausgräbt. Es gibt nur eine Chance, wirklich nur eine, jeden Teil einer Fundstätte freizulegen. Deshalb galt eine ordentliche Befundaufnahme als unabdingbar. Reisner publizierte zwar nicht so schnell und brachte die Ergebnisse seiner Grabungen in Samaria erst 1924, etwa vierzehn Jahre nach Abschluss der Arbeiten, heraus, doch dann waren sie gut aufbereitet mit aussagekräftigen Beschreibungen, schönen Fotos und verständlichen Architekturplänen, die noch heute verwendbar sind.
|44|1914, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, beauftragte der Palestine Exploration Fund T. E. Lawrence mit der archäologischen Oberflächenaufnahme in Südpalästina. Der heute nach dem biographischen Film von 1962 mit Peter O’Toole in der Hauptrolle allgemein besser als »Lawrence von Arabien« bekannte Archäologe hatte in Oxford studiert und 1910 dort seinen Abschluss gemacht. Als der PEF ihn unter Vertrag nahm, hatte er schon in Byblos im heutigen Libanon, in Karkemisch in Nordsyrien und mit Petrie in Ägypten gegraben.
In nicht einmal zwei Monaten gelang es Lawrence und seinem Kollegen Leonard Woolley (der später noch selbst als Ausgräber von Ur im Irak zu Ruhm gelangen und für seine Leistungen zum Ritter geschlagen werden sollte), viele archäologische Befunde aus den verschiedensten Zeiten aufzunehmen, die in der Negev-Wüste und im Wadi Araba offen zutage liegen. Die ganze Zeit suchten sie angeblich nach biblischen Stätten und verfolgten alte Karawanenwege in einem Gebiet, das die Bibel die »Wüste Zin« nennt. Kaum jemand wusste, dass die archäologische Oberflächenbegehung eigentlich nur ein Deckmantel für eine britische militärische Vermessungsoperation war, bei der es um die Landwege ging, auf denen ein osmanisches Heer Ägypten im Falle eines Krieges erreichen könnte. Unabhängig von diesen militärischen Aufträgen wurde Lawrence’ und Woolleys Bericht über ihre Funde unter dem Titel The Wilderness of Zin 1915 vom PEF herausgegeben und wird noch heute von der Wissenschaft genutzt; 2003 hat der PEF einen Nachdruck mit einem neuen Vorwort und zusätzlichem historischen Material herausgebracht.
Als der Erste Weltkrieg endete, hatte sich die Biblische Archäologie seit ihren ersten Anfängen schon stark verändert, besonders |45|durch die Leistungen von Männern wie Petrie und Reisner. Allerdings steckte das Fach eigentlich noch immer in den Kinderschuhen und sollte bald noch weitere tiefgreifende Veränderungen erleben.