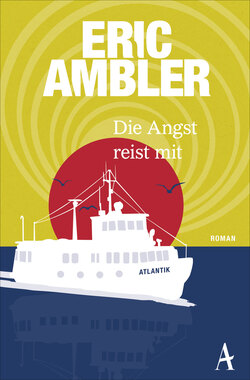Читать книгу Die Angst reist mit - Eric Ambler - Страница 5
1
ОглавлениеDer Dampfer Sestri Levante lag hoch aufragend am Pier. Stürmischer Wind vom Schwarzen Meer trug Schneeregen heran, der sogar auf das kleine Schutzdeck niederging. An der Achterluke waren die türkischen Schauerleute, mit Sackleinen über den Schultern, noch immer dabei, Fracht zu verladen.
Graham beobachtete, wie der Steward mit seinem Koffer durch eine Tür mit der Aufschrift Passeggeri verschwand, und wandte sich dann zur Seite, um zu sehen, ob die beiden Männer, die sich am Fuß der Gangway von ihm verabschiedet hatten, noch dort standen. Sie waren nicht mit an Bord gekommen, denn die Uniform, die einer der beiden trug, sollte keine Aufmerksamkeit auf Graham lenken. Jetzt gingen sie quer über die Gleise zu den Lagerhallen in Richtung Hafenausfahrt. Als sie den Schutz des ersten Schuppens erreicht hatten, drehten sie sich um. Graham hob den linken Arm, sie winkten zurück, eilten weiter und waren bald verschwunden.
Fröstelnd stand er da und starrte in den Dunst, der die Kuppeln und Minarette von Istanbul umfing. Durch das Rasseln und Rumpeln der Seilwinden rief der türkische Vorarbeiter in schlechtem Italienisch einem der Schiffsoffiziere etwas zu. Graham erinnerte sich wieder, dass man ihn gebeten hatte, bis zur Abfahrt des Schiffes in seiner Kabine zu bleiben. Er folgte dem Steward durch die Tür.
Der Mann wartete am Fuß einer kurzen Treppe auf ihn. Von den anderen neun Passagieren war nichts zu sehen.
»Cinque, signore?«
»Ja.«
»Da questa parte.«
Graham stieg hinter ihm hinunter.
Nummer fünf, eine Einzelkabine, ausgestattet mit einem Kleiderschrank und eingebautem Waschbecken, war so klein, dass er und sein Koffer gerade noch hineinpassten. Die Bullaugeneinfassung war mit Grünspan bedeckt, und es roch stark nach Farbe. Der Steward schob den Koffer unter das Bett und zwängte sich in den Flur hinaus.
»Favorisca darmi il suo biglietto ed il suo passaporto, signore. Li porterò al commissario.«
Graham reichte ihm Fahrkarte und Pass und bat ihn mit einer Handbewegung, das Bullauge zu öffnen.
»Subito, signore«, sagte der Steward und entfernte sich.
Graham setzte sich müde auf die Koje. Zum ersten Mal seit fast vierundzwanzig Stunden war er allein. Er nahm die bandagierte rechte Hand vorsichtig aus der Manteltasche und betrachtete den Verband. Sie pochte und schmerzte furchtbar. Wenn ein Streifschuss schon so wehtat, konnte er seinen Sternen danken, dass die Kugel ihn nicht richtig erwischt hatte.
Er sah sich in der Kabine um. Dass er dort saß, nahm er ebenso gleichmütig hin, wie er all die anderen Absurditäten hingenommen hatte, seit er in der Nacht zuvor in sein Hotel in Pera zurückgekehrt war. Irgendwie schien ihm nur, als hätte er etwas Wertvolles verloren. In Wahrheit hatte er nichts Wertvolleres verloren als einen Fetzen Haut und ein Stück Knorpel der rechten Hand. Er hatte erlebt, was Todesangst ist – mehr war nicht passiert.
Unter den Ehemännern der Freundinnen seiner Frau galt Graham als Glückspilz. Er hatte eine hochbezahlte Stellung bei einem großen Rüstungsbetrieb, ein schönes Haus im Grünen, das vom Büro nur eine Autostunde entfernt war, und eine allseits beliebte Frau. Nicht, dass er es nicht verdient hätte. Er war, auch wenn man es ihm nicht ansah, ein hervorragender Ingenieur, mit einer ziemlich wichtigen Arbeit sogar, wenn es stimmte, was man so hörte. Irgendetwas mit Kanonen. Er unternahm häufig Geschäftsreisen ins Ausland. Er war ein ruhiger, umgänglicher Mensch, der andere gern zu einem Whisky einlud. Die Vorstellung, man würde ihn näher kennenlernen, war natürlich abwegig (ob er schlechter Golf oder Bridge spielte, ließ sich schwer sagen), doch er war stets freundlich. Nicht überschwänglich, einfach freundlich, fast so wie ein teurer Zahnarzt, der einen abzulenken versucht. Eigentlich sah er auch wie ein teurer Zahnarzt aus: schlank und etwas vornübergebeugt, mit seinen gut geschnittenen Anzügen, seinem sympathischen Lächeln und dem schon leicht angegrauten Haar. Und obwohl kaum vorstellbar war, dass eine Frau wie Stephanie ihn auch ohne sein Geld geheiratet hätte, musste man zugeben, dass sie sich ausgezeichnet verstanden. Da sah man mal wieder …!
Graham selbst hielt sich ebenfalls für einen Glückspilz. Von seinem Vater, einem zuckerkranken Lehrer, hatte er als Siebzehnjähriger Gelassenheit, fünfhundert Pfund in bar aus einer Lebensversicherung sowie eine mathematische Begabung geerbt. Dank dieses Vermächtnisses hatte er klaglos einen unwilligen und mürrischen Vormund ertragen, den Studienplatz annehmen können, den eine Universität ihm angeboten hatte, und mit Mitte zwanzig sein naturwissenschaftliches Studium mit der Promotion abgeschlossen. Seine schriftliche Arbeit über ein ballistisches Problem war von einer Fachzeitschrift in gekürzter Form abgedruckt worden. Mit dreißig wurde er Chef der Entwicklungsabteilung in seiner Firma und war ganz überrascht, dass er für eine Tätigkeit, die ihm Spaß machte, so viel Geld bekam. Im selben Jahr heiratete er Stephanie.
Nie wäre er auf den Gedanken gekommen, zu behaupten, sein Verhältnis zu Stephanie unterscheide sich von dem anderer Männer zu ihren Frauen, mit denen sie zehn Jahre verheiratet sind. Er hatte Stephanie geheiratet, weil er der möblierten Zimmer überdrüssig war und (zu Recht) vermutete, dass sie ihn heiraten wollte, um von ihrem Vater wegzukommen, einem griesgrämigen und wenig begüterten Arzt. Sie gefiel ihm wegen ihres guten Aussehens, ihres Humors und ihrer Fähigkeit, mit Hausangestellten umzugehen und Freundschaften zu schließen, und wenn er ihre Freunde manchmal langweilig fand, suchte er die Schuld dafür eher bei sich als bei ihnen. Stephanie ihrerseits akzeptierte klaglos, dass ihm sein Beruf wichtiger war als alles andere. Sie lebten in einer Atmosphäre von freundlicher Zuneigung und gegenseitiger Toleranz und fanden, dass ihre Ehe so gut war, wie man es vernünftigerweise erwarten konnte.
Der Kriegsausbruch im September 1939 hatte kaum Auswirkungen auf Grahams Privatleben. Da er die vorangegangenen zwei Jahre in der Gewissheit verbracht hatte, dass der Krieg so unausweichlich war wie der Sonnenuntergang, reagierte er weder überrascht noch bestürzt, als es schließlich so weit war. Er hatte ganz genau überlegt, welche Folgen ein Krieg auf sein Privatleben haben würde, und im Oktober zeigte sich, dass seine Überlegungen korrekt gewesen waren. Für ihn bedeutete der Krieg nur zusätzliche Arbeit, nicht mehr. Weder seine wirtschaftliche noch seine private Sicherheit war betroffen. Er würde keinesfalls eingezogen werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein deutsches Bombenflugzeug seine Fracht irgendwo in der Nähe seines Hauses oder seines Arbeitsplatzes abladen würde, war so gering, dass man sie schon ignorieren konnte. Als er knapp drei Wochen nach Unterzeichnung des anglo-türkischen Beistandspakts hörte, dass er geschäftlich in die Türkei fahren sollte, betrübte ihn nur die Aussicht, Weihnachten nicht zu Hause sein zu können.
Seine erste Dienstreise ins Ausland hatte er mit zweiunddreißig unternommen. Es war ein großer Erfolg gewesen. Seine Chefs stellten fest, dass er nicht nur fachlich begabt war, sondern auch das bei einem Spezialisten wie ihm ungewöhnliche Talent besaß, ausländische Regierungsbeamte für sich einzunehmen. In den anschließenden Jahren waren gelegentliche Auslandsreisen Bestandteil seiner beruflichen Tätigkeit geworden. Er reiste gern. Das Unterwegssein selbst gefiel ihm fast ebenso sehr wie das Kennenlernen fremder Länder. Er kam gern mit Menschen anderer Nationalität zusammen, lernte Brocken ihrer Sprache und war immer wieder erstaunt, wie wenig er im Grunde verstand. Das Wort »typisch« stieß bei ihm inzwischen auf kräftige Abneigung.
Mitte November traf er – via Paris – mit dem Zug in Istanbul ein und fuhr sogleich nach Izmir und Gallipoli weiter. Ende Dezember hatte er seine Arbeit an diesen beiden Orten abgeschlossen, sodass er am 1. Januar mit dem Zug zurück nach Istanbul fuhr, um von dort aus die Heimreise anzutreten.
Es waren sechs anstrengende Wochen gewesen. Seine schwierige Aufgabe war insofern noch erschwert worden, als er sich über komplizierte technische Details mit Hilfe von Dolmetschern hatte verständigen müssen. Das furchtbare Erdbeben in Anatolien hatte ihn ähnlich erschüttert wie seine Gastgeber. Die Zugverbindung zwischen Gallipoli und Istanbul war wegen Überschwemmung zeitweilig unterbrochen. Erschöpft und deprimiert traf er schließlich in Istanbul ein.
Am Bahnhof wurde er von Kopejkin, dem Türkei-Repräsentanten seiner Firma, abgeholt.
Kopejkin, der 1924 zusammen mit fünfundsechzigtausend anderen Russen in die Türkei gekommen war, hatte sich als Falschspieler, Bordellbetreiber und Uniformlieferant für die türkische Armee durchgeschlagen, bevor er – warum, wusste nur der Chef – den lukrativen Posten bekam, den er gegenwärtig innehatte. Graham mochte diesen rundlichen, lebenslustigen Mann mit den großen Segelohren, der immer gute Laune hatte und außerordentlich gerissen war.
Enthusiastisch schüttelte er Graham die Hand. »War es eine schlimme Reise? Tut mir sehr leid. Schön, Sie wiederzusehen. Wie sind Sie mit Fethi zurechtgekommen?«
»Ganz gut. Nach Ihrer Beschreibung hatte ich ihn mir viel schlimmer vorgestellt.«
»Mein lieber Freund, Sie unterschätzen Ihre gewinnende Art. Er gilt allgemein als schwierig, ist aber ein wichtiger Mann. Hier wird jetzt alles reibungslos gehen. Über das Geschäftliche werden wir bei einem Glas reden. Ich habe Ihnen wie üblich ein Zimmer im Adler Palace reserviert. Für heute Abend habe ich ein Abschiedsessen arrangiert. Auf meine Kosten.«
»Sehr nett von Ihnen.«
»Es ist mir eine große Freude, mein Lieber. Anschließend werden wir uns ein wenig amüsieren. Es gibt hier einen Nachtclub, der zur Zeit sehr en vogue ist. Le Jockey Cabaret. Wird Ihnen gefallen. Ganz hübsch eingerichtet, und man trifft dort nur nette Leute. Keinen Nepp. Ist das Ihr Gepäck?«
Graham sank das Herz. Er hatte zwar damit gerechnet, dass er mit Kopejkin essen würde, sich aber fest vorgenommen, gegen zehn Uhr ein heißes Bad zu nehmen und mit einem Krimi ins Bett zu gehen. Sich im Jockey Cabaret oder sonst einem Nachtclub zu amüsieren, war das Letzte, wonach ihm der Sinn stand. Während sie dem Gepäckträger zu Kopejkins Auto folgten, sagte er: »Vielleicht sollte ich heute Abend früh zu Bett gehen, Kopejkin. Ich habe eine Zugfahrt von vier Tagen und Nächten vor mir.«
»Mein Freund, es wird Ihnen guttun, noch etwas aufzubleiben. Außerdem fährt Ihr Zug morgen erst um elf Uhr, und ich habe einen Schlafwagenplatz für Sie reserviert. Sie können bis Paris durchschlafen, wenn Sie müde sind.«
Beim Abendessen im Hotel Pera Palace sprach Kopejkin über den Krieg. Die Sowjets waren für ihn noch immer die »Julimörder« von Nikolaus II., endlos redete er von finnischen Siegen und russischen Niederlagen. Die Deutschen hatten weitere britische Schiffe versenkt und noch mehr U-Boote verloren. Die Holländer, Dänen, Schweden und Norweger vertrauten auf ihre Verteidigungsmaßnahmen. Die Welt rechnete mit einem blutigen Frühjahr. Dann sprachen sie über das Erdbeben. Um halb elf verkündete Kopejkin, dass es Zeit sei, ins Jockey Cabaret aufzubrechen.
Der Club lag in Beyoğlu, unweit der Grande Rue de Pera, in einer Straße, deren Häuser den Geist eines französischen Architekten der zwanziger Jahre ausstrahlten. Kopejkin nahm ihn freundschaftlich am Arm, als sie eintraten.
»Es ist sehr nett hier«, sagte er. »Serge, der Besitzer, ist ein Freund von mir. Man wird uns also nicht übers Ohr hauen. Ich werde Sie vorstellen.«
Für einen Mann seines Typs besaß Graham erstaunlich umfangreiche Kenntnisse von großstädtischem Nachtleben. Aus irgendeinem ihm unverständlichen Grund schienen seine ausländischen Gastgeber davon auszugehen, dass die einzige Form von Unterhaltung, die ein englischer Ingenieur akzeptierte, in eher zweifelhaften Kaschemmen zu suchen war. Solche Etablissements hatte er in Buenos Aires und in Madrid kennengelernt, in Valparaíso und Bukarest, in Rom und Mexiko, und er konnte sich an keines erinnern, das sich von den anderen unterschieden hätte. Er erinnerte sich an die Geschäftspartner, mit denen er bis in den frühen Morgen hinein dagesessen und unerhört teure Sachen getrunken hatte; aber die Bars selbst waren in seiner Erinnerung zum typischen Bild einer verqualmten Souterrainspelunke verschmolzen: auf der einen Seite das Podium für die Kapelle und eine kleine, von Tischen eingerahmte Tanzfläche, auf der anderen Seite ein Bartresen mit Hockern, wo die Getränke angeblich billiger waren.
Er rechnete nicht damit, dass das Le Jockey Cabaret anders aussehen würde. Er hatte recht.
Die futuristisch bemalten Wände mit ihren Darstellungen von windschiefen Wolkenkratzern, saxophonspielenden Schwarzen, grünen magischen Augen, Osterinselmasken, Telefonen und aschblonden Hermaphroditen mit langen Zigarettenspitzen schienen die Atmosphäre der Straße widerzuspiegeln. Es war gerammelt voll in dem Lokal und sehr laut. Serge, ein Russe mit scharf geschnittenem Gesicht und grauen Stoppelhaaren, trat so auf, als würden seine Gefühle ständig mit ihm durchgehen. Ein Blick in seine Augen verriet Graham, dass damit aber kaum zu rechnen war. Serge begrüßte sie höflich und führte sie zu einem Tisch neben der Tanzfläche. Kopejkin bestellte eine Flasche Cognac.
Die Kapelle, die sich mit einem amerikanischen Schlager abquälte, hörte abrupt auf und begann, einen Rumba zu spielen, was ihr mehr lag.
»Hier ist immer was los«, sagte Kopejkin. »Möchten Sie tanzen? Es gibt jede Menge Mädchen hier. Sagen Sie mir, welche Ihnen gefällt, dann spreche ich mit Serge.«
»Nein, nein, lassen Sie nur. Ich glaube, ich werde wirklich nicht lange bleiben.«
»Sie sollten nicht an Ihre Reise denken. Trinken Sie noch einen Cognac, dann fühlen Sie sich besser.« Er stand auf. »Ich werde jetzt mal tanzen und ein nettes Girl für Sie auftreiben.«
Graham fühlte sich nicht sehr wohl. Er hätte mehr Begeisterung zeigen müssen. Kopejkin bemühte sich schließlich. Es war bestimmt kein Vergnügen für ihn, einen übermüdeten Engländer zu unterhalten, der am liebsten im Bett liegen wollte. Er trank demonstrativ noch etwas Cognac. Immer mehr Gäste kamen. Er sah, wie Serge sie herzlich begrüßte und dann, sobald sie ihm den Rücken zugekehrt hatten, dem zuständigen Kellner verstohlen Anweisungen erteilte – eine kleine Erinnerung daran, dass er und sie nicht zum Vergnügen im Le Jockey Cabaret waren. Er drehte den Kopf zur Seite und sah Kopejkin beim Tanzen zu.
Das Mädchen war dünn und dunkel und hatte extrem große Zähne. Das rote Satinabendkleid schlotterte ihr am Leib, als wäre es für eine fülligere Frau angefertigt worden. Sie lächelte oft. Kopejkin hielt sie ein wenig auf Abstand und redete die ganze Zeit. Graham fand, dass Kopejkin, trotz seiner Leibesfülle, der einzige Mann auf der Tanzfläche war, der sich völlig ungezwungen bewegte. Da war der ehemalige Bordellbesitzer, der sich in einer vertrauten Atmosphäre befand. Als die Musik aufgehört hatte, brachte er das Mädchen zu ihrem Tisch.
»Das ist Maria«, sagte er. »Sie kommt aus Ägypten. Sieht man ihr nicht an, was?«
»Nein.«
»Sie spricht ein bisschen Französisch.«
»Enchanté, Mademoiselle.«
»Monsieur.« Ihre Stimme war überraschend heiser, aber ihr Lächeln war angenehm. Sie war offensichtlich gutmütig.
»Armes Kindchen!« Kopejkin klang wie eine Gouvernante, die hoffte, ihr Schützling werde sich vor den Gästen nicht danebenbenehmen. »Sie hat gerade eine Halsentzündung auskuriert. Aber sie ist ein nettes Mädchen und hat anständige Manieren. Assieds-toi, Maria!«
Sie setzte sich neben Graham. »Je prends du champagne«, sagte sie.
»Oui, mon enfant. Plus tard«, sagte Kopejkin vage. »Sie bekommt Provision, wenn wir Champagner bestellen«, bemerkte er zu Graham und schenkte ihr einen Cognac ein.
Sie nahm das Glas ohne Kommentar, hob es an die Lippen und sagte: »Skål!«
»Sie hält Sie für einen Schweden«, sagte Kopejkin.
»Wie kommt sie denn darauf?«
»Sie schwärmt für Schweden, also habe ich ihr erzählt, dass Sie ein Schwede sind.« Er lachte. »Sie können nicht behaupten, dass der türkische Repräsentant nichts für die Firma tut.«
Sie hatte ihnen mit verständnislosem Lächeln zugehört. Als die Musik dann wieder einsetzte, fragte sie Graham, ob er tanzen wolle. Sie tanzte gut, so gut, dass er selber fast glaubte, ein guter Tänzer zu sein. Er fühlte sich weniger deprimiert und forderte sie auch zum nächsten Tanz auf. Diesmal drückte sie ihren mageren Körper eng an den seinen. Er sah einen schmuddeligen Träger, der unter dem roten Satin hervorrutschte, und roch die Wärme ihres Körpers unter ihrem Parfüm. Er merkte, dass er schon genug von ihr hatte.
Sie fing an zu plaudern. Ob er Istanbul gut kenne? Ob er schon einmal hier gewesen sei? Ob er Paris kenne und London? Er sei wirklich zu beneiden. Sie sei in beiden Städten noch nicht gewesen, wolle aber unbedingt einmal dorthin. Nach Stockholm auch. Ob er viele Freunde in Istanbul habe? Unmittelbar nach ihm und seinem Freund sei nämlich ein Herr in die Bar gekommen, der ihn offenbar kenne. Denn er beobachte ihn.
Graham hatte sich schon überlegt, wie er möglichst bald hier wegkam. Plötzlich merkte er, dass sie auf eine Antwort von ihm wartete. Unbewusst hatte er ihre letzte Bemerkung aufgeschnappt.
»Wer beobachtet mich?«
»Wir können ihn jetzt nicht sehen. Der Herr sitzt an der Bar.«
»Bestimmt beobachtet er dich.« Ihm fiel nichts anderes ein.
Aber sie meinte es offensichtlich ernst. »Er ist an Ihnen interessiert, Monsieur. Der Herr dort mit dem Taschentuch in der rechten Hand.«
Sie befanden sich jetzt an einer Stelle der Tanzfläche, von wo aus er die Bar überblicken konnte. Der Mann saß auf einem Hocker und hatte ein Glas Wermut vor sich.
Es war ein kleiner, dünner Mann mit einem stumpfsinnigen, sehr knochigen Gesicht mit großen Nasenlöchern, hohen Wangenknochen und vollen Lippen, die er aufeinanderpresste, als hätte er Zahnweh oder als müsste er sich krampfhaft beherrschen. Er war ungewöhnlich bleich, sodass die kleinen, tiefliegenden Augen und die dünnen, lockigen Haare dunkler erschienen, als sie wirklich waren. Das Haar klebte ihm in Strähnen am Kopf. Er trug einen zerknitterten braunen Anzug, ein weiches Hemd und eine neue Krawatte. Während Graham ihn beobachtete, wischte er sich mit einem Taschentuch die Unterlippe ab, als mache ihm die Hitze in der Bar zu schaffen.
»Er sieht gerade nicht her«, sagte Graham. »Ich kenne ihn jedenfalls nicht.«
»Das glaube ich auch nicht, Monsieur.« Sie drückte seinen Arm mit dem Ellbogen an ihre Seite. »Aber ich wollte ganz sicher sein. Ich kenne ihn auch nicht, aber dieser Typ ist mir vertraut. Sie sind fremd hier, Monsieur, und Sie haben vielleicht Geld bei sich. Istanbul ist nicht Stockholm. Wenn solche Typen Sie mehr als einmal ansehen, sollte man aufpassen. Sie sind stark, aber ein Messer im Rücken kommt für einen starken Mann aufs Gleiche raus wie für einen schwachen.«
Ihre ernste Art war grotesk. Er lachte, sah aber noch einmal hinüber zu dem Mann, der mit einem Glas Wermut an der Bar saß. Eine harmlose Gestalt. Wahrscheinlich wollte das Mädchen ihm nur auf etwas tollpatschige Art klarmachen, dass sie selbst vertrauenswürdig sei.
Er sagte: »Ich glaube, ich brauche mir keine Sorgen zu machen.«
Der Druck auf seinem Arm ließ ein wenig nach. »Vielleicht.« Plötzlich schien sie das Thema nicht mehr zu interessieren. Die Kapelle hörte auf zu spielen, und sie kehrten zu ihrem Tisch zurück.
»Sie tanzt sehr gut, nicht?«, sagte Kopejkin.
»Sehr.«
Sie schenkte ihnen ein Lächeln, setzte sich und leerte durstig ihr Glas. Dann lehnte sie sich zurück. »Wir sind zu dritt«, sagte sie, mit dem Finger zählend, damit auch alle verstanden. »Soll ich eine Freundin von mir holen, dann können wir zu viert trinken? Sie ist sehr sympathisch. Sie ist meine beste Freundin.«
»Später, vielleicht«, sagte Kopejkin. Er schenkte ihr wieder ein.
In diesem Moment spielte die Kapelle einen Tusch, und die meisten Lichter gingen aus. Ein Scheinwerfer huschte über die freie Fläche vor dem Podium.
»Die Attraktionen«, sagte Maria, »sind sehr gut.«
Serge trat in den Lichtkegel, leierte eine lange Ansage auf Türkisch herunter und wies abschließend mit schwungvoller Geste auf eine Tür neben dem Podium. Daraufhin stürmten zwei junge Männer in hellblauem Smoking heraus und legten einen energischen Stepptanz hin. Bald japsten sie nach Luft, und ihre Haare waren zerzaust, aber am Ende bekamen sie nur lauwarmen Beifall. Dann klebten sie sich falsche Bärte an und spielten zwei torkelnde alte Männer. Die Begeisterung des Publikums hielt sich auch diesmal in Grenzen. Schweißgebadet – und ziemlich beleidigt, wie Graham fand – zogen sie ab. Dann trat eine langbeinige schwarze Schönheit auf, die eine artistische Nummer präsentierte. Ihre unbefangen obszönen Verrenkungen lösten Lachsalven aus. Auf Zurufe zeigte sie dann noch einen Schlangentanz, der ihr aber weniger gut gelang, da die Schlange, die so vorsichtig aus einem vergoldeten Weidenkorb hervorgeholt wurde, als handelte es sich um eine ausgewachsene Anakonda, sich als mickrige und ziemlich altersschwache Python herausstellte, die am liebsten in den Händen ihrer Herrin eingeschlafen wäre. Schließlich wurde sie in den Korb zurückgelegt, und die Farbige machte noch ein paar Verrenkungen, bevor sie verschwand. Dann trat der Besitzer wieder in das Scheinwerferlicht und machte eine Ansage, die mit Klatschen aufgenommen wurde.
Das Mädchen flüsterte Graham ins Ohr. »Jetzt sind Josette und ihr Partner José dran. Ein Paar aus Paris. Heute ist ihr letzter Abend. Sie hatten bombastischen Erfolg.«
Rosa Scheinwerferlicht schwenkte zur Eingangstür, ein Trommelwirbel ertönte, und während die Kapelle den Donauwalzer zu spielen begann, kamen die beiden Tänzer heraus.
Für den übermüdeten Graham war ihr Tanz ein genauso typisches Element eines Nachtclubs wie die Bar und das Podium für die Kapelle. Damit ließen sich die Getränkepreise rechtfertigen, und es bewies, dass ein kleiner, ungesund aussehender Mann mit einer breiten Schärpe um den Bauch unter Anwendung der Gesetze der klassischen Mechanik eine fünfzig Kilo schwere Frau wie ein Kind herumwirbeln konnte. Josette und ihr Partner waren nur insofern bemerkenswert, als sie ihre Standarddarbietungen keineswegs perfekt beherrschten, dafür aber sehr viel effektvoller vorführten.
Die Frau war schlank, hatte schöne Arme und Schultern und üppiges, blond schimmerndes Haar. Die Augen, deren schwere Lider beim Tanzen halb geschlossen waren, und die vollen, zu einem maskenhaft starren Lächeln verzogenen Lippen standen in einem merkwürdigen Widerspruch zu der Leichtigkeit ihrer Bewegungen. Graham sah, dass sie keine Tänzerin war, sondern eine Frau, die ihre Bewegungen einstudiert hatte und sie nun mit lasziver Sinnlichkeit vorführte, wobei sie sich voll auf die Wirkung ihres jugendlichen Körpers, ihrer langen Beine und des Spiels der Muskeln von Schenkeln und Bauch verließ. Wenn ihre Darbietung künstlerisch nicht überzeugte, als Attraktion im Le Jockey Cabaret war sie ein enormer Erfolg, und das trotz ihres Partners.
Der war ein dunkler, angestrengt wirkender Mann mit schmalen Lippen, einem blassen Gesicht und der irritierenden Angewohnheit, vor jeder größeren Kraftanstrengung die Zunge in die Backe zu klemmen. Er bewegte sich plump, und sooft er sich anschickte, seine Partnerin hochzuheben, wirkte der Griff seiner Hände unsicher, als wüsste er nicht genau, wo er anzusetzen hatte.
Doch das Interesse des Publikums galt nicht ihm, und am Ende ihrer Darbietung wurde laut nach einer Zugabe gerufen. Der Wunsch wurde erfüllt, die Kapelle spielte wieder einen Tusch, Mademoiselle Josette verbeugte sich, und Serge überreichte ihr einen Blumenstrauß. Sie kam mehrmals heraus, verbeugte sich und warf Kusshände.
»Sie ist wundervoll, nicht?«, sagte Kopejkin auf Englisch, als das Licht wieder anging. »Ich habe Ihnen ja versprochen, dass man hier prima unterhalten wird.«
»Sie ist nicht schlecht. Aber dieser mottenzerfressene Valentino kann einem leidtun.«
»José? Der kommt schon nicht zu kurz. Möchten Sie sie zu einem Drink einladen?«
»Sehr gern. Aber wird das nicht ziemlich teuer?«
»Um Himmels willen, nein. Sie kriegt keine Provision.«
»Wird sie denn kommen?«
»Natürlich. Serge hat mich ihr vorgestellt. Ich kenne sie gut. Sie könnte Ihnen gefallen. Diese Ägypterin ist ein bisschen dumm. Josette ist sicher auch dumm, aber auf ihre Weise sehr anziehend. Wenn ich als junger Mensch nicht so viel gelernt hätte, würde ich mich selber in sie vergucken.«
Maria sah ihm hinterher, als er über die Tanzfläche ging, und schwieg einen Moment. Dann sagte sie: »Er ist in Ordnung, Ihr Freund.«
Graham war nicht ganz sicher, ob es eine Feststellung, eine Frage oder ein kläglicher Versuch war, Konversation zu machen. Er nickte. »Ja.«
Sie lächelte. »Er kennt den Besitzer. Wenn Sie wünschen, wird er Serge bitten, dass er mich gehen lässt, wenn Sie es wollen, und nicht erst, wenn hier geschlossen wird.«
Er lächelte so bedauernd, wie er nur konnte: »Tut mir leid, Maria, ich muss noch packen. Mein Zug geht morgen früh.«
Sie lächelte wieder. »Macht nichts. Schweden finde ich besonders nett. Kann ich noch etwas Cognac haben, Monsieur?«
»Sicher.« Er füllte ihr Glas.
Sie trank es halb leer. »Gefällt Ihnen Mademoiselle Josette?«
»Sie tanzt sehr gut.«
»Sie ist sehr sympathisch. Weil sie Erfolg hat. Erfolgreiche Menschen sind sympathisch. José findet niemand sympathisch. Er ist ein Spanier aus Marokko und furchtbar eifersüchtig. Sie sind alle gleich. Ich weiß nicht, wie sie zu ihm steht.«
»Hast du nicht gesagt, sie sind aus Paris?«
»Sie sind in Paris aufgetreten. Josette ist aus Ungarn. Sie spricht Deutsch, Spanisch, Englisch, aber ich glaube, kein Schwedisch. Sie hat viele reiche Liebhaber gehabt.« Sie machte eine Pause. »Sind Sie Geschäftsmann, Monsieur?«
»Nein, Ingenieur.« Amüsiert stellte er fest, dass Maria nicht so dumm war, wie er zuerst dachte, und dass sie genau wusste, weshalb Kopejkin verschwunden war. Indirekt, aber unmissverständlich machte sie ihn darauf aufmerksam, dass Mademoiselle Josette sehr teuer sei, dass es schwierig sei, mit ihr zu kommunizieren, und dass er es mit einem eifersüchtigen Spanier zu tun haben werde.
Sie leerte ihr Glas und starrte in Richtung Bar. »Meine Freundin sieht so einsam aus«, sagte sie. Sie schaute ihm direkt in die Augen. »Schenken Sie mir hundert Piaster, Monsieur?«
»Wofür denn?«
»Trinkgeld, Monsieur.« Sie lächelte, allerdings nicht mehr so freundlich wie bisher.
Er gab ihr einen Hundertpiasterschein. Sie faltete ihn zusammen, steckte ihn in ihr Handtäschchen und stand auf. »Bitte entschuldigen Sie mich. Ich möchte mit meiner Freundin sprechen. Wenn Sie es wünschen, komme ich wieder.« Sie lächelte.
Ihr rotes Satinkleid verschwand in der Menge. Fast im selben Moment kehrte Kopejkin zurück.
»Wo ist die Ägypterin?«
»Sie wollte mit ihrer Freundin sprechen. Ich habe ihr hundert Piaster gegeben.«
»Hundert! Fünfzig hätten völlig gereicht. Aber was soll’s. Josette bittet uns zu einem Drink in ihre Garderobe. Sie reist morgen ab und möchte nicht herauskommen. Jeder würde sie ansprechen, und sie muss noch packen.«
»Stören wir dann nicht?«
»Mein Lieber, sie will Sie unbedingt kennenlernen. Sie hat Sie während ihres Auftritts gesehen. Sie war sehr erfreut, als ich ihr sagte, dass Sie Engländer sind. Den Cognac können wir hier stehen lassen.«
Mademoiselle Josettes Garderobe maß etwa drei mal drei Meter und war durch einen braunen Vorhang von der anderen Hälfte abgetrennt, in der sich anscheinend das Büro des Besitzers befand. Eine ausgeblichene rosarote Tapete mit blauen Streifen bedeckte die drei Wände. Hier und da ein dunkler Fleck, wo sich die Leute angelehnt hatten. Zwei Bugholzstühle standen im Zimmer sowie zwei wacklige Schminktische voller Cremetiegel und benutzter Make-up-Tücher. Es roch nach einer Mischung aus kaltem Rauch, Puder und muffiger Polsterung.
Auf ein brummiges »Entrez!« von José traten sie ein, woraufhin er sich von seinem Schminktisch erhob, sich noch einmal übers Gesicht wischte und das Zimmer verließ, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Kopejkin zwinkerte Graham aus einem unerfindlichen Grund zu. Josette tupfte sich, vorgebeugt auf ihrem Stuhl sitzend, mit einem feuchten Wattebausch eifrig eine Augenbraue. Sie hatte ihr Kostüm abgelegt und trug einen rosafarbenen Samtmorgenmantel. Das Haar hing locker herab, als hätte sie es ausgeschüttelt und gekämmt. Graham fand, dass sie wunderschönes Haar hatte. Sie begann jetzt auf Englisch zu sprechen, langsam und sorgfältig, und die Worte mit dem Wattebausch zu unterstreichen.
»Bitte entschuldigen Sie. Es ist die grässliche Schminke. Es … Merde!«
Sie warf den Wattebausch ungeduldig hin, erhob sich plötzlich und wandte ihnen das Gesicht zu.
Im kalten Licht der nackten Glühbirne, die über ihr hing, sah sie kleiner aus als auf der Tanzfläche und auch etwas hagerer. Graham dachte an die blühende Schönheit seiner Stephanie und sagte sich, dass die Frau, die da vor ihm stand, in zehn Jahren wahrscheinlich reizlos sein würde. Andere Frauen pflegte er mit Stephanie zu vergleichen. Mit dieser meist recht erfolgreichen Methode brauchte er sich nicht einzugestehen, dass andere Frauen ihn nach wie vor interessierten. Josette war jedoch ungewöhnlich. Wie sie in zehn Jahren aussehen mochte, spielte keine Rolle. Im Moment war sie eine überaus attraktive, selbstbewusste Frau mit weichem, lächelndem Mund, leicht hervorstehenden blauen Augen und von elektrisierender Laszivität.
»Das, meine liebe Josette«, sagte Kopejkin, »ist Mr. Graham.«
»Ihr Auftritt hat mir sehr gefallen, Mademoiselle«, sagte Graham.
»Das hat Kopejkin mir schon erzählt«, sagte sie achselzuckend. »Es hätte besser sein können, aber es ist sehr nett von Ihnen, mir dieses Kompliment zu machen. Zu behaupten, Engländer seien nicht höflich, ist Unsinn.« Sie machte eine ausholende Handbewegung. »Ich kann Sie kaum einladen, in diesem Chaos Platz zu nehmen, aber vielleicht versuchen Sie, es sich irgendwie bequem zu machen. Kopejkin kann sich auf Josés Stuhl dort setzen, und wenn Sie Josés Sachen beiseiteräumen, können Sie die Ecke des Tisches nehmen. Zu schade, dass wir uns nicht draußen hinsetzen können, aber es gibt so viele Männer, die großes Getue machen, wenn man nicht stehen bleibt und sich zu einem Glas Champagner einladen lässt. Der Champagner hier ist grauenhaft. Ich möchte nicht mit Kopfschmerzen aus Istanbul abreisen. Wie lange bleiben Sie noch, Mr. Graham?«
»Ich reise ebenfalls morgen ab.« Sie amüsierte ihn. Ihre Posen waren grotesk. Binnen einer Minute war sie eine große Schauspielerin, die wohlhabende Freunde empfing, eine sympathische Frau von Welt, und dann wieder die geniale, desillusionierte Tänzerin. Jede Bewegung, jede Geste war auf Wirkung bedacht. Sie schien immer noch zu tanzen.
Und dann wurde sie ernst. »Es ist furchtbar, dieses Herumreisen. Und Sie kehren zurück in Ihren Krieg. Es ist schlimm. Diese Nazis. Was für ein Jammer, dass es immer Kriege geben muss. Wenn es keine Kriege sind, dann Erdbeben. Immer Tod. Es ist schlecht für das Geschäft. Der Tod interessiert mich nicht. Kopejkin vermutlich schon. Wahrscheinlich weil er Russe ist.«
»Ich denke nicht an den Tod«, sagte Kopejkin. »Ich denke nur daran, ob der Kellner mir die bestellten Getränke bringt. Nehmen Sie eine Zigarette?«
»Ja, gern. Die Kellner hier sind schrecklich. In London gibt es bestimmt viel bessere Nachtlokale als hier, Mr. Graham.«
»Die Kellner sind auch dort ganz miserabel. Kellner sind vermutlich überall schlecht. Aber ich hätte angenommen, dass Sie schon mal in London waren. Ihr Englisch …«
Nachsichtig lächelte sie über diese Indiskretion, deren Tragweite ihm nicht klar sein konnte. Ebenso gut hätte man Madame Pompadour fragen können, wer für ihre Rechnungen aufkam. »Ich habe es von einem Amerikaner in Italien gelernt. Ich finde die Amerikaner sehr sympathisch. Sie sind clevere Geschäftsleute und trotzdem so großzügig und offen. Es ist sehr wichtig, offen zu sein. Hat es Ihnen Spaß gemacht, mit der kleinen Maria zu tanzen, Mr. Graham?«
»Sie tanzt ganz gut. Sie scheint Sie sehr zu bewundern. Sie sagt, dass Sie hier großen Erfolg hatten. Was natürlich stimmt.«
»Großen Erfolg? Hier?« Das desillusionierte Genie hob die Augenbrauen. »Hoffentlich haben Sie ihr ein anständiges Trinkgeld gegeben, Mr. Graham.«
»Er hat ihr doppelt so viel wie nötig gegeben«, sagte Kopejkin. »Ah, da sind die Drinks.«
Sie sprachen eine Weile über Leute, die Graham nicht kannte, und über den Krieg. Er merkte, dass sie hinter ihrer Pose eine aufgeweckte und clevere Person war, und überlegte, ob der Amerikaner in Italien seine »Offenheit« vielleicht bedauert hatte. Nach einer Weile erhob Kopejkin das Glas.
»Ich trinke«, sagte er pathetisch, »auf Ihre beiden Reisen.« Plötzlich stellte er das Glas ab, ohne daraus getrunken zu haben. »Nein, das ist absurd«, sagte er missmutig. »Mein Trinkspruch kommt nicht von Herzen. Ich finde es einfach schade, dass es zwei Reisen gibt. Sie fahren beide nach Paris. Sie sind beide Freunde von mir, und deswegen haben Sie« – er tätschelte sich den Bauch – »vieles gemeinsam.«
Graham lächelte und bemühte sich, kein allzu verdutztes Gesicht zu machen. Sie war zweifellos sehr attraktiv, und es war angenehm, ihr gegenüberzusitzen, wie in diesem Moment. Dass aus der Bekanntschaft aber mehr werden könnte, auf diese Idee war er einfach nicht gekommen. Er war verwirrt. Er sah, dass sie ihn amüsiert beobachtete, und hatte das unangenehme Gefühl, dass sie genau wusste, was ihm durch den Kopf ging.
Er versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. »Das wollte ich auch schon vorschlagen. Sie hätten es mir überlassen sollen, Kopejkin. Mademoiselle wird sich fragen, ob ich so ehrlich bin wie ein Amerikaner.« Er lächelte sie an. »Ich fahre morgen Vormittag um elf.«
»Erster Klasse, Mr. Graham?«
»Ja.«
Sie machte ihre Zigarette aus. »Dann können wir aus zwei simplen Gründen nicht zusammen reisen. Ich nehme einen anderen Zug und reise ohnehin zweiter Klasse. Ist vielleicht ganz gut so. José würde die ganze Zeit mit Ihnen Karten spielen wollen, und Sie würden Ihr Geld verlieren.«
Offensichtlich wollte sie, dass ihre Gäste austranken und gingen. Graham war eigentümlich enttäuscht. Er wäre gern noch geblieben. Außerdem wusste er, dass er sich ungeschickt benommen hatte.
»Vielleicht können wir uns ja in Paris treffen«, sagte er.
»Vielleicht.« Sie erhob sich und lächelte ihn an. »Ich werde im Hôtel des Belges in der Nähe der Trinité wohnen, wenn es noch existiert. Ich würde mich freuen, Sie wiederzusehen. Kopejkin sagt, Sie sind ein bekannter Ingenieur.«
»Kopejkin übertreibt immer – so wie er übertrieben hat, als er sagte, dass wir Sie nicht stören. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise.«
»Es war sehr schön, Sie kennenzulernen. Es war nett von Ihnen, Kopejkin, mir Graham vorzustellen.«
»Es war seine Idee«, sagte Kopejkin. »Adieu, meine liebe Josette, und bon voyage. Wir würden gern noch bleiben, aber es ist schon spät, und ich bestehe darauf, dass Mr. Graham etwas Schlaf bekommt. Wenn ich es nicht verhindere, würde er so lange mit Ihnen plaudern, dass er seinen Zug verpasst.«
Sie lachte. »Sie sind nett, Kopejkin. Wenn ich das nächste Mal nach Istanbul komme, werden Sie es als Erster erfahren. Auf Wiedersehen, Mr. Graham, und gute Reise!« Sie reichte ihm die Hand.
»Das Hôtel des Belges bei der Trinité«, sagte er, »ich werde daran denken.« Es war etwas weniger als die Wahrheit. In den zehn Minuten, die sein Taxi von der Gare de L’Est bis zur Gare St.-Lazare unterwegs war, würde er vermutlich daran denken.
Sanft drückte sie seine Hand. »Bestimmt«, sagte sie. »Adieu, Kopejkin. Sie finden hinaus?«
»Ich glaube«, sagte Kopejkin, während sie auf die Rechnung warteten, »ich glaube, ich bin ein bisschen enttäuscht von Ihnen, mein Freund. Sie haben einen ausgezeichneten Eindruck auf sie gemacht. Sie hätten sie mühelos haben können. Sie hätten sie nach der Abfahrtszeit ihres Zuges fragen müssen.«
»Ich bin ganz sicher, dass ich keinen Eindruck auf sie gemacht habe. Offen gestanden, ich war verlegen. Mit dieser Sorte Frau kann ich nicht umgehen.«
»Diese Sorte Frau, wie Sie es nennen, liebt Männer, die ein bisschen schüchtern sind. Ihre Unsicherheit war anziehend.«
»Du lieber Himmel! Na, immerhin habe ich gesagt, dass ich mich in Paris mit ihr treffen werde.«
»Mein Freund, ihr ist völlig klar, dass Sie nicht die leiseste Absicht haben, sich in Paris mit ihr zu treffen. Schade. Sie ist wirklich etwas Besonderes. Ich weiß das. Sie hatten die besten Chancen, aber Sie wollten es nicht wahrhaben.«
»Mein Gott, Sie scheinen zu vergessen, dass ich verheiratet bin.«
Kopejkin warf die Hände in die Luft. »Typisch englisch! Was soll man dazu sagen. Man kann nur dastehen und sich wundern.« Er seufzte tief. »Da kommt die Rechnung.«
Beim Hinausgehen kamen sie an Maria vorbei, die mit ihrer besten Freundin, einer melancholisch dreinblickenden Türkin, an der Bar saß. Sie schenkte ihnen ein Lächeln. Graham fiel auf, dass der Mann im zerknitterten braunen Anzug verschwunden war.
Draußen auf der Straße war es kalt. Der Wind pfiff durch die Telefonleitungen, die an den Häuserwänden befestigt waren. Um drei Uhr früh wirkte die Stadt Suleimans des Prächtigen wie ein Bahnhof nach Betriebsschluss.
»Es wird bald schneien«, sagte Kopejkin. »Ihr Hotel ist ganz in der Nähe. Wir werden zu Fuß dorthin gehen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ich wünsche Ihnen«, fuhr er fort, »dass Ihnen unterwegs Schneefälle erspart bleiben. Letztes Jahr wurde der Simplon-Orient-Express in der Nähe von Saloniki drei Tage lang aufgehalten.«
»Ich werde eine Flasche Cognac mitnehmen.«
Kopejkin brummte. »Trotzdem beneide ich Sie nicht um Ihre Reise. Vielleicht werde ich alt. Außerdem, in dieser Jahreszeit zu verreisen …«
»Och, ich bin ein geübter Reisender. Ich langweile mich nicht so schnell.«
»Ich habe nicht an Langeweile gedacht. In Kriegszeiten können viele unangenehme Dinge passieren.«
»Sicher.«
Kopejkin knöpfte sich den Mantelkragen zu. »Um Ihnen nur ein Beispiel zu geben … Während des letzten Krieges fuhr ein österreichischer Freund von mir, der in Zürich geschäftlich zu tun gehabt hatte, nach Berlin zurück. In seinem Abteil saß ein Mann, der sich als Schweizer aus Lugano ausgab. Während der Fahrt kamen die beiden ins Gespräch. Der Schweizer erzählte von seiner Frau und seinen Kindern, von der Firma und seinem Zuhause. Er schien ganz sympathisch zu sein. Kurz hinter der Grenze hielt der Zug an einem kleinen Bahnhof, Soldaten und Polizisten stiegen ein und verhafteten den Schweizer. Mein Freund musste ebenfalls aussteigen, da er im selben Abteil saß. Er hatte keine Angst. Er war ein guter Österreicher, und seine Papiere waren in Ordnung. Doch der Mann aus Lugano war sehr erregt. Er wurde bleich und schrie wie ein Kind. Später erfuhr mein Freund, dass der Mann kein Schweizer war, sondern ein italienischer Spion, und dass er erschossen wurde. Meine Frau war ganz schockiert. Wissen Sie, man spürt immer, wenn jemand über etwas redet, was ihm lieb ist, und dieser Mann hatte zweifellos die Wahrheit über seine Frau und seine Kinder gesagt. Es stimmte alles, bis auf einen Punkt: Sie lebten nicht in der Schweiz, sondern in Italien. Krieg«, sagte Kopejkin pathetisch, »ist etwas Hässliches.«
»Richtig.« Sie hatten das Hotel Adler Palace erreicht. »Kommen Sie noch auf ein Glas herein?«
Kopejkin schüttelte den Kopf. »Netter Vorschlag von Ihnen, aber ich muss schlafen gehen. Ich fühle mich jetzt schuldig, weil ich so lange mit Ihnen aus war. Unser gemeinsamer Abend hat mir aber Spaß gemacht.«
»Mir auch. Ich danke Ihnen.«
»Es war mir ein Vergnügen. Wir brauchen uns jetzt noch nicht zu verabschieden. Ich bringe Sie morgen Vormittag zum Zug. Könnten Sie um zehn Uhr fertig sein?«
»Gewiss.«
»Also dann, gute Nacht, mein Freund.«
»Gute Nacht, Kopejkin.«
Graham ging hinein, ließ sich an der Rezeption seinen Schlüssel geben und bat den Nachtportier, ihn um acht Uhr zu wecken. Und da nachts kein Lift fuhr, stieg er müde die Treppe hinauf bis in den zweiten Stock.
Sein Zimmer lag am Ende des Flurs. Er steckte den Schlüssel ins Schloss, drehte ihn um, öffnete die Tür und tastete mit der rechten Hand nach dem Lichtschalter an der Wand.
Im nächsten Moment zuckte ein Blitz durch das Dunkel, und es gab einen ohrenbetäubenden Knall. Ein Stück Putz von der Wand neben ihm traf seine Wange. Ehe er sich rühren oder auch nur denken konnte, blitzte und krachte es erneut, und ihm war, als würde ein Stück weiß glühendes Metall an seinen Handrücken gedrückt. Er schrie vor Schmerz und wankte nach vorn, aus dem Licht des Flurs in das Dunkel seines Zimmers. Abermals ging ein Schuss los, und ein Stück Putz fiel zu Boden.
Dann war Stille. Zusammengekauert lehnte er an der Wand neben dem Bett, seine Ohren sangen vom Krach der Detonationen. Er sah undeutlich, dass das Fenster offen stand und sich jemand dort bewegte. Seine Hand schien wie taub, aber zwischen den Fingern spürte er Blut.
Er rührte sich nicht. Sein Schädel dröhnte. Pulverdampf lag in der Luft. Und als sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah er, dass die Gestalt am Fenster verschwunden war.
Er wusste, dass neben seinem Bett noch ein zweiter Lichtschalter war. Mit der linken Hand tastete er sich an der Wand entlang. Dann berührte er das Telefon. Ohne recht zu wissen, was er tat, nahm er den Hörer.
Er hörte ein Klicken, sobald der Nachtportier die Verbindung hergestellt hatte.
»Zimmer sechsunddreißig«, sagte er und registrierte überrascht, dass er brüllte. »Es ist etwas passiert. Ich brauche Hilfe.«
Er legte den Hörer auf, stolperte ins Badezimmer und machte dort Licht. Aus einer großen Schramme quer auf dem Handrücken floss Blut. Durch die Wellen von Übelkeit, die ihn erfassten, hörte er Türengeräusche und aufgeregte Stimmen im Korridor. Jemand hämmerte an seine Zimmertür.