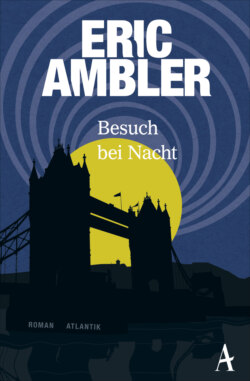Читать книгу Besuch bei Nacht - Eric Ambler - Страница 3
1
ОглавлениеDie wöchentliche Dakota aus Selampang war meines Wissens noch nie vor Mittag auf der Rollbahn im Tal gelandet oder vor eins zum Rückflug gestartet. Nach der Abschiedsparty, die man mir am Abend zuvor gegeben hatte, hätte ich mindestens bis elf schlafen müssen. Aber nein; bei Morgengrauen war ich hellwach, hatte gepackt und mich reisefertig gemacht.
Nicht dass ich viel zu packen gehabt hätte. Die meisten von meinen Sachen – die weiten, dhobi-zerschlissenen Hosen und Buschhemden, die Moskitostiefel und die schweißverschmutzten Hüte – hatte ich samt meinem Feldbett Kusumo gegeben, der während der letzten drei Jahre mein Diener gewesen war. Die wenigen Dinge, die noch übrig blieben – Schuhe, ein paar weiße Hemden, Unterwäsche und andere persönliche Kleinigkeiten –, waren leicht in einen kleinen Metallkoffer gegangen. Den einzigen Anzug, den ich besaß, hatte ich an. Ich war so einfältig gewesen, ihn bei einem Versandhaus in Singapur zu bestellen, und er hing an mir wie ein Duschvorhang. Aber an diesem Morgen war mir egal, wie ich aussah; und wie lange ich auf die Maschine zu warten hatte, war mir ebenfalls egal. Hauptsache war damals für mich, dass meine Abreise feststand und dass ich in meiner Brusttasche außer meinem Pass und einem Ticket für einen BOAC-Qantas-Flug von Djakarta nach London einen Brief hatte – das Avis von der Zweigstelle der Hongkong and Shanghai Bank in Singapur, die mir mitteilte, dass mir mit Erfüllung meines Vertrages als beratender Ingenieur beim North Sunda Power and Irrigation Project die Summe von achtundfünfzigtausendachthundertundsechsundneunzig Straits-Dollar gutgeschrieben worden war.
Kurz nach elf lieh ich mir einen von den Jeeps der Wartungsstelle und fuhr hinüber zum Büro des leitenden Ingenieurs, um good-bye zu sagen.
Jetzt, da ich wegfuhr, konnte ich die Gegend mit freundlicheren Augen sehen. Als der Jeep über den Knüppelweg an den neuen attap-Häusern und der Reihe von Nissenhütten, wo die europäischen Arbeitskräfte wohnten, vorbeiratterte, empfand ich sogar etwas Stolz auf das Geleistete.
Es war ein Colombo-Plan-Projekt, und an Finanzierungskapital vonseiten der Amerikaner und des britischen Commonwealth hatte es nicht gefehlt. Aber um in einer Gegend wie dem Tangga-Tal Dämme zu bauen, ist mehr vonnöten als Geld und guter Wille. Als ich mit dem Vortrupp auf dem Gelände angekommen war, hatte es nichts gegeben als Sümpfe und Dschungel, Blutegel und eine Kolonie von Sechsmeterpythons. Es verging fast ein Monat, bis das Unternehmen seine ersten zwei Bulldozer von der Küste heraufgeschafft hatte. Und im ersten Jahr hatten wir gleich nach dem Hereinbrechen des Monsuns die gesamte Ausrüstung stehen lassen und auf höheres Gelände ziehen müssen, um am Leben zu bleiben. Doch jetzt war auf dem Baugelände ein Camp von der Größe einer Kleinstadt, es gab eine Rollbahn, und dort, wie ein Keil in der Engstelle des Tales, die ungeheure Masse aus Stein und Stahl und Beton, das Herzstück des ganzen Projekts. Durch diesen Damm war es möglich geworden, an die zweihundert Quadratmeilen Buschland unten am Tangga-Delta in fruchtbare padi-Felder zu verwandeln. Dieses Jahr würde Sunda zum ersten Mal einen Überschuss an Reis haben, der an die benachbarten Inseln von Indonesien verkauft werden konnte. Und wenn das Kraftwerk unterhalb des Dammes fertig sein würde, wenn die Hochspannungsleitungen erst einmal anfingen, sich in die zinn- und wolframhaltigen Gebiete im Norden zu erstrecken, war noch gar nicht abzusehen, wie reich der junge Staat noch werden würde. Das Tangga-Tal-Modell war etwas, worauf man stolz sein konnte. Meine persönlichen Beweggründe, nach Sunda zu gehen, waren durchaus nicht edel oder selbstlos gewesen. Für drei Jahre Arbeit im Tangga-Tal hatte man mir so viel gezahlt – und zwar steuerfrei –, wie ich in England in zehn Jahren verdient hätte. Doch davon abgesehen, war der Job auch an sich befriedigend gewesen. Wohl hing mir Sunda zum Hals heraus, und zweifellos war ich froh, abreisen zu können, aber ich hatte die Sundanesen lieb gewonnen und freute mich, ihnen nützlich gewesen zu sein.
Im Büro des leitenden Ingenieurs waren bereits zwei andere Männer, als ich den Kopf zur Tür hineinstreckte, aber Gedge winkte mich herein.
»Setz dich, Steve. Wir sind gleich fertig.« Er drehte sich um und fuhr fort mit dem, was er zu sagen hatte. »Also, Major Suparto, lassen Sie uns das klarstellen …«
Ich setzte mich und hörte zu.
Gedge, vom Unternehmen als Bauleiter eingesetzt, war ein sehr fähiger und erfahrener südafrikanischer Bauingenieur, der den größten Teil seines Arbeitslebens im Osten verbracht hatte, und zwar von sich aus. Viele Jahre hatte er in China gearbeitet und dann, seit dem chinesisch-japanischen Krieg, in Indien und Pakistan. Er hatte dort kein Geheimnis daraus gemacht, dass er Asiaten den Menschen seiner eigenen Rasse vorzog, nicht nur als Arbeitskollegen, sondern auch als Freunde. Bei den Europäern hieß es natürlich, er sei exzentrisch, und von Zeit zu Zeit kursierten Gerüchte über ihn – er sympathisiere mit dem Kommunismus oder er halte sich sechs eurasische Konkubinen oder er sei heimlich Buddhist geworden.
Momentan jedoch waren seine Gefühle für seine asiatischen Mitarbeiter alles andere als freundschaftlich. Er hatte Ärger mit ihnen. Und wirklich, seit Major Suparto vor sechs Monaten mit seinen fünf Bruder-Offizieren aus Selampang eingetroffen war, hatte es praktisch nichts als Ärger gegeben.
Sunda war früher ein Teil Niederländisch-Ostindiens. 1942 wurde es von den Japanern besetzt. Als drei Jahre später die Holländer zurückkamen, sahen sie sich einer sundanesischen »Befreiungsarmee« gegenüber und standen vor der Forderung nach Unabhängigkeit, der sie schließlich nachgeben mussten. 1949 wurde Sunda eine Republik.
Der Augenblick der größten Schwierigkeit für alle revolutionären Führer scheint der Augenblick des Erfolgs zu sein; der Augenblick, in dem sie – eben noch Rebellen im Konflikt mit den Herrschenden – selber plötzlich die Herrschenden geworden sind; in dem die Kämpfer, die den Sieg herbeigeführt haben, erwartungsvoll und ungeduldig ihre Belohnung einfordern. Es ist leichter, eine Befreiungsarmee zu rekrutieren, als sie zu entwaffnen und aufzulösen.
Zuerst sah es aus, als wüsste die provisorische Regierung der neuen Republik von Sunda sich recht klug aus dieser Verlegenheit zu helfen. Eine Politik des Abmarsches wurde betrieben, um den esprit de corps zu brechen. Keine Einheit als solche wurde aufgelöst. Männer aus denselben Gebieten wurden zusammengefasst und dann in ihre jeweiligen Gebiete zurücktransportiert, bevor sie entwaffnet und demobilisiert wurden. Inzwischen baute die Regierung schnell die kleine reguläre Armee auf, auf der in der Zukunft ihre Autorität beruhen sollte, und setzte sie gegen alle früheren Mitkämpfer ein, die noch auf dem Kriegspfad waren. Und das waren natürlich einige; besonders jüngere Soldaten, die sich oft zusammenrotteten und die Menschen in den Dörfern terrorisierten. Aber diese Art Banditentum hatte kaum politische Bedeutung. Nach der Unabhängigkeitserklärung Präsident Nasjahs schien ein paar Monate lang alles ganz gut zu gehen.
Unglücklicherweise hatte das Problem eine Seite, die von der Regierung übersehen worden war. In ihrem ängstlichen Bestreben, die Mannschaften und Unteroffiziere heimzuschicken, hatte sie versäumt, sich Gedanken darüber zu machen, wie die Offiziere abzuschieben seien; und als sie die Schwere dieses Fehlers erkannte, war es zu spät, um ihn wiedergutzumachen.
Es gab mehrere Hundert von diesen überschüssigen Offizieren; viel mehr, als die reguläre Armee oder der neue Polizeiapparat in vernünftiger Weise hätte absorbieren können. Hinzu kam, dass viele nicht Offiziere im üblichen Wortsinn – also Männer von ausgeprägter Loyalität – waren, sondern Guerillaführer und Exbanditen, die gegen die japanische Besatzungsmacht sowohl gekämpft als auch mit ihr kollaboriert hatten, bevor sie sich dann bei den holländischen Kolonialtruppen genauso verhielten. Es stand also zu erwarten, dass sie anfangen würden, die neue Regierung in Selampang zu bekämpfen, wenn das verheißene Utopia nicht sofort Wirklichkeit werden würde; oder wenn sie mit ihrem Beuteanteil oder ihren neuen Posten nicht mehr zufrieden wären. Machiavelli meinte, der kluge Usurpator solle, sobald er an die Macht komme, gegen seine ehrgeizigen Anhänger Anklagen erfinden und sie beseitigen lassen, bevor sie übermütig werden können. Aber so umsichtig oder praktisch veranlagt ist nicht jeder Politiker.
Obwohl die Gefahr bereits manifest geworden war, wurde sie von der Nasjah-Regierung unterschätzt. In der Auseinandersetzung mit wichtigen Tagesproblemen der Verwaltung und eingespannt in den politischen Kampf, der um die neue Verfassung geführt wurde, meinte sie, gerade in diesem Augenblick keine Zeit zu haben, sich mit den kleinen Unzufriedenen abzugeben. Zweifellos musste bald etwas getan werden, aber nicht jetzt. Mit der besonderen Unschuld von Politikern, die ans Ruder gekommen sind, nahmen sie sogar an, die überschüssigen Offiziere würden den Führern der Republik die Treue halten, solange sie nur weiterhin ihren Sold und ihre Sonderzulagen beziehen würden. Hatten diese Männer nicht gekämpft, um das alles erst möglich zu machen? Waren sie im Grunde nicht Patrioten?
Die Antwort hatten die Politiker bald. Als es so weit war, dass sie der Generalversammlung den Verfassungsentwurf vorlegen konnten, gab es eine Streitmacht von nahezu dreitausend Aufständischen, die im zentralen Hochland operierte. Angeführt wurde sie von einem Excolonel namens Sanusi, der sich selbst zum General befördert hatte und schnell die Herrschaft über einen Verwaltungsbereich gewann, der sich über die einzigen zwei Straßen erstreckte, die die Hauptstadt mit den nördlichen Provinzen verbanden. Überdies war Sanusi ein frommer Moslem und verbreitete eine Reihe von Manifesten, in denen er alle Rechtgläubigen aufrief, seiner Nationalen Freiheitspartei von Sunda beizutreten und den Ungläubigen in Selampang, die den neuen Staat bereits im Augenblick seiner Geburt verraten hätten, den Heiligen Krieg zu erklären.
Die Aufstände, die darauf folgten, führten zu einigen Toten unter der eurasischen Bevölkerung der Stadt, aber schließlich konnte die Ordnung ohne großes Blutvergießen wiederhergestellt werden. Obwohl die meisten Sundanesen Moslems sind und die Mehrheit der Männer die schwarze Kappe des Islam trägt, spielt die Religion keine große Rolle in ihrem Leben. Das eigentliche Problem besteht darin, dass General Sanusi das Innere des Landes im Griff hatte. Eine gegen ihn ausgesandte Strafexpedition musste sich schmachvoll zurückziehen, als einer ihrer Regimentskommandeure desertierte, und zwar mit seinem ganzen Regiment und dem größten Teil des Munitionsvorrats der Expedition. Die darauf folgenden Luftangriffe auf das, was man für Sanusis Hauptquartier hielt, führten durch das risikoreiche Fliegen in den Bergen zum Verlust von zweien der zehn überalterten Maschinen, aus denen die Luftwaffe der Regierung bestand.
Nachdem sie diese Demütigungen geschluckt hatte, war die Regierung genötigt, das Problem etwas realistischer zu sehen. Sie glaubte, Sanusi habe weder Panzer noch Artillerie und dass er deshalb gezwungen sei, in den Bergen zu bleiben. Sie wusste außerdem, dass sie es sich nicht leisten konnte, noch mehr das Gesicht zu verlieren, ohne das Vertrauen der Öffentlichkeit stark zu erschüttern. Auch mussten gewisse Empfindlichkeiten im Ausland berücksichtigt werden. Verhandlungen darüber, ob großzügige Kredite in US-Dollars zur Verfügung gestellt werden würden, standen kurz vor dem Abschluss. Ein Anschein von Ruhe und Stabilität musste unter allen Umständen gewahrt werden.
Man entschied sich also zum Bluffen.
Ein vom Informationsminister veröffentlichtes Kommuniqué verkündete, die »Sanusi-Bande« sei eingekesselt und vernichtet worden; und in einer Direktive bekamen die Zeitungsherausgeber Order, sich jeglicher weiteren Anspielung auf den »Zwischenfall« zu enthalten. Von Sanusis Geheimagenten in Selampang verübte Morde seien »kolonialistischen Reaktionären« anzulasten. Für neugierige Ausländer, die wissen wollten, warum es noch immer nicht möglich sei, die Straßen von der Hauptstadt in den Norden zu benutzen, gab es die freundliche Auskunft, angesichts weitreichender Brückenbeschädigungen und Straßenverminungen – vorgenommen von holländischen Truppen bei ihren Rückzugsgefechten – würde es mindestens noch ein Jahr dauern, bis die Landverbindungen wieder passierbar seien. Bis dahin stelle man sowohl See- als auch Luftwege bereitwilligst zur Verfügung.
Gleichzeitig wurde der Verteidigungsminister zu geheimen und besonderen Vorsichtsmaßnahmen gegen jeden weiteren Verrat in den Streitkräften angewiesen. Jeder Armeeoffizier sei durch den Einsatz von agents provocateurs sorgfältig auf seine Zuverlässigkeit zu überprüfen. Von Andersdenkenden sei eine Liste zu erstellen, und Schritte zu ihrer Kaltstellung seien zu unternehmen. Sanusi solle sich in den Bergen die Beine in den Bauch stehen, bis eine umfassende Offensive gegen ihn gestartet werden könne.
Das Gefühl der Sicherheit, das der Regierung aus diesen Entscheidungen erwuchs, währte nicht lange. Die vom Verteidigungsminister durchgeführten Nachforschungen führten bald zu dem erschreckenden Ergebnis, dass unter den Offizieren offen von einem Staatsstreich gesprochen wurde; dass eine Gruppe bereits in geheimer Verbindung mit Sanusi stand; und dass es zweifelhaft war, ob im Ernstfall auf mehr als ein Drittel der Offiziere der Garnison Selampang Verlass wäre.
Die erste Reaktion des Ministerrats war Panik, und für vielleicht eine Stunde palaverte man offenbar sehr aufgeregt darüber, ob man aus Singapur ein britisches Kriegsschiff als Beistand erbitten solle. Dann rissen sie sich zusammen und gaben General Ishak, dem Verteidigungsminister, Sondervollmachten für das Vorgehen gegen die Verschwörer. Vierundzwanzig Stunden später waren sechzehn der höheren Offiziere erschossen, und weitere sechzig saßen im Gefängnis in Erwartung des Kriegsgerichts.
Die unmittelbare Krise war gebannt; aber die Regierung hatte einen üblen Schrecken bekommen und würde diese Erfahrung so schnell nicht vergessen. Die Nachrichten aus Indonesien über den »Turko«-Westerling-Zwischenfall verstärkten die Angst der Regierung. Wenn eine kleine Truppe javanischer Konterrevolutionäre, angeführt von ein paar verrückten Holländern, vor den Augen der rechtmäßigen indonesischen Regierung eine Stadt wie Bandung erobern konnte, dann konnte eine große Truppe sundanesischer Aufständischer unter Sanusi wahrscheinlich auch Selampang erobern. Nur die Garnison von Selampang mit ihren japanischen Panzern und Panzerspähwagen und ihren sechs deutschen 88-Millimeter-Kanonen hinderte sie an dem Versuch. Wenn es Sanusi gelingen würde, die Garnison dadurch zu neutralisieren, dass er sich – wie er es ja fast schon einmal geschafft hatte – mit Verschwörern einer Art von Fünfter Kolonne verbündete, wäre das Spiel aus. Von jetzt an war höchste Wachsamkeit geboten. Verlässliche Polizeispitzel mussten gefunden werden, die über die Tätigkeiten eines jeden Offiziers und früheren Offiziers zu berichten haben würden. Die Unzufriedenen mussten mit Klugheit behandelt werden. Bei einem entschlossenen Unruhestifter würde ein Messer in den Rücken die einzige sichere Lösung sein. Bei einem Mann, der eigennütziger war, konnte die beste Antwort vielleicht ein gutbezahlter Amtssessel sein. Und war seine Loyalität gekauft und konnte man hoffen, ihn darüber hinaus auch noch als Informant zu gewinnen, so konnte man ihn ja mit einem noch lukrativeren Posten belohnen.
Da Eigennutz der vorherrschende Charakterzug bei den meisten Offizieren auf der Liste der Verdächtigen war, funktionierte die neue Politik. Von Zeit zu Zeit gab es Verschwörungspsychosen und mitternächtliche Exekutionen, und für die Dauer eines Monats herrschte das Standrecht; aber obgleich die Straßen nach Norden jetzt in fester Hand der Aufständischen waren (Sanusi war so unverschämt, von den Dörfern in seinem Gebiet Steuern zu kassieren), verlor die Regierung keinen Boden mehr. Die Verluste lagen jetzt mehr auf moralischem als auf territorialem Sektor.
Der schwarze Markt beispielsweise. Für sein Wachstum gab es einfache wirtschaftliche Gründe. Die amerikanischen Kredite waren nicht in Produktionsmitteln angelegt worden, sondern man hatte sie verschwendet für Dinge wie Autos, Kühlschränke, Radios und Klimaanlagen, deren Importierung bei Regierungsmitgliedern und deren Untergebenen zu ungeheuren persönlichen Bestellungen geführt hatte. Bemühungen, die daraus resultierende Inflation unter Kontrolle zu bringen, waren halbherzig gewesen. »Verursachersteuern« waren auferlegt worden, nur um umgangen zu werden. In Selampang gab es für praktisch alles einen schwarzen Markt. In den von der Weltgesundheitsorganisation eingerichteten Tuberkulosekliniken war es an der Tagesordnung, dass ein mantri seinen Patienten sogar Wasser injizierte, um das BCG-Vakzin stehlen und auf dem schwarzen Markt verkaufen zu können. Schiebereien jeder Art standen in Blüte. In Asien, das sei zugegeben, wird es als normal angesehen, Bestechungsgelder zu verteilen und anzunehmen, will man etwas erreichen; aber in Sunda nahm das groteske Ausmaße an.
Die Regierung erkannte zwar, dass zur Bewältigung dieses Problems Maßnahmen vonnöten waren, konnte sich jedoch nicht darüber einig werden, worin diese Maßnahmen bestehen sollten. Das war nicht nur Unentschiedenheit und lag auch nicht einfach daran, dass persönliche Interessen einiger Minister zu berücksichtigen waren. Die Unfähigkeit der Regierung, sich wirksam mit diesem oder irgendeinem der anderen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Probleme, mit denen sie konfrontiert war, auseinanderzusetzen, hatte einen tieferen Grund. Die Sanusi-Affäre hatte auf irgendeine hintersinnige Weise dazu gedient, sie zu demoralisieren, und zwar gründlich. Nachdem 1950 die Verschwörung aufgedeckt worden war, wurden alle Regierungsgeschäfte in Sunda in einer tödlichen Atmosphäre von Schuld, Habsucht und gegenseitiger Verdächtigung geführt, sodass jede größere Entscheidung furchtbar gefährlich erschien. Die Nasjah-Regierung litt tatsächlich unter einem sich wiederholenden Albtraum, und die Angst davor machte sie unfähig. Das Einzige, was Einmütigkeit hätte herbeiführen können, wäre ein wasserdichter Plan zur Ausschaltung Sanusis gewesen.
Oben im Tangga-Tal waren wir bis zu einem gewissen Grad von diesem ganzen Irrsinn isoliert; wenigstens während des ersten Jahres. Besucher, vor allem Leute von der Weltgesundheitsorganisation und der UNICEF, die zur Arbeit in unser Gebiet kamen, erzählten uns, was vorging, und wir waren dann jedes Mal überrascht, dass so intelligente Männer tatsächlich erwarteten, wir würden ihnen die phantastischen Geschichten, die sie uns erzählten, glauben. Später, als unsere eigene Verbindung mit der Hauptstadt enger wurde, mussten wir uns eines Besseren belehren lassen. Aber solange Gedge die nötigen Arbeitskräfte hatte und solange von unserem kleinen Hafen an der Küste regelmäßig die Versorgung zu uns heraufkam, konnten wir das Gefühl haben, die Vorgänge in Selampang seien ohne Bedeutung für uns.
Und dann begannen die »Regierungsrentner« einzutreffen.
Es ist eines der Grundprinzipien der Colombo-Plan-Politik, dass – wenn Unterstützung für ein Projekt wie das des Tangga-Staudammes gewährt wird – so viel Führungsposten wie möglich von Asiaten eingenommen werden sollen. Stehen qualifizierte Asiaten nicht gleich zur Verfügung und müssen Europäer (d.h. Weiße) unter Vertrag genommen werden, so soll nach besten Kräften versucht werden, die Europäer durch Asiaten zu ersetzen, wenn deren Verträge auslaufen. Dass dies vernünftig ist, liegt auf der Hand, und ein Mann wie Gedge war natürlich ein eifriger Befürworter dieses Prinzips. Aber das entscheidende Wort ist eben »qualifiziert«. In Asien besteht ein akuter Mangel an Technikern jeder Ausbildungsstufe, und auf der Ebene der Führungskräfte ist dieser Mangel geradezu schreiend. In Sunda war die Lage, wie sie schlechter nicht hätte sein können.
Diese Tatsache bremste die Behörden in Selampang jedoch nicht. Wenn Leib und Leben einer Regierung dadurch gesichert werden, dass eine Politik der jobs for the boys betrieben wird, werden hochbezahlte Posten rar. Hinzu kommt noch, dass die Löhne und Gehälter von den Unternehmern des Colombo-Plans gezahlt wurden und nicht von der Regierung. Als die Dienstverträge der Europäer auszulaufen begannen, muss das Tangga-Tal-Projekt in Selampang ausgesehen haben wie eine Goldgrube. In seiner Unschuld nahm Gedge an, dass sein förmliches, routinemäßiges Anfordern von Asiaten, die die scheidenden Europäer ersetzen sollten (Anfragen, zu denen er vertraglich verpflichtet war), zur Kenntnis genommen und dann auf die übliche Weise vergessen werden würde. Er wusste ganz genau, dass sie keine Fachkraft hatten, die sie ihm hätten schicken können. Und er hatte recht.
Der erste der überschüssigen Offiziere, der sich zum Dienst melden sollte, war ein bulliger Kerl in der Uniform eines Captains der Infanterie, der verkündete, er werde den Posten eines Aufsehers über das Projekt einnehmen, und dann ein Jahresgehalt als Vorschuss verlangte. Nach seinen Qualifikationen gefragt, behauptete er, er sei Absolvent der neuen Schule für Nationalökonomie in Selampang, und zog ein entsprechendes Zeugnis hervor. Außerdem zog er eine Pistole, mit der er bis zum Ende des Interviews vieldeutig herumspielte. Ich war dabei, und es war eine nervenaufreibende Stunde. Zum Schluss gab Gedge ihm einen warmen Empfehlungsbrief für einen Posten bei der zentralen Beschaffungskommission (deren Gehälter die Regierung zahlte) und hielt das Flugzeug fest, sodass der Captain sofort zur Hauptstadt zurückfliegen und den Brief vorlegen konnte.
Bald stellte sich heraus, dass der Captain ein ziemlich typisches Beispiel für das gewesen war, was uns bevorstand. Nachdem drei weitere Möchtegernaufseher und über ein Dutzend Anwärter auf andere Posten zurückgeschickt worden waren, hatte die Regierung den Arbeitsminister angewiesen, seine Taktik zu ändern. Anstatt den Bewerber persönlich zu schicken, wurde dessen Name geschickt, zusammen mit einer imponierenden Aufzählung der angeblichen Qualifikationen des Bewerbers, und alles war vom Arbeitsminister als korrekt bescheinigt. Gedge hatte also nur noch die Wahl, den Bewerber blind zu akzeptieren – aufgrund der Bewertung durch das Ministerium – oder diese Bewertung infrage zu stellen und somit an der Ehrlichkeit des Ministers zu zweifeln.
Am Ende mussten beide Seiten zu einem Kompromiss kommen. Das Ministerium versprach aufzuhören, schwachsinnige Gangster zu schicken, die selbst nach sundanesischen Maßstäben nicht hätten angestellt werden können. Gedge erklärte sich bereit, sechs sundanesische Offiziere mit Erfahrung im Verwaltungsdienst als »Verbindungsmanager« einzustellen. Die entscheidenden Posten wurden, wie Gedge es immer für richtig gehalten hatte, teils durch Vertragserneuerung ausgefüllt, teils durch Beförderung und teils dadurch, dass von draußen neue Männer hereingebracht wurden, Asiaten wie Europäer.
Ich glaube, wir waren alle der Ansicht, dass er sich gut aus der Affäre gezogen hatte. Die freundschaftliche Beziehung mit der Regierung war gewahrt worden. Seine eigene Autorität war ungeschmälert geblieben. Die Interessen seiner Arbeitgeber waren sichergestellt worden. Die Arbeit konnte ihrer Vollendung nun glatt entgegengehen (plan- und termingerecht), bis zu dem Augenblick, wo er über der östlichen Abflussrinne barhäuptig im Wind stehen würde, um die Gratulation des Präsidenten entgegenzunehmen. Vom Hauptbüro des Unternehmens war die Genehmigung gekommen, die Gehälter für sechs nutzlose sundanesische Offiziere dem Konto für Sonderausgaben zur Last zu schreiben. Es blieb jetzt nur noch abzuwarten, ob die Regierung ihr Versprechen halten würde.
Auf ihre spezifisch unredliche Weise hielt sie ihr Versprechen. Was sie schickte, waren nicht schwachsinnige, sondern intelligente Gangster.
Sie kamen alle auf einmal, vier Majore und zwei Captains. Sie kamen in einer Sondermaschine aus der Hauptstadt, und sie begannen damit, dass sie sich beschwerten, weil der leitende Ingenieur nicht zur Stelle war, um sie offiziell willkommen zu heißen. Dann verkündeten sie, dass sie warten würden, bis er eintreffe. Ich war gerade bei Gedge, als er diese Nachricht erhielt.
Er seufzte. »Verstehe. Primadonnen. Das kann man denen nicht durchgehen lassen. Würde es dir etwas ausmachen hinzufahren, Steve?«
»Ich?« Streng genommen hatte ich mit so etwas nichts zu tun. Arbeitsverhältnisse waren Sache des Unternehmers. Ich war da, um die Firma der beratenden Ingenieure zu vertreten, die das Projekt geplant hatten, und darauf zu sehen, dass das Unternehmen die Bauarbeiten nach unseren Plänen ausführte. Aber ich war mit Gedge immer gut ausgekommen und konnte sehen, wie ernst es ihm war.
»Wenn sie nicht irgendein wichtiger Mann begrüßt, verlieren sie das Gesicht«, erklärte er. »Und du weißt, dass ich mir mit diesen Leuten keinen schlechten Start leisten kann.«
»Na gut. Aber es wird dich zwei große Scotchs kosten.«
»Abgemacht. Und wenn du gleich fährst, sollen es von mir aus auch drei sein.«
Ich konnte damals noch nicht wissen, dass er mir damit in gewisser Weise das Leben rettete.
Ich fand die Neuankömmlinge bei der Funkerbude. Sie standen im Schatten und stierten finster in die Gegend. Die Jeepfahrer, die losgeschickt worden waren, um sie abzuholen, sahen verängstigt aus. Ich stieg aus meinem Jeep und ging hinüber.
Alle waren sie sehr schmuck ausstaffiert, mit makellosen Uniformhemden und blankgewichsten Pistolentaschen. Ich war doch einigermaßen beeindruckt.
Als ich näher kam, wandten sie sich mir zu und nahmen Haltung an. Einer von den Majoren trat einen Schritt vor und nickte kurz. Er war ein schlanker, gutaussehender kleiner Mann mit den flachen Zügen und hohen Backenknochen des Südsundanesen und mit einem strengen, arroganten Mund. Sein Englisch war fast perfekt.
»Mr. Gedge?«
»Nein. Mein Name ist Fraser. Ich bin hier der beratende Bauingenieur. Sie sind …?«
»Major Suparto. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mr. Fraser.« Wir gaben uns die Hände, und er drehte sich um zu der Gruppe hinter ihm. »Ich darf vorstellen – die Majore Idrus, Djaja und Tukang; Captain Kerani und Captain Emas.« Auch sie nickten kurz mit den Köpfen, und er wandte sich wieder mir zu.
»Eigentlich hatten wir erwartet, dass Mr. Gedge uns die Ehre erweisen würde, uns bei unserer Ankunft willkommen zu heißen, Mr. Fraser.«
»Sie sind selbstverständlich willkommen, Major. Bedauerlicherweise hat Mr. Gedge momentan ziemlich viel zu tun, aber er würde sich trotzdem freuen, Sie und die anderen Herren in seinem Büro begrüßen zu dürfen.«
Major Suparto schien darüber nachzudenken. Dann lächelte er plötzlich. Es war ein so charmantes, freundliches Lächeln, dass es mich für einen Augenblick täuschte; was es wohl auch sollte. Fast hätte ich zurückgelächelt.
»Sehr schön, Mr. Fraser. Wir akzeptieren Sie als den Stellvertreter von Mr. Gedge.« Das Lächeln verschwand so plötzlich, wie es gekommen war. »Wir können ja jetzt gleich zu seinem Büro fahren, wenn Sie nicht meinen, dass er nur deswegen viel zu tun haben könnte, um uns warten zu lassen.«
»Wir haben hier nicht viel Zeit für das Protokoll, Major«, sagte ich; »aber Sie werden keinen Grund haben, sich über Unhöflichkeit zu beklagen.«
»Hoffentlich nicht.« Er lächelte wieder. »Sehr schön. Dann können wir gehn. Darf ich vielleicht mit Ihnen fahren, Mr. Fraser?«
»Selbstverständlich.«
Der Rest folgte in den anderen Jeeps. Unterwegs erklärte ich die Geographie des Camps und hielt an einem Punkt der Strecke, von dem aus alle einen guten Blick auf den Damm hatten. Aus den Jeeps hinter uns kamen Rufe des Staunens, aber Major Suparto schien nicht besonders interessiert. Beim Weiterfahren merkte ich jedoch, dass er mich mit unauffälligen Seitenblicken musterte. Dann sprach er.
»Was ist ein Verbindungsmanager, Mr. Fraser?«
»Ich glaube, das ist ein ganz neuer Posten.«
»Und bestimmt ein unnötiger. Nein, sagen Sie nichts. Ich möchte Sie nicht in Verlegenheit bringen.«
»Sie bringen mich nicht in Verlegenheit, Major. Ich kann Ihre Frage einfach nur nicht beantworten.«
»Ich bewundere Ihre Diskretion, Mr. Fraser.«
Ich überging diese Spitze mit Stillschweigen.
»Ich bin ein vernünftiger Mensch, Mr. Fraser«, fuhr er nach einer Weile fort. »Ich bin durchaus in der Lage, diese Situation philosophisch zu nehmen. Aber meine Genossen sind da ein bisschen anders. Sie werden irgendetwas suchen, was sie befriedigt, und das kann zu Schwierigkeiten führen. Ich glaube, Mr. Gedge täte gut daran, das zu bedenken.«
»Ich werde ihn darüber unterrichten, aber ich glaube, Sie können bei ihm mit Verständnis rechnen.«
Er sagte nichts mehr, bis wir an Gedges Büro vorfuhren. Als ich mich anschickte auszusteigen, legte er mir eine Hand auf den Arm.
»Verständnis ist eine feine Sache«, sagte er, »aber manchmal ist es besser, einen Revolver bei sich zu haben.«
Ich sah ihn ernst an. »An Ihrer Stelle, Major, würde ich vor Mr. Gedge derlei Scherze unterlassen. Er könnte auf den Gedanken kommen, Sie wollten ihn einschüchtern, und das würde ihm ganz und gar nicht gefallen.«
Er starrte mich an, und obgleich seine Hände keine Bewegung machten, war ich mir der Pistole an seinem Gürtel für einen kurzen Augenblick fast schmerzhaft bewusst. Dann lächelte er. »Ich mag Sie, Mr. Fraser«, sagte er. »Ich bin sicher, dass wir noch Freunde werden.«
Der Besuch bei Gedge verlief ganz gut. Die Verbindungsmanager behaupteten alle, Erfahrung in der Verwaltung zu haben. Überraschender war die Tatsache, dass sie alle einigermaßen Englisch sprachen. Obgleich Englisch heute in Sunda die zweite offizielle Sprache ist (die erste ist Malaiisch), gibt es wenig Sundanesen, die es wirklich sprechen. Es gab eine gewisse Gespanntheit, als klar wurde, dass das, was man ihnen in Selampang über ihre Aufgaben erzählt hatte, nicht mit dem übereinstimmte, was Gedge ihnen erzählte, aber am Ende schienen sie die Situation recht gelassen hinzunehmen. Major Suparto nickte und lächelte wie ein Vater, der sich darüber freut, wie brav seine Kinder sich in Gegenwart Erwachsener benehmen. Am Abend kam es dann noch zu einer Zusammenkunft mit den einzelnen Abteilungsleitern. Alle waren sie vorher unterrichtet worden, und so erhoben sie keine Einwände, als jedem von ihnen ein Verbindungsmanager zugeordnet wurde. Im Grunde würde der eine Art Lehrling sein. Mochte er ruhig herumtrödeln. Sollte er sich nützlich machen können, um so besser; wenn nicht, würde es auch nichts machen.
Keiner von ihnen behauptete, irgendwelches technisches Wissen zu haben. Major Suparto bat darum, zur Transportabteilung zu kommen. Die übrigen wurden aufgeteilt auf die Abteilungen für Versorgung, Maschinen, Elektrizität, Bauwesen und Hochspannungsverlegung.
Das erste Anzeichen für Schwierigkeiten kam drei Tage später aus der Abteilung für Bauwesen. Einer der Männer, die in Abschnitt drei des Kraftwerks arbeiteten, war von Captain Emas angegriffen und übel zugerichtet worden. Nach dem Zwischenfall befragt, erklärte Captain Emas, der Mann habe es an Respekt fehlen lassen. In der Woche danach wurden aus demselben Grund noch zwei Männer von Captain Emas verprügelt. Die Wahrheit kam stückchenweise zutage. Allem Anschein nach organisierte Captain Emas eine Bauarbeitergewerkschaft, und die Männer, die verprügelt worden waren, missbilligten es offen, Beiträge zu zahlen. Vorsitzender und Schatzmeister der Gewerkschaft war Captain Emas.
Gedge war in einer schwierigen Lage. Die Arbeiter stammten ausnahmslos aus den umliegenden Dörfern, und die kleineren Streitfälle, die es gegeben hatte, waren dadurch beigelegt worden, dass man die Dorfältesten eingeschaltet hatte. Eine regelrechte Gewerkschaftsorganisation war bislang nicht für nötig befunden worden. Unglücklicherweise war nach sundanesischem Arbeitsrecht die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft für Handwerker obligatorisch. Captain Emas wusste das offenbar. Sollte man ihn hinauswerfen und nach Selampang zurückschicken, so würde er beim Arbeitsministerium einfach Beschwerde darüber erheben, dass er gesetzwidrige Zustände vorgefunden habe und ein Opfer seines Versuchs geworden sei, diese Zustände zu beheben. Das Ministerium hätte seine Freude. Im Handumdrehen wäre Captain Emas zurück, ausgestattet mit Sondervollmachten zur Organisation einer Arbeiterbewegung im gesamten Tangga-Tal.
Gedge wählte das kleinere Übel. Er berief eine Versammlung der Vorarbeiter ein, hielt ihnen das Gesetz vor Augen und versicherte sich ihrer Zustimmung dafür, dass er bei der Arbeitergewerkschaft in der Hauptstadt einen offiziellen Organisator anfordern werde. Dann instruierte er sie darüber, dass in Zukunft über alle an Captain Emas gezahlten Beträge Buch zu führen sei, sodass Captain Emas später dafür zur Rechenschaft gezogen werden könne. Dann rief er Captain Emas herein und wiederholte seine Instruktion in dessen Gegenwart.
Damit war Captain Emas für ein paar Wochen kaltgestellt, aber bald sickerte durch, dass die Majore Djaja und Tukang auf dem Maschinenpark und in der Elektrizitätsabteilung das gleiche Gaunerstück betrieben hatten. Weitere Vorarbeiterversammlungen wurden notwendig.
Das alles war ermüdend genug. Die Vorarbeiter fühlten, dass ihre Autorität unterminiert wurde, und stellten sich auf die Hinterbeine. Die Arbeiter hatten etwas dagegen, Gewerkschaftsbeiträge zahlen zu müssen, bloß weil irgendwer in Selampang das verlangte, und ließen bei der Arbeit nach. Kleine Schwierigkeiten begannen, zu großen Terminverzögerungen zu führen. Aber es sollte noch schlimmer kommen.
Etwa fünfzehn Meilen östlich vom Tal-Camp, an der von Port Kail heraufkommenden Straße, die von unseren Versorgungslastern benutzt wurde, lagen ein paar große Gummiplantagen. Zwei davon wurden noch immer von Holländern geführt.
Die Lage der in Sunda verbliebenen Holländer war ebenso schwierig wie gefährlich. Die meisten standen im Dienst der wenigen holländischen Geschäftshäuser, die, wenn auch unter Aufsicht der Regierung, immer noch betrieben werden durften; Banken beispielsweise. Der Rest waren zum größten Teil Kautschukpflanzer in entlegenen Gegenden, wo die antiholländischen Emotionen weniger heftig gewesen waren. Es handelte sich um Männer, die eher bereit waren, die neuen Gefahren des Lebens in Sunda auf sich zu nehmen, als die bittere Aussicht ins Auge zu fassen, alles aufzugeben, was sie besaßen, und in einem anderen Land noch einmal ganz von vorn anzufangen.
Für die Holländer waren diese neuen Gefahren sehr real. Gab es Ärger auf den Straßen, hatte jeder Europäer Angst, für einen Holländer gehalten zu werden. Nach einer Reihe entsetzlicher Zwischenfälle in Selampang hatte der Polizeichef sogar eine Regelung erlassen, der zufolge jeder Europäer, der mit seinem Auto in einen Verkehrsunfall verwickelt war, ohne anzuhalten einen Kilometer weiterfahren durfte, bevor er sich der Polizei stellte. Denn blieb er am Unfallort stehen, wurde er samt den Mitfahrenden von der Menge unweigerlich verprügelt, oftmals sogar ermordet. Zwischen Männern und Frauen wurde da kein Unterschied gemacht. Als Entschuldigung für das Verbrechen diente jedes Mal die Erklärung, die Opfer seien anscheinend Holländer gewesen. Holländische Besitzer von Kautschukplantagen waren in einer nahezu hoffnungslosen Situation. Außer an die Regierung, die sie in einer Währung bezahlte, die dadurch blockiert war, dass sie nicht ausgeführt werden konnte, durften sie ihren Grundbesitz nicht verkaufen oder verpachten. Bearbeiteten sie ihre Plantagen weiter, mussten sie ihren gesamten Ertrag an die Regierung verkaufen, und zwar zu einem Preis, den die Regierung bestimmte. Auf der anderen Seite mussten sie ihren Plantagenarbeitern einen Mindestlohn zahlen, der es praktisch unmöglich machte, dass sich die Plantage rentierte. Wollten sie überleben, blieb ihnen nur die Möglichkeit, den Inspektoren der Regierung einen Teil ihres Ertrages zu verheimlichen und den dann für Straits-Dollars an die chinesischen Dschunkenschiffer zu verkaufen, für die es ein einträgliches Geschäft war, in Sunda gekauften »schwarzen« Kautschuk in Singapur an den Mann zu bringen.
Mulder und Smit waren beides Männer um die fünfzig, die den größten Teil ihres Lebens in Sunda verbracht hatten. Mulder war dort geboren. Keiner von beiden hatte irgendwelches Kapital in Holland. Jeder Gulden, den sie besaßen, steckte in ihren Plantagen. Darüber hinaus hatten sie beide sundanesische Frauen und große Familien, die sie sehr liebten. Es lag also auf der Hand, dass sie sich zum Bleiben entschlossen hatten.
In den Anfangstagen des Camps waren wir sehr oft bei den beiden Männern gewesen. Ja, während der ersten paar Monate, als die Straße noch nicht ganz fertig war, hatten wir ihre Gasträume benutzt, als hätten wir sie gemietet. Smit war ein hünenhafter rotgesichtiger Mann mit breitem Lächeln und einem unglaublichen Fassungsvermögen für Flaschenbier. Mulder hatte eine Leidenschaft für deutsche Volkslieder, die er, begleitet von einem Grammophon, beim geringsten Anlass zu singen pflegte. Miteinander spielten sie Schach, mit uns pokerten sie. Später hatten wir uns dann für ihre Gastfreundschaft etwas revanchieren können, aber eigentlich waren sie nie besonders gern in unser Camp gekommen. Im Europäischen Club waren Frauen nicht zugelassen, und so konnten wir sie nicht bitten, ihre Frauen mitzubringen. Und es gab viele Sundanesen im Lager, die an der Anwesenheit von Holländern Anstoß nahmen. Als die Verbindungsmanager eintrafen, hatte ich seit Wochen keinen von den beiden mehr gesehen.
Eines frühen Morgens, etwa drei Monate vor meinem Abreisetermin, kam Mulder ins Lager und brachte die Nachricht, dass Smit und seine Frau ermordet worden waren.
Der erste Teil der Geschichte ist schnell erzählt. Um ein Uhr an jenem Morgen waren Mulder und seine Frau von dem ältesten Sohn der Smits geweckt worden, einem Jungen von sechzehn Jahren. Er sagte, eine halbe Stunde zuvor seien zwei Männer am Bungalow vorgefahren und hätten so lange an die Tür gehämmert, bis man sie hereinließ. Von dem Krach sei er wach geworden. Er habe gehört, wie sein Vater mit ihnen sprach, und es sei zu einem Streit gekommen. Sein Vater sei wütend geworden. Plötzlich hätten vier Schüsse geknallt. Seine Mutter habe geschrien, und es seien noch mehr Schüsse abgefeuert worden. Dann seien die Männer weggefahren. Mutter und Vater seien verwundet gewesen, und er habe es der ayah überlassen, sich um sie zu kümmern, und sei losgerannt, um Hilfe zu holen.
Als Mulder am Bungalow angekommen war, war Smit bereits tot gewesen. Die Frau starb kurz danach. Später hatte er die Kinder und deren ayah zu seinem Bungalow mit zurückgenommen. Um die Sicherheit seiner Familie bangend, war er, bis es hell wurde, bei ihr geblieben und erst dann in unser Lager gekommen, um uns zu bitten, die Sache über Funk der Polizei in Port Kail zu melden.
Die Art, wie er das erzählte, legte den Gedanken nahe, dass er mehr wusste, als er sagte. Als ich mit ihm allein war und ihm versprach, den Mund zu halten, erzählte er mir den Rest:
Vor einer Woche waren zwei Sundanesen mit einem Vorschlag zu ihm gekommen. Sie sagten, sie wüssten, dass er Kautschuk aus dem Land schmuggelte und dafür in Straits-Dollars bezahlt werde. Von allen künftigen Abschlüssen wollten sie die Hälfte als Anteil. Bekämen sie das nicht, würden ihm und seiner Familie unangenehme Dinge widerfahren. Er habe zwei Tage Bedenkzeit, und er solle mit niemandem darüber sprechen.
Er ging zu Smit und erfuhr, dass die Männer auch bei ihm gewesen waren. Die zwei Pflanzer besprachen ihre Situation sorgfältig. Sie wussten, dass sie keine Chance hatten. Um Polizeischutz zu bitten kam natürlich nicht in Frage. Abgesehen davon, dass sie ihren Schmuggel hätten zugeben müssen – was für Holländer selbstmörderisch gewesen wäre –, bestand noch die Möglichkeit, dass die Männer selber mit der Polizei in Verbindung standen. Am Ende entschieden sie sich zu zahlen, aber nicht, ohne vorher zu verhandeln. Sie meinten, die Männer würden vielleicht mit einem Angebot von zehn Prozent zufrieden sein.
Die Männer waren damit nicht zufrieden. Sie wurden wütend. Sie gaben Mulder eine weitere Frist von vierundzwanzig Stunden, innerhalb deren er sich einverstanden erklären konnte, und verlangten außerdem zweitausend Straits-Dollar in bar, die die Ernsthaftigkeit seiner Absichten bekunden sollten.
Das war in der vergangenen Nacht gewesen. Die Männer mussten direkt zu Smit gefahren sein und an dem, was er sagte, gemerkt haben, dass die Opfer sich abgesprochen hatten. Dann hatten sie sich wohl entschieden, Mulder zu zeigen, dass nicht mit ihnen zu spaßen war. Und das war ihnen gelungen. Mulder war jetzt so weit, dass er ihnen seine ganze Plantage geschenkt hätte, wenn sie es gewollt hätten.
Aber so ganz klar war mir das alles immer noch nicht. Smit war nicht der Typ gewesen, der sich leicht einschüchtern lässt. Ich konnte mir nur schwer vorstellen, dass er zwei Gangstern mitten in der Nacht die Tür aufgemacht hatte, ohne eine geladene Pistole in der Hand zu haben. Und was Mulder betrifft, so wäre ich nicht sonderlich überrascht gewesen, wenn er mich gebeten hätte, ihm zu helfen, die zwei Männer aus dem Hinterhalt kaltzumachen und ihre Leichen den Geiern zu überlassen.
Erst als ich ihn überredet hatte, mir Näheres über die zwei Männer zu berichten, verstand ich. Es wäre der Tod gewesen, auch nur einen von beiden anzurühren. Es waren Offiziere der sundanesischen Armee, ein Major und ein Captain. Die Beschreibungen, die er mir gab, ließen mich über ihre Identität nicht im Zweifel. Ich überredete Mulder, mit mir zu Gedge zu gehen und ihm die Geschichte zu erzählen.
In der Nacht, in der Major Idrus und Captain Kerani bei Mulders Bungalow ankamen, standen Gedge und ich wartend hinter den Fliegentüren zum Schlafzimmer. Wir hörten, wie sie beschrieben, was sie mit Smit und seiner Frau gemacht hatten, und wie sie Mulder dasselbe androhten, wenn er nicht zahlen würde. In dem Augenblick kamen wir heraus, bewaffnet mit Schrotflinten und einer Kurzfassung dessen, was wir gehört hatten. Eine ganze Weile gab es nichts als Protestgeschrei, schließlich aber kamen wir zu einer Einigung. Wenn Major Idrus und Captain Kerani Mulder in Ruhe ließen, würden wir nichts weiter unternehmen. Mulder würde unsere unterschriebenen Erklärungen bei seiner Bank deponieren, sodass sie, sollte ihm irgendetwas zustoßen, der Polizei zugehen würden. Es war ein miserables Abkommen, doch da Mulder nicht in ein Polizeiverhör verwickelt werden durfte, war es das Beste, was wir tun konnten. Idrus und Kerani lächelten, als sie gingen, um mit einem Lastwagen der Versorgungsabteilung zum Camp zurückzufahren: Sie hatten Grund zu lächeln; wir hatten ihnen wegen ihrer Morde nichts anhaben können.
Wir blieben noch eine Weile bei Mulder draußen und tranken zu viel Gin. Für Gedge wurde die Sache dadurch nicht besser.
»Wie würde es dir gefallen, noch weiter hierzubleiben, Steve?«, fragte er plötzlich, als ich den Jeep zum Camp zurückfuhr.
»Wie meinst du das?«
»Du kannst meinen Job haben, wenn du willst.«
»Nein, danke.«
»Klug von dir. Es ist nicht gerade ein Vergnügen, Mörder in nächster Nähe zu haben.«
»Verständnis ist eine feine Sache«, sagte ich, »aber manchmal ist es besser, einen Revolver bei sich zu haben.«
»Woher hast du denn solche Sprüche?«
»Das stammt von Major Suparto.«
Und nun saß ich zum letzten Mal bei Gedge im Büro, hörte mir an, was gesagt wurde, und wusste dabei ganz genau, dass das, was ich hörte, mir in weniger als drei Stunden so weit entfernt vorkommen würde wie ein Traum.
Anders als seine fünf Bruder-Offiziere war Suparto ein voller Erfolg gewesen. Die Fähigkeit zu planen und zu organisieren ist selten bei den Sundanesen. Aber in dieser Hinsicht war Suparto eine überragende Ausnahme. Abgesichert durch einen Zweijahresvertrag, hatte der Abteilungsleiter für unser Transportwesen nicht die geringsten Bedenken, seinem so fähigen und tatkräftigen Assistenten volle Verfügungsgewalt zu übertragen, und hatte sich gegen die Versuche der anderen Abteilungsleiter, ihn abzuwerben, gewehrt.
Suparto hatte die Situation klar umrissen. In der vergangenen Woche hatten unten in Port Kail die Stauer gestreikt, und so waren einige wichtige Maschinenteile von der Schiffsbesatzung entladen und auf die Kaimauer gestellt worden. Jetzt machten die Leute vom Zoll Schwierigkeiten bei der Identifizierung der einzelnen Teile auf der Frachtliste des Schiffes und weigerten sich, die Sachen freizugeben. Nach seiner Ansicht machten sie aus einem kleinen Durcheinander ein großes, weil sie sich einen dicken Batzen Schmiergeld davon versprachen. Er meinte, das Problem werde sich sehr schnell in nichts auflösen, wenn er nach Kail hinunterführe und mit dem Chef der Zollinspektion persönlich spräche. Der Leiter der Transportabteilung teilte diese Meinung.
»Wir haben bis jetzt noch nie Schwierigkeiten mit dem Zoll gehabt«, sagte Gedge gerade. »Nicht mal ganz zu Anfang, als sie uns die Dinge noch einfach nach Lust und Laune leicht- oder schwermachen konnten.«
»Major Suparto meint, die Leute dort stehen vielleicht unter Druck von oben«, sagte der Leiter der Transportabteilung.
»Ich halte das für möglich«, sagte Suparto. »Aber so etwas lässt sich nicht mit Funksprüchen aufklären. Ich muss mit diesen Leuten privat sprechen.«
Gedge nickte. »Na gut, Major. Wir überlassen das Ihnen. Hauptsache ist, wir kriegen diese Maschinenteile hier hoch. Wie lange werden Sie weg sein?«
»Zwei Tage, vielleicht drei. Ich schlage vor, dass ich gleich abfahre.« Er wandte sich mir zu. »Mr. Fraser, ich werde sonst keine Gelegenheit mehr haben – darf ich Ihnen eine gute Reise wünschen und eine glückliche Zukunft?«
»Danke, Major. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben.«
Wir gaben uns die Hände, und er ging mit dem Leiter der Transportabteilung hinaus. Dann begann das etwas umständlichere Zeremoniell der Verabschiedung von Gedge.
Die Dakota kam um zwölf Uhr dreißig an. Als sie die zwei Postsäcke, ein paar Kartons Trockenmilch und zwei kleine Luftkompressoren ausgeladen hatten, hoben sie meinen Koffer an Bord und schleuderten die weggehende Post hinterher. Mein Nachfolger und ein oder zwei engere Freunde waren mit auf das Rollfeld hinausgekommen, um mich noch ein Stück zu begleiten, und so musste noch mehr Unsinn geredet und mussten noch mehr Hände geschüttelt werden, bis ich endlich an Bord klettern konnte.
Roy Jebb war der Pilot. Erster Offizier war ein Sundanese namens Abdul. Bei diesen Flügen war die Besatzung nie vollzählig, und so setzte ich mich, da ich der einzige Passagier war, direkt hinter sie auf den Sitz des Funkers. Die Maschine hatte eine Stunde in der Sonne gestanden, und es war erstickend heiß in der Kanzel. Aber ich war so froh wegzukommen, dass ich darüber ganz vergaß, die Jacke auszuziehen. Ich konnte die Männer, die mich zum Flugzeug gebracht hatten, zu den Jeeps zurückgehen sehen, und fragte mich ziemlich unbeteiligt, ob ich wohl je einen von ihnen wiedersehen würde. Dann begann der Schweiß mir in die Augen zu rinnen, und Jebb rief mir zu, ich solle mich anschnallen.
Zwei Minuten später waren wir in der Luft.