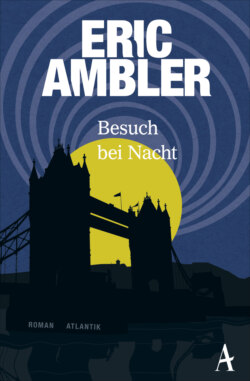Читать книгу Besuch bei Nacht - Eric Ambler - Страница 4
2
ОглавлениеDie dunkelgrüne Fläche des Dschungels glitt unter uns weg, und wir begannen der Küste mit ihrem ausgefransten Saum aus Inseln und türkisfarbenem Seichtwasser zu folgen.
Jebb blickte über die Schulter zu mir zurück. Er war hager, sehnig und sehr australisch.
»Schon um ein Zimmer gekümmert, Steve?«, fragte er.
»Ich dachte, ich versuch’s im Orient.«
»Da kriegst du vielleicht ein Bett. Aber kein Zimmer für dich allein. Stimmt’s, Abdul?«
»O ja. Man kann in Selampang nicht allein schlafen. So sagt man.« Der Erste Offizier kicherte. »Es ist ein Witz.«
»Und kein sehr komischer. In ein paar von diesen Dreckzimmern im Orient stehen jetzt sechs Betten. So richtig schäbig.«
»Wenn ich was springen lasse, komme ich da schon unter«, sagte ich. »Ich bin schon früher da abgestiegen. Ist ja sowieso nur für drei Tage. Freitag kriege ich hoffentlich eine Maschine nach Djakarta.«
»Versuchen kannst du’s ja, wenn du willst. Aber mit irgendwem anderen wirst du dein Zimmer wohl trotzdem teilen müssen. Warum kommst du nicht mit mir zum Air House rüber?«
»Ich wusste gar nicht, dass die Zimmer vermieten.«
»Tun sie auch nicht. Ich habe da ein kleines Apartment, ganz oben über dem Radiosender. Du kannst im Wohnzimmer pennen, wenn du willst.«
»Das ist nett von dir, aber …«
»Kein ›aber‹. Du würdest mir einen Gefallen tun damit. Ich muss morgen nach Makassar und komme nicht vor Freitag zurück. Heutzutage ist es sträflicher Leichtsinn, ein Apartment unbewohnt zu lassen.«
»Einbrecher?«
»Entweder das, oder man kommt zurück, und inzwischen hat irgendein Scheißkerl von der Polizei sich einen Beschlagnahmungsbefehl erschlichen. Auf die Weise habe ich meinen Bungalow verloren, als ich voriges Jahr in Urlaub fuhr. Jetzt versuche ich, immer einen Kollegen zu finden, der bei mir wohnt, solange ich weg bin.«
»Na, dann nehme ich gerne an.«
»Abgemacht. Und was hast du vor an deinem ersten Abend in Freiheit?«
»Wo gibt’s denn jetzt das beste Essen?«
»Die Restaurants sind alle ziemlich beschissen. Weißt du überhaupt, dass wir einen neuen Club haben? The New Harmony Club heißt er.«
»Es ist ein Jahr her, seit ich das letzte Mal hier unten gewesen bin.«
»Dann ist das geritzt. Dein Abendprogramm steht fest. So, Abdul, wie wär’s mit einem Schluck Tee? Wo ist denn die Thermosflasche?«
Selampang liegt am Eingang einer tiefen Bucht, die sich nach Westen auf die Java-See öffnet. Früher hieß es Nieu Willemstad, und entlang den Kanälen in Hafennähe gibt es immer noch ein paar von den alten Häusern mit braunen Ziegeldächern und Fenstern aus kleinen Rhombenscheiben, die von den frühen holländischen Kolonisten erbaut wurden. Es steht auf einstigem Sumpfland, und das Netz der Kanäle, das sich über das gesamte Stadtgebiet erstreckt, ist eigentlich ein System von Abflussgräben zur Trockenlegung; Gräben, in welchen die Mehrheit der Bevölkerung – unbekümmert die neuen sanitären Bestimmungen ignorierend – nach wie vor ihre Exkremente deponiert und sich und ihre Wäsche wäscht. Als die Holländer abzogen, hatte Selampang etwa eine halbe Million Einwohner; heute sind es über anderthalb Millionen. Trotzdem hat man nicht den Eindruck von Überbevölkerung, wenn man im modernen Teil der Stadt durch die breiten, baumbestandenen Straßen fährt und an den großen, soliden Bungalows vorbeikommt, die auf weiträumigen Grundstücken stehen. Nur der durchdringende Geruch von den Kanälen und gelegentlich ein flüchtiger Blick auf die von Menschen wimmelnden attap-Siedlungen, die sich an ihren Ufern entlangziehen, gemahnen einen immer wieder daran. Hinter der Kolonialfassade des alten Slums ist die neue Slum-City aus dem Boden geschossen wie ein Pilz.
Das Air House stand auf der Südseite des großen Van-Riebeeck-Platzes neben einer Residenz aus dem achtzehnten Jahrhundert, die einen Teil des Gesundheitsministeriums beherbergte. Es war das höchste und modernste Gebäude in Selampang – es war von einem Konsortium von Öl- und Fluggesellschaften als Bürohaus errichtet worden und 1942, als die Japaner die Stadt besetzten, fast fertig gewesen. Eine Zeit lang hatten die Japaner es als militärisches Hauptquartier benutzt; dann hatten es die Leute von der psychologischen Kriegführung in Beschlag genommen, hatten auf dem Dach Gitterantennen errichtet und einen Kurzwellen-Radiosender daraus gemacht. Nur das Erdgeschoss war den Fluggesellschaften zurückgegeben worden, und das war jetzt ein Reisebüro und die Endstation für den Bus zum Flugplatz.
Jebbs Apartment war im obersten Stock. Der Fahrstuhl ging nur bis zum fünften; danach ging man durch einen mit Kautschuk ausgelegten Korridor, durch ein paar Schwingtüren und dann ein Treppenhaus hinauf. Hinter den Türen war das Gebäude noch Rohbau: Das behelfsmäßige Treppenhaus war nackter Beton, so wie die Bauarbeiter es 1942 zurückgelassen hatten. Trostlos hallten unsere Schritte durch den Schacht hinab. Die Fensteröffnungen waren grob mit Brettern vernagelt, und es war nicht leicht zu sehen, wohin man trat.
»Du musst aufpassen, sonst bleibst du mit deinen Klamotten hängen«, sagte Jebb.
Wir kamen um einen Betonpfeiler, aus dem wie gesträubte Stacheln Eisenstangen ragten, und gingen ein kurzes Stück durch einen staubigen Gang. Dann blieb Jebb vor einer Tür stehen und holte einen Schlüssel aus der Tasche.
»Sie hatten gerade angefangen, die Wasserleitungen in diese Apartments hier einzubauen, da kamen die Japsen«, sagte er. »Das hier ist das einzige, das sie fertiggestellt haben. Die andern fünf stehen immer noch leer. Stell dir mal vor – die ganze Zeit; und bei der Wohnraumknappheit! Was für ein Land! Ich musste erst mal das ganze Rathaus bestechen, bis die mir hier endlich das Wasser aufgedreht haben.«
Er machte die Tür auf, und wir gingen hinein.
Im Treppenhaus war ich ein bisschen skeptisch geworden und hatte an mein Feldbett zurückgedacht, das ich so zuversichtlich weggegeben hatte; aber drinnen sahen die Dinge schon anders aus. Von einem kleinen gekachelten Vorraum ging es in eine Küche, und eine andere Tür führte in das Wohnzimmer. Dieses war lang und schmal, aber fast die ganze Außenwand bestand aus Fenstertüren, die auf eine große Terrasse mit Betonbalustrade hinausführten. Die Terrasse war mit einem Bambusgeflecht teilweise gegen die Sonne überdacht und an den Seiten von attap-Wänden begrenzt. Viel Möbel gab es nicht; außer den üblichen Bambus-Liegestühlen und einem Sofa, das offensichtlich als Gastbett diente, gab es ein Radio, ein tragbares Grammophon, ein Bücherregal voller Taschenbuchromane und ein Rolltischchen aus Bambus, auf dem Likörflaschen standen. An den Wänden hingen ein paar balinesische Bilder. Es war kühl und wohnlich. Ich sagte ihm das.
»Meine Freundin hat mir geholfen beim Einrichten.« Er machte den Deckenventilator an, der sehr langsam ging. »Auf das Scheißding musst du aufpassen. Schalt es nicht gleich voll ein, sonst knallt einen Stock tiefer die Hauptsicherung durch. Also, was soll’s sein, Steve? Erst einen Drink oder erst duschen? Weißt du was? Wir machen uns erst mal einen Longdrink, und ich zeige dir, wo alles ist. Danach duschen wir, und dann werden wir sehen. Also was? Brandy dry? Gin-Fizz? Wenn du willst, auch Scotch; aber wenn du bis zum Abend beim selben bleiben willst, dann ist Brandy oder Gin wohl leichter. Ich hole mal das Eis.«
Als er die Drinks gemacht hatte, zeigte er mir sein Schlafzimmer und führte mich dann hinaus auf die Terrasse. Sie ging nach Norden, und von einer Seite aus konnte man über die Schlote und Masten der Schiffe im Hafen und über die Bucht hinaus blicken. Auf der anderen Seite befand sich hinter einer der attap-Wände ein holländisches Bad mit einem großen Zuber und einer verzinkten Schöpfkelle.
»Na, was soll man davon halten?«, wollte er wissen. »Ehrlich! Stell dir vor – so was in einem Neubau!«
»Manche behaupten, es ist die beste Dusche, die’s gibt.«
»Ich nicht. Sich mit so einer Art Henkeltopf das Wasser über den Wanst zu kippen, wenn man es ein bisschen höher aus einer Brause kommen lassen könnte – ist doch beknackt! Außerdem muss man ziemliche Verrenkungen machen, um sich überall die Seife abzuspülen. Das Klo ist okay – das übliche Zivilisationsmodell. In meiner letzten Behausung war es noch der gute alte Donnerbalken.«
»Wie lange bist du jetzt hier, Roy?«
»In diesem Land? Vier Jahre. Versteh mich nicht falsch. Es gibt außer dem dicken Gehalt, das sie mir zahlen, noch eine ganze Menge mehr, was ich hier mag. Aber es ist schon ein komisches Völkchen. Zum Beispiel all diese Dinge, die sie jetzt kriegen – Autos, Kühlschränke, Radios und so weiter –, das betrachten sie nicht als etwas, was man benutzt. Sie tragen das wie Amulette. Ob diese Dinge irgendeinen Nutzen für sie haben oder nicht, ob sie überhaupt funktionieren, spielt gar keine Rolle für sie. Sie müssen sie einfach haben, um sich wohlzufühlen. Abdul hat in einem Film einen Amerikaner mit einer goldenen Uhr gesehen, also musste er auch eine haben. Er hat drei Monate gehungert, um sich so ein Ding kaufen zu können. Warum? Er guckt nie auf die Uhr, zieht das Scheißding nicht auf und ist nicht mal besonders stolz darauf. Nur dass es eben ihm gehört. Die meisten sind so, und dadurch kriegt man ein ganz schiefes Bild von ihnen. Man denkt, sie sind einfach ein Haufen von angeberischen Kindsköpfen, die die westliche Zivilisation nachäffen wollen.«
»Bis man eines Tages entdeckt, dass es durchaus keine Kindsköpfe sind und dass man überhaupt noch nicht angefangen hat, sie zu verstehen.«
»Ganz recht. Weißt du, als ich noch neu war hier, habe ich mal ein paar von den Jungs auf dem Flugplatz gefragt, was nach ihrer Meinung das schlimmste Verbrechen ist, das ein Mann begehen kann. Weißt du, was sie gesagt haben?«
»Jedenfalls nicht Mord. Davon machen wir zu viel Aufhebens, finden sie.«
»Nein, nicht Mord. Einem andern die Frau wegnehmen, das, meinten sie, sei das schlimmste.«
»Der Witz ist mir neu.«
»War er mir auch. Ich wusste damals noch nicht, dass es keinen Sinn hat, in diesem Land Fragen zu stellen. Man kriegt doch immer nur die Antwort, von der sie meinen, man möchte sie hören. Während des Krieges war meine Frau mit einem andern durchgebrannt. Ich hatte mich gerade von ihr scheiden lassen, und diese Witzbolde hatten das zufällig mitgekriegt, das ist alles.« Er grinste. »Verheiratet, Steve?«
»Nicht mehr. Dieselbe Geschichte.«
Er nickte. »Mina wird dir schon jemand besorgen.«
»Wer ist das?«
»Meine Freundin. Pass auf – dusch du dich erst mal. Ich rufe sie inzwischen an und sage ihr, sie soll eine Freundin mitbringen.«
Es war dunkel, als wir wieder auf den Platz hinuntergingen, und die Stadt war zum Leben erwacht. Überall waren Menschen. Die Kasuar-Bäume und Madagaskar-Palmen, die um die Grünanlagen in der Mitte standen, waren mit Lichtergirlanden behängt, und darunter waren Marktstände aufgebaut worden. Chinesische Essbuden, umgeben von kleinen Gruppen, die im Staub hockten und aßen. Ein vielleicht zehnjähriger Junge spielte in der Hocke ein Bambus-Xylophon, während ein anderer neben ihm trommelte. Die Straße, die um den Platz lief, war gedrängt voll von Autos, die im Kriechtempo fuhren, und unablässig klingelten die betjak-Fahrer, die sich mit ihren buntbemalten Dreirädern durch die Lücken schlängelten. Dank dem Reichtum und Einfluss der Hintermänner des schwarzen Marktes von Selampang gab es in einer Stadt, in der das billigste amerikanische Auto dreimal so viel kostete wie in Detroit, ein modernes Verkehrsproblem.
Vor dem Eingang des Air House stand eine Reihe leerer betjaks, und kaum hatte einer der Fahrer Jebb erblickt, scherte er aus der Reihe aus und kam diensteifrig lächelnd zu uns herangetrampelt.
»Wir brauchen zwei heute Abend, Mahmud.«
»Ich kann euch beide fahren, tuan.«
»Das glaub ich dir schon, Alter, aber wir wollen’s bequem haben. Wo ist denn dein Freund?«
Ein anderer Fahrer wurde herangewinkt, und wir fuhren los.
Hat man einmal gelernt, sich an dem Schnaufen des Fahrers, der hinter einem in die Pedale tritt, nicht zu stören, und hat man das Gefühl überwunden, die sitzende Zielscheibe für jedes sich nähernde Auto zu sein, ist das betjak eine angenehme Transportform, besonders an einem heißen Abend. Man wird gerade schnell genug dahingetragen, um die Luft als kühl zu empfinden, aber auch wieder nicht so schnell, dass der Schweiß einen frösteln macht. Man kann sich bequem zurücklehnen und in die Bäume und Sterne hinaufschauen, ohne von Insekten gebissen zu werden; und vorausgesetzt, der Fahrer besteht nicht darauf, einem dauernd obszöne Einladungen für das nächste Bordell ins Ohr zu säuseln, kann man seinen Gedanken nachhängen.
Ich war froh über den Aufschub. Nach den Tangga-Bergen war Selampang erstickend schwül, und schon ein leichtes Leinenhemd kam einem vor wie eine Decke. Außerdem hatte ich im Apartment drei große Brandys getrunken; einen mehr, als ich eigentlich gewollt hatte. Ich hatte einiges zu tun am nächsten Tag und gedachte nicht, mich mit einem Kater zu belasten. Und ich hatte auch nicht vor, die Nacht mit irgendeinem von Jebbs Freundin ausgesuchten einheimischen Flittchen zu verbringen. Ich hatte die Anweisungen gehört, die er ihr am Telefon gegeben hatte, und war zu der Erkenntnis gelangt, dass Gastfreundschaft an einem bestimmten Punkt in Aufdringlichkeit umschlagen kann. Und war man es gewohnt, keusch zu leben, so sollte man sich ein Abweichen von dieser Gewohnheit – besonders wenn die Umstände einen dazu genötigt hatten – nicht allzu leichtfertig gönnen. Ich hatte diesbezüglich meine eigenen Vorstellungen, und Selampang hatte in ihnen momentan keinen Platz.
Der New Harmony Club war außerhalb der Stadt. Nach dem Rennplatz kam für etwa eine halbe Meile ein Stück gerader, unbeleuchteter Straße mit großen umzäunten Bungalow-Siedlungen zu beiden Seiten. Es war sehr still auf dieser Straße, und wenn ein Auto sich näherte, konnte man es fast gleichzeitig mit dem Sichtbarwerden seiner Scheinwerfer hören. Selbst die Zikaden klangen gedämpft, und der Gestank der Kanäle lag nun hinter uns.
»Ganz schöne Gegend«, sagte Jebb; »solange man nicht zu nahe am Rennplatz wohnt.« Die beiden betjaks fuhren jetzt nebeneinander.
»Was wohnen denn hier für Leute?«
»Meistens Auslandsvertretungen. Ein oder zwei reiche Chinesen. Die müssen für dieses Vorrecht aber auch ganz schön blechen. Schau, da ist der Club. Das Licht da vorne. Na, dann leg mal einen Zahn zu, Mahmud! Wir brauchen einen Drink.«
Es war ein Bungalow, der sich von den anderen nur unwesentlich unterschied. An der Einfahrt hing eine Leuchtschrift, und ein Torwärter mit spitzer Mütze beäugte uns prüfend, als wir einbogen. Wir hielten, und wieder schien die schwüle, feuchte Luft sich um uns zu schließen – nur war sie jetzt schwer vom Duft des Jasmins, der im Vorgarten blühte; und von drinnen kam das internationale Luxusgeklimper eines Nachtclub-Pianisten, der sentimentale amerikanische Weisen spielte.
Im Vestibül stellte mir ein chinesischer Türhüter in hellem Kunstseiden-Smoking eine zeitlich begrenzte Mitgliedskarte aus und verkaufte mir zum doppelten Schwarzmarktpreis ein Päckchen amerikanischer Zigaretten. Dann traten wir in den Raum dahinter.
Früher waren es zwei Räume gewesen, die Trennwand war durch Bogendurchgänge ersetzt worden. Auf der einen Seite war eine mit Teakholz verkleidete Bar, und in einer Nische stand auf einem Podium ein Klavier. Im übrigen war der Raum mit Tischen vollgestellt, einem Dutzend etwa. Draußen, auf der überdachten Terrasse, gab es noch ein paar Tische mehr und eine leicht erhöhte Tanzfläche. Die Wandbemalung sollte Mauerwerk imitieren, und das Licht kam von elektrischen Kerzen in schmiedeeisernen Wandhaltern.
Es war früh, und nur zwei oder drei Tische waren bis jetzt besetzt. An der Bar jedoch herrschte Andrang. Von den Männern waren die meisten Europäer, auf den Barhockern saßen aber auch zwei junge Sundanesen in adretten Luftwaffenuniformen und ein tadellos gekleideter Chinese mit randloser Brille. Der Pianist war ein arrogant dreinschauender Inder mit Goldarmband und Rubinring. Ein holländisches Pärchen mit Gläsern in den Händen lehnte am Flügel und hörte hingerissen zu. Die Frisur der Frau hatte etwas gelitten, und sie schien ein bisschen betrunken zu sein. Der Inder ignorierte die beiden.
»›A bunch of the boys were whooping it up in the Malamute saloon‹«, zitierte Jebb scherzend und begann sich mit den Ellbogen zur Bar durchzukämpfen, wobei er nach links und rechts Leute begrüßte. »Hallo, Ted. Wie geht’s denn so, Alter? Grüß dich, Marie.«
Marie war ein stämmiges dunkles Mädchen mit großen, vorstehenden Zähnen und einem engen Seidenkleid. Sie lächelte mechanisch und blies Zigarettenrauch an die Decke. Jebb zwinkerte mir zu. Ich hatte keine Ahnung, was das Zwinkern bedeuten sollte, aber ich grinste verständnisinnig zurück. Die Mühe war vergebens. Er begrüßte den Chinesen mit der randlosen Brille.
»Abend, Mor Sai. Ich möchte dir einen Freund vorstellen, Steve Fraser. Steve, das ist Lim Mor Sai. Ihm gehört der Laden hier.«
Als wir uns die Hände gaben, kam durch die Tür neben der Bar eine Blondine mit übernächtigten Augen und dümmlichem Mund. »Hallo, Roy, mein Schatz«, sagte sie und henkelte sich bei Jebb ein. »Ich dachte, du wolltest nach Makassar.«
»Nein, das ist erst morgen. Molly, das ist Steve Fraser. Steve, das ist Molly Lim.«
Mit glasigem Blick sah sie mich an. »Wieder so ein Drecksbrite, hä? Warum bleibt ihr nicht zu Hause?«
Ich lächelte.
»Eines Tages, mein Liebling«, sagte förmlich ihr Mann, »wirst du einen solchen Scherz einmal zu oft gemacht haben. Dann wird eine Menge von unsern Möbeln zu Bruch gehen, und es wird Ärger mit der Polizei geben.«
»Ach du, hör doch auf!« Sie streichelte ihm die Wange. »Er weiß doch, dass ich nur Spaß mache. Dreimal dürfen Sie raten, wo ich her bin, Mr. Fraser.«
»Lancashire?«
»Natürlich. Mor Sai sagt, ich würde sogar Kantonesisch mit Liverpool-Akzent sprechen. Stimmt’s, Schatz?«
Lim schien ihrer leicht überdrüssig zu sein. »Da Sie den Club zum ersten Mal besuchen«, sagte er zu mir, »müssen Sie einen Schluck auf Kosten des Hauses trinken.«
»Das ist genau das, worauf wir gewartet haben«, sagte Jebb. »Wir nehmen Brandy.«
»Es wird auf der Rechnung stehen«, sagte Mrs. Lim spöttisch und entfernte sich.
Lim schnippte dem Barmann mit den Fingern und bestellte. Jebb stupste mich an. Ich blickte durch den Raum und sah, wie Mrs. Lim einem Mann das Glas aus der Hand nahm und es in einem Zug leerte. Der Mann lachte.
Auch Lim sah es. Als unsere Drinks kamen, entschuldigte er sich und ging zu ihr.
»Ich hätte dich warnen sollen wegen unserer Molly«, sagte Jebb. »Du darfst ihr unter keinen Umständen einen Drink ausgeben.«
»Sieht nicht so aus, als ob sie erst lange darauf wartet.«
»Ja, du musst dein Glas festhalten, wenn sie in der Nähe ist. Der Kerl da müsste eigentlich Bescheid wissen. Er wird sich unbeliebt machen bei Lim, wenn er nicht aufpasst.«
»Ist denn das so was Schlimmes?«
»Es ist besser, man steht gut mit ihm. Lim hat Freunde im Polizeipräsidium. Weißt du, wie viel Zeit die für Ausreisepapiere brauchen? Wenn sie schlecht gelaunt sind, dauert das manchmal eine Woche. Das letzte Mal, als ich in Urlaub fuhr, hat Lim das alles in zwei Tagen für mich geregelt, aber ich kann dir sagen …« Er brach ab, grinste über meine Schulter und sagte: »Grüß dich, Mina-Baby!«
Es ist schwer, Eurasierinnen genau zu beschreiben. Beim ersten Eindruck überwiegen bestimmte rassische Merkmale immer so sehr, dass man alle anderen dabei praktisch übersieht; bei näherer Bekanntschaft scheint dieser erste Eindruck dann immer ins Gegenteil umzuschlagen. Es ist nicht einfach nur eine Sache der Kleidung. In einem europäischen Kleid kann dieselbe Frau einmal mehr und einmal weniger asiatisch aussehen; wann das kippt, weiß man nicht – es ist wie bei diesen optischen Täuschungen, wo man einmal eine Pyramide massiver Kuben sieht, und beim nächsten Hinschauen sind es dann plötzlich leere Würfel.
Auf den ersten Blick sah Mina vollkommen europäisch aus. Sie war eine schlanke, attraktive Brünette mit jener etwas adlerhaften Gesichtsstruktur, wie man sie vorwiegend im östlichen Mittelmeerraum findet; Griechin, hätte man vielleicht getippt. Ihre Freundin, Rosalie, sah dagegen aus wie ein Filipino-Mädchen aus gutem Hause, das beim Studium in Amerika gelernt hatte, sich zu kleiden. Doch nach zehn Minuten kamen Minas Züge mir unverwechselbar sundanesisch vor, während Rosalie aussah wie ein europäisches Mädchen, das in seinem Gehabe seine Lieblingsballerina nachahmt. Ihre Stimmen hatten etwas damit zu tun. Beide sprachen sie gutes Englisch mit holländischem Akzent; aber bei Mina konnte man noch die sundanesischen Gutturale heraushören. Sie wirkte etwas angespannt und laut. Rosalie war ruhiger und selbstsicherer.
Jebb hatte erklärt, dass sie beide an einer von einem Chinesen geleiteten Schule westlichen Tanz unterrichteten und dass sie erwarteten, dafür bezahlt zu werden, dass sie den Abend mit uns im Club verbrachten. Nach Mitternacht würden neue Verhandlungen notwendig werden; aber die hätte ich selber zu führen. Mit Mina hätte er mehr oder weniger ein Dauerabkommen. Rosalie war, soweit man wusste, sehr wählerisch; wenn sie einen nicht mochte, war nichts zu machen, nicht einmal, wenn man Millionär war. Es liege ganz bei mir.
Daraufhin hatte ich mich resigniert auf einen langweiligen und wahrscheinlich nicht ganz sauberen Abend eingestellt. Doch es sollte anders kommen. Das Eis wurde bei mir, glaube ich, dadurch gebrochen, dass ich merkte – so unsentimental das ist –, dass das Verhältnis von Mina und Jebb auch auf echter Zuneigung beruhte. Ich glaube nicht, dass ich das erfand. Bei Liebe kann einem was vorgemacht werden, aber wenn zwei sich mögen, geht das nicht so einfach.
Zuerst redete Mina sehr viel. Die meiste Zeit spielte sie ein Lieblingsspiel der Sundanesen. Wenn man einem Mann Geld schuldet oder durch ihn irgendwie das Gesicht verloren hat oder wenn er ein Vorgesetzter ist, den man nicht leiden kann, so erfindet man etwas Skandalöses über ihn, vorzugsweise mit einer Fülle übelriechender Details, so etwa, dass er impotent ist, gehörnt oder pervers. Niemand glaubt die Geschichte, aber je umständlicher man das erzählt, je mehr man seine Zuhörer zu packen versteht, umso überlegener wird man seinem Feind. Minas Skandale waren ätzend und schamlos, und sie erzählte sie wie eine gute Komödiantin, die ob der Absonderlichkeiten ihrer Geschichten selber ins Staunen kommt. Jebbs Rolle bestand darin, sich zu weigern, auch nur ein Wort von dem zu glauben, was sie sagte. Wurde beispielsweise über den Polizeichef hergezogen, behauptete Jebb, er kenne den Mann persönlich, ihre Geschichte könne nicht stimmen. Das wiederum führte dann zu einem weiteren Ausholen, um die Geschichte zu beweisen.
Das hätte langweilig werden können, wurde es aber aus irgendeinem Grunde nicht. Ein- oder zweimal, als ich loslachen musste, lachte sie mit und beeilte sich dann, mich davon zu überzeugen, dass das, was sie erzählt habe, nichts zum Lachen sei. Rosalie lächelte nur. Ihr Verhalten gegenüber Mina war das eines Erwachsenen gegenüber einem frühreifen Kind, das möglicherweise allzu wild wird; amüsiert und ein wenig besorgt. Hin und wieder sah ich aus einem Augenwinkel, wie sie mich abwägend prüfte. Dass mich das überhaupt nicht störte, war eine überraschende Entdeckung für mich. Einmal merkte sie, dass ich sie taxierte. Sie sagte gerade etwas zu Jebb und verlor durch meinen Blick für einen kurzen Moment den Faden; aber sonst schien sie sehr selbstbeherrscht.
Das Essen war vietnamesisch und sehr gut. Danach gingen wir hinaus auf die Terrasse und tranken Tee. Dann stellte Lim einen Plattenspieler an, und wir tanzten eine Weile; aber bald war es zu eng auf der kleinen Tanzfläche, und so schlenderten wir auf dem Grundstück umher.
Früher war das eine Gartenanlage mit schönen Plattenwegen und Blumenrabatten und Teichen für Zierfische gewesen; jetzt war das alles überwuchert, die Krotons und die Bananenstauden waren verwildert, die Teiche lagen erstickt unter Java-Algen. Aber die Luft duftete angenehm, und ich war froh, dem Lärm des Plattenspielers entronnen zu sein. Ich zündete mir eine Zigarette an, und ein oder zwei Minuten wandelten wir einen Weg entlang, der auf einer Seite des Grundstücks vom gröbsten Unkraut gereinigt worden war. Dann flatterte mir eine Fledermaus dicht über den Kopf, und ich fluchte. Der Mond war sehr hell, und ich sah das Mädchen zu mir aufblicken.
»Sie brauchen mir gegenüber nicht höflich zu sein«, sagte sie.
»Wie meinen Sie das?«
»Es ist jetzt elf. Mina und Roy bleiben mindestens noch zwei Stunden. Sie haben heute eine weite Reise gehabt. Bestimmt sind Sie sehr müde.«
»Ich habe diesen Abend genossen, aber jetzt – ja, ich bin müde.«
»Dann sollten Sie gehen und schlafen.« Sie lächelte, als ich zögerte. »Wir können uns ja morgen wiedersehen, wenn Sie möchten.«
»Ja, das würde ich gern. Roy muss morgen früh nach Makassar, und sonst kenne ich niemand in dieser Stadt. Das heißt, niemand, den ich treffen möchte.« Ich zögerte wieder. Wir waren stehen geblieben, und sie blickte auf zu mir.
»Was möchten Sie sagen?«
»Zu unserem Handel gäbe es von meiner Seite aus auch noch …«
»Ich finde, darüber brauchen wir nicht zu reden. Sie werden noch zwei, drei Tage hier sein. Wenn Sie abfliegen, werden Sie mir ein Geldgeschenk machen. Wenn wir uns nicht gemocht haben, werden Sie es mir mit Verachtung geben. Und wenn wir uns gemocht haben, wird es den Abschied erleichtern. In jedem Fall werden Sie großzügig sein.«
»Sind Sie sich dessen sicher?«
»Ja, das bin ich.«
Das war alles, was gesagt wurde. Sie henkelte sich ein, und schweigend setzten wir unseren Rundgang um das Grundstück fort. Es war eine schöne Nacht, und plötzlich fühlte ich mich ganz ruhig.
Wir gingen gerade den Weg entlang, der parallel zur Straße hinter dem abgrenzenden Zaun verlief, als ich vor uns ein Licht durch das Bambusdickicht flackern sah.
»Was ist das für ein Licht?«, fragte ich.
»Da stehen ein paar alte kampong-Häuser. Als die Holländer den Bungalow bewohnten, lebte da drüben das Dienstpersonal. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt noch benutzt werden.«
Die Steinplatten des Weges hatten aufgehört, und wir gingen auf weicher Erde, die das Geräusch unserer Schritte schluckte. Dann hörten wir vor uns Stimmen, und wir gingen langsamer. Eine der Stimmen war die von Mrs. Lim, und ich glaube, wir waren in dem Moment beide nicht daran interessiert, mit ihr zusammenzutreffen. Gerade wollte ich vorschlagen umzukehren, als sie aus Leibeskräften zu schimpfen begann.
»Und ich sage, sie können nicht! Sollen wir alle umgebracht werden? Du musst doch völlig den Verstand verloren haben!«
Ein Mann sagte etwas sehr schnell. Mrs. Lim gab etwas wie ein Stöhnen von sich, als wäre sie geschlagen worden, und begann zu weinen.
Rosalie fasste meinen Arm fester. Plötzlich hörte man ein leises Stapfen von Füßen auf Holzstufen und dann das Geräusch von jemand, von Mrs. Lim wahrscheinlich, die zum Bungalow zurücklief.
Einen Moment standen wir unschlüssig da. Wir hatten uns halb schon zum Umkehren gewendet; aber der kürzeste Weg zurück zum Bungalow war jetzt geradeaus, und es schien wenig sinnvoll, auf demselben Weg zurückzugehen. Wir gingen weiter.
Die Häuser der Dienerschaft befanden sich zwischen ein paar Palmen auf der entfernteren Seite eines Trampelpfades, der durch eine Einfahrt auf die Straße hinausführte. Sie war breit genug für einen Ochsenkarren und war wohl einmal so etwas wie ein Lieferantenzugang gewesen. Die Häuser waren auf Teakpfählen errichtet, und das Grundgerippe war noch instand, nur die attap-Wände hatten unter den Auswirkungen des Monsuns gelitten, und beide Häuser schienen seit langem leer zu stehen. Das Licht, das aussah, als käme es von einer Petroleumlampe, brannte in dem vom Pfad entfernteren Haus und leuchtete durch die Risse in den Wänden. Aus dem Inneren kam das gedämpfte Murmeln von Männerstimmen. Es schienen vier zu sein. Vor den Verandastufen des näher gelegenen Hauses stand ein Jeep.
Jeeps sind in diesem Teil der Welt etwas ganz Alltägliches. Was mich veranlasste, stehen zu bleiben und genauer hinzuschauen, das war eine an die Seite angeschweißte senkrechte Halterung. Diese Halterung findet man bei vielen ausrangierten Armee-Jeeps. Ursprünglich war daran ein senkrechter Auspuff befestigt, um den Jeep bei Landungsmanövern wassertüchtig zu machen; aber diese Halterung stand in einem Winkel, der mir irgendwie bekannt vorkam. Ich blickte hinunter auf das Nummernschild.
In einer Gegend, wo man praktisch für jeden Weg auf ein Motorfahrzeug angewiesen ist, bekommt sogar ein völlig durchgenormtes Fahrzeug wie ein Jeep Charakter, hat seine eigenen kleinen Besonderheiten, sein ganz spezielles Fahrverhalten. Manche fährt man lieber als andere, und weil sie alle genau gleich aussehen, lernt man es, sie an ihren Nummern zu unterscheiden.
Die Nummer dieses Jeeps kannte ich nur zu gut. Ich hatte ihn an dem Tag schon einmal gesehen. Er hatte vor dem Büro von Gedge gestanden.
Ich muss überrascht zurückgezuckt sein, denn Rosalie blickte rasch zu mir auf.
»Was ist? Was ist los?«
»Warten Sie hier einen Moment.«
Das Haus mit dem Licht war etwa zwanzig Schritt entfernt. Ich ging darauf zu. Ich hatte in dem Augenblick tatsächlich die Absicht, da hineinzugehen und zu fragen, was zum Teufel ein Jeep vom Tangga-Tal-Projekt hier unten in Selampang zu suchen habe. Auf halbem Weg kam ich glücklicherweise zur Vernunft und blieb stehen. Es war vormittags gegen elf gewesen, als ich den Jeep zuletzt in Tangga gesehen hatte, und doch war er kaum mehr als zwölf Stunden später in Selampang. Auf dem Seeweg konnte er in dieser Zeit nicht gekommen sein. Und der Luftweg schied ebenfalls aus. Das hieß, dass er zweihundert Meilen über Straßen gefahren worden war. Und das wiederum hieß, dass er schnell und sicher durch jede von den Aufständischen in Sanusis Gebiet kontrollierte Straßensperre gekommen war und genauso unbehelligt die Vorposten der Garnison Selampang passiert hatte. Das hieß, dass derjenige, der damit gekommen war, jemand sein musste, den man vorerst besser mied; und die Freunde des Betreffenden ebenfalls.
Ein oder zwei Sekunden stand ich da und hatte dabei höchst unangenehmes Herzklopfen. Ich konnte die Stimmen da drinnen jetzt unterscheiden. Sie sprachen malaiisch. Ein Mann wiederholte etwas mit Nachdruck. Er hatte eine hohe, hässliche Stimme, und es klang, als versuchte er gleichzeitig zu sprechen und zu schlucken.
»Alle müssen wir haben. Alle«, sagte er gerade.
Die Stimme, die antwortete, war mit Sicherheit die Major Supartos. Sie war sehr ruhig und beherrscht. »Dann muss es auf den zweiten Tag verschoben werden«, sagte er. »Wir müssen Geduld haben, General.«
Leise drehte ich mich um und ging zurück zu Rosalie. Sie sagte nichts und hakte sich wieder bei mir unter, um zum Club zurückzugehen.
Nach einer kleinen Weile sagte sie: »Ist irgendwas nicht in Ordnung?«
Ich zögerte. Ich fürchtete, sie könnte mich für dumm halten. »Dieser Jeep da hinten«, sagte ich schließlich, »der war heute morgen noch in Tangga. Ein Offizier der sundanesischen Armee hat ihn heute hierhergefahren – auf dem Landweg. Ein Major. Der sitzt jetzt da drin.«
Meine Befürchtung war überflüssig gewesen. Als ihr klar wurde, was ich gesagt hatte, zog sie scharf den Atem ein.
»Mit Lim Mor Sai?«, sagte sie rasch.
»Vermutlich ja. Es waren noch andere da, einer davon ein General. Ich glaube, wir vergessen das besser.«
»Ja, wir müssen das vergessen.«
Wir setzten unseren Weg zur Terrasse fort. Mina und Jebb waren in der Bar, und da die Tanzfläche jetzt nicht mehr so voll war, beschlossen wir, noch einmal zu tanzen, bevor ich ging.