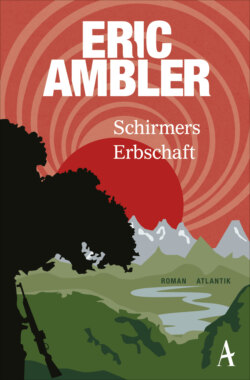Читать книгу Schirmers Erbschaft - Eric Ambler - Страница 5
1
ОглавлениеGeorge Carey kam aus einer Familie in Delaware, die aussah, als wäre sie einer Werbung für eine teure Automarke entsprungen. Sein Vater war ein wohlhabender Arzt mit schlohweißem Haar. Seine Mutter entstammte einer alten Familie in Philadelphia und war ein wichtiges Mitglied des Gartenclubs. Seine Brüder waren hoch gewachsen, kernig und gut aussehend. Seine Schwestern waren schlank, kräftig und lebhaft. Alle hatten schöne, regelmäßige Zähne, die man sah, wenn sie lächelten. Die ganze Familie wirkte derart glücklich, sorglos und erfolgreich, dass einem unwillkürlich der Verdacht kam, die Wahrheit über sie sähe womöglich ganz anders aus. Aber nein, sie waren tatsächlich glücklich, sorglos und erfolgreich. Sie waren außerdem ungemein selbstgefällig.
George war der jüngste Sohn, und obwohl seine Schultern nicht so breit waren wie die seiner Brüder und sein Lächeln nicht so selbstzufrieden, war er der Begabteste und Intelligenteste in der Familie. Seine Brüder hatten, als der Ruhm ihrer Zeit als Footballspieler verblasst war, ohne rechtes Ziel den Weg ins Geschäftsleben genommen. George hatte von dem Moment an, als er von der High-School abging, klare Zukunftspläne. Ungeachtet der Hoffnungen seines Vaters auf einen Nachfolger für die Arztpraxis hatte George es abgelehnt, ein Interesse für Medizin vorzugeben, das er nicht empfand. Er wollte sich auf die Jurisprudenz legen; und zwar nicht auf den Zweig, der sich mit Verbrechen befasst und im Gerichtssaal abspielt, sondern den, der schon im mittleren Alter in den Vorstand von Eisenbahngesellschaften und Stahlfirmen oder in hohe politische Ämter führt. Der Krieg, der kurz nach seinem Examen in Princeton ausbrach, nahm ihm viel von seinem Ernst und seiner Selbstgefälligkeit und wirkte sich günstig auf seinen Sinn für Humor aus, vermochte ihn jedoch nicht von seinem gewählten Berufsweg abzubringen. Nach viereinhalb Jahren als Bomberpilot studierte er Jura in Harvard. Anfang 1949 legte er cum laude sein Examen ab. Dann, nach einem nutzbringenden Jahr als Sekretär eines gelehrten und berühmten Richters, trat er bei Lavater ein.
Die Anwaltskanzlei Lavater, Powell und Sistrom in Philadelphia zählt zu den wirklich bedeutenden Kanzleien im Osten der Vereinigten Staaten, und die lange Liste ihrer Teilhaber liest sich wie eine Auswahl vielversprechender Kandidaten für einen frei werdenden Sitz im Supreme Court. Bis zu einem gewissen Grad rührt ihr gediegener Ruf sicherlich noch von der Erinnerung an den gewaltigen Handel mit Versorgungsanleihen her, mit dem sie in den Zwanzigern befasst war; andererseits hat es in den letzten dreißig Jahren kaum einen wirtschaftsrechtlichen Fall von einiger Größenordnung gegeben, in dem die Kanzlei nicht ein wichtiges Mandat innegehabt hätte. Sie ist nach wie vor ein tatkräftiges, vorausschauendes Unternehmen, und eine Stelle von ihr angeboten zu bekommen stellt für einen jungen Anwalt ein höchst schmeichelhaftes Zeichen der Anerkennung dar.
George hatte somit allen Grund, mit dem Fortgang seiner Karriere zufrieden zu sein, während er sich mit seinen Habseligkeiten in einem der komfortabel ausgestatteten Büros der Kanzlei einrichtete. Gewiss, für die etwas untergeordnete Position, die er einnahm, war er schon ein bisschen alt, aber er war schlau genug, um sich klarzumachen, dass seine vier Jahre bei der Luftwaffe aus beruflicher Sicht keine völlig verlorene Zeit und dass seine Kriegsauszeichnungen für sein Hiersein ebenso ausschlaggebend gewesen waren wie seine Leistungen auf der Universität und die warmen Empfehlungen des gelehrten Richters. Wenn daher alles gut ging (und warum sollte es das nicht?), konnte er mit einem raschen Aufstieg, wertvollen Kontakten und wachsendem persönlichem Ansehen rechnen. Er hatte das Gefühl, es geschafft zu haben.
Die Nachricht, dass er sich mit dem Fall Schneider-Johnson beschäftigen sollte, war daher ein unangenehmer Schlag. Sie war auch in anderer Hinsicht überraschend. Die Fälle, mit denen Lavater normalerweise zu tun hatte, waren von der Art, die ebenso gewiss Ansehen wie Geld einbrachte. Nach allem, was George noch von dem Fall Schneider-Johnson wusste, handelte es sich dabei um eine jener grotesken Affären, die sich jeder Wirtschaftsanwalt, der auf seinen Ruf bedacht ist, auf Armeslänge vom Leibe hält.
Es handelte sich um eine der notorischen Absurditäten der Vorkriegsjahre, bei denen es um den fehlenden Erben eines Vermögens ging.
1938 war Amelia Schneider-Johnson, eine senile alte Dame von einundachtzig Jahren, in Lamport, Pennsylvania, gestorben. Sie hatte allein in dem heruntergekommenen Holzhaus gelebt, das ihr der verblichene Mr. Johnson zur Hochzeit geschenkt hatte, und ihre letzten Jahre in einer Atmosphäre vornehmer Armut zugebracht. Nach ihrem Tode jedoch hatte man festgestellt, dass zu ihrem Nachlass drei Millionen Dollar in festverzinslichen Wertpapieren gehörten, die sie in den zwanziger Jahren von ihrem Bruder Martin Schneider, einem Soft-Drink-Magnaten, geerbt hatte. Aufgrund eines übersteigerten Misstrauens gegen Banken und Schließfächer hatte sie die Wertpapiere in einer Blechschatulle unter ihrem Bett aufbewahrt. Sie hatte auch Anwälten misstraut und daher kein Testament gemacht. Die seinerzeit in Pennsylvania geltende Erbfolge war durch ein Gesetz von 1917 geregelt worden, welches besagte, dass noch der entfernteste Blutsverwandte des Erblassers unter Umständen Anspruch auf einen Teil des Nachlasses hatte. Amelia Schneider-Johnsons einzige bekannte Verwandte war Miss Clothilde Johnson, eine ältere Jungfer, gewesen. Aber sie war lediglich mit Amelia verschwägert und kam daher als Erbin nicht in Betracht. Unter begeisterter und sich verheerend auswirkender Mithilfe der Presse hatte eine Suche nach Amelias Blutsverwandten begonnen.
Der Eifer der Presse war in Georges Augen nur allzu verständlich. Sie hatte einen zweiten Fall Garrett gewittert. Die alte Mrs. Garrett war 1930 gestorben und hatte siebzehn Millionen Dollar hinterlassen, ohne ein Testament zu machen – nun, acht Jahre später, war die Sache immer noch munter im Gange und hielt bei mittlerweile sechsundzwanzigtausend Anwärtern auf das Geld dreitausend Anwälte in Lohn und Brot, und über allem schwebte ein leichter Hautgout von Korruption. Der Fall Schneider-Johnson konnte sich ebenso lang hinziehen. Er hatte zwar nicht die gleiche Größenordnung, doch Größe war nicht alles. Er war dafür reich an menschlichen Aspekten – das auf dem Spiel stehende Vermögen, die romantische Zurückgezogenheit der alten Dame in ihren letzten Jahren (ihr einziger Sohn war in den Argonnen gefallen), ihr einsamer Tod ohne einen Verwandten am Sterbebett, die ergebnislose Suche nach dem Testament –, es gab keinen Grund, warum der Fall nicht ebenso zählebig sein sollte. Der Name Schneider und seine amerikanischen Varianten waren weit verbreitet. Die alte Dame musste irgendwo Blutsverwandte gehabt haben, selbst wenn sie diese – oder ihn! Oder sie! – nicht gekannt hatte. Ja, es konnte durchaus sein, dass es nur einen einzigen Erben gab, der nicht zu teilen brauchte! Schön und gut, aber wo steckte er? Oder sie? Auf einer Farm in Wisconsin? In einem Immobilienbüro in Kalifornien? Hinter dem Ladentisch eines Drugstores in Texas? Wer von den Tausenden von Schneiders, Snyders und Sniders in Amerika würde der Glückliche sein? Wer war der ahnungslose Millionär? Kitsch? Nun ja, vielleicht, aber immer gut für eine Story und von landesweitem Interesse.
Und landesweit war das Interesse tatsächlich gewesen. Bis Anfang 1939 war der Nachlassverwalter von über achttausend Anwärtern auf das Erbe in Kenntnis gesetzt worden, ein Heer von Winkeladvokaten hatte sich eingeschaltet, um sie auszubeuten, und die ganze Sache war zügig in ein Wolkenkuckucksheim von Phantasterei, Schwindel und juristischer Farce entschwebt, wo sie verblieb, bis sie bei Ausbruch des Krieges plötzlich in Vergessenheit geriet.
Was Lavater für ein Interesse daran haben konnte, einen derart unappetitlichen Leichnam wiederauferstehen zu lassen, konnte George sich beim besten Willen nicht vorstellen.
Mr. Budd, einer der Seniorpartner, klärte ihn darüber auf.
Die Hauptlast des Nachlasses Schneider-Johnson war von Moreton, Greener und Cleek getragen worden, einer altmodischen, hochangesehenen Anwaltskanzlei in Philadelphia. Als Anwälte von Miss Clothilde Johnson hatten sie auf deren Anordnung hin die offizielle Suche nach einem Testament durchgeführt. Nachdem das Fehlen eines solchen von Amts wegen festgestellt worden war, kam die Angelegenheit vor das Waisengericht in Philadelphia, und das Testamentsregister hatte Robert L. Moreton als Nachlassverwalter eingesetzt. Das war er bis Ende 1944 geblieben.
»Und nicht zu seinem Nachteil«, sagte Mr. Budd. »Wenn er nur so viel Verstand gehabt hätte, es dabei zu belassen, hätte ich ihm keinen Vorwurf gemacht. Aber nein, der alte Zausel hat seine eigene Kanzlei zum Rechtsvertreter des Nachlassverwalters bestellt. Heiliger Strohsack! In einem solchen Fall war das der reinste Selbstmord!«
Mr. Budd war ein hühnerbrüstiger Mann mit länglichem Schädel, einem ordentlich gestutzten Schnurrbart und einer Bifokalbrille. Er war immer schnell mit einem Lächeln bei der Hand, hatte die Angewohnheit, veraltete Redewendungen zu gebrauchen, und trug eine Miene sorgloser Gutgelauntheit zur Schau, der George zutiefst misstraute.
»Das Gesamthonorar«, sagte George vorsichtig, »muss bei einem Nachlass dieser Größenordnung ziemlich hoch gewesen sein.«
»Kein Honorar«, erklärte Mr. Budd, »ist so groß, dass es sich für eine anständige Kanzlei lohnte, sich mit einer Bande von Unfallgeiern und Schurken gemein zu machen. Auf der ganzen Welt gibt es Dutzende unabgeschlossener Erbschaftsfälle. Sehen Sie sich nur den Nachlass Abdul Hamid an! Den haben die Briten am Bein, und das nun schon seit über dreißig Jahren. Er wird vermutlich nie geregelt. Oder sehen Sie sich den Fall Garrett an! Überlegen Sie nur, wie viele Menschen er ihren guten Ruf gekostet hat. Alles Quatsch! Es ist doch immer das Gleiche. Ist A ein Hochstapler? Ist B geistesgestört? Wer ist vor wem gestorben? Ist das auf dem alten Foto Tante Sarah oder Tante Flossie? War hier ein Fälscher mit blässlicher Tinte am Werk?« Er wedelte wegwerfend mit den Armen. »Ich sage Ihnen, George, der Fall Schneider-Johnson hat Moreton, Greener und Cleek als ernst zu nehmende Anwaltskanzlei so gut wie erledigt. Und als Moreton vierundvierzig krank wurde und in den Ruhestand treten musste, war das das Ende. Sie haben sich aufgelöst.«
»Hätte denn nicht Greener oder Cleek die Nachlassverwaltung übernehmen können?«
Mr. Budd heuchelte Entsetzen. »Mein lieber George, ein solches Amt übernimmt man doch nicht einfach. Es ist eine Belohnung für gute und treue Dienste. In diesem Fall war unser gelehrter, hochgeachteter und verehrter John J. Sistrom der Glückliche.«
»Aha. Ich verstehe.«
»Das Investitionskapital arbeitet, George, und unser John J. kassiert das Honorar als Nachlassverwalter. Allerdings«, fuhr Mr. Budd mit einem Anflug von Zufriedenheit in der Stimme fort, »sieht es so aus, als würde er das nicht mehr lange tun. Sie werden gleich verstehen, warum. Nach dem, was mir der alte Bob Moreton seinerzeit erzählt hat, stellte sich die Sache ursprünglich folgendermaßen dar: Amelias Vater hieß Hans Schneider, ein Deutscher, der 1849 eingewandert ist. Bob Moreton und seine Partner waren am Ende ziemlich überzeugt, dass, wenn überhaupt irgendwer Anspruch auf den Nachlass hatte, es einer der Verwandten des alten Herrn in Deutschland sein musste. Die ganze Geschichte wurde allerdings durch die Frage der Rechtsnachfolge kompliziert. Wissen Sie irgendetwas darüber, George?«
»Bregy gibt in seinem Kommentar zum Gesetz von neunzehnsiebenundvierzig eine sehr klare Zusammenfassung der früheren Bestimmungen.«
»Bestens.« Mr. Budd grinste. »Ich habe davon nämlich offen gestanden nicht die geringste Ahnung. Wenn wir das ganze Zeitungsgesums einmal beiseite lassen, war der Hergang der Sache kurz gesagt folgender: Neununddreißig ist der alte Bob Moreton nach Deutschland gereist, um Nachforschungen über den anderen Zweig der Familie anzustellen. Natürlich der reine Selbsterhaltungstrieb. Sie brauchten Fakten, auf die sie sich stützen konnten, um all die falschen Ansprüche abzuschmettern. Dann, nach seiner Rückkehr, passierte etwas ganz Blödes. In diesem verrückten Fall passieren andauernd die blödesten Geschichten. Offenbar hatten die Nazis von Bobs Nachforschungen Wind bekommen. Jedenfalls sahen sie sich die Sache an und zogen einen alten Mann namens Rudolph Schneider aus dem Hut. Und erhoben dann in seinem Namen Anspruch auf den gesamten Nachlass.«
»Daran kann ich mich noch erinnern«, sagte George. »Sie haben McClure zu ihrem Rechtsvertreter bestellt.«
»Richtig. Dieser Rudolph stammte aus Dresden oder sonstwoher, und sie behaupteten, er sei ein Cousin ersten Grades von Amelia Johnson. Moreton, Greener und Cleek fochten diesen Anspruch an. Mit der Begründung, dass die von den Krauts vorgelegten Dokumente gefälscht seien. Die Sache war jedenfalls noch gerichtsanhängig, als wir einundvierzig in den Krieg eintraten, und damit war der Fall für sie erledigt. Der Treuhänder für Feindvermögen schaltete sich ein und machte einen Anspruch geltend. Wegen des deutschen Anspruchs, natürlich. Dann tat sich nichts mehr. Als Bob Moreton in den Ruhestand trat, übergab er sämtliche Dokumente John T. Das waren über zwei Tonnen, und im Augenblick liegen sie in unserem Keller, und zwar genau da, wo sie gelagert worden sind, als Moreton, Greener und Cleek sie vierundvierzig ausgehändigt haben. Kein Mensch hat sich je die Mühe gemacht, sie durchzusehen. Dazu gab es auch keinen Grund. Nun allerdings gibt es einen.«
George sank der Mut. »So?«
Mr. Budd suchte sich diesen Moment aus, um seine Pfeife zu stopfen, und vermied so Georges Blick, während er fortfuhr. »Die Situation ist folgende, George: Wie es scheint, beläuft sich der Nachlass einschließlich Wertzuwachs und Zinsen mittlerweile auf vier Millionen Dollar, und der Staat Pennsylvania hat beschlossen, seine gesetzlichen Rechte wahrzunehmen und das Ganze zu beanspruchen. Allerdings hat man John T., als Nachlassverwalter, gefragt, ob er den Anspruch anzufechten gedenkt, und er findet, wir sollten nur der Form halber die Dokumente noch einmal durchsehen, um sicherzugehen, dass auch ja kein ernst zu nehmender Anspruch mehr offensteht. Und genau das sollen Sie erledigen, George. Sehen Sie sie einfach durch. Nur um sicherzugehen, dass er nichts übersehen hat. Okay?«
»Ja, Sir. Okay.«
Doch es gelang ihm nicht ganz, einen resignierten Unterton aus seiner Stimme herauszuhalten. Mr. Budd blickte auf und schmunzelte mitfühlend. »Und wenn es ein Trost für Sie ist, George«, meinte er, »kann ich Ihnen sagen, dass uns schon seit einiger Zeit der Kellerraum knapp wird. Falls es Ihnen gelingt, uns den ganzen Kram vom Hals zu schaffen, ist Ihnen der tief empfundene Dank der gesamten Kanzlei gewiss.«
George brachte ein Lächeln zustande.