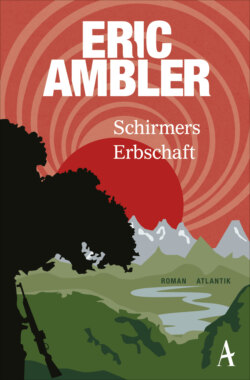Читать книгу Schirmers Erbschaft - Eric Ambler - Страница 6
2
ОглавлениеEs bereitete ihm keine Schwierigkeiten, die Akten zum Fall Schneider-Johnson zu finden. Sie waren feuchtigkeitsfest verpackt und lagerten in einem eigenen Kellerverschlag, den sie vom Boden bis zur Decke füllten. Was ihr Gesamtgewicht anging, hatte Mr. Budd mit seiner Schätzung eindeutig nicht übertrieben. Glücklicherweise waren sämtliche Päckchen sorgfältig beschriftet und systematisch geordnet. George vergewisserte sich zunächst, dass er das zugrunde liegende System begriff, traf dann eine Auswahl unter den Päckchen und ließ sie in sein Büro hinaufschaffen.
Es war Spätnachmittag, als er mit der Arbeit begann. In der Absicht, einen allgemeinen Überblick über den Fall zu gewinnen, ehe er sich ernsthaft mit den einzelnen Ansprüchen befasste, nahm er sich zunächst ein umfangreiches Päckchen mit der Aufschrift »Schneider-Johnson-Zeitungsausschnitte« vor. Diese Bezeichnung erwies sich als leicht irreführend. In Wirklichkeit enthielt das Päckchen eine Chronik des hoffnungslosen Kampfes von Moreton, Greener und Cleek mit der Presse und ihrer Bemühungen, sich der Flut von unsinnigen Ansprüchen entgegenzustemmen, die sie überschwemmte. Es war eine mitleiderregende Lektüre.
Die Chronik setzte zwei Tag nach Mr. Moretons Bestellung zum Nachlassverwalter ein. Ein New Yorker Boulevardblatt hatte herausgefunden, dass Amelias Vater Hans Schneider (»der alte Neunundvierziger«, wie die Zeitung ihn nannte) eine New Yorkerin namens Smith geheiratet hatte. Das aber hieß, behauptete das Blatt aufgeregt, dass der Name des gesuchten Erben ebenso gut Smith wie Schneider sein könnte.
Moreton, Greener und Cleek hatten sich füglich beeilt, die Behauptung zurückzuweisen; aber anstatt mehr oder weniger unkompliziert darauf hinzuweisen, dass Amelias Cousinen und Cousins mütterlicherseits alle schon seit Jahren tot waren und die Angehörigen der Familie Smith aus New York demzufolge nicht als Erben in Betracht kamen, hatten sie sich damit begnügt, ganz pedantisch das Gesetz zu zitieren, welches besagte, dass »eine Erbfolge zwischen Seitenverwandten nach den Enkeln von Brüdern, Schwestern und Kindern von Tanten und Onkeln nicht zulässig« sei. Dieser unglückliche Satz, ironisch unter der Überschrift »Augenwischerei« zitiert, war das Einzige, was man von ihrer Erklärung gedruckt hatte.
In der Folge hatten die meisten Erklärungen der Anwaltskanzlei ein ähnliches Schicksal gefunden. Von Zeit zu Zeit hatten sich einige der verantwortungsbewussteren Zeitungen ernsthaft bemüht, ihren Lesern das Erbrecht zu erklären, doch die Kanzlei hatte solche Bemühungen, soweit George sehen konnte, niemals unterstützt. Dass Amelia keine lebenden nahen Verwandten hatte und als Erben deshalb nur etwaige Nichten und Neffen des verstorbenen Hans Schneider infrage kamen, der bei Amelias Tod noch am Leben gewesen war, wurde von der Kanzlei niemals ausdrücklich festgestellt. Einer klaren Aussage noch am nächsten kamen die Anwälte mit einer Erklärung, in der sie zu bedenken gaben, es existierten »in Amerika vermutlich keine Cousinen und Cousins ersten Grades der testamentlosen Erblasserin mehr, welche die Erblasserin überlebt« hätten, und wenn es überhaupt welche gäbe, so wären sie höchstwahrscheinlich in Deutschland zu finden.
Sie hätten sich die Mühe sparen können. Die Vermutung, der gesetzliche Erbe des Nachlasses könnte in Europa anstatt irgendwo in Wisconsin leben, hatte die Zeitungen von 1939 nicht interessiert; die Möglichkeit, dass es überhaupt keinen gab, hatten sie allesamt von vornherein ignoriert. Außerdem hatte der Unternehmungsgeist einer in Milwaukee beheimateten Zeitung der Geschichte gerade eine neue Wendung gegeben. Mit Hilfe der Einwanderungsbehörden war es dem Sonderrechercheur des Blattes gelungen zu ermitteln, wie viele Familien mit Namen Schneider in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts aus Deutschland eingewandert waren. Die Zahl war gewaltig. Ob denn nicht die Vermutung erlaubt sei, hatte das Blatt gefragt, dass wenigstens einer der jüngeren Brüder des alten Neunundvierzigers dessen Beispiel gefolgt und ausgewandert war? Gewiss doch! Und schon war die Jagd wieder auf gewesen, und ganze Heerscharen von Sonderrechercheuren hatten sich auf den Spuren der eingewanderten Schneiders hoffnungsfroh durch Personenstandsregister, Grundbücher und Staatsarchive gewühlt.
Mit einem Seufzer verschnürte George das Päckchen wieder. Er wusste bereits, dass er die kommenden Wochen nicht genießen würde.
Die Gesamtzahl der erhobenen Ansprüche lag bei knapp über achttausend, und er stellte fest, dass es für jeden eine eigene Akte gab. Die meisten enthielten nur zwei, drei Briefe, viele aber waren recht dick, und manche umfassten ihrerseits ganze Päckchen und waren prall von eidesstattlichen Erklärungen, Fotokopien von Dokumenten, zerrissenen Fotos und Stammbäumen. Ein paar enthielten alte Bibeln und andere Familienerbstücke, und in einer steckte aus unerfindlichen Gründen sogar eine speckige Pelzmütze.
George machte sich an die Arbeit. Bis Ende der Woche hatte er siebenhundert Ansprüche durchgesehen und empfand tiefes Mitleid für die Kanzlei Moreton, Greener und Cleek. Ein großer Teil der Ansprüche stammte natürlich von Spinnern und Verrückten. Da war der zornige Mann aus North Dakota, der behauptete, er heiße Martin Schneider, er sei keineswegs tot und Amelia Schneider habe ihm das Geld im Schlaf gestohlen. Da war die Frau, die den Nachlass im Namen einer kalifornischen Gesellschaft zur Verbreitung der kataphrygischen Häresie beanspruchte und geltend machte, der Geist der verstorbenen Amelia sei in Mrs. Schultz, die ehrenamtliche Schatzmeisterin der Gesellschaft, gefahren. Und da war der Mann, der mit verschiedenfarbiger Tinte aus einer staatlichen Klinik schrieb, er sei aufgrund einer heimlichen ersten Heirat Amelias mit einem Farbigen deren legitimer Sohn. Doch bei der Mehrzahl der Anspruchsteller schien es sich um Menschen zu handeln, die zwar nicht klinisch verrückt waren, aber allenfalls rudimentäre Vorstellungen davon hatten, was einen Beweis darstellte. So gab es in Chicago einen Mann namens Higgins, der einen komplizierten Anspruch aus der Erinnerung daran ableitete, dass er seinen Vater hatte sagen hören, Cousine Amelia sei ein gemeiner alter Geizhals; und einen weiteren Mann, der aufgrund eines alten Briefes von einem dänischen Verwandten namens Schneider auf einen Anteil des Nachlasses pochte. Dann gab es die Misstrauischen, die es ablehnten, Beweise zur Untermauerung ihres Anspruchs vorzulegen, damit diese nicht gestohlen wurden, um der Sache eines anderen Anspruchstellers zum Erfolg zu verhelfen, und andere, die Reise- und Hotelspesen forderten, damit sie persönlich ihre Sache dem Nachlassverwalter vortragen konnten. Und vor allem gab es die Anwälte.
Von den ersten siebenhundert Ansprüchen, die George prüfte, waren nur vierunddreißig von Anwälten vertreten worden, doch um sich durch deren Akten durchzufinden, brauchte er allein mehr als zwei Tage. Die betreffenden Ansprüche waren größtenteils von fragwürdiger Berechtigung, und ein, zwei waren ganz offensichtlich unlauter. In Georges Augen hätte kein anständiger Anwalt sie auch nur mit der Feuerzange angefasst. Aber hier handelte es sich um Winkeladvokaten. Sie hatten sie nicht nur angefasst, sondern festgehalten. Sie hatten nicht existierende Präzedenzfälle zitiert und irrelevante Dokumente kopiert. Sie hatten unredliche Rechercheure beschäftigt, um sinnlose Nachforschungen anzustellen, und unseriöse Ahnenforscher, um gefälschte Stammbäume herzustellen. Sie hatten ominöse Briefe geschrieben und finstere Drohungen ausgestoßen. Das Einzige, was offenbar keiner von ihnen jemals getan hatte, war, seinem Mandanten zu raten, den Anspruch zurückzuziehen. In einer der Akten fand sich ein Brief an den Nachlassverwalter, in dem eine Frau namens Snyder es bedauerte, dass sie kein Geld mehr hatte, um ihren Anwalt zu bezahlen, und darum bat, ihren Anspruch deswegen nicht zu übersehen.
In seiner zweiten Woche mit all den Akten schaffte es George trotz einer heftigen Erkältung, die Zahl der von ihm geprüften Ansprüche auf eintausendneunhundert hinaufzuschrauben. In der dritten Woche überschritt er die Dreitausend. Am Ende der vierten Woche hatte er die Hälfte geschafft. Er war außerdem zutiefst deprimiert. Die ihrem Wesen nach langweilige Arbeit und der geballte Effekt so vieler Belege menschlicher Dummheit waren an sich schon niederschmetternd. Das belustigte Mitgefühl seiner neuen Kollegen und das Bewusstsein, dass er seine Karriere bei Lavater als Opfer eines stehenden Bürowitzes begann, taten ein Übriges. Mr. Budd, dem er zuletzt im Fahrstuhl begegnet war, als dieser vom Lunch zurückkam, hatte sich munter über Baseball verbreitet und es nicht einmal für nötig gehalten, sich nach seinen Fortschritten zu erkundigen. Am Montagmorgen der fünften Woche beäugte George voller Abscheu die Aktenstapel, die noch zu prüfen waren.
»Wollen wir die Os fertig machen, Mr. Carey?« Der Fragesteller war der Hausmeister, der den Keller in Ordnung hielt, die Aktenpäckchen abstaubte und sie zwischen Keller und Georges Büro hin und her trug.
»Nein, ich fange mal lieber mit den Ps an.«
»Ich kann die restlichen Os rausfrickeln, wenn Sie wollen, Mr. Carey.«
»Na gut, Charlie. Wenn Sie’s schaffen, ohne dass der ganze Krempel einstürzt.« Die Schneisen, die er bereits in die hochgetürmten Aktenstapel geschlagen hatte, hatten die Stabilität des Ganzen allmählich stark beeinträchtigt.
»Klar doch, Mr. Carey«, sagte Charlie. Er griff nach einem der unteren Päckchen und zog daran. Es gab ein schleifendes Geräusch, ein Poltern, und eine Aktenlawine verschlang ihn. In der Staubwolke, die ihrem Niedergang folgte, rappelte er sich, die Hand am Kopf, hustend und fluchend auf. Er blutete aus einer langen Schramme über dem Auge.
»Um Gottes willen, Charlie, wie ist denn das passiert?«
Der Hausmeister versetzte etwas Hartem, das unter den Aktenhaufen um ihn herum lag, einen Fußtritt. »Das verdammte Ding da hat mich am Kopf getroffen, Mr. Carey«, erklärte er. »Muss irgendwo dazwischengesteckt haben.«
»Ist es schlimm?«
»Ach wo. Es ist ja nur ein Kratzer. Tut mir leid, Mr. Carey.«
»Lassen Sie’s trotzdem lieber verbinden.«
Nachdem er den Hausmeister der Obhut eines der Fahrstuhlführer übergeben und der Staub im Keller sich wieder gesetzt hatte, ging George hinein und besah sich die Bescherung. Sowohl die Os als auch die Ps waren unter einem Geröll von S und Ws verschwunden. Er schob einige der Päckchen zur Seite und sah, woran sich der Hausmeister die Augenbraue verletzt hatte. Es war eine große schwarz lackierte Dokumentenschatulle, wie man sie früher in den Regalen alter Familienanwälte zu sehen pflegte. In weißer Schablonenschrift standen darauf die Worte: »SCHNEIDER – VERTRAULICH«.
George zerrte die Schatulle zwischen den Päckchen hervor und versuchte sie zu öffnen. Sie war verschlossen, und an keinen der beiden Griffe war ein Schlüssel angehängt. George zögerte. Er hatte sich nur mit den Akten der Ansprüche zu befassen, und es war töricht, Zeit zu vergeuden, um seine Neugier nach dem Inhalt einer alten Dokumentenschatulle zu befriedigen. Andererseits würde es eine Stunde dauern, das Durcheinander zu seinen Füßen aufzuräumen. Es hatte wenig Sinn, sich mit Staub und Spinnweben zu beschmutzen, um den Vorgang zu beschleunigen, und Charlie würde in ein paar Minuten wieder da sein. Er ging ins Zimmer des Hausmeisters, nahm einen Meißel und einen Hammer vom Werkzeugregal und kehrte zu der Schatulle zurück. Ein paar Schläge durchstießen das dünne Metall um den Riegel des Schlosses, sodass er den Deckel aufstemmen konnte.
Auf den ersten Blick schien die Schatulle lediglich ein paar persönliche Habseligkeiten aus Mr. Moretons Büro zu enthalten. Da war ein in Kalbsleder gebundener Terminkalender mit eingeprägten Goldinitialen, eine Schreibgarnitur aus Onyx, ein handgeschnitztes Zigarrenetui aus Teakholz, eine Schreibunterlage aus gepunztem Leder und zwei dazu passende, mit Leder bezogene Briefkörbe. Einer der Briefkörbe enthielt ein Handtuch, ein paar Aspirintabletten und ein Fläschchen mit Vitaminkapseln. George hob den Briefkorb an. Darunter lag ein dicker Loseblattordner mit der Aufschrift »DEUTSCHE NACHFORSCHUNGEN IN SACHEN SCHNEIDER VON ROBERT L. MORETON, 1939«. George überflog ein, zwei Seiten, sah, dass das Ganze in Tagebuchform abgefasst war, und legte es zwecks späterer Lektüre beiseite. Darunter lag ein brauner Umschlag mit einer Unzahl von Fotografien, bei denen es sich offenbar größtenteils um deutsche juristische Dokumente der einen oder anderen Art handelte. Ansonsten enthielt die Schatulle nur noch ein versiegeltes Päckchen und einen versiegelten Umschlag. Auf dem Päckchen stand »Briefwechsel zwischen Hans Schneider und seiner Frau nebst anderen Dokumenten, die Sept. 1938 von Hilton G. Greener und Robert L. Moreton in der Habe der verstorbenen Amelia Schneider-Johnson gefunden wurden«. Auf dem Umschlag stand: »Fotografie, von Pfarrer Weichs in Bad Schwennheim an R.L.M. ausgehändigt«.
George legte Mr. Moretons persönliche Gegenstände in die Schatulle zurück und nahm den Rest mit nach oben in sein Büro. Dort öffnete er als Erstes das versiegelte Päckchen.
Die Briefe darin waren von Mr. Greener und Mr. Moreton sorgfältig nummeriert und mit ihren Initialen versehen worden. Es waren insgesamt achtundsiebzig, allesamt mit seidenem Band zu kleinen Päckchen verschnürt und jeder mit einer gepressten Blume darin. George öffnete eines der Päckchen. Die Briefe darin stammten aus der Zeit der jungen Liebe zwischen Amelias Eltern Hans Schneider und Mary Smith. Aus ihnen ergab sich, dass Hans seinerzeit in einem Lagerhaus gearbeitet und Englisch gelernt und dass Mary Deutsch gelernt hatte. Nach Georges Empfinden waren die Briefe förmlich, unelegant und langweilig. Für Mr. Moreton allerdings mussten sie von beträchtlichem Wert gewesen sein, denn sie hatten wahrscheinlich die rasche Auffindung der betreffenden Familie Smith ermöglicht und dazu geführt, dass man sie glücklich aus dem Kreis der Anspruchsteller streichen konnte.
George verschnürte das Päckchen wieder und wandte sich einem alten Fotoalbum zu. Es enthielt Fotos von Amelia und Martin als Kinder, von ihrem Bruder Frederick, der mit zwölf gestorben war, und natürlich von Hans und Mary. Interessanter jedoch, weil noch älter, war eine Daguerreotypie von einem alten Mann mit üppigem Bart.
Er saß aufrecht und mit strenger Miene da, die großen Hände umklammerten die Armlehnen des Fotografenstuhls, und er hatte den Kopf fest gegen die Rückenlehne gepresst. Seine Lippen waren voll und entschlossen. Das Gesicht unter dem Bart war grob und ausdrucksstark. Die versilberte Kupferplatte mit dem Porträt war auf roten Samt aufgezogen. Darunter hatte Hans geschrieben: »Mein geliebter Vater Franz Schneider, 1782–1850«.
Das einzige andere Dokument war ein dünnes, ledergebundenes Notizbuch, das mit Hans’ spinnendürrer Handschrift gefüllt war. Es war in Englisch geschrieben. Auf der ersten Seite fand sich, mit kunstvollen Schnörkeln verziert, eine Beschreibung des Inhalts: »Bericht von der heldenhaften Teilnahme meines geliebten Vaters an der Schlacht zu Preußisch-Eylau im Jahre 1807, von seiner Verwundung und seiner Begegnung mit meiner geliebten Mutter, welche sein Leben rettete. Niedergeschrieben von Hans Schneider für seine Kinder im Juni 1867, auf dass sie ihren Namen mit Stolz tragen.«
Der Bericht begann mit den Ereignissen, die zur Schlacht führten, und knüpfte daran Schilderungen der diversen Gefechte, in welche die Ansbacher Dragoner den Feind verwickelt hatten, sowie einiger spektakulärer Ereignisse der Schlacht: eine russische Kavallerieattacke, die Einnahme einer Geschützbatterie, die Enthauptung eines französischen Offiziers. Was Hans niedergeschrieben hatte, war offensichtlich eine auf dem Schoß des Vaters gehörte Legende. In Teilen besaß es noch immer die Kunstlosigkeit eines Märchens. Doch mit dem Fortgang des Berichts ließ sich verfolgen, in welche Verlegenheit Hans als Mann von mittleren Jahren bei dem Versuch kam, seine Kindheitserinnerungen mit dem Wirklichkeitssinn des Erwachsenen in Einklang zu bringen. Die Niederschrift des Berichts, dachte George, musste eine seltsame Erfahrung für ihn gewesen sein.
Nach der Schilderung der Schlacht jedoch hatte Hans seine Mittel sicherer zu handhaben gewusst. Die Gefühle des verwundeten Helden, seine Gewissheit, dass Gott mit ihm war, seine Entschlossenheit, bis zum Ende seine Pflicht zu tun; das alles war mit geübtem Pathos beschrieben. Und als der schreckliche Moment des Verrats kam, als die feigen Preußen den verwundeten Helden, der einem getroffenen Kameraden half, im Stich gelassen hatten, ließ Hans einen wahren Sturzbach von biblischem Zorn los. Wenn Gott das Ross des Helden nicht zur Kate der liebreizenden Maria Dutka geführt hätte, wäre gewiss alles zu Ende gewesen. Wie die Dinge lagen, war Maria der preußischen Uniform gegenüber verständlicherweise misstrauisch gewesen, und ihre Mitmenschlichkeit wäre (wie sie dem Helden später gestand) um ein Haar von ihrer Angst um ihre Tugend und ihren darniederliegenden Vater verdrängt worden. Am Ende aber wurde natürlich alles gut. Als seine Wunde geheilt war, hatte der Held seine Retterin im Triumph heimgeführt. Im darauffolgenden Jahr war Hans’ älterer Bruder Karl zur Welt gekommen.
Der Bericht schloss mit einer frömmelnden Homilie zum Thema Gebet und Vergebung der Sünden. Diesen Teil schenkte sich George und ging zu Mr. Moretons Tagebuch über.
Mr. Moreton war Ende März 1939 mit einem Dolmetscher, den er in Paris engagiert hatte, in Deutschland eingetroffen.
Sein Plan war, jedenfalls der Absicht nach, einfach gewesen. Er wollte zunächst Hans Schneiders Spur zurückverfolgen. Sobald er wusste, wo die Familie Schneider gelebt hatte, würde er sich daran machen, zu ermitteln, was aus all den Brüdern und Schwestern von Hans geworden war.
Der erste Teil des Plans hatte sich leicht durchführen lassen. Hans stammte aus Westfalen; und im Jahre 1849 hatte ein Mann im wehrpflichtigen Alter eine Erlaubnis gebraucht, um das Land verlassen zu dürfen. In Münster, der alten Hauptstadt, hatte Moreton die Urkunde über Hans’ Ausreise aufgetrieben. Hans war aus Mühlhausen gekommen und nach Bremen weitergereist.
In Bremen hatte eine Durchsicht der alten, von der Hafenbehörde archivierten Schiffsmanifeste ergeben, dass Hans Schneider aus Mühlhausen am 10. Mai 1849 mit der Abigail, einem englischen Schiff von sechshundert Tonnen, ausgereist war. Das deckte sich mit einer Bemerkung, die Hans in einem seiner Briefe an Mary Smith über seine Ausreise aus Deutschland gemacht hatte. Mr. Moreton zog daraus den Schluss, dass er auf der Spur des richtigen Hans Schneider war. Als Nächstes begab er sich nach Mühlhausen.
Dort allerdings sah er sich einer verwirrenden Situation gegenüber. Obwohl die Kirchenbücher Eheschließungen, Taufen und Beerdigungen bis zurück zum Dreißigjährigen Krieg verzeichneten, musste er feststellen, dass keines der Register für die Jahre 1807 und 1808 irgendeinen Hinweis auf den Namen Schneider enthielt.
Mr. Moreton grübelte vierundzwanzig Stunden über die Enttäuschung nach; dann hatte er eine Idee. Er nahm sich die Kirchenbücher noch einmal vor.
Diesmal ging er die von 1850, dem Jahr von Franz Schneiders Tod, durch. Tod und Begräbnis waren verzeichnet, die Lage des Grabes angegeben. Moreton war hingegangen, um es sich anzusehen. Und dabei hatte er eine höchst unerfreuliche Überraschung erlebt. Ein verwitterter Grabstein hatte die verwirrende Information geliefert, dass dies der letzte Ruheplatz von Franz Schneider und seiner geliebten Frau Ruth war. Laut Hans’ Bericht war der Name seiner Mutter Maria gewesen.
Mr. Moreton nahm sich erneut die Kirchenbücher vor. Er brauchte lange, um sich von 1850 bis 1815 zurückzuarbeiten, doch als er damit fertig war, kannte er die Namen von nicht weniger als zehn von Franz Schneiders Kindern und das Datum seiner Heirat mit Ruth Vogel. Zu seinem Entsetzen hatte er auch festgestellt, dass keines der Kinder den Namen Hans oder Karl trug.
Der Gedanke, dass es eine frühere Heirat in einer anderen Stadt gegeben haben musste, war ihm recht bald gekommen. Wo aber konnte diese frühere Heirat stattgefunden haben? Mit welchen anderen Städten ließ sich Franz Schneider in Verbindung bringen? In welcher Stadt war er beispielsweise zur preußischen Armee eingezogen worden?
Es gab nur einen einzigen Ort, wo derlei Fragen, wenn überhaupt, beantwortet werden konnten. Mr. Moreton und sein Dolmetscher waren nach Berlin gereist.
Mr. Moreton hatte bis Ende März gebraucht, um das Dickicht der Nazibürokratie zu durchdringen und in den Potsdamer Archiven so tief zu graben, dass er an die Tagebücher der Ansbacher Dragoner aus der Zeit der napoleonischen Kriege herankam. Er brauchte weniger als zwei Stunden, um herauszufinden, dass der Name Schneider zwischen 1800 und 1815 nur ein einziges Mal in der Stammrolle des Regiments auftauchte. Ein Wilhelm Schneider war 1803 durch einen Sturz vom Pferd ums Leben gekommen.
Es war ein herber Schlag gewesen. Der betreffende Tagebucheintrag Mr. Moretons schloss mit den mutlosen Worten: »Also ist es wohl doch ein fruchtloses Unterfangen. Trotzdem werde ich morgen noch einmal alles nachprüfen. Sollte dies ergebnislos bleiben, werde ich die Nachforschungen einstellen, da ich weitere Bemühungen für sinnlos halte, wenn es nicht gelingt, Hans Schneiders Verbindung mit der Mühlhausener Familie urkundlich zu belegen.«
George blätterte um und machte ein verdutztes Gesicht. Der nächste Tagebucheintrag bestand zur Gänze aus Zahlen. Zeile um Zeile füllten sie die Seite. Für die nächste und die übernächste Seite galt das Gleiche. Er blätterte rasch weiter. Mit Ausnahme der Datumszeile bestanden sämtliche Folgeeinträge – und das Tagebuch umfasste noch mehr als drei Monate – aus Zahlen. Außerdem bildeten die Zahlen Fünfergruppen. Mr. Moreton hatte sich also nicht nur dagegen entschieden, seine Nachforschungen in Deutschland aufzugeben, sondern er hatte es auch für notwendig erachtet, deren Ergebnisse verschlüsselt zu notieren.
George legte das Tagebuch zur Seite und sah rasch den Stapel fotografierter Dokumente durch. Er konnte Deutsch schon in Druckschrift nicht besonders gut lesen, und vor der herkömmlichen Sütterlinschrift musste er vollends kapitulieren. Die betreffenden Dokumente waren allesamt handgeschrieben. Zwei, drei davon betrafen, wie eine sorgfältige Untersuchung ergab, Geburt und Tod von Menschen namens Schneider, doch das war kaum überraschend. Er legte sie beiseite und öffnete den Umschlag.
Das Foto, »von Pfarrer Weichs in Bad Schwennheim an R.L.M. ausgehändigt«, erwies sich als eselsohriges, postkartengroßes Porträt eines jungen Mannes und einer jungen Frau, die nebeneinander auf der rustikalen Bank eines Berufsfotografen saßen. Die Frau war von einer gewissen anspruchslosen Hübschheit und möglicherweise schwanger. Der Mann war unscheinbar. Ihre Kleidung entsprach der Mode der zwanziger Jahre. Sie wirkten wie ein glückliches Arbeiterpaar an seinem freien Tag. Der gemalte Hintergrund zeigte schneebedeckte Tannen. In der Bildecke stand in Sütterlinschrift ›Johann und Ilse‹. Laut dem Stempel des Fotografen auf der Rückseite des Abzuges war die Aufnahme in Zürich gemacht worden. Sonst enthielt der Umschlag nichts.
Charlie kam mit einem Heftpflaster auf der Stirn und einer weiteren Ladung Päckchen herein, und George machte sich wieder über die Ansprüche her. An diesem Abend jedoch nahm er den Inhalt der Dokumentenschatulle mit in seine Wohnung und ging ihn erneut sorgfältig durch.
Er war in einer schwierigen Lage. Man hatte ihn beauftragt, die Ansprüche auf den Nachlass zu überprüfen, die bei dem früheren Nachlassverwalter eingegangen waren; sonst nichts. Wenn die Dokumentenschatulle nicht heruntergefallen wäre und den Hausmeister am Kopf verletzt hätte, wäre sie ihm wahrscheinlich entgangen. Man hätte sie woandershin geräumt und dann im Keller vergessen. Er hätte sich durch die Ansprüche durchgearbeitet und dann zweifellos Mr. Budd berichtet, was Mr. Budd hören wollte: dass es keine offenstehenden Ansprüche gab, die zu behandeln sich lohnte, und dass der Staat Pennsylvania wie geplant vorgehen könne. Dann wäre er, George, die ganze leidige Geschichte los gewesen, um sich mit einem Auftrag belohnen zu lassen, der seinen Fähigkeiten eher entsprach. Nun sah es so aus, als hätte er die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten, sich zum Narren zu machen: Er konnte den Inhalt der Dokumentenschatulle ignorieren und so riskieren, dass Mr. Sistrom einen schweren Schnitzer machte; oder er konnte Mr. Budd mit müßigen Phantastereien auf die Nerven gehen.
Hohe politische Ämter und Sitze im Vorstand von Eisenbahngesellschaften schienen an diesem Abend in weite Ferne gerückt. Erst in den frühen Morgenstunden fiel ihm ein, wie er Mr. Budd die Sache taktvoll beibringen konnte.
Mr. Budd nahm Georges Bericht sehr ungnädig auf.
»Ich weiß gar nicht mal, ob Bob Moreton noch lebt«, sagte er gereizt. »Für mich deutet dieser ganze Geheimschrift-Sums jedenfalls darauf hin, dass der Mann sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Paranoia befand.«
»Hat er denn einen gesunden Eindruck gemacht, als Sie ihn vierundvierzig gesehen haben, Sir?«
»Den Eindruck mag er gemacht haben, aber nach dem, was Sie mir da zeigen, war er’s anscheinend nicht.«
»Aber die Nachforschung hat er fortgesetzt, Sir.«
»Und wenn schon?« Mr. Budd seufzte. »Hören Sie, George, wir wollen bei dieser Geschichte keine Komplikationen. Wir wollen die Sache einfach loswerden, je früher, desto besser. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie gründlich sein wollen, aber ich möchte doch meinen, dass das alles eigentlich ganz einfach ist. Sie besorgen sich einen Deutschübersetzer für die fotografierten Dokumente, stellen fest, worum es sich dabei handelt, gehen dann sämtliche Ansprüche von Leuten namens Schneider durch und überprüfen, ob die Dokumente sich auf einen davon beziehen. Im Grunde ganz simpel, nicht?«
George kam zu dem Schluss, dass nun ein taktvolles Vorgehen angezeigt war. »Ja, Sir. Aber ich hatte an eine Möglichkeit gedacht, die ganze Sache zu beschleunigen. Ich bin nämlich noch nicht bis zu den Schneiders gekommen, aber nach den Papiermengen im Keller zu urteilen, muss es davon mindestens dreitausend geben. Dabei habe ich schon fast vier Wochen dafür gebraucht, so viele gewöhnliche Ansprüche zu überprüfen. Die Schneiders werden mit Sicherheit länger dauern. Aber mittlerweile habe ich mich eingehender mit der Sache befasst, und ich habe so das Gefühl, wir könnten eine Menge Zeit sparen, wenn ich einmal mit Mr. Moreton sprechen könnte.«
»Wieso? Inwiefern?«
»Nun ja, Sir, ich habe mir ein paar von den Berichten über die Sache angesehen, die die Kanzlei gegen den Anspruch von Rudolph Schneider und die deutsche Regierung durchgefochten hat. Es erschien mir ganz klar, dass Moreton, Greener und Cleek über eine ganze Menge von Fakten verfügten, die die Gegenseite nicht besaß. Ich glaube, sie hatten ganz eindeutige Informationen, dass es keinen lebenden Schneider-Erben gab.«
Mr. Budd sah ihn durchdringend an. »Wollen Sie damit etwa andeuten, George, dass Moreton über jeden begründeten Zweifel hinaus festgestellt hat, dass es keinen Erben gab, und dass er und seine Partner diese Tatsache dann verschwiegen haben, um weiterhin Honorar aus dem Nachlass kassieren zu können?«
»Möglich wäre es, Sir, nicht wahr?«
»Was für Zyniker Ihr jungen Männer doch manchmal seid!« Mr. Budd wurde plötzlich wieder jovial. »Na schön, worauf wollen Sie hinaus?«
»Wenn wir die Ergebnisse von Moretons vertraulichen Nachforschungen bekommen könnten, hätten wir vielleicht genügend Informationen, um uns jede weitere Überprüfung all dieser Ansprüche sparen zu können.«
Mr. Budd strich sich übers Kinn. »Verstehe. Ja, nicht schlecht, George.« Er nickte lebhaft. »Okay. Sehen Sie zu, was Sie tun können, falls der alte Knabe noch am Leben und bei klarem Verstand ist. Je rascher wir die ganze Sache los sind, desto besser.«
»Ja, Sir«, sagte George.
Am Nachmittag bekam er einen Anruf von Mr. Budds Sekretärin: Eine Nachfrage bei Mr. Moretons früherem Club habe ergeben, dass er sich in Montclair, New Jersey, zur Ruhe gesetzt hatte. Mr. Budd habe brieflich bei dem alten Herrn angefragt, ob er George empfangen würde.
Zwei Tage später kam Antwort von Mrs. Moreton. Ihr Mann sei seit einigen Monaten bettlägerig, doch angesichts der früheren Geschäftsverbindung sei er gerne bereit, sein Gedächtnis Mr. Carey zur Verfügung zu stellen, vorausgesetzt, der Besuch sei kurz. Mr. Moreton schlafe nachmittags. Vielleicht würde Freitagmorgen elf Uhr Mr. Carey passen.
»Das muss seine zweite Frau sein«, sagte Mr. Budd.
Freitagmorgen legte George die Dokumentenschatulle nebst vollständigem ursprünglichem Inhalt auf den Rücksitz seines Wagens und fuhr nach Montclair.