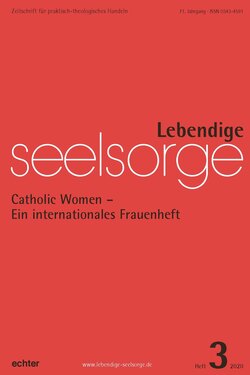Читать книгу Lebendige Seelsorge 3/2020 - Erich Garhammer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPro und Contra
Von Quellen und dem Umgang mit ihnen. Wie Theologie und Kirche nach dem „Willen Gottes“ im Blick auf Frauen forschen
Die Replik von Andrea Qualbrink auf Jacqueline Straub
Jacqueline Straub legt eine klare Positionierung vor: In der katholischen Kirche sind Frauen nicht gleichberechtigt – sie sind zu Weiheämtern nicht zugelassen. Diese Diskriminierung aufgrund des Geschlechts entspricht nicht dem Willen Jesu – darum braucht es einen weltweiten Aufstand. In meiner Replik will ich vier Punkte aus Straubs Aufsatz aufgreifen und weiterdenken. In allen Punkten versuche ich, einen Schritt zurückzutreten und Hinter- und Untergründe mit wahrzunehmen.
DIE ANLIEGEN DER FRAUEN UND DAS FRAUENPRIESTERTUM
Straub macht deutlich: Ihr Fokus ist die Zulassung der Frauen zu den Weiheämtern, vor allem zum Priestertum. Zugleich spricht sie aber auch allgemeiner von den „Anliegen der Frauen“ und dem fehlenden Interesse zahlreicher geweihter Männer im Vatikan, „die Stellung der Frau in Kirche und Gesellschaft zu verbessern“. Das ist wichtig. Die sogenannte „Frauenfrage“ geht nicht in der Forderung nach dem Priesteramt oder den Weiheämtern auf. Sie führt vielmehr zu der fundamentalen Frage nach dem Umgang mit den Geschlechtern in Theologie und Kirche. Von hier gehen die Forderungen weiter: Es geht um Geschlechterbilder, um verschiedenste Orte und Aufgaben, um Anerkennung und Diskriminierung, um alle Menschen jeglichen Geschlechts im Volk Gottes. Es geht in intersektionaler Perspektive um Hierarchisierungen aufgrund von Geschlecht und Stand, es geht um Macht und um die Begründung von Ausschlüssen, um die Sakramentalität der Kirche, um Aufgaben, Dienste und Ämter – und um die Frage, ob Gott die Kirche so gewollt hat. Und dann ist die Diskussion um und die Weiheämter für Frauen zentral, tangiert sie doch alle eben genannten Bereiche und darüber hinaus, ob und wie Berufungen anerkannt werden. Bei den „Anliegen der Frauen“ geht es für Kirche und Lehramt in einem ersten Schritt um eine Haltung der Conversio: Zuhören und Hinschauen statt Definieren und Platzieren (vgl. Gruber, 49ff.).
DIE FRAGE DER GLEICHBERECHTIGUNG UND DER UMGANG MIT QUELLEN
Die Haltung der Conversio bezieht sich – tritt man einen Schritt zurück – auch auf die Quellen für theologische Auseinandersetzungen. Jacqueline Straub schreibt, dass es um „Gleichberechtigung von Mann und Frau“ gehe, dass die Kirche die Grundrechte der Menschen nach außen einzufordern und nach innen durchzusetzen habe und schließlich, dass es dem Willen Jesu nicht entspräche, dass Frauen unter einem patriarchalischen Frauenbild leiden. Dem stimme ich zu – und ergänze: Es braucht eine Auseinandersetzung mit der Frage, auf welche Quellen Theologie und Kirche im Blick auf Frauen zurückgreifen und wie: Wie werden Erkenntnisse aus Referenzwissenschaften rezipiert und welche (normative) Kraft haben sie? Wie gehen wir mit Bibel, Tradition und Lehramt um und welche Bedeutung haben die Zeichen der Zeit?
Die rechtliche Situation beschreibt Christiane Florin salopp treffend so: „Der demokratische, gewaltenteilig verfasste Staat schreibt den Religionsgemeinschaften nicht vor, sich demokratisch, gewaltenteilig zu organisieren. Er lässt ihnen auch die Freiheit, Art. 3 des Grundgesetzes außer Acht zu lassen. Religionen dürfen bei der Ämtervergabe Menschen aus Gründen des Geschlechts und der sexuellen Orientierung benachteiligen; sie dürfen behaupten, das sei keine Diskriminierung, das sei die Wahrheit“ (Florin 2020). Gleichzeitig wäre es aber Aufgabe der Kirche, die Menschenrechte und Antidiskriminierungsgesetze als Zeichen der Zeit zu erkennen und im Licht des Evangeliums zu deuten (vgl. hierzu Ahlers sowie Buser). Auch der sensus fidei (vgl. Lumen gentium 12) müsste als Quelle ernstgenommen werden: Welche Bedeutung wird etwa dem breiten Aufbegehren und den 42.349 Unterschriften im offenen Brief an den Papst durch die Initiative Maria 2.0 beigemessen?
Hinsichtlich der Weihe werden Frauen als Folge von dem benachteiligt, was Menschen als „Wille Gottes“ bzw. „Willen Jesu“ beschrieben haben. Doch was genau wissen wir darüber? Ich sehe als Theologin nicht, wie Menschen Gottes oder Jesu Willen endgültig einsehen könnten. Nach Gaudium et spes 62 ist es allerdings unsere Aufgabe, uns um eine tiefe Erkenntnis der geoffenbarten Wahrheit zu bemühen und die uns zur Verfügung stehenden Quellen zu nutzen – hierzu gehören auch die genannten Referenzwissenschaften. So können etwa die differenzierenden Sichtweisen aus der interdisziplinären Geschlechtertheoriedebatte nicht weiter ignoriert werden, wenn sich das Lehramt zu den Geschlechtern äußert und daraus weitreichende Konsequenzen zieht. Auch auf dem Synodalen Weg und nicht nur im Forum „Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche“ wird es darum gehen müssen, wie mit nicht-theologischen Referenzwissenschaften umgegangen wird.
Was den Umgang mit den zentralen Quellen Bibel, Tradition und Lehramt anbelangt, ist die Gemengelage problematisch. Zwar hat das Zweite Vatikanische Konzil in Dei Verbum sich deutlich für eine fundierte theologische Auseinandersetzung mit den biblischen Quellen ausgesprochen, letztlich aber, dies zeigt Georg Essen in aller Härte auf, behält das Lehramt in der Auslegung von Bibel und Tradition formal immer recht: „Maßgeblich und entscheidend ist nicht, was mit welchem Argument vorgetragen wird, sondern allein, wer mit welcher formalen Geltung spricht“ (Essen, 4). Treffend wertet er die im 19. Jahrhundert konstituierte Hermetik so: „Der Mühlstein des 19. Jahrhunderts hängt ihr, der Kirche, um den Hals und lähmt ihren aufrechten Gang“ (Essen, 7). Man könnte hinzufügen: Es erschwert die Conversio und führt dazu, dass Hinschauen und Zuhören nicht zu notwendigen Konsequenzen führen.
GEGEN AUFGABEN, DIENSTE UND ÄMTER „SUI GENERIS“
Jacqueline Straub beschreibt, wie Frauen und Männer aufgrund ihres Geschlechts in Theologie und Kirche durch Jahrhunderte hindurch unterschieden und wie Frauen Männern untergeordnet wurden. Auch in aktuellen lehramtlichen Texten werden Frauen und Männer differenziert – wobei das differenzierende und definitorische Interesse ausschließlich dem „Genius der Frau“ (Schreiben über die Zusammenarbeit von Mann und Frau), ihrer „spezifischen Macht“ und „dem eigenen weiblichen Stil“ (Nr. 101.103) gilt. Tritt man einen Schritt zurück, liegt in der geschlechtsbezogenen Differenzierung auch der Grund für jene Ansätze, neue frauenspezifische Aufgaben, Dienste und Ämter zu entwickeln (vgl. auch hier Nr. 102). Dem widerspreche ich ausdrücklich. Aufgaben, Dienste und Ämter sollten vom Auftrag der Kirche her (weiter-)entwickelt und entsprechend der vielfältigen Charismen und Kompetenzen von Menschen besetzt werden – unabhängig von ihrem Geschlecht.
DIE WELTKIRCHLICHE PERSPEKTIVE
Am Ende ihres Textes tritt Jacqueline Straub selbst einen Schritt zurück und schreibt sehr zutreffend, dass eine katholische Weltkirche, die die Gleichberechtigung von Mann und Frau vertrete, Vorreiterin einer besseren, friedlicheren und gerechteren Welt sein könnte. Damit dreht sie auch den bekannten Einwand, die Forderung nach gleichen Rechten und Weiheämtern für Frauen in der katholischen Kirche sei kein weltkirchliches Thema, um. Ich ergänze: Wir sind in der privilegierten Situation, uns in Breite und Tiefe mit dem christlichen Glauben, der Theologie und Fragen um Frauen in der Kirche auseinanderzusetzen. Es ist darum auch eine Verantwortung, genau das zu tun und die Erkenntnisse weltweit zur Diskussion zu stellen. Die bestehenden Aufstände sind für die Weiterentwicklung der Kirche notwendig. Kraft gewinnen sie vor allem durch Öffentlichkeit und durch viele Beteiligte – dabei neben der Basis, den Verbänden, Orden, Gruppierungen, Einzelpersonen, haupt- und ehrenamtlich Tätigen und den Bischöfen auch die Wissenschaft.
Zum Schluss noch einmal Christiane Florin: „Warum bist du noch dabei, werde ich immer häufiger gefragt. Ich stammle dann etwas von Nostalgie und Biografie. Aber eigentlich denke ich ganz böse: Wir Geduldigen sind Komplizen“ (Florin 2019). Viele Frauen bleiben. Duldend und ungeduldig zugleich. Es ist ein Balanceakt.
LITERATUR
Ahlers, Stella, Gleichstellung der Frau in Staat und Kirche – ein problematisches Spannungsverhältnis, Münster 2006.
Buser, Denise, Der Zugang der Frauen zu religiösen Leitungsämtern – eine Frage der Gerechtigkeit, 2015; abrufbar unter: https://www.feinschwarz.net/der-zugang-der-frauen-zu-religioesenleitungsaemtern-eine-frage-der-gerechtigkeit/#more-1517.
Essen, Georg, The „Invention of Tradition“. Führung und Macht jenseits der Theologie des 19. Jahrhunderts?, in: Jürgens, Benedikt/Sellmann, Matthias (Hg.), Führen und Entscheiden in der katholischen Kirche (Arbeitstitel; Quaestiones Disputatae), Freiburg i. Br. in Vorbereitung.
Florin, Christiane, Die Herrenboutique, der Klerus und die Demokratie, 2020; abrufbar unter: https://www.weiberaufstand.com/post/die-herrenboutique-der-klerus-und-die-demokratie.
Florin, Christiane, Warum, zum Teufel, bin ich so geduldig?, 2019; abrufbar unter: https://www.weiberaufstand.com/post/2019/02/25/warum-zum-teufel-bin-ich-so-geduldig.
Gruber, Margareta, „Frau, dein Glaube ist groß“. Ermutigungen zu einer Konversio, in: Bode, Franz-Josef (Hg.), Als Frau und Mann schuf er sie. Über das Zusammenwirken von Frauen und Männern in der Kirche, Paderborn 2013, 37-54.
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Nachsynodales Apostolisches Schreiben Querida Amazonia von Papst Franziskus an das Volk Gottes und an alle Menschen guten Willens (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 222), Bonn 2020. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Schreiben an die Bischöfe der katholischen Kirche über die Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in der Welt (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 166), Bonn 2004.
[Links alle zuletzt eingesehen am 22. April 2020]