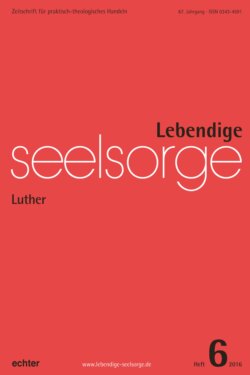Читать книгу Lebendige Seelsorge 6/2016 - Erich Garhammer - Страница 6
ОглавлениеKatholische Luther-Bilder zwischen Dämonisierung, Pathologisierung und neuer Offenheit
Zu ihrer Bedeutung für eine katholische Selbstkritik
500 Jahre Luther und die Reformation zu feiern, mag Katholiken verstören. Sie können sich dem wohl nur anschließen, wenn sie die eigene Traditionsgeschichte der konfessionellen Abgrenzung hinter sich lassen und so den fremden Luther suchen. Dieser bietet dann aber genügend Potential, mit den vertrauten Luther-Bildern auch andere verengende Entwicklungen in der katholischen Kirchengeschichte zu hinterfragen. Klaus Unterburger
Die Feier des Reformationsjubiläums bedeutet für Katholiken eine gewisse Verlegenheit. Historische Jubiläen mit ihren Ausstellungen, Vorträgen und Katalogen sind zwar zur Routine geworden als Praktiken der Selbstvergewisserung und der Vermittlung von historischen Wissensbeständen. Jubiläumsfeiern sind aber auch Gedächtnispolitik, da sie Geschichtsbilder und Identitäten zu definieren suchen. Soweit das christliche Selbstverständnis konfessionell bestimmt ist, gehört die Abgrenzung vom konfessionell Anderen zur eigenen Identität. Eine Feier der Reformation scheint so für Katholiken eine Art Selbstnegation zu sein, da diese doch gerade die Befreiung aus den Fesseln der mittelalterlichen Papstkirche gewesen sein will, weshalb im Umkehrschluss ein Katholik nur ein Luthergegner sein könnte. Wir stehen in der Traditionsgeschichte der konfessionellen Auseinandersetzung: Wunden leben wieder auf, wie also damit umgehen?
Ein bemerkenswerter Versuch, nicht hinter den Stand der ökumenischen Annäherung der letzten Jahrzehnte im Reformationsgedenken zurückzufallen, ist das gemeinsame Wort von EKD und Deutscher Bischofskonferenz „Erinnerung Heilen – Christus bezeugen“: Die konfessionelle Konfliktgeschichte, die sich in Deutungsmustern und Selbstprofilierungen immer mehr verdichtet hat, gilt es abzutragen. Haben sich die Konfessionen nämlich erst allmählich, vor allem seit dem zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts, herausgebildet, so gibt es einen vorkonfessionellen Luther. Dieser ist, wie es Kurt Koch schon vor Jahren aufgezeigt hat, von erheblicher ökumenischer Relevanz. Er ermöglicht es Katholiken, in ihm auch ihr Eigenes zu bejahen und von ihm als „Vater im Glauben“ zu lernen. Umgekehrt müssen sich Protestanten dadurch nicht enteignet sehen: Luther in einer gewissen Distanz zu eigenen späteren Festlegungen zu sehen, kann vielmehr auch für sie Inspirationsquelle, kritischer Bezugspunkt und Verbindungsglied zur antiken und mittelalterlichen Kirche sein.
Klaus Unterburger
Prof. Dr., Professor für mittlere und neue Kirchengeschichte in Regensburg; beschäftigt sich gerne mit theologiegeschichtlichen Fragen; zu den Arbeitsschwerpunkten gehören die konfessionellen Konflikte des 16. Jahrhunderts und die Entwicklung des Katholizismus seit dem 19. Jahrhundert.
Natürlich ist die Frage nach einem vorkonfessionellen Luther interessegeleitet, jedoch nicht anders, als es die evangelischen und katholischen Lutherbilder vergangener Reformationsjubiläen ebenfalls waren. Hans-Georg Gadamer hat das interessierte Vorurteil ja als notwendige Voraussetzung des Verstehensprozesses erwiesen und gezeigt, wie Traditionsabbrüche der Anlass sind für den Versuch, die Vergangenheit neu zu erschließen: Im Folgenden sollen aus katholischer Perspektive zunächst wichtige Etappen der Wirkungsgeschichte bewusst gemacht werden, in der der Rekurs auf Luther steht. Ein zweiter Schritt soll Elemente einer Annäherung an den vorkonfessionellen Luther skizzieren. Gerade den fremden Luther wahr- und in seiner Theologie ernst zu nehmen, bildet die Chance eines neuen Verstehens, einer „Verschmelzung“ und damit Erweiterung des eigenen „Horizonts“ (Gadamer).
WIRKUNGSGESCHICHTE: KATHOLISCHE LUTHER-BILDER
Offizielle katholische Luther-Bilder gibt es natürlich nicht, sondern nur solche von Katholiken. Manche von ihnen waren aber doch so prägend und haben so sehr dem kirchlichen Selbstverständnis einer Epoche entsprochen, dass sie zum festen Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses geworden sind. Bekannt ist, wie die konfessionelle Polemik der Kontroverstheologen Luther in einer Frontalablehnung regelrecht dämonisiert hat. Die Acta et commentaria des Johannes Cochläus lieferten – wie Adolf Herte gezeigt hat – über die Jahrhunderte die biographischen Bausteine der Ablehnung Luthers. Ebenso wichtig ist, dass Luthers frühe katholische Gegner (es gab auch katholische Bewunderer) ihn unter zwei Vorzeichen verstanden, dem antihussitischen und dem libertinistischen: Wie die Hussiten Rebellen gegen die göttliche Ordnung und den Klerus gewesen seien, sich die Unzufriedenheit der Laien mit dem Klerus zunutze gemacht haben und sich dabei auf die Schrift beriefen, so Luther; dessen Rechtfertigungslehre führe zum Niedergang der Sitten, zu Ausschweifung und Verachtung der guten Werke; wie die Hussiten predigen deshalb auch die Lutheraner dem Klerus Wasser und trinken selbst Wein. Die Acta des Cochläus illustrierten dies an Luthers Biographie.
Eine Neubewertung der Reformation setzte in der katholischen Aufklärung ein; freilich galt diese kaum Luthers Theologie. Reform von Kirche und Sitten, Kampf gegen Aberglauben, nationaler Aufbruch gegen romanisch-kuriale Bevormundung waren Anliegen der Zeit, für die Luther als Kronzeuge galt, wenn auch viele Aufklärer eher mit Erasmus sympathisierten. Die Neukonfessionalisierung des 19. Jahrhunderts brachte dann wieder ein Aufleben der alten polemischen Kategorien. So versuchte der junge Ignaz von Döllinger aus den zeitgenössischen Quellen zu zeigen, wie Luther und die Reformation einen sittlichen Niedergang der Gesellschaft bewirkt hätten.
Einflussreich wurde dann der Dominikaner Heinrich Denifle, der Entdecker des lateinischen Werks Meister Eckharts: Wer wie er (und anders als die protestantische Forschung) mit der mittelalterlichen Theologie vertraut sei, erkenne, dass Luther die paulinische Gerechtigkeit aus Gnade gar nicht neu entdecken musste. Diese Behauptung Luthers sei der durchsichtige Versuch, den eigenen Bruch der Klostergelübde sekundär zu rechtfertigen: Triebhafte Unkeuschheit sei also der Schlüssel zum Verständnis Luthers. Eine verwandte materialreiche Lutherdeutung legte dann der Jesuit Hartmann Grisar vor, freilich mit einem anderen Akzent: Hinter der Heilsfrage Luthers und seinen Anfechtungen stecke eine Psychopathologie, eine krankhafte Neurose.
Diese Lutherdeutungen korrespondierten mit einer Entwicklung, die zeitgenössisch meist mit „Ultramontanismus“ bezeichnet wurde. Zu diesem gehörte nicht nur die Abgrenzung gegen die Moderne, sondern auch massive Feindbilder, etwa das des Protestantismus als Ursprungssünde und erster Schritt hin zur Gottlosigkeit der Gegenwart. Zugleich war der Ultramontanismus aber Produkt der Modernisierung, Dynamisierung und Umgestaltung eines traditionalen Katholizismus. Dem entspricht der methodisch-wissenschaftliche Anspruch der ultramontanen Lutherdeutungen. Dagegen blieben nichtultramontane Katholiken wie der spätere Döllinger oder der Würzburger Kirchenhistoriker Sebastian Merkle mit ihren wohlwollenderen Lutherdeutungen Außenseiter.
Der entscheidende Umbruch im katholischen Lutherbild des 20. Jahrhunderts ging erst von einem Mann aus, der einerseits von reformkatholischen Lehrern geprägt war, andererseits aber in seinem antiliberalen Objektivismus auch zentrale Intentionen des Ultramontanismus transformiert fortführte, Joseph Lortz. Auf eine ganz charakteristische Weise kam er in den 1930er Jahren zu einer einflussreichen Neudeutung der Reformation. An einem idealisierenden Bild des Hochmittelalters und der Theologie des Thomas von Aquin orientiert konnte er in der spätmittelalterlichen Kirche nur Verfall und Subjektivismus erkennen; so habe sich der junge Luther an einer Theologie abgearbeitet, die eigentlich gar nicht mehr wirklich katholisch gewesen sei. Zugleich sei er aber selbst Kind des anhebenden Subjektivismus gewesen, in dem er seine Autorität über das objektive Urteil der Kirche gestellt habe. In Lortz‘ Reformationsdeutung konnten drei Anliegen Platz finden, ein ökumenisches, das dem jungen Luther berechtigte Anliegen konzedierte, ein ultramontanes, das im Ungehorsam gegen das kirchliche Amt die verhängnisvolle Neuerung Luthers ausmachte, schließlich der Antiliberalismus, der Lortz anfällig für den Nationalsozialismus machte.
Erst in der Schülergeneration von Lortz und im Umfeld des II. Vatikanischen Konzils haben dann katholische Lutherdeutungen den Subjektivismusvorwurf hinter sich gelassen. Bei ihnen – und parallel bei protestantischen Forschern – wurde die Einsicht leitend, dass sich Luther aus spätmittelalterlichen Traditionen heraus entwickelt hat und sein Anliegen mit Subjektivismus jedenfalls nicht getroffen ist. Vielmehr konnten Otto Hermann Pesch, Peter Manns und andere, etwa der hinter den Publikationen „Lehrverurteilungen – kirchentrennend?“ stehende Ökumenische Arbeitskreis zeigen, wie der Widerspruch zwischen Luther, den Bekenntnisschriften und den Trienter Beschlüssen, aber auch zwischen Luther und mittelalterlichen Theologen wie Thomas von Aquin mitunter nur ein terminologischer gewesen ist und keine wechselseitigen Anathematisierungen rechtfertigt.
Die Schuld am Bruch wurde so auf beide Seiten verteilt, wobei die Weichenstellungen seit dem 19. Jahrhundert insofern fortwirkten, als man den entscheidenden Scheidungsgrund in den Aussagen Luthers zu Papst, Konzil und Kirche sieht, zu denen er auch durch seine frühen Gegner gedrängt wurde. Dies korrespondiert mit dem ökumenischen Dialog der Gegenwart: Missstände und Reformbedarf und damit berechtigte Anliegen Luthers werden heute von Katholiken umso leichter zugegeben, als sich die Sozial- und Finanzstruktur des kirchlichen Lebens ohnehin grundlegend geändert hat; Papstamt und Kirchenverfassung erweisen sich hingegen heute als Hauptprobleme der Ökumene, während die Rechtfertigungslehre eine Art Mittelposition einnimmt, da sie zwar vielfach bejaht und dann doch in der Gegenwart eher nur modifiziert vertreten wird.
MARTIN LUTHER – ANSTOSS ZU KATHOLISCHER SELBSTKRITIK
Man kann konstatieren, dass die allmähliche Revision des katholischen Lutherbilds mit einer wirkungsgeschichtlichen Krise des Ultramontanismus als Erben der forcierten konfessionellen Abgrenzung einherging. Die konfessionellen Denktraditionen sich bewusst zu machen, um den fremden, vorkonfessionellen Luther als Gesprächspartner ernst nehmen zu können, ist so ein wichtiges Anliegen des gemeinsamen Wortes zum Reformationsjahr. Wird Luthers Theologie aus ihrer Genese verstanden, so verteilen sich Tradition und Innovation, die eben beide bei ihm und bei seinen „alt“gläubigen Gegnern zu finden sind. Hierüber besteht ein weitgehender Konsens auch in der evangelischen Lutherforschung. Welche Elemente der Theologie und Frömmigkeit Luthers aus welchen Quellen aber übernommen wurden, wie sich seine eigene theologische Entwicklung vollzog, wie Theologie und Ablassstreit zusammenhängen und schließlich, wodurch der ekklesiologische Bruch bedingt ist, darüber gibt es nach wie vor eine lebhafte Diskussion.
Sechs Aspekte, die wichtig erscheinen, um eine katholische Selbstkritik der eigenen konfessionellen Festlegungen zu befördern und Luther als „Vater des Glaubens“ für die Gegenwart fruchtbar machen zu können, seien deshalb skizziert:
1. Luthers Theologie entwickelte sich in der Auseinandersetzung mit der Hl. Schrift, vor allem mit den Psalmen und Paulus. Die Schrift war für den mittelalterlichen Universitätstheologen die selbstverständliche Textgrundlage. Sobald wir von Luther längere theologische Texte haben, bezieht er sich theologisch in signifikanter Weise auch auf Augustinus. Eine „nominalistische“ Phase wirklich nachzuweisen, dürfte schwierig sein; vielmehr beruft er sich für das in der Frühtheologie zentrale Gegensatzdenken zwischen dem Frommen, der auf die Gnade Gottes vertraut und dem Stolzen, der die Selbstgerechtigkeit sucht, auf Augustinus. Heiko A. Oberman und andere haben deshalb die Frage gestellt, ob Luther einer spätmittelalterlichen „Augustinus-Schule“ seines Ordens zuzuordnen sei; auf einer formellen Ebene lässt sich die Existenz einer solchen „Schule“ jedoch kaum nachweisen. Dafür lässt sich etwas anderes zeigen: In Luthers Orden wuchs die spirituelle Bedeutung des Kirchenvaters seit dem 14. Jahrhundert massiv an: Man verstand sich als sein verlängerter Leib und begründete so die Exzellenz der eigenen Lebensform gegen konkurrierende Orden (Saak). Die Spiritualität von Augustinus als monastischem Vorbild war aber, nichts durch die eigenen Werke und alles von der Gnade Gottes zu erhoffen. Diese augustinische Frömmigkeitstheologie prägte schon Luthers erste Vorlesungen.
2. In diesen ersten Vorlesungen war auch eine ekklesiologische Position grundgelegt; die Lehre von der Kirche ist für Luther so keineswegs sekundär; Christus als Haupt, der im Glauben seine Gnade dem Sünder verleiht, ist die zentrale Denkfigur, die Luther in stetem Kontakt mit dem Psalmenkommentar des Augustinus entwickelte. Die Kirche ist ein „Spital“, da Kranke, Sünder, in einem „fröhlichen Wechsel und Tausch“ (auch dieses Bild ist bereits augustinisch) die Gnade Christi verliehen bekommen; dagegen suchen Aristoteliker, Juristen und Kanonisten nur immer die eigene Gerechtigkeit und die eigenen Werke.
3. Zentrale Theologoumena des reformatorischen Luthers sind in seiner Frühtheologie bereits angelegt. In seinen Werken kann kein Bruch mit der eigenen theologischen Vergangenheit nachgewiesen werden, wohl aber Weiterentwicklungen. Einen Bruch, ein Turmerlebnis, wie ihn verschiedene Lebensrückblicke nahelegen, kann man nicht ausschließen. Dieser müsste dann wohl sehr früh angesetzt werden, noch vor dem Psalmenkommentar. Wahrscheinlicher ist aber der Vorschlag (Leppin), dass der Gegensatz zwischen Werkgerechtigkeit und Gnade nach den Bekehrungsbeispielen der maßgebenden Lehrer der Gnade, Paulus und Augustinus, bei Luther hier einfach biographisch stilisierend anschaulich gemacht wird.
4. Häufig wird die Neuartigkeit lutherischer ekklesiologischer Positionen betont, etwa dass der päpstliche Primat sich erst allmählich ausgebildet hat, oder dass einzelne Päpste oder Konzilien irren können. Es lässt sich aber zeigen, dass Luthers zentrale ekklesiologische Annahmen sich aus Augustinus speisen und dass auch die zeitgenössische Kanonistik mit irrenden Päpsten und Scheinkonzilien rechnete (Bäumer). Gerade Luthers Gegner und Richter Kardinal Cajetan führte Neuerungen ein, als er die Möglichkeit eines irrenden Papstes einschränkte und die Möglichkeiten eines legitimen Widerstands restringierte (Horst). Da viele seiner Gegner dominikanische Papalisten waren, die zugleich die Gnade mit aristotelisch-thomistischer Begrifflichkeit deuteten, interpretierte Luther den Streit um seine Theologie als Schulstreit, in dem die thomistische Schule sich mit der Lehre der Kirche zu identifizieren suchte.
5. Immer wieder wurde auf die wichtige Rolle von Staupitz für die Ausbildung von Luthers Theologie aufmerksam gemacht. Beide glaubten sich im Verständnis des Evangeliums als dem zentralen Inhalt der christlichen Botschaft einig. Da aber Staupitz katholisch blieb, kann hierin ein Indiz gesehen werden, dass Exkommunikation und Kirchenspaltung kontingente Ereignisse waren und eine frühlutherische Frömmigkeitstheologie unter anderen Bedingungen auch in der katholischen Kirche hätte bleiben können.
6. Luther vertrat in dem Sinne keine Mystik, als die Gerechtigkeit Christi eine fremde Gerechtigkeit bleibt. Dennoch verkürzt die spätere Imputationslehre den seelischen Erfahrungsbezug von Luthers Rechtfertigungslehre: Immer wieder brachen in der katholischen Kirchengeschichte Konflikte um die augustinische Gnadenlehre auf, vor und nach Luther: Während sich eine Position durchgesetzt hat, die die Gnade als unerfahrbare, neue Qualität an der Seele definierte, glaubte der Augustinismus, die sündhafte Selbstbezogenheit des Menschen und die das Herz umgestaltende Macht der christlichen Gnadenbotschaft (die freilich den alten Menschen nie ganz zum Schweigen bringt, weshalb er stets auf die Barmherzigkeit Gottes verweisen bleibt), anders deuten zu müssen. Wenn Luther als Lehrer der Gnade Vater im Glauben für Katholiken sein kann, dann darin, dass das Drama um Sünde und Gnade einen Erfahrungsbezug hat; wenn Sünde und Gnade nicht erfahrbar sind, scheinen sie dem säkularen Denken nicht relevant zu sein, eine Erlösungsreligion scheint dann überflüssig zu sein.
LITERATUR
Bäumer, Remigius, Nachwirkungen des konziliaren Gedankens in der Theologie und Kanonistik des frühen 16. Jahrhunderts, Münster 1971.
Beyna, Werner, Das moderne katholische Lutherbild, Essen 1969.
Erinnerung heilen – Christus bezeugen. Ein gemeinsames Wort zum Jahr 2017, hg. von der Evangelischen Kirche Deutschland und vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Hannover-Bonn 2016.
Hamel, Adolf, Der junge Luther und Augustin (2 Bd.), Gütersloh 1934-1935.
Hamm, Berndt, Der frühe Luther. Etappen reformatorischer Neuorientierungen, Tübingen 2010.
Horst, Ulrich, Juan de Torquemada und Thomas de Vio Cajetan. Zwei Protagonisten der päpstlichen Gewaltenfülle, Berlin 2012.
Koch, Kurt, Gelähmte Ökumene. Was jetzt noch zu tun ist, Freiburg 1991.
Leppin, Volker, Transformationen. Studien zu den Wandlungsprozessen in Theologie und Frömmigkeit zwischen Spätmittelalter und Reformation, Tübingen 2015.
Lortz, Joseph, Die Reformation in Deutschland (2 Bd.). Voraussetzungen, Aufbruch, erste Entscheidung, Freiburg/Basel/Wien 51962.
Saak, Eric Leland, Creating Augustine: Interpreting Augustine and Augustinianism in the later Middle Ages, Oxford 2012.
Schwarz, Reinhard, Luther, Göttingen 32004.
Ders., Martin Luther. Lehrer der christlichen Religion, Tübingen 2015.
Unterburger, Klaus, Unter dem Gegensatz verborgen. Tradition und Innovation in der Auseinandersetzung des jungen Martin Luther mit seinen theologischen Gegnern, Münster 2015.
Vercruysse, Joseph, Fidelis populus, Wiesbaden 1968.
Wriedt, Markus, Produktives Mißverständnis? Zur Rezeption des lateinischen Kirchenvaters Augustinus im Werk Martin Luthers (1483–1546), in: Fischer, Norbert (Hg.), Augustinus. Spuren und Spiegelungen seines Denkens. I: Von den Anfängen bis zur Reformation, Hamburg 2009, 211-225.