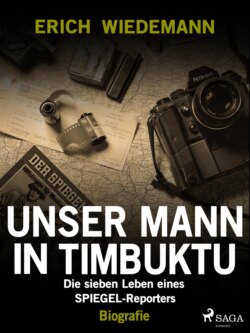Читать книгу Unser Mann in Timbuktu - Erich Wiedemann - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеDie Gesamtheit meiner sieben Leben ist unteilbar wie eine Primzahl. Meistens war das eine Leben noch nicht zu Ende, wenn ich ein neues begann. Manchmal lebte ich zwei oder drei Leben eine Weile lang parallel. Das afrikanische habe ich immer wieder gelebt. Es war das Hauptleben.
Die Inventur meiner biografischen Module zeigt, dass ich keine Mühe hätte, mich einer Vielseitigkeitsprüfung zu stellen, wenn ich dazu aufgefordert würde. Ich war Fotograf, Afrika-Korrespondent, Desk-Redakteur, News-Reporter, Führungskraft, Verlagsscout, investigativer Reporter. Sachbuchautor und Kommunalpolitiker zähle ich nicht mit.
Ich habe nicht in allen Disziplinen gleichermaßen sichtbare Spuren hinterlassen. Als Chef brachte ich es nur bis in den Mittelbau. Ich glaube, als stellvertretender Leiter der Spiegel-Auslandsredaktion habe ich mich am weitesten von meinem Naturell entfernt. Ich hätte es vorher wissen können. Denn ich hatte schon als Gruppenführer bei der Bundeswehr erfahren, dass ich mich nicht dazu eignete, anderen zu sagen, was sie tun sollten. Einfach weil ich, gegen alle Erfahrungen, an die angeborene Autonomie des Individuums glaube.
Zwei Jahre lang war ich auch Kaufmann. Ich hatte im Hamburger Antik-Center einen Laden für afrikanische Kunst. Ein Kollektiv junger Künstler in Daressalam lieferte mir Makonde-Skulpturen. Weil ich aber ständig unterwegs war, hatte ich das Geschäft nie unter Kontrolle. Irgendwann machte ich den Laden dicht. Ich fragte meinen Steuerberater, wie viel ich damit verdient hätte. Er sagte: »Nix.« »Und wie viel habe ich zugesetzt?« »Auch nix.« Für ein Greenhorn wie mich war das kein schlechtes Ergebnis. Außerdem redete ich mir ein, ich sei ein Mäzen gewesen. Das war besser als Reibach.
Beinahe wäre ich auch Romancier geworden. Ich schrieb einen Roman von 450 Seiten mit dem Titel Mord in Wackelsbeck. Darin habe ich das Leben eines neurotischen Neurologen namens Artur Ypsilon geschildert. Ypsilon soll den russischen Präsidenten vom Locked-in-Syndrom befreien und Russland für die Zivilisation retten. Doch mordbereite Finsterlinge wollen das Rettungswerk verhindern. Ein Profikiller verwechselt im Suff die handelnden Personen und schießt statt dem deutschen Doktor dem Bürgermeister von Wackelsbeck die Schädeldecke weg.
Der Mord in Wackelsbeck blieb ungedruckt. Journalisten sind nicht wirklich literaturfähig. Sie wollen immer etwas Neues beschreiben. Literatur ist aber vorwiegend statisch oder rückwärtsgewandt. Sie befasst sich am liebsten mit Bestehendem.
Romane wie Sachbücher werden aus Wörtern gemacht. Aber Romanautor ist ein anderer Beruf als Sachbuchautor. Vielleicht krankte Artur Ypsilon daran, dass ich ihn als postmodernen intellektuellen Skeptiker aufgebaut habe. Die Helden in den erfolgreichen Romanen der Weltliteratur sind häufig keine Intellektuellen: Gatsby, Captain Ahab, Effi Briest. Sie besitzen auch mentale Leerräume, die es dem Leser gestatten, sie mit eigenen Vorstellungen zu besetzen. Ich glaube, mein Ypsilon war nicht unvollendet genug.
1997 sollte ich in Warschau für den Spiegel die Gründung eines polnischen Nachrichtenmagazins vorbereiten. Die halbe Mannschaft hatte ich schon ausgesucht. Es wurde nichts draus, weil die Spiegel-Verlagsleitung den Kapitalbedarf des Objekts für zu hoch befand.
Andere deutsche Zeitungsverlage haben sich in Polen goldene Geldzähldaumen verdient. Das polnische Nachrichtenmagazin hat dann statt des Spiegel-Verlags der Axel Springer Verlag gemacht. Es wurde ein Riesenerfolg. Nach dem Fehlschlag hatte ich keine Lust auf einen zweiten Versuch.
Fotograf war ich immer mit Leidenschaft, immer wieder, aber immer nur nebenberuflich. Ich wollte Bilder einfangen, die mir der Alltag zuspielte. Genau zielen, schnell schießen, Leben schockgefrieren. Meine Bilder waren selten arrangiert. Sie lebten, wenn sie gut waren, von der Ästhetik des Augenblicks. Glück, Liebe, Trauer, Verzweiflung, das ist alles flüchtig. Das kann man nicht glaubwürdig arrangieren.
Bevor ich als Redakteur zum Spiegel nach Hamburg ging, hatte ich mich der Fotoagentur Magnum angedient. Ich erschien mit einer großen Fotomappe und hohen Erwartungen im Magnum-Büro in der Rue Christine in Paris. Nach Begutachtung meines Œuvres und meiner Person zogen sich der Geschäftsführer und zwei Beisitzer zur Beratung zurück. Zehn Minuten später tauchte der Geschäftsführer wieder auf und erklärte mir väterlich: »Mon cher, Sie sind noch jung und entwicklungsfähig. Schauen Sie in drei, vier Jahren noch mal rein.« Die Vorstellung, meine Bilder hätten es mit denen der Göttlichen von Magnum – Seymour, Capa, Cartier-Bresson – aufnehmen können, war wohl auch etwas vermessen gewesen.
Das achte Leben war nur eine theoretische Option. Spiegel-Kollege Olaf Ihlau und ich hatten Markus Wolf, den ehemaligen DDR-Spionagechef, in Moskau aufgespürt, wohin er sich nach dem Untergang der ostdeutschen Schrottrepublik zurückgezogen hatte. Jahrzehntelang hatten sich die westlichen Geheimdienste an Wolf die Zähne ausgebissen. Sie wussten noch nicht mal, wie er aussah. Und nun saß er tatsächlich vor uns, im Restaurant des Penta Hotels am Moskauer Olympia-Gelände, um über sein Leben auszupacken.
Mischa, wie er von seinen Freunden genannt wurde, wusste, wie man Leute einseift. Ich hatte versucht, ihn dezent auszuhorchen. Aber er ließ mich auflaufen. Er klopfte mir nur jovial auf die Schulter und sagte: »Geben Sie sich keine Mühe, junger Mann, der Schalter ist geschlossen.« Und dann zu Olaf Ihlau: »Er hat investigatives Talent, so einer hätte bei mir was werden können. Chapeau.« Ich erlag aber nicht der Versuchung, das als schmeichelhaft zu empfinden. Ein Leben als Spion ausgerechnet für den kommunistischen deutschen Unterdrückerstaat, ja, schönen Dank.
Der besseren Lesbarkeit wegen habe ich mein Curriculum Vitae nicht chronologisch geordnet. Ich schildere es als Abfolge von Momentaufnahmen. Die Momente sind unterschiedlich lang. Einige Kapitel spannen sich über ein paar Stunden, andere über einige Wochen. Das Buch ist ein Flickenteppich von Ereignissen und Erkenntnissen. Aber auch das Leben ist ungeordnet. Es folgt keiner dramaturgischen Vorgabe.
Ich bin nicht mit dem Öl des Analytikers gesalbt. Es war mein Beruf, Erlebtes so professionell zu erzählen, dass sich daraus die Exegese von selbst ergab. Dabei war ich bemüht, mich aus dem, was ich beschrieb, selbst herauszuhalten.
Reporter sollen im Hintergrund bleiben und in den Geschichten, die sie erzählen, nicht in Erscheinung treten. Ich habe mich immer an dieses Gebot gehalten. Dies Buch ist seit meinem Aufsatz »Meine Eindrücke am Wandertag im Rumbachtal« in der Untersekunda meine erste Geschichte in der Ich-Form.
Reporter sind von Berufs wegen der Neugier verpflichtet. Warum öffnen sie gern Türen, auf denen »Zutritt verboten« steht, warum blicken sie in der U-Bahn statt in die eigene Zeitung in die des Nachbarn? Egon Erwin Kisch, der Urvater der Reporter, hat es uns gesagt: Neugier ist Wahrheitssuche. Er schrieb: »Ich gaffe in fremde Fenster, ich lese die Wohnungsschilder in dem Haus, in dem ich zu Besuch bin, ich durchforsche Friedhöfe nach vertrauten Namen.« Um nichts als der Wahrheit willen.
Viele Reporter glauben, dass sie Literatur schaffen, wenn sie Zeitungsgeschichten schreiben. Dem ist nicht so. Von Ex-Spiegel-Verlagsleiter Hans-Detlef Becker ist der Ausspruch überliefert, eine Zeitung sei ein Nachrichtenträger und kein Lunapark. Er wollte damit sagen: Die Schönheit der Sätze ist erwünscht, aber sie darf nicht das Faktische dominieren. Ein guter Reporter muss beschreiben können, wie eine Spülmaschine oder ein Atomkraftwerk funktioniert. Wobei nicht jeder, der das kann, schon ein guter Reporter ist.
Früher mussten sich Zeitungsvolontäre einen Zettel mit den berühmten sechs Ws unter die Glasplatte auf ihrem Schreibtisch legen: Wer, Was, Wann, Wo, Wie, Warum. Kein nachrichtlicher Bericht ging ins Blatt, in dem diese sechs Fragen nicht beantwortet wurden. Und zwar nach Möglichkeit in der oben genannten Reihenfolge. Heute wird das Gott sei Dank nicht mehr so eng gesehen.
Meine interessantesten Geschichten waren nicht die erfolgreichsten. Und umgekehrt. Die zwei Jahrhundertschurken Idi Amin und Josef Mengele, die ich suchte, habe ich nicht gefunden. Das Bernsteinzimmer, dem ich monatelang nachspürte, auch nicht. Die Geschichten, wie ich mein Ziel nicht erreichte, fanden trotzdem ihr Publikum.
Das Copyright auf den Titel dieses Buches haben eigentlich die damaligen Kollegen der Hamburger Spiegel-Auslandsredaktion. Sie nannten mich »Unser Mann in Timbuktu«, obwohl ich nur zweimal dort gewesen war.
Timbuktu, die legendäre Oasenstadt in Mali am Südrand der Sahara, steht für die Wunder und Mysterien des schwarzen Kontinents. Sie ist nicht typisch für Afrika. Denn dazu ist sie zu schön. Der Stadtkern besteht aus 5000 Würfeln, die aus Lehm gebrannt sind. Vom 14. bis zum 16. Jahrhundert war diese Lehmagglomeration nach Kairo das zweitwichtigste Zentrum der islamischen Kultur in Afrika.
In der Bibliothek und in der Universität von Timbuktu lagern tausend Jahre alte Handschriften und Episteln. Norwegische und französische Bibliothekare kämpfen gegen deren Verfall. Doch der größte Teil der Bestände ist nicht zu retten.
Irgendwann wird die Sahara Timbuktu begraben. Von Norden her arbeitet sich die Wüste immer tiefer in die Stadt hinein. Ganze Straßenzüge sind bereits versandet. Weil Timbuktu wirtschaftlich keine Zukunft hat, ziehen die Menschen weg, und nur noch Sand wird Zurückbleiben.
Bei meinen zweiten Besuch anlässlich des Festival au desert, das jährlich im Herbst in Timbuktu stattfindet, war ich zu einem Leseabend ins Haus eines Archivars von der Sankoré-Bibliothek eingeladen. Eine junge Frau las aus Schriften des arabischen Reisenden Ibn Batuta aus dem 14. Jahrhundert. Ich bekam die Verführungskraft der arabischen Poesie zu spüren. Obwohl ich kein Wort verstand, war ich verzaubert, allein von der Melodie der Wörter.
Ich hätte gern einmal einen Spiegel-Artikel über die schöne Stadt geschrieben. Aber in all den Jahren ist es mir nie gelungen, eine Timbuktu-Geschichte ins Blatt zu kriegen. Kein Sex, kein Elend, kein Krieg, kein Doping – wer will eine Geschichte über eine Stadt lesen, die nur schön ist?
Ich hatte viele gute Jahre beim Spiegel, obwohl in dem grauen Betonhaus am Hamburger Sandtorkai gewöhnlich im Team gearbeitet wird und ich immer ein notorischer Solist war. Deshalb singe ich aber keine Oden an die Freude, beim Spiegel gearbeitet zu haben. Er und ich, wir sind einander nichts schuldig. Er hat mich ordentlich bezahlt, und ich habe ihm ordentliche Geschichten dafür geliefert. Die Arbeitsbedingungen waren gut. Doch unsere Beziehung war nicht das, was man eine Herzensangelegenheit nennt.
Ich wollte das auch gar nicht. Nestwärme kann leicht beklemmend werden. Weil viele das so ähnlich empfinden, schließen Spiegel-Redakteure auch nicht so schnell Freundschaft miteinander. Wirklich freundschaftlich verbunden war ich in all den Jahren nur dreien. Rudolf Augstein hat gelehrt: »Ein Journalist kann keine dauerhaften Freundschaften haben.« Keine Freunde, hätte ich nicht gesagt, aber nicht viele.
Als ich 25 Jahre beim Spiegel war, erschien Personalchef Eike Mahlstedt mit einem teuren Blumenstrauß in meinem Büro. Ich bedankte mich, und dann fragte er: »Wie lange wollen Sie denn eigentlich noch bleiben?« Für mich hörte es sich so an wie: »Merken Sie eigentlich nicht, dass Sie hier eine Planstelle blockieren? Machen Sie doch endlich Platz.« Ich antwortete: »Sehen Sie in meiner Personalakte nach. Da steht es drin, wie lange ich bleibe.« Nämlich bis zum »Ende des Monats, in dem Sie das 65. Lebensjahr erreichen«. Und so ist es geschehen.
Der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Frank Schirrmacher schrieb in seinem Buch Das Methusalem-Komplott: »Man wird vernehmbar über unsere Überzähligkeit diskutieren, über Euthanasie, über die letzten teuren Wochen in den Krankenhäusern.« Panikträume eines Angstpredigers? Ich glaube, dass die düsteren Prophezeiungen nicht übertrieben sind.
Im Umgang von Alten und Jungen gilt auch beim Spiegel das altersdarwinistische Grundmuster: Ein Reporter, der sich in den letzten fünf Jahren vor seiner Pensionierung noch um den Nachweis bemüht, dass er sein Geld wert ist, zeigt dadurch, dass er dem Altersstarrsinn verfallen ist. Widerspruch unterstreicht den Eindruck der Uneinsichtigkeit. Es ist so wie mit dem Teufel im Mittelalter. Wer ihn leugnete, bewies dadurch, dass er von ihm besessen war.
Die Gerontologen predigen den Mut zur Endlichkeit. In meinem Heimatort in der Lüneburger Heide haben wir einen praktischen Arzt, der mit Ende siebzig noch gebrochene Knochen schient und EKGs erstellt. Und in der Woche, nachdem sie mich relegiert hatten, wurden in Stockholm die Namen der Nobelpreisträger 2007 bekannt gegeben. Sieben der zehn Preisträger waren älter als ich, einer sogar 25 Jahre. Es gibt fast nichts, was ich in Amerika für besser halte als in Europa. Aber dass es dort ein Gesetz gegen Altersdiskriminierung gibt, das finde ich gut.
Anderen erging es nicht besser als mir. Einer hatte immer ein handschriftliches Vermächtnis von Rudolf Augstein in der Brieftasche. Darauf stand: »Der Redakteur Soundso darf so lange beim Spiegel arbeiten, wie er will.«
Mein Abschied nach 32 Jahren vollzog sich ohne Beigabe von rituellem Zierat. Ich verzichtete auf die übliche Feier, überwies stattdessen 500 Euro an Amnesty International und heftete die Quittung ans schwarze Brett.
Von den Kollegen erhielt der Verrentete trotzdem das obligate Abschiedsgeschenk: ein Spiegel-Cover mit einem Foto-Cluster und einer passenden Schlagzeüe. Meine lautete: »Wiedemann – drei Jahrzehnte auf der Suche nach der Wahrheit«. Auf einem Bild lag der Laureat hinter einem schweren MG in der Wüste von Nevada, das zweite zeigte ihn untertage in England mit Streikbrechern. Auf dem dritten stand er breitbeinig und mit verschränkten Armen vor dem Haupteingang der Moskauer Prawda. Für den, der es nicht weiß: »Prawda« ist russisch und heißt »Wahrheit«.
Als ich in den Ruhestand ging, ließ ich im Stehsatz vier Reportagen zurück, die nicht mehr gedruckt wurden, obwohl sie bei meinem Abgang alle nicht älter als drei Monate waren. Für die teuerste davon, eine Reportage über die Elefantenschwemme im südlichen Afrika, hatte der Spiegel rund 5000 Euro für Spesen ausgegeben.
Samstag, der 29. September 2007. Meinen letzten Arbeitstag verbrachte ich in Oslo. Es war ein goldener Herbsttag. Die Sonne schien in Strömen, die Frauen trugen luftige Jungmädchenkleider. Zu schön für Ultimo. Meine Stimmung war schlecht. Fast alles, was ich an diesem Tag tat, tat ich zum letzten Mal.
Vormittags um zehn führte ich ein Interview mit zwei exilburmesischen Radioaktivisten, die beim Aufstand der Mönche in Rangun per Internet eine Nachrichtenbrücke von Burma zum Rest der Welt geschlagen hatten. Danach ging ich mit dem Fotografen, der mich begleitete, in dessen Wohnung und schrieb meinen Text auf seinem Apple. Um zwei war die Geschichte fertig, meine letzte Spiegel-Geschichte in 32 Jahren. Dann ging ich zu McDonald’s und kaufte mir einen Double Cheeseburger und eine Cola. Das Menü war so teuer wie ein Mittagessen mit drei Gängen und einem Glas Riesling im Block House in Hamburg. Während ich den Burger mampfte, rief die Dokumentation auf meinem Mobiltelefon an und teilte mir mit, dass ich den Namen des Ministerpräsidenten falsch geschrieben hätte und dass es nicht »birmanisch«, sondern »burmesisch« heiße. Ich war mit den Korrekturen einverstanden.
Wegen einer Buchungspanne war ich von der Passagierliste der SAS-Nachmittagsmaschine nach Hamburg gestrichen worden. Ich konnte deshalb erst um 22 Uhr mit der Lufthansa zurückfliegen. Es war ein Canadair-Jet. Ich hatte den Sitzplatz 4A in der Business-Klasse. Zum Dinner gab es Hühnerbeinchen mit scharfer Soße an pikantem Kohlsalat. Dazu trank ich ein Viertel roten Bordeaux.
In Fuhlsbüttel wartete mein Taxifahrer aus Jesteburg. »Schicht?«, fragte er, weil er wusste, dass es mein letzter Tag war. »Jau«, sagte ich.
Am nächsten Vormittag fuhr ich mit zwei Hartschalenkoffern nach Hamburg. Noch ein stummer Gruß an den rostigen Stahlblechwolf, der im Atrium vor der Drehtür bezeugte, dass der Spiegel mit der modernen Kunst versöhnt war. Dann im Edelstahlaufzug rauf in den achten Stock. Schreibtisch aufräumen, Bilder abhängen, einpacken, ein warmer Händedruck für den Pförtner, kein Blick zurück.
Im neuen Spiegel, der am Sonntagmorgen im Briefkasten steckte, war ich schon aus dem Impressum gestrichen. Ich riss die Seite raus, um sie abzuheften. Zum ersten Mal seit 32 Jahren kein Wiedemann im Impressum. As time goes by.
Als ich am Montagmorgen mein Auto in der Tiefgarage parken wollte, war das elektronische Sesam-öffne-dich-Kärtchen schon gesperrt. Die Spiegel-Verwaltung ist wirklich ein perfekt organisiertes Universum. Es funktioniert einfach alles.
In den ersten zehn Jahren hatte ich gar nicht bemerkt, dass sich die Sanduhr langsam leerte. Dann rieselte der Sand immer schneller. Die letzten fünf Jahre verstrichen im Zeitraffer. Zeit ist relativ, aber anders, als Einstein gedacht hat.
Nachmittags hatte ich Holländisch-Unterricht. Kanzler Bismarck, der Eiserne, hatte gelehrt, die Kenntnis von Fremdsprachen sei »das Talent der Oberkellner«. Nun würde ich sie ja nicht mehr so dringend benötigen. Trotzdem wollte ich – außer Englisch und Französisch – wenigstens eine etwas abgelegenere Sprache sprechen. Volkhard Windfuhr, der Korrespondent in Kairo, war mein Vorbild. Er sprach ein halbes Dutzend arabische Dialekte akzentfrei, außerdem Farsi, Türkisch und die gängigen westeuropäischen Sprachen.
Dem babylonischen Charme der Spiegel-Auslandsredaktion konnten sich auch welterfahrene Besucher nur schwer widersetzen. Weil die Türen fast immer geöffnet waren, konnte man zuweilen sieben, acht verschiedene Sprachen aus den Büros hören, wenn man den Flur im achten Stock entlangschlurfte: Englisch, Französisch, Kroatisch, Rumänisch, Spanisch, Russisch, Polnisch. Stefan Simons sprach Mandarinchinesisch, Wulf Küster Japanisch. In all den Jahren hatten wir nur einen Auslandsredakteur, der gar keine Fremdsprache konnte. Er schrieb aber sehr gebildete Artikel.
Das Leben ist bekanntlich eine lebenslange Universität. Der Spiegel war für mich auch eine Art weiterführende, höhere Lehranstalt. Meinen letzten Erkenntnisschub empfing ich bei der Recherche über die verheerenden Brände in Griechenland von der Sängerin Vicky Leandros, die gerade als Kandidatin bei den Parlamentswahlen in ihrem Wahlkreis Piräus durchgefallen war.
Zugegeben, ich hatte von Frau Vicky eine eher negative Vorstellung: Ein Trällerchen im Babydoll, und dann war sie auch noch mit einem deutschen Adligen verheiratet. Eine Frau, aus der man Blondinenwitze macht. Wer braucht denn so was in der Politik?
Wie man sich täuschen kann. Die Dame wusste bestens Bescheid über die Athener Szene. Sie konnte spannend und kenntnisreich erzählen, wie die Flammen des Jahrhundertfeuers auf den Wahlkampf übergegriffen hatten, und sie prangerte die Inkompetenz und Korrumpierbarkeit der Behörden sowie die Machenschaften von kriminellen Spekulanten an, die Brände gelegt hatten, um aus Grünfläche Bauland zu machen. Ergo: Propere Sängerinnen sind nicht per se Dummchen. Das hatte ich vorher nicht gewusst. Diese Lektion erhielt ich eine Woche nach meiner Pensionierung, als ich schon nicht mehr dazugehörte. Die Geschichte über Vicky Leandros und die griechischen Brände war mein Requiem.
Und wie fing es an? Wie kam ich zum Spiegel?
Auslandschef Dieter Wild hatte mir 1963 erklärt, der Biss (kann auch sein, dass er »Verbissenheit« sagte) beim Recherchieren meiner Geschichte über den sozial abgestürzten älteren Bruder von Österreichs Bundeskanzler Bruno Kreisky, die ich dem Spiegel verkauft hatte, habe ihm gefallen. Er meinte auch, den Eindruck gewonnen zu haben, dass ich sogar eines gewissen deutschen Ausdrucks fähig sei.
Der ältere Kreisky, ein Heiliger von der traurigen Gestalt, lebte allein, fromm und verbittert in einer Zwei-Zimmer-Wohnung am Stadtrand von Jerusalem. Er war enttäuscht von Israel und empört über seinen prominenten Bruder, weil der sich mit der westlichen Lebensart arrangiert hatte und das orthodoxe Judentum verspottete. Zweimal hatte er mich rausgeschmissen, beim dritten Besuch bekam ich dann mein Interview. Es war mein erster Spiegel-Beitrag. Der erste von knapp tausend, wenn man die Panorama-Meldungen und Zulieferungen dazuzählt.
In den ersten viereinhalb Spiegel-Jahren war Nairobi (Kenia) meine Operationsbasis. Nairobi war damals noch ein erfreulicher Ort – sicher, komfortabel, gut klimatisiert, nicht zu regnerisch und nicht zu teuer. Ich war zunächst ein schlecht bezahlter »fester Freier«, wie es im Redaktionsbuchhalterjargon heißt. Als Dienstfahrzeug hatte ich ein 125er Yamaha-Zweitaktmotorrad. Und als Fixum bekam ich monatlich tausend Mark, dazu Spesen und Zeilenhonorar.
Der Spiegel zahlte auch die Reisen für die Geschichten, die er selbst nicht druckte und die dann in meinem Zeitungspool erschienen. Ich bediente sechzehn regionale Blätter, darunter die Kieler Nachrichten, die Hannoversche Allgemeine, den Tagesspiegel in Berlin, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung in Essen, die Kölnische Rundschau, die Badischen Neuesten Nachrichten und den Südkurier in Konstanz, außerdem die Schweizer Weltwoche, die damals führende Wochenzeitschrift der Eidgenossenschaft.
1978 erhielt ich den Ruf nach Hamburg. Hans Hielscher, der im Haus das Afrika-Ressort verwaltete, gestand mir viel später, dass er alles versucht habe, um meine Festeinstellung zu verhindern. Er fand, dass ein konservativer Knochen wie ich nicht in das hochprogressive Spiegel-Auslandsressort passte.
Nachdem er sich im Laufe der folgenden Jahre davon überzeugt hatte, dass der ständige Dissens zwischen mir und dem Rest der Crew auch ein belebendes Element war, wurden Hans und ich Freunde. Ganz langsam. Auf Reisen habe man mich als »warmherzigen Kumpel« erleben können, schrieb er zu meinem Abschied in den verlagsinternen Hausmitteilungen.
Ich glaube, es hat in all den Jahren beim Spiegel keine so intakte Freundschaft zwischen zwei Mitarbeitern so unterschiedlicher Denkart gegeben wie die zwischen Hans Hielscher und mir. Manchmal riss er meine Bürotür auf, warf die Hände in die Höhe und rief: »Da Mensch!«, und dann musste ich ebenso laut schreien: »Iss a Sau!« Das war unser immer wiederkehrendes Fraternisierungsritual. Unser Doppelschrei drückte die gemeinsame Überzeugung aus, dass ein Teil der Menschheit schlecht und unverbesserlich sei. Wobei Hans Hielscher einen anderen Teil meinte als ich.
In den ersten zehn Jahren residierte ich in einem kleinen Büro im achten Stock mit Blick auf die backsteinfarbenen Hafenspeicher am Sandtorkai. In meinen zwei Chefjahren hatte ich ein doppelt so großes Büro auf derselben Seite. Dann zog ich um nach gegenüber an die Ost-West-Straße, die heute Willy-Brandt-Straße heißt.
Erst war ich Redakteur für afrikanische und nahöstliche Angelegenheiten, später dann Auslandsreporter vorwiegend für Unheil aller Art, ein Vertreter der Gattung »3-D-Reporter«, wie es im amerikanischen Tabloid-Jargon heißt. »3 D« steht für Death, Disaster, Destruction.
Der Job des lonesome riders war streckenweise unkommod. Krieg, Erdbeben, Hochwasser, Ebola. Aber ich war gern Frontschwein. Die Chefs ließen mich meistens in Ruhe, und ich brauchte mich beim Schreiben auch nicht dem Zwang der Spiegel-Masche zu unterwerfen.
Journalisten hängen sich gern Weltkarten mit farbigen Pinnnadeln über den Schreibtisch. Die Nadeln markieren die Orte ihres Wirkens. Ich hatte nie eine solche Karte. Wenn ich eine besessen hätte, wäre sie schön bunt gewesen. Ich habe mal überschlagen: Von 53 afrikanischen Staaten habe ich 42 besucht, viele davon mehrfach, außerdem Nordamerika kreuz und quer, auch die Arktis und die Antarktis. In Europa habe ich alle Hauptstädte erlebt, mit Ausnahme von Minsk und Vilnius. Nur in Asien und Lateinamerika hätte meine Pinnkarte ein paar große weiße Flecken gehabt.
Der Mond und der Orbit fehlen mir auch in meiner Erlebnissammlung. Ich habe 1985 versucht, die Lücke zu schließen, und bei der NASA einen Antrag auf Teilnahme an einem Trip ins All gestellt. Die Antwort der NASA-Presseabteilung war unverbindlich. Man sehe keine Möglichkeit, mir meinen Wunsch zu erfüllen, jedenfalls »for the time being«. Man werde es mich wissen lassen, wann es so weit sei. Es wurde nichts draus, obwohl ich in Abständen von zwei bis drei Jahren nachhakte. Und irgendwann war ich auch zu alt für die Raumfahrt. Ich glaube, der Spiegel hätte das Unternehmen sowieso nicht bezahlen können.
Die summarische Aufzählung der besuchten Orte sagt natürlich nichts über den Horizont des Reisenden. Deshalb soll sie hier auch nicht vertieft werden. Alte Flugkapitäne und Stewardessen sind mehr herumgekommen als ich. Trotzdem sind sie vermutlich in Geografie auch nicht besser.
Warum reist der Mensch?
Auch ohne berufliche Verpflichtung wäre ich nie der Sesshaftigkeit erlegen. Es ging mir wie Ismael in Melvilles Moby Dick. Er hat seinen Reisetrieb so erklärt: »Immer wenn ich merke, dass ich um den Mund herum grimmig werde, immer wenn in meiner Seele nasser, nieseliger November herrscht, ist es höchste Zeit für mich, sobald ich kann, auf See zu kommen.« Ich brauchte, um aufzubrechen, noch nicht mal den nassen November.
Manchmal musste ich meine Zielkoordinaten im Flug ändern. Oder im Taxi. Wie nach dem Ausbruch der Ebola-Seuche in Zaire. Ich war auf dem Weg zum Hamburger Flughafen, um nach Zürich zu fliegen und eine Geschichte über heroinabhängige Banker und Broker zu recherchieren. Unterwegs rief das Auslandssekretariat im Taxi an. Ich solle nach Brüssel und von da nach Kinshasa fliegen, um die Ebola-Szene zu covern. Das Visum für Zaire sei in Brüssel hinterlegt. Am nächsten Morgen um sechs landete ich in Kinshasa.
Natürlich lässt mit den Jahren die Lust am Vagabundieren nach. Erst war für mich das Reisen »der Mai, der alles neu macht«, wie Thomas Mann schrieb. Zum Schluss war es nur noch schöner Eskapismus. Trotzdem genieße ich die Zigeunerei noch heute.
Peter Scholl-Latour reiste im Alter von 83 Jahren noch nach Ost-Timor. Er hatte den Ehrgeiz, auf seiner Pinnkarte alle Länder der Erde zu besetzen. Ost-Timor war das einzige Land, das er noch nicht besucht hatte.
Damit kein Missverständnis entsteht, ich habe mit diesem Buch keine Memoiren geschrieben, ich habe nur meine Erinnerungen aufgeschrieben. Memoiren werden im Allgemeinen von bedeutenden Personen der Zeitgeschichte verfasst, deren Bücher sich nicht durch Lust- oder Wissensgewinn bei den Lesern legitimieren müssen. Dies Buch soll Spaß machen. Es soll auch einen Eindruck davon vermitteln, wie Europas größtes und erfolgreichstes Nachrichtenmagazin und seine Crew ticken. Wer daraus lernen will, der mag es versuchen.
Mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Es lässt die kleinen Gedanken durchfallen und hält die großen zurück. Was freilich keine Gewähr dafür ist, dass nicht auch mal etwas Kleingeistiges darin hängen bleibt.
Es war nicht allzu schwer, das Material für dieses Buch zu beschaffen. Ich hatte gute Quellen, die mir dabei halfen, meine Vergangenheit zu entblättern. Die drei besten waren mein Gedächtnis, die Spiegel-Dokumentation, in der alle meine Geschichten archiviert sind, und der Schuhkarton im Heizungskeller, in dem ich die alten Notizblöcke und Terminkalender verwahre.
Aus diesem Buch lernt man nicht, wie man ein guter Journalist wird. Denn dafür gibt es keine Regeln. Denen, die es interessiert, gebe ich hilfsweise einen Tipp: Am besten, man macht es wie Lutz Mükke aus Leipzig. Er kam im Frühjahr 2003 in mein Büro und sagte, er habe in Leipzig bei Professor Michael Haller Journalismus studiert und müsse jetzt für seinen Abschluss eine selbst recherchierte und geschriebene große Geschichte abliefern, sein Meisterstück sozusagen.
Mein Freund Christoph Maria Fröhder, Beisitzer der Interessenvereinigung Netzwerk-Recherche e.V. und grauer Terrier vom Dienst beim ARD-Fernsehen, hatte Lutz geraten, mich zu besuchen. Ich sei des Schreibens und des Zeitungmachens nicht ganz unkundig und würde ihm sicher gern mit Rat zur Seite stehen, wenn er das für nützlich hielte.
Lutz Mükke hatte sich ein verwegenes Thema ausgesucht. Er wollte darüber berichten, dass Äthiopien ein entwicklungspolitischer Trümmerhaufen sei und dort im großen Stil westliche Steuergelder verschwendet würden, weil es den flächendeckenden Hunger, von dem uns das Fernsehen und Karlheinz Böhm erzählten, in dieser Weise gar nicht gebe.
Ich war erschüttert über so viel jugendlichen Unverstand. »Ja, wo wollen Sie die Story denn verkaufen?«, habe ich ihn gefragt. »Das ist doch für den deutschen Zeitgeist ein Tritt in die Magengrube, das druckt doch keiner.« Lutz lächelte das Lächeln des Wissenden und verabschiedete sich.
Sechs Wochen lang habe ich von Lutz Mükke nichts gehört. Dann erschien in der Zeit ein sechsseitiges Dossier über Äthiopien: »Der inszenierte Hunger – von Lutz Mükke«. Eine tolle Geschichte.
Ich habe gleich in Leipzig angerufen: »Glückwunsch, Bruder«, habe ich gesagt. »Ich wollte Ihnen nur noch einen guten Rat nachreichen: Nehmen Sie die Ratschläge der alten Säcke nicht so ernst.«