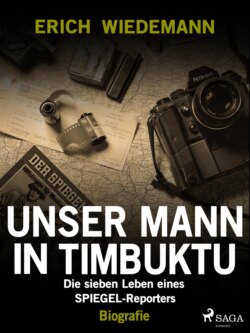Читать книгу Unser Mann in Timbuktu - Erich Wiedemann - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
»Feldmarschall Idi Amin, wie ich vermute«
Оглавление»Finden Sie Idi Amin«, sagte Spiegel-Auslandsressortleiter Dieter Wild. Er holte einen Apfel aus seinem Pfeffer-und-Salz-Jackett, biss hinein und lächelte.
Ich lächelte zurück. Wild sollte nicht merken, dass ich weiche Knie hatte. Aber natürlich merkte er es doch. Er war ein gescheiter Kerl und ließ sich nicht täuschen.
Wild erklärte, er weise mich mit großem Ernst darauf hin, dass das Unternehmen auf der Basis absoluter Freiwilligkeit zu erfolgen habe. »Wir nehmen es Ihnen nicht übel, wenn es Ihnen zu gefährlich ist.« Schon die Formulierung war ein Stich in mein Pfadfinderherz. Ich und Angst. Er konnte sich darauf verlassen, dass ich den Auftrag nicht zurückweisen würde. Außerdem hatte ich ja selbst die Idee gehabt, den gestrauchelten Revolverpotentaten Idi Amin Dada aus Uganda im Exil in Tripolis zu suchen.
Warum lässt sich ein Journalist auf solche delikaten Extratouren ein?
Ich war meiner Reputation verpflichtet. Weil ich ein paarmal in Amins Residenz auf dem Kololo-Berg in Uganda zu Gast gewesen war und auch weil ich ein Buch über ihn geschrieben hatte, das sich ganz gut verkauft hatte, war ich beim Spiegel der Amin-Experte.
BBC hatte gemeldet, Big Daddy, wie er bei seinen Fans genannt wurde, sei nach seinem Sturz mit dem größeren Teil seiner Familie von Uganda nach Libyen geflüchtet, um sich dort unter den Schutz von Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi zu begeben. Es war nicht mehr als eine Vermutung. Keiner hatte ihn gesehen. Doch der bewohnbare Teil von Libyen ist nicht besonders groß. Wenn er wirklich da war, musste man mit ein bisschen Glück seine Spur aufnehmen können. Und im Übrigen war es auch dann eine gute Geschichte, wenn ich ihn nicht fand.
Gaddafi hatte sich mit seinen Rankünen, Komplotten und Extravaganzen in der Welt nicht beliebt gemacht. Und er wurde nicht beliebter dadurch, dass er Afrikas entthrontem Blutsäufer Nummer eins Asyl gewährte. Wer Amin in Libyen aufspürte und damit die libysche Volksrepublik bloßstellte, musste damit rechnen, Gaddafis Unwillen auf sich zu ziehen. Und das nahm selten ein gutes Ende.
Den ersten Satz für die Geschichte hatte ich schon fertig: »Field marshall Idi Amin, I presume, Feldmarschall Idi Amin, wie ich vermute.« Analog zu der berühmten Floskel, mit der der schottische Journalist und Abenteurer Henry Morton Stanley 1871 dem verschollenen Missionar und Forscher David Livingstone in Ujiji am Tanganjika-See entgegengetreten war. Sie war natürlich nur passend, wenn ich ihn fand.
In dem BBC-Bericht hatte es geheißen, der Amin-Clan habe vermutlich im Hotel Schati Andalus, zwanzig Kilometer westlich von Tripolis, Quartier bezogen. Der Einfachheit checkte ich auch im Schati Andalus ein.
Weil angeblich sonst im Haus nichts frei war, bot mir der Rezeptionist an, ein Zimmer mit einem jungen Italiener namens Giancarlo zu teilen, der im Flugzeug von Rom nach Tripolis neben mir gesessen und den es merkwürdigerweise auch ins Schati Andalus verschlagen hatte. Ich nahm den Vorschlag an. Das war keine gute Idee. Doch als mir Zweifel daran kamen, dass Giancarlo wirklich ein harmloser Brunnenbauer sei, wie er mir erzählt hatte, war es zu spät.
Ich hatte die Amins schnell geortet, obwohl sie versuchten, sich unauffällig im Hotelbetrieb zu bewegen: zwei Ehefrauen und um die zwanzig Kinder. Sie bewohnten drei Apartments. Morgens um acht Uhr strömten sie zum Frühstück durch eine Hintertür ins Restaurant. Mittag- und Abendessen nahmen sie in ihren Zimmern ein. Tagsüber sah man sie nicht.
Die Geheimniskrämerei war überflüssig. Alle Gäste wussten, wer sich da im hinteren Trakt des Hotels versteckte. Die Kinder plapperten laut auf Kisuaheli miteinander. Und auf der Leine vor einem der Apartmentfenster hingen neben weißen Tennissocken und Damen- und Kinderunterwäsche auch T-Shirts mit dem Aufdruck »Uganda National Parks«.
Big Daddys Unterwäsche hing nicht auf der Leine. Ich hätte sie sofort erkannt. Mein Freund Klaus Meyer-Andersen vom stern hatte ein halbes Jahr vorher aus Amins leerstehender Villa in Kololo einen Schlüpfer als Souvenir mitgenommen. Er hing seit ein paar Monaten in einem vergoldeten Bilderrahmen über dem Sofa in Meyer-Andersens Wohnzimmer in Hamburg-Eppendorf. Es war eine Unterhose, in der man leicht einen halben Zentner Kartoffeln hätte transportieren können, wenn man die Beine zugebunden hätte. So etwas Kolossales wäre hier aufgefallen.
Das Hotelgelände war zur Landseite hin durch eine große Mauer abgeschirmt. Zur See hin war es offen. Weil sich die libysche Regierung offenbar Sorgen machte, durfte Idi Amin nur ausnahmsweise im Schati Andalus übernachten. Er wechselte häufig sein Quartier. Ich habe ihn in Tripolis jedenfalls nie gesehen.
Die Sorgen der Libyer waren nicht unbegründet. Israel hatte noch eine Rechnung mit Amin offen. Es wäre für ihn gefährlich gewesen, in einem Hotel direkt am Mittelmeerstrand zu logieren, das sich so gut für ein Kommandounternehmen eignete. Der israelische Geheimdienst Mossad hatte mehr als einmal Palästinenser direkt aus Beirut heraus gekidnappt. Er hätte sicher kein Problem damit gehabt, Amin aus Tripolis zu entführen, wenn er ihn geortet hätte.
Die Rechnung stammte vom Juli 1976. In der »Operation Thunderbolt« hatte eine israelische Kommandotruppe nachts auf dem Flughafen von Entebbe im Handstreich hundert gefangene Passagiere und Besatzungsmitglieder aus einem entführten Air-France-Flugzeug befreit. Eine der Geiseln, die 75-jährige Witwe Dora Bloch aus Tel Aviv, war – angeblich auf Amins Befehl – ermordet worden.
Weil es im Speisesaal des Schati Andalus zu dunkel zum Fotografieren war, musste ich zwei Tage lang mit meiner Leica am Fenster meines Zimmers warten, bevor ich zum Schuss kam. Morgens, kurz vor neun, fuhr ein kleiner Autobus vor dem Empfangsgebäude vor. Fünf Minuten später taperte die ganze Amin-Sippe über den Rasen und bestieg den Bus. Ich verschoss fast einen ganzen Film.
Im Shooting-Fieber war ich wohl etwas unvorsichtig gewesen. Ich sah durchs geöffnete Fenster, wie einer der Türsteher zum Telefon rannte und aufgeregt in den Hörer zu palavern begann. Grund genug für mich, einen schnellen Standortwechsel vorzunehmen. Ich hatte zwar nichts Böses geplant oder getan. Aber es war schon klar, dass mein Verhalten auf Nichteingeweihte einen konspirativen Eindruck machen musste und deshalb böse Folgen haben konnte.
So schnell hatte ich noch nie den Koffer gepackt. Ab ins Auto damit und dann nichts wie weg. Die Rechnung wollte ich später von Deutschland aus bezahlen.
Meine Hektik war unsinnig. Denn ich war längst geortet worden. Darüber bin ich mir heute im Klaren. Ich bin sicher, dass Giancarlo mich die ganze Zeit observiert hatte. Am Vortag hatte ich ihn dabei erwischt, wie er meinen Koffer durchwühlte. Er hatte gesagt, er wolle sich meine Zahnpasta ausleihen. Dabei stand die Tube Pepsodent im Zahnputzbecher auf dem Regal im Bad. Ich glaube, dass er mich von Anfang an beschattet hat.
Aber wie hatten sie von dem Unternehmen überhaupt erfahren? Außerhalb der Spiegel-Redaktion wusste niemand von der Operation.
Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass Spiegel-Interna bei radikalen Arabern gelandet waren. Im Jahr zuvor hatte uns ein Konfident von der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) gesteckt, in seinen Kreisen werde die Behauptung verbreitet, mein Kollege Wolf-Dieter Steinbauer und ich seien Mossad-Agenten. Einmal, als Steinbauer schon die Koffer für einen Trip nach Jordanien gepackt hatte, bekam er einen Tipp aus Amman: Er solle die Reise absagen, weil er nicht lebend zurückkehren würde. Ein Killerkommando solle ihn hinrichten, als Warnung für alle Feinde der palästinensischen Sache.
Es war absurd. Ausgerechnet Steinbauer. Er hatte sich immer für die Rechte der Palästinenser eingesetzt und das Engagement – zum Ärger der israelischen Botschaft in Bonn – auch in seine Nahost-Geschichten einfließen lassen. Aber er nahm den Rat an und blieb zu Hause. Das war sicher gut so.
Nach dem Rückzug aus dem Schati Andalus kroch ich erst mal in der deutschen Botschaft unter. Ich muss bei der Ankunft wohl einen ziemlich gehetzten Eindruck gemacht haben. Denn der Attaché fragte, ob er einen Arzt rufen solle. »Nein«, sagte ich, »es wird schon besser.« »Machen Sie sich mal keinen Kopf«, antwortete der Attaché. Dann ließ er von seiner Sekretärin für 18 Uhr einen Business-Platz für den Lufthansa-Flug nach Frankfurt buchen.
Ich gab zu bedenken, dass die Geheimpolizei sicher Zugriff auf die Passagierlisten der Fluglinien habe. Man solle doch lieber anonym einen Platz buchen. Doch der Attaché winkte ab: »Wir sind hier nicht im Kongo. Der Chargé d’Affaires bringt Sie zum Flughafen. Im Mercedes des Herrn Botschafter und mit Stander. Da traut sich keiner ran.«
Der Chargé d’Affaires überwachte erst das Einchecken meines Gepäcks und geleitete mich dann bis vor die Transithalle. Dann wollte er sich auf die Flughafenterrasse begeben, um mit eigenen Augen zu sehen, dass meine Maschine auch wirklich startete, und dies dann nach Bonn melden.
Die Lufthansa-Maschine hob pünktlich ab. Nur, ich war nicht drin. Eine halbe Stunde vor dem Start war ein Herr in blauem Anzug an mich herangetreten und hatte mich gefragt: »Are you Mister Erich, Sir?« In der naiven Annahme, das Schicksal sei damit noch zu wenden, erwiderte ich: »No, I am not Mister Erich. That is not my name.«
Der Mann verschwand. Zehn Minuten später war er wieder da. »But are you Mister Wiedemann?« Ich sah ihm traurig in die Augen. Aus, vorbei, inschallah. Sie brachten mich erst in ein Kabäuschen neben der Eingangshalle. Dann legten sie mir Handschellen an. Ich musste zwei Stunden warten, dann stopften sie mich in einen alten Mercedes und brachten mich in ein zweistöckiges Gebäude, nicht weit von der deutschen Botschaft.
Ich erkannte das Haus gleich wieder. Es war der Kabusch, ein Betonkäfig mit vergitterten Fenstern, in dem die Geheimpolizei ihre unerledigten Fälle verwahrte. Ein Taxifahrer hatte mir erzählt, wozu er diente, als wir zwei Tage zuvor daran vorbeifuhren.
Verhaftet zu werden ist ein brutaler Schock, fast so schlimm, wie wenn einem das Genick gebrochen wird, glaube ich. Von einer Sekunde auf die nächste ist man nicht mehr sein eigener Herr. Der Gedanke, völlig fremdbestimmt zu sein, und die Aussicht, es lange zu bleiben, legten sich mir wie Würgeeisen um den Hals. Es war ein Sturmtief der Gefühle, und ich hatte Mühe, meinen Schließmuskel unter Kontrolle zu halten. Die Seele ist ein sehr verletzliches Organ.
Sie sperrten mich wortlos ein. Das Licht blieb an. Meine Zelle war zweimal zweieinhalb Meter groß. Sie hatte einen Fußboden aus Kacheln mit Zwiebelmuster und gekalkte Wände. In der Zelle stand nachts ein eisernes Bettgestell, das morgens entfernt und abends wieder zurückgebracht wurde.
An den Wänden hatten frühere Häftlingsgenerationen ihre Spuren hinterlassen, in die Wand eingeritzte Figuren, Hieroglyphen und Piktogramme. Es waren auch Sprüche in lateinischer Schrift dabei. Der kürzeste: »Merde.«
Im Vergleich zu den anderen fünf Zellen hatte meine den Vorteil, dass man mit ein bisschen Übung erkennen konnte, ob es Tag oder Nacht war. Wenn man einen Klimmzug an der Luke über der Zellentür machte, sah man tagsüber in der entferntesten Ecke des überdachten Vorhofes einen Schimmer Tageslicht. Für die Insassen der benachbarten Zellen, die nicht in den Hof blicken konnten, war es Tag, wenn der Wärter das Licht anknipste, und Nacht, wenn er es wieder ausknipste.
Nachts meinte ich, Kindergeschrei zu hören. Dann Orgelmusik, Bach oder Buxtehude, das konnte ich nicht unterscheiden. Es waren Halluzinationen.
Am Abend nach meiner Festnahme und auch am folgenden Tag gab es nichts zu essen. Das war keine Schikane. Es wurde irgendein Jahrestag gefeiert. »Tag der Vertreibung der Italiener«, glaube ich. Deshalb war die Küche geschlossen. Es störte mich nicht, weil ich sowieso keinen Appetit hatte. Zu trinken gab es nur Wasser. Am dritten Tag wurde ein Blechteller mit zwei Marmeladenbroten durch die Klappe in der eisernen Tür geschoben. Ich mümmelte ein wenig an den Broten herum und schob sie nach einer halben Stunde durch die Klappe zurück.
Danach wurde täglich zweimal Hühnchen mit gemischtem Salat oder Fleisch mit Brot gereicht. Alles durchaus appetitlich angerichtet. Doch der Magen verweigerte die Annahme. Angst macht satt.
Nachts träumte ich, dass ich in einem libyschen Gefängnis war. Am nächsten Morgen, als ich erwachte, stellte ich fest, dass es kein Traum war. Ich fiel in Panik, stand eine Weile zitternd und würgend in der Mitte der Zelle. Bis einer der Wärter durch die Klappe in der Tür rief: »Mister, take it easy!«
Ich versuchte, mit den Wärtern ins Gespräch zu kommen. Aber sie waren wortkarg. Sie konnten auch nur ein paar englische Floskeln: »What’s your name? Where do you come from? You like football?« Und ich konnte auf Arabisch nur grüßen, zählen und ein bisschen fluchen.
Am dritten Tag fingen die Kapos an, mich zu schikanieren. Wenn ich schlafen wollte, drehten sie vor der Tür ein Transistorradio auf. Dann war es wieder eine Stunde ganz still, bis plötzlich die eiserne Klappe in der Tür aufflog. Vielleicht hatten sie den Auftrag, mich mit Psychoterror weich fürs Verhör zu klopfen.
Einmal wurde ich für anderthalb Stunden mit den Händen an das vergitterte Fenster in der Zellentür gekettet. Es war nicht schmerzhaft. Aber ich hatte noch niemals vorher einen derartigen Totalverlust meiner Autonomie erlebt. Ich hing an der Kette, die Knie gegen die Zellentür gepresst, und konnte mir nicht mal den Schweiß von der Stirn wischen. Hinterher war ich nicht mehr derselbe.
Die Jungs, die mich bewachten, waren keine Sadisten. Ich hatte den Eindruck, dass ihnen die Quälerei selbst zuwider war. Einer hauchte sogar einmal »Sorry« durch die Luke, nachdem er mich mit seinem Geschrei geweckt hatte.
Ich wurde in der ganzen Zeit nie körperlich misshandelt. Was mich verwunderte, weil Libyen auf den schwarzen Listen von Amnesty International als harter Folterstaat geführt wurde.
Am Vormittag des dritten Tages wurde ich zum Verhör gebracht. Auf dem Weg dorthin musste ich eine lederne Gesichtsmaske tragen. Ich hörte die Kakophonie des Verkehrs, einen Muezzin, ein landendes Flugzeug. Welchen Vorteil brachte es den Schergen, wenn der Gefangene nichts sehen konnte? Es nützte ihm doch nichts, wenn er wahrnahm, wo er war und wohin er gebracht wurde. Er konnte ja ohnehin nicht weglaufen.
Es war das uralte Repressionsritual, das Panik und Verunsicherung generieren sollte. Auch die gefangenen Iraker in Abu Ghraib müssen Gesichtsmasken tragen, wenn sie zum Verhör abgeholt werden. Wer nichts sehen kann, der ist dem Sehenden untertan.
Isolation, Schlafentzug, die Erniedrigung, die erzwungene Untätigkeit sind wirksame Foltermethoden. Die Zellenwand begann sich nach ein paar Tagen mit psychedelischen Bildern zu beleben. Nachts geisterten Stimmen durch den Raum. Ich versuchte, mir auszurechnen, wie lange es dauern würde, mit der Büroklammer, die ich am Flughafen geklaut hatte, die Zellentür aus den Fugen zu kratzen. Depersonalisierung nennt das der Fachmann. Wenig später war ich reif für die Inquisition. Am fünften Tag hörten die Schikanen ebenso plötzlich auf, wie sie begonnen hatten.
Es war meine zweite Knasterfahrung. Die erste hatte ich 1964 in Südafrika gemacht. Ich war in der Hauptstadt Pretoria im Haus indischer Freunde verhaftet worden. Unter Kommunismusverdacht, wie es hieß. Der »suppression of communism act« war ein Allerweltsparagraph. Er umfasste sonderbare Delikte, unter anderem auch die »Fraternisierung mit rassisch Andersartigen«. Ich hatte unter dem Dach eines »Gujarati-Kaffers« genächtigt, wie die Inder genannt wurden. Das war hier schon Rassenschande.
Bei der Durchsuchung meines Zimmers im Haus meiner Gastgeber beging ich die Dummheit, einen Zeitungsartikel, den ich für die Neue Ruhr Zeitung in Essen geschrieben hatte, aus der Schreibmaschine zu ziehen, um ihn aufzuessen. Der Kommissar, der die Veranstaltung leitete, warf sich auf mich und riss mir das Manuskript aus dem Mund, bevor ich es runterwürgen konnte.
Es stand gar nichts Gefährliches darin. Dass die Schwarzen unterdrückt und sich die Ungerechtigkeiten irgendwann rächen würden, das konnte man in vielen Artikeln in der westlichen Presse lesen. Aber der Kommissar wertete meinen Text als Beweis dafür, dass ich Südafrika kommunistisch hatte unterwandern wollen.
Die Haft und die Verhöre brachten mich seelisch auf null. Die zwei Polizisten spielten mit mir das uralte Inquisitionsspiel Good-cop-bad-cop. Manchmal stundenlang. Einmal knallte mir der Böse einen Hanfstrick auf den Tisch und schrie mich an: »Häng dich selbst auf, du baumelst sowieso.«
Der Kulturattaché der westdeutschen Botschaft, der am nächsten Tag zu Besuch kam, beruhigte mich. »So schnell hängen sie hier keinen und ein Greenhorn wie Sie schon gar nicht.« Es dauerte dann noch vier Tage, bis der Staatsanwalt begriffen hatte, dass ich tatsächlich ein harmloser Ignorant war. Am fünften Tag ordnete er meine Freilassung und sofortige Ausweisung an.
Tags drauf saß ich in einer viermotorigen Constellation von Trek Airways. Der Flug dauerte vier Tage. Erste Etappe Johannesburg – Entebbe, zweite Etappe Entebbe – Kairo, dritte Etappe Kairo – Malta, vierte Etappe Malta – Luxemburg.
Ich habe die Geschichte später in ideologischen Standortdebatten beim Spiegel gern ausgeschlachtet. Wenn mich die Kollegen wegen antikommunistischer Tendenzen in meiner Berichterstattung schalten, trumpfte ich mit meiner Knasterfahrung auf: »Ich und Antikommunist? Ich bin der einzige Spiegel-Redakteur außer Werner Detsch, der schon mal als Kommunist im Gefängnis saß.«
Werner Detsch war Leserbriefredakteur. Mitte der fünfziger Jahre war er Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen und mit Adenauers KPD-Verbot in Konflikt geraten. Ein paar Wochen saß er in U-Haft, dann wurde er, soviel ich weiß, ohne Verfahren entlassen.
Tripolis schien mir gefährlicher als Pretoria. Der Mann, der mich verhörte, wollte wissen, wer meine Auftraggeber waren. Dass mich der Spiegel geschickt hatte, glaubte er nicht. Er war nervös, wenn auch korrekt. Kein Gebrüll, kein scharfes Wort. Er drehte ständig einen Bleistift in seinen Fingern. Manchmal klopfte er damit wie mit einem Trommelstock auf die Tischplatte.
Der Mann hatte es offenbar mit den Bronchien. Er spuckte in einer Stunde ein halbes Paket Papiertaschentücher mit gelbem Schleim voll. Seine pedantische Feindseligkeit gab mir Hoffnung. Solange sie noch die Anstrengung unternahmen, mir Aussagen und Geständnisse zu entlocken, beabsichtigten sie offenbar, mir den Prozess zu machen. Und so lange würden sie mich nicht kurzerhand erschießen und im Wüstensand verscharren. Bildete ich mir ein.
Neun Monate zuvor war Imam Moussa Sadr, der Führer der libanesischen Schiiten, der wegen seiner liberalen Haltung Gaddafis Missfallen erregt hatte, in Tripolis auf dem Weg vom Flughafen in sein Hotel verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Ich fürchtete, mir könnte das gleiche Schicksal drohen. Ich hatte Idi Amin zwar persönlich nicht gesehen. Aber wo der Clan war, da konnte der Clan-Chef nicht weit sein. Und ich konnte mit meinen Fotos den Nachweis führen, dass seine Familie in Tripolis Asyl genoss. Das Regime hatte ein starkes Interesse daran, das zu verhindern.
Mein ganzes Denken war auf ein einziges Ziel gerichtet: überleben. Sollte ich mir eine Verletzung zufügen, um ins Krankenhaus zu kommen, weil da die Aussicht vermutlich größer war, Kontakt nach draußen aufnehmen zu können? Es war klar, dass ich in Deutschland vermisst wurde. Der Spiegel würde etwas unternehmen, um mich zu finden und rauszuholen. Aber das würde dauern. Ich musste Zeit gewinnen.
Der Plan zur Selbstverstümmelung scheiterte daran, dass ich an kein passendes Werkzeug kam. Sie hatten mir alles abgenommen, und die Zelle war leer. Die Spiralen in der Matratze, die man vielleicht dazu hätte gebrauchen können, waren so fest vernäht, dass ich sie mit den Fingern nicht herauspulen konnte.
Überlebenswille reduziert den Menschen, wenn es schlimm kommt, auf sein animalisches Minimum. Wenn man an der letzten Schwelle zu stehen meint, macht er alle anderen Regungen und Werte platt: Moral, Ehre, Ekel, Scham. Mir kam der Gedanke, in der Toilette Fäkalien zu fressen, um krank zu werden. In den zwei Klos neben dem Zellentrakt war die Spülung kaputt, deshalb häufte sich darin der Kot. Es war zwar nicht auszuschließen, dass sie keinen Arzt holen und mich einfach verrecken lassen würden. Aber besser kämpfend und voll fremder Scheiße untergehen, als mit einem Genickschuss in der Wüste verrecken.
Ich kann die bulgarische Krankenschwester Kristiana Valcheva verstehen, die acht Jahre lang unschuldig in einem Gefängnis in Tripolis gefangen war und nach ihrer Freilassung 2007 sagte, sie habe keine Scham mehr empfunden, sondern nur noch Angst und Schmerzen, als Polizisten sie auszogen und dann mit einem Elektrostab folterten.
Heute bin ich nicht mehr so sicher, dass mein Plan funktioniert hätte. Der menschliche Körper ist ein robustes Behältnis. Meine alte Cousine, die als Gerichtsmedizinerin in der Sache einen gewissen Durchblick hatte, sagte mir später, außer ein bisschen Kotzen hätte es vermutlich nichts gebracht.
Außerdem wäre die Ausführung schon daran gescheitert, dass beim Defäkieren des Gefangenen die Klotür offenzubleiben hatte und einer der Wärter stets auf Tuchfühlung neben mir stand. Und ehrlich gesagt, ich bin mir auch nicht sicher, dass ich meine Ekelschwelle tatsächlich überwunden hätte. Ich ekelte mich ja sogar schon davor, mir meinen Hintern ohne Papier mit den Händen zu säubern.
Das seelische Fegefeuer setzte mir hart zu. Am sechsten Tag hätte ich vermutlich gestanden, dass ich in der Absicht gekommen sei, den drei Zentner schweren Idi Amin im Koffer zu entführen.
Ich bestritt auch gar nicht, dass ich hinter Amin her gewesen war. Aber ich hatte ja nur mit ihm sprechen wollen. Auch nach libyscher Rechtslage konnte das nicht strafbar sein.
Aus der Nazi-Zeit sind Geschichten von Häftlingen überliefert, die die Ungewissheit fast umgebracht hat und die in der Nacht, nachdem ihnen das Todesurteil vorgelesen worden war, wieder gut schliefen. Sie beweisen, dass drohendes Unheil in dem Moment an Schrecken verliert, in dem es eintritt. Denn der Mensch fürchtet den Tod nicht so sehr wie die Angst vor dem Tod.
Zwei-, dreimal gaben sie mir eine Beruhigungsspritze, obwohl ich mich widersetzte, weil ich Angst hatte, dass die Injektionsnadel dreckig war. Aber sie half nicht. In aller Frühe, noch bevor der Morgen graute, wurde ich immer wach. Dann tobten mir bizarre und sentimentale Gedanken durch den Kopf. Ich musste Mutter sagen, dass ich sie gern habe, wenn ich hier raus kam. Ich hatte sie einen Tag vor meiner Abreise nach Tripolis am Telefon herablassend behandelt. Ob Marion an mich dachte? Wo war der Pfennig mit unseren eingestanzten Initialen, den wir als Souvenir vom Hamburger Dom mitgebracht hatten? Ich trug ihn normalerweise in der Brieftasche. Ich musste aufpassen, dass ich ihn zurückbekam, wenn sie mich entließen.
Bei der Registrierung am Tag der Inhaftierung hatte mir der Wachhabende des Gefängnisses ein Blatt Papier und einen Bleistiftstummel mitgegeben. Ich sollte meine Personalien und ein Geständnis daraufschreiben. Das habe ich nicht getan. Später sprach auch niemand mehr davon. Der Bleistift und das Blatt Papier wurden vergessen. In meinem ganzen Leben habe ich nie wieder so viel Besitzerglück empfunden.
Ein Din-A4-Blatt ist eine unglaublich große Fläche. Ich hatte es sechsmal gefaltet, so dass ich es im Hosenbeinumschlag verstecken konnte. Nach meiner Rechnung konnte man, so, wie ich es nutzte, darauf vorn und hinten 80 000 Buchstaben unterbringen. Das waren fast so viele wie zwei Spiegel-Titelgeschichten Anschläge haben.
Das Papier und der Bleistiftstummel waren meine wichtigsten Waffen gegen den Wahnsinn. Am ersten Tag schrieb ich auf einem schmalen Streifen oben am Kopf des Blattes die US-Bundesstaaten auf, an deren Namen ich mich erinnerte. Ganz langsam und mit vielen Pausen. Ich kam mir hinterher selbst sehr gebildet vor, weil mir 47 von 50 Staaten eingefallen waren. Mir fehlten nur Delaware, Rhode Island und New Hampshire.
Ein paar Jahre danach habe ich den Test zu Hause noch mal gemacht. Diesmal fehlten mir sechs Namen. Ich glaube, heute wären es noch mehr. Woraus zu schließen ist, dass sich die Konzentrationsfähigkeit im Gefängnis leichter entfaltet als an einem Schreibtisch in Jesteburg in der Nordheide.
Am nächsten Tag hatte ich Poesie auf dem Zettel. Ich schrieb ein langes Gedicht von Dieter Hildebrandt über den Mann im Kabarett, der erst begeistert Beifall klatscht und dann, als er sich einen angetüttelt hat, alles beschissen findet. Ich hatte es mal in einer Sendung der Lach- und Schießgesellschaft gehört, mir das Manuskript schicken lassen und es dann auswendig gelernt, weil es mir so gut gefallen hatte. Die Gedächtnisübungen hielten die grauen Zellen beieinander, und sie halfen dabei, die Gegenwart ein bisschen zu verdrängen.
Und dann Schillers »Glocke«, allerdings mit großen Lücken. Ich habe auch noch die Primzahlen aufgeschrieben, die ich kannte. Aber damit kam ich nicht weit. Ich konnte gut rechnen, hatte aber immer Probleme mit der höheren Mathematik.
Den Zettel habe ich nicht mehr vollgekriegt. Irgendwann nachmittags wurde ich freigelassen. Ich glaube, nach sechs Tagen. Für mich waren sie wie sechs Wochen gewesen. Ein Mann in dunklem Anzug trat in meine Zelle, entfaltete ein Schreiben und sagte auf Englisch: »Sie sind frei. Die libysche Regierung hat entschieden, dass Sie sofort das Land zu verlassen haben.« Keine weitere Erklärung. Meinerseits Jauchzen in der Magengrube. Sie luden mich in den Mercedes, mit dem sie mich hergebracht hatten, lieferten mich bei der deutschen Botschaft ab und ließen sich vom Portier schriftlich den Empfang bestätigen.
Weil die letzte Maschine nach Europa weg war und weil ich mich in einem Hotel nicht sicher gefühlt hätte, bot mir der deutsche Botschafter für die Nacht ein Bett in seiner Residenz an. Ich habe abends zum ersten Mal nach gut einer Woche wieder richtig gegessen. Es gab Leipziger Allerlei mit fetten Bratkartoffeln. Dazu wurde Sauerländer Bier in geeisten Gläsern gereicht. Es war herrlich. Ich habe zweimal Nachschlag genommen. Die Kalorien spielten keine Rolle, nachdem ich in knapp einer Woche vier Kilo verloren hatte.
Nach dem Dinner knipste der Botschafter das Licht aus. Dann zog er die Vorhänge zurück. Draußen vor dem Tor standen zwei Männer in dunklen Mänteln. »Die Herren vom Geheimdienst, die passen auf, dass Sie nicht geklaut werden«, sagte er. Herrje, was habe ich gelacht. Was wollten die Kerle denn noch?
Tags drauf auf dem Lufthansa-Flug nach Frankfurt zählte ich bange die ersten Minuten. Ich war erst beruhigt, als über der linken Flügelspitze die tunesische Insel Djerba auftauchte und ich sicher sein konnte, dass die Maschine den libyschen Luftraum verlassen hatte. Ich ließ mir einen Bourbon bringen, holte das Din-A-4-Blatt mit den Namen der US-Bundesstaaten und dem Gedicht von der Lach- und Schießgesellschaft raus und las. Aber ich las nicht lange, dann knüllte ich das Blatt zusammen und stopfte es in die Sitztasche vor mir. Ich hatte Angst vor der Erinnerung.
Nach der Rückkehr aus Libyen musste ich in der Chefredaktion rapportieren. Erich Böhme erzählte mir, wie sie mich rausgeholt haben. Zum Schluss sagte er beiläufig, ich möge die Personalabteilung anrufen und ihr sagen, sie solle mir die Tage, an denen ich im Knast gesessen und nicht gearbeitet hatte, vom Urlaub abziehen. Ich sah ihn ratlos an und wollte etwas Infantiles sagen. Als Böhme bemerkte, dass ich für frivole Scherze noch nicht wieder ganz empfänglich war, klopfte er mir jovial auf die Schulter und sagte nur: »Döskopp«.
Das dritte Knasterlebnis hatte ich 1987 in Bangkok. Diesmal allerdings nicht als Häftling. Für eine Gefängnisreportage war ich pro forma einer Hilfsgruppe der deutschen evangelischen Pfarrgemeinde in Bangkok beigetreten. Sie betreute deutsche Strafgefangene, die im Bang-Kwang-Gefängnis langjährige Haftstrafen wegen Drogenschmuggels verbüßten.
Um mich als mildtätiger Bruder zu legitimieren, hatte ich mir eine Staude Bananen auf die Schulter packen lassen. Die Häftlinge bekamen einmal im Monat Obst, weil sie unter Vitaminmangel litten.
Schon der Weg in die Schattenwelt von Bang Kwang war ein bedrückendes Erlebnis. Schlüsselklirren, Gebrüll, lautes Zuschlagen stählerner Türen. Das Gebrüll war überall, man konnte auch nicht sagen, woher es kam, weil man die brüllenden Wärter nicht sah. Meine Begleiterinnen von der Knasthilfe und ich folgten dem Kapo, der uns als Betreuer zugeteilt worden war, und nahmen vor einem geräumigen Käfig Platz.
Der erste deutsche Häftling, den sie uns vorführten, war ein hagerer, fast glatzköpfiger Junge mit einem von Verzweiflung ausgehöhlten Blick. Er war vielleicht neunzehn Jahre alt. An den Füßen hatte er Ketten, an denen schwere eiserne Gewichte hingen. Er hatte zwei Jahre hinter sich und noch achtzehn vor sich. Seine Haut war gelblich fahl und von Pickeln übersät. Leberschaden, tuschelte eine der barmherzigen Damen, die mich hier hereingeschmuggelt hatten. Er war eine gepeinigte, erniedrigte Kreatur fast ohne menschliches Antlitz.
Der Junge im Käfig erzählte stockend seine Geschichte. Eine Hure habe ihm ein Päckchen Heroin in den Koffer gesteckt und ihn dann bei der Polizei angeschwärzt. Er hätte von Anfang an keine Chance gehabt. Der Anwalt ließ ihn hängen, weil er nicht zahlen konnte. Das Gericht glaubte ihm kein Wort. Was er zu seiner Verteidigung vortrug, war die Standardgeschichte aller ertappten Drogenschmuggler.
Die ersten vier Monate bis zur Verurteilung hatten sie ihn im Untersuchungsgefängnis an die Zellenwand geschmiedet. Danach wurde er in eine Gemeinschaftszelle in Bang Kwang verlegt. Die Zustände waren animalisch, die Korruption der Wärter, der ständige Lärm, die unwürdige Hygiene. »Alles ist dreckig, überall Kot, überall Jauche.« Exkremente von 7500 Mann und keine Kläranlage.
Die Gefängnisverwaltung ließ die Jauche auf die Blumenfelder zwischen den Blocks schütten. Deshalb waren die freien Flächen zwischen den Gebäuden von Bang Kwang ein buntes Blumenmeer. So viel liebliche Natur neben so viel Grauen.
Ich bin davon überzeugt, dass es keine Schuld gibt, die eine irdische Instanz legitimiert, aus einem menschlichen Wesen einen Zombie zu machen. Kein Terrorist, kein Kindermörder, kein Nazi-Verbrecher hat das verdient.
Irrsinn stand in den Augen des Jungen, als wir gingen. Drogenschmuggel ist kein Kavaliersdelikt. Aber was bringt es der Gesellschaft, dem Verursacher das Leid, das er anderen zugefügt hat, mit dem gleichen Leid zu vergelten? Die Statistik widerlegt die These von der Abschreckungskraft solcher Quälereien. Sie können ja auch gar nicht abschrecken, weil die abzuschreckende Öffentlichkeit sie gar nicht wahrnimmt.
Damals habe ich verstanden, warum der Jurist und Schriftsteller Kurt Tucholsky in den zwanziger Jahren eine Revision der Ausbildungsrichtlinien für deutsche Richter und Staatsanwälte gefordert hatte. Sie müssten ihre Prüfungsarbeit hinter Gittern schreiben, damit sie wüssten, was sie in der Seele eines Menschen anrichteten, den sie ins Gefängnis schickten, schrieb er. Zu viel Entmündigung ist Mord an der Identität. Wer Zweifel hat, soll Walter Kempowski lesen: Im Block. 310 Seiten lang, man kann das Buch aufschlagen, wo man will, es ist überall gleich grauenhaft. Und Bangkok ist nicht besser als Bautzen. Ich bin, seit ich den Block gelesen habe, ein treuer Anhänger von Amnesty International.
Nach dem Jungen führten sie uns noch drei weitere deutsche Häftlinge vor. Der jüngste war Mitte zwanzig, der älteste Mitte dreißig. Sie saßen alle schon vier, fünf Jahre. Ihre Gesichter waren stumpf. Die Haft in Bang Kwang töte die Persönlichkeit langsam ab, sagte eine meiner Begleiterinnen. Wenn sie ganz erloschen sei, könne man das Leid leichter ertragen. Die drei Männer waren maulfaul, sie gaben kaum Antwort auf unsere Fragen. Sie nahmen die Liebesgaben, die wir mitgebracht hatten, und schlurften nach ein paar Minuten klirrend und wortlos davon.
Nein, so grausam wie die verurteilten Heroin-Kuriere in Bangkok war ich in dem tripolitanischen Betonloch nicht behandelt worden. Trotzdem brauchte ich zwei, drei Jahre, um das Trauma zu verarbeiten.
Ich sprach zu niemandem darüber, weil ich mir des selbst gestrickten Wahns bewusst war. Jedes Mal, bevor ich in einen Flieger stieg, musterte ich die anderen Passagiere auf verdächtige Äußerlichkeiten. Natürlich war immer einer dabei, der aussah wie ein Kidnapper. Jeder Flug war für mich eine Tortur. Verfolgungswahn in Reinkultur.
Ein paarmal buchte ich im letzten Moment auf eine andere Maschine um, weil ich mich verfolgt fühlte. Einmal ließ ich auf der Rückreise von Kamerun nach Hamburg in Paris-Orly die letzte Maschine fliegen und nahm mir einen Mietwagen. Morgens gegen vier kam ich dann völlig übernächtigt, aber entspannt in Jesteburg an.
Es gab ein paar Einsätze, die mich leicht das Leben hätten kosten können. Aber keiner hat mich dermaßen seelisch lädiert wie das Knasterlebnis in Tripolis. Ich habe gelernt, überlebende KZ-Insassen zu verstehen, die noch ein halbes Jahrhundert nach ihrem Martyrium von dem Selektionskapo an der Rampe träumten.
Ein Dreivierteljahr lang konnte ich nur fliegen, wenn ich vorher eine Valium genommen hatte. Irgendwann, nach drei, vier Jahren, wurden die Ängste schwächer. Dann sah es so aus, als sei es vorbei. Und irgendwann dann war alles plötzlich wieder da: die Panik, die ich durchlebt hatte, als sie mich in den Betonkubus stießen, das Radiogeplärr vor meiner Zellentür, die vollgeschissenen Klos, der ekelhafte Kerl mit dem vollgeseiberten Taschentuch. Es kommt vor, dass mir Tränen in die Augen schießen wegen eines Anlasses, der dreißig Jahre zurückliegt.
Der Mensch hat einen seelischen Selbstschutzmechanismus. Die Steuerungszentrale im Gehirn schirmt im Moment des Erlebens das Bewusstsein gegen den Stress ab. Aber das Trauma ist nur verkapselt. Im Alter wird das hemmende Netzwerk löchrig. Die Kapsel bricht auf. Man wird mental um Jahrzehnte zurückgeworfen. Ich frage mich, was da noch an posttraumatischem Stress auf mich zukommt. Denn Tripolis ist nicht der einzige Stress-Cluster in meinem Unterbewusstsein.
Ich bin der Spiegel-Reisestelle heute noch zu Dank verpflichtet, weil sie meine teuren Extravaganzen kommentarlos hinnahm. Wenn Wiedemann lieber sieben Stunden Auto fährt, als eine Stunde zu fliegen, wird er wohl seine Gründe haben, hat sich die Kollegin sicherlich gedacht.
In Kolumbien hätte ich Grund zur Angst vor Kidnappern gehabt. Aber da war ich furchtlos – weil ich die Gefahr nicht erkannte. Ich war den Tag über durch die Slums von Bogotá gezogen, um für eine Geschichte über Zwangsprostitution mit Nutten zu sprechen. Die Damen in den kleinen Hütten, die so aussahen wie früher die Bergmannshäuser in meiner Ruhrpottheimat, waren ziemlich wortkarg. Die Recherche war nicht besonders erfolgreich, weil ich meinen Dolmetscher verpasst hatte. Die Damen verstanden nur wenig Englisch, und ich verstand nur wenig Spanisch.
Mädchenhandel und Bordellgewerbe sind in Kolumbien in der Hand der Kartelle, die auch den Drogenhandel und das organisierte Kidnapping kontrollieren. In Bogotá wurden damals 500 Entführungen im Jahr gemeldet.
Am nächsten Tag war ich zum Antrittsbesuch in der deutschen Botschaft. Der Presseattaché sagte in nur einem Satz, wie er mich einschätzte, als ich ihm von meinen Spaziergängen in den Slums erzählte: »Sie sind ein Kamikaze oder ein Trottel.«
In Deutschland war ich vorsichtiger als in Kolumbien. Dass ich in Deutschland nie im Gefängnis war, habe ich meinem angeborenen Misstrauen zu verdanken.
Ich war in den siebziger Jahren in eine Fluchthilfe-Affäre hineingezogen worden. Ich wollte live über eine Fluchtaktion berichten. Ein gewisser Pfitzmann von der Berliner Fluchthilfefirma Freedom International hatte mir versprochen, mir Bescheid zu geben, wenn sie den nächsten Kunden im Kofferraum in den Westen schafften. Der Tipp kam, ich wartete nachts vier Stunden lang am Zonengrenzübergang in Lauenburg, aber die Flüchtlinge kamen nicht. Irgendwas hätte nicht geklappt, sagte mir Pfitzmann am Telefon. Er würde sich wieder melden. Dann hörte ich nichts mehr von ihm.
Zwei Wochen später stand in einer Berliner Zeitung, am Grenzübergang in Helmstedt seien ein professioneller Fluchthelfer von Freedom International und zwei im Auto versteckte DDR-Bürger festgenommen worden. Die Flüchtlinge hätten ausgesagt, die Firma arbeite eng mit einem Mann aus Hamburg zusammen. Es war klar, Pfitzmann hatte den Flüchtlingen vorgelogen, ich sei sein Kontaktmann im Westen. Und die Flüchtlinge hatten das natürlich im Verhör bei der Stasi weitererzählt.
Bis zur Wende hatte ich Angst, mit dem Auto durch die DDR zu fahren. Und das war gut so. Obwohl der damalige DDR-Korrespondent des Spiegel sich über meine Bangbüxigkeit lustig machte, reiste ich immer nur per Flugzeug nach Berlin. Ich wäre unweigerlich wegen Menschenhandels vor Gericht gekommen, wenn die Vopo mich gegriffen hätte. Darauf standen acht bis zehn Jahre Bautzen.
Die DDR ließ politische Häftlinge nach der Verurteilung immer erst zwei, drei Jahre schmoren. Dann wurden sie an die Bundesrepublik verkauft. Es waren halbseidene Geschäfte, die nicht mit dem Grundgesetz und mit den Richtlinien des Bundesrechungshofes in Einklang gebracht werden konnten. Aber die Regelbrüche waren die einzige Hoffnung der gequälten Kreaturen, die der Stasi in die Fänge geraten waren. Ohne die Intervention der Bonner Regierung wäre mein libysches Abenteuer wohl auch nicht so gut ausgegangen.
Das Auswärtige Amt hatte von meinem Missgeschick erfahren, weil der libysche Innenminister am Tag nach meiner Verhaftung mit Bonn telefoniert und seinen Kollegen Gerhart Baum gefragt hatte: »Habt ihr uns diesen Kerl auf den Hals geschickt, der hinter Amin herschnüffelt?« Um Gottes Willen, hatte Baum gesagt. Niemals.
Es kostete Baum einen Anruf bei der Botschaft in Tripolis, um den Gefangenen zu identifizieren. Dann rief er die Spiegel-Chefredaktion an: Ob sie das Indianerspielen nicht lassen können? Das Verhältnis zu den Arabern sei kompliziert genug.
Meine Befreiung war das Resultat einer konzertierten Aktion von Gerhart Baum und seinem libyschen Kollegen gewesen. Sie hatten sich über eine Affäre kennengelernt, die die politisch nicht ganz korrekte Ausbildung von libyschen Polizisten beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden ausgelöst hatte.
Baum hatte, wie erst viel später bekannt wurde, Gaddafi sogar heimlich in Tripolis besucht, um mit ihm über die Einstellung der libyschen Hilfe für europäische »Befreiungsbewegungen« zu verhandeln. Der Kontakt, so sagte er im April 2008 der FAZ, sei sehr eng geblieben. Die bundesdeutsche und die libysche Regierung hatten jahrzehntelang Beziehungen, von denen die westdeutsche Öffentlichkeit nichts wusste. Es sei »ein Geben und Nehmen« gewesen, sagte Gerhart Baum. Unter die Rubrik »Nehmen« fiel meine Freilassung.
Gerhart Baum hatte, wie die meisten hochrangigen Liberalen, ein gutes Verhältnis zu Rudolf Augstein. Davon habe ich profitiert. Die FDP wurde zwar vom Spiegel gelegentlich geprügelt, aber Augstein hat sie zeitlebens gehätschelt, mit finanziellen Zuwendungen und mit freundlichen Spiegel-Geschichten, die sie nicht immer verdient hatte. Zum Dank war bei größeren Festen im Spiegel-Haus immer ein prominenter Liberaler anwesend, meistens Hans-Dietrich Genscher im gelben Pullunder.
Bei Gerhart Baum habe ich mich mit einem artigen Brief für die freundliche Hilfe bedankt. Ich würde mich revanchieren, wenn sich eine Gelegenheit böte, schrieb ich. Und ich wäre im Grunde meines Herzens auch ein Liberaler. Er antwortete sinngemäß: »Gern geschehen. Wenn Sie was Gutes tun wollen und wenn Sie wirklich ein Liberaler sind, dann treten Sie in die FDP ein. Wir brauchen Mitglieder.«
Das habe ich getan. Es war der Start einer bescheidenen Kommunalpolitikerkarriere. 27 Jahre lang war ich Ratsherr im Gemeinderat von Jesteburg und zehn Jahre lang stellvertretender Vorsitzender der liberalen Kreistagsfraktion im Landkreis Harburg, einmal auch FDP-Bundestagskandidat (mit schlechtem Listenplatz und mäßigem Ergebnis) und zwei Jahre lang Vizebürgermeister von Jesteburg. Die Bürde meiner Würden wäre geringer gewesen, wenn die Heidjer Liberalen nicht so knapp an Talenten gewesen wären, dass sie einen verbiesterten Ikonoklasten wie mich immer wieder in die Arena schicken mussten.
Die Kommunalpolitik war ein gutes Kontrastprogramm zu meinem Spiegel-Job. Einmal kam ich um kurz vor sechs Uhr abends aus Afghanistan in Hamburg-Fuhlsbüttel an und saß dann um kurz nach sieben im Jesteburger Gemeinderat, um über Bebauungspläne und die Anschaffung eines Rasenkantenmähers für den Bauhof zu beraten.
Die FDP hat mir nicht viel zu verdanken und ich ihr auch nicht. Mein Vorbild war FDP-Mitglied Rudolf Augstein. Er war im Gegensatz zu mir immerhin in den Bundestag gewählt worden. Nur dass er die Epauletten schon ein paar Wochen danach wieder abgab, weil er begriffen hatte, dass man nicht mit einem Bein im Lager der dritten und mit dem anderen im Lager der vierten Gewalt stehen kann.
Die Jesteburger Kommunalpolitik barg für mich keine Interessenkonflikte, weil die kleine Welt der Nordheide keine Berührungspunkte zu meiner beruflichen Welt hatte. Im Jesteburger Gemeinderat habe ich mich zu morganatischen Allianzen hinreißen lassen. Von gelegentlichen Ausnahmen abgesehen, waren stets die Roten und die Grünen meine Verbündeten im Kampf gegen die schwarzen Grundstückschacherer. Solche Bündnisse wären mir im Spiegel nicht zugestoßen – wenn es da Schwarze gegeben hätte.
Idi Amin, dem ich in Tripolis nachgestiegen war, bin ich nie wieder begegnet. Ende 1989 habe ich ein paar Minuten lang mit ihm telefoniert. Er wohnte im Sands Hotel in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda. Drei Monate zuvor war er aus seinem Asyl ausgebrochen und nach Kinshasa geflogen, um seinen alten Freund Mobutu Sese Seko, den Diktator von Zaire, dazu zu bewegen, ihm Geld und Waffen für die Rückeroberung Ugandas zu geben. Aber Mobutu wollte von dem Abenteuer nichts wissen und schickte Amin mit seinem Privatjet zurück nach Saudi-Arabien.
Ich hatte Amins Telefonnummer damals von einem britischen Kollegen bekommen, der ihn nach seinem Ausflug nach Zaire interviewt hatte. Big Daddy war unwirsch. »Ich gebe keine Interviews mehr.«
Ich sagte, dass ich Träger der ugandischen »Medal for distinguished Service to the State« sei. Das war ein Orden dritter Klasse, den mir Amins Informationsminister, Juma Oris, anlässlich eines Hintergrundgesprächs in Kampala mal als Souvenir ans Revers geheftet hatte. Er trug auf der Vorderseite Big Daddys Porträt.
Das schien Amin zu gefallen. Er wurde zutraulich. »Wissen Sie, dass selbst solche historischen Männer wie ich manchmal große Probleme haben?«
»Welche Probleme haben Sie, Sir?«
»Die Saudis wollen nicht, dass ich Kontakt zu Journalisten habe. Sie haben gedroht, dass sie mich rausschmeißen, wenn ich noch mal ein Interview gebe.«
Ich sagte ihm, ich sei der »Kiigermani«, der Deutsche, der ein Buch über ihn geschrieben hatte.
»Ja, ich habe es mir damals aus Nairobi kommen lassen. Aber es war auf Deutsch geschrieben. Ihr Botschafter hat mir gesagt, es sei noch viel größerer Bullshit als das Buch von David Martin.«
Amin-Biograf David Martin war damals Afrika-Korrespondent des Londoner Observer und der Lieblingsfeind Amins. Im Makindye-Gefängnis in Kampala sei für ihn immer eine Zelle reserviert, hatte Big Daddy gedroht. Aber er hatte ihn nie gekriegt.
Ich sagte: »O nein, Sir, es war ein sehr objektives Buch. Der Titel müsste Ihnen gefallen haben. Es hieß: Idi Amin, ein Held von Afrika.« Das Fragezeichen hinter dem Buchtitel habe ich unterschlagen.
Amin wollte sich nicht dazu äußern. Er hängte einfach ein. Ich rief in den Wochen danach noch ein paarmal im Sands an, wurde aber nicht mehr durchgestellt.
Idi Amin ging es blendend in Dschiddah. Er bewohnte wechselweise eine kleine, weiße Villa am Meer und eine Suite im Sands. Die Saudis zahlten ihm eine ordentliche Apanage, er hatte immer einen Amischlitten neuester Bauart in der Garage und konnte sich ziemlich frei bewegen. Das sei der Dank dafür, dass er sich als Staatschef in Uganda für die Ausbreitung des Islam eingesetzt habe, sagte mir ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Riad.
Ich weiß, mit welchen Mitteln der Kreuzzug geführt worden war: Amin hatte für jeden Ugander, der zum Islam konvertierte, auf Kosten der saudischen Botschaft in Kampala eine halbe Kiste Bier spendiert. Es war ein Riesenerfolg. Nur, als das Bier alle war, kehrten die Bekehrten fast alle zum Christentum und zum Animismus zurück.
Amins Exilidylle wurde nie durch eine rächende oder strafverfolgende Instanz gestört. Er hatte politische Gegner lebend an Krokodile verfüttert und das Blut politischer Gegner gesoffen. Er hatte mindestens 100 000 Menschenleben auf dem Gewissen. Der serbische Popanz Slobodan Milošević war im Vergleich zu ihm beinahe ein Philanthrop. Die Amerikaner hätten Amin haben können, wenn sie seine Auslieferung von den Saudis gefordert hätten. Sie haben es aber nie versucht. Sein Fall zeigt, wie relativ Gerechtigkeit auf Erden ist.
Mein erstes Treffen hatte ich mit dem »Bezwinger des Britischen Empire«, wie Amin sich gern nannte, während einer Gipfelkonferenz der Organisation Afrikanischer Einheit (OAU) im Hilton in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Das Hotel war für die Zeit der Gipfelkonferenz fürs Publikum gesperrt. Weil ich den Manager gut kannte, hatte ich trotzdem ein Zimmer bekommen.
Im Hilton hatte ich ständig relativ leichten Zugang zu den dreißig Staatschefs, die zur Gipfelkonferenz erschienen waren. Man brauchte sich nur zu ihnen an den Frühstückstisch zu setzen oder sich abends an die Theke zu stellen und ein Gespräch anzufangen. Die meisten waren immer zu einem Schnack bereit. Sie fragten auch nicht, was denn der »Muzungu«, der Weiße, unter all den schwarzen Nobilitäten tat. Deshalb war ich eine Woche lang der mutmaßlich bestinformierte Journalist von Afrika. Mit zwei, drei Frankophonen habe ich auch Brüderschaft getrunken.
Am Nachmittag, nachdem er in einer launigen Plenarrede das Präsidentenpublikum zu Lachstürmen hingerissen hatte, traf ich Idi Amin in der Pool-Bar. Er trug eine frivole Dreiecksbadehose von der Sorte, wie sie in deutschen Badeanstalten in den fünfziger Jahren aus Sittlichkeitsgründen verboten gewesen war. »Eh«, rief er, »komm her, wir machen ein Match.« Er wollte mit mir Wettschwimmen.
»Sorry, Sir«, sagte ich, »aber ich kann nicht schwimmen.« Das war nur ein bisschen gelogen. Ich schaffte zwei, drei Längs-Takes im Freistil durchs Becken, und dann war Schluss. Amin dagegen war ein gefürchteter Butterfly-Virtuose. Er hatte einen ganzen Schrank voll Pokale, die er bei Wettschwimmen als Soldat der Queen’s African Rifles in Kenia und später als Stabsoffizier in Uganda gewonnen hatte. Die Blamage, haushoch gegen ihn zu verlieren, wollte ich mir nicht antun.
Amin schäumte vor Verachtung. »Du traust dich nicht, du Schlappschwanz, weil du weißt, dass du gegen einen Meisterschwimmer wie den starken Idi Amin Dada keine Chance hast.« Leider hatte er Recht. Er wandte sich zu einem schwedischen Kollegen, der wohl auch gute Beziehungen zum Hotelmanagement hatte und deshalb hier wohnen durfte: »Dann komm du ins Wasser!«
Der Kollege parierte – und wurde von Amin prompt nach Strich und Faden abgewatscht. Ein Dutzend afrikanischer Staatspräsidenten hat herzhaft gelacht und geklatscht.
Es war mein viertes und letztes Jahr als Korrespondent in Nairobi. Ich flog alle zwei, drei Monate rüber nach Uganda. Manchmal aus dienstlichen, manchmal aus privaten Gründen. Wobei beide Anlässe zuweilen ineinanderflossen.
Der private Anlass hieß Dana. Ich hatte sie im Speke Hotel in Kampala kennengelernt. Wir hatten einen schönen Abend unter einem zauberhaften Äquatormond gehabt. Ein Bier, zwei Bier, drei Bier, nach dem fünften Bier waren wir sicher, dass es Liebe war.
Dana war eine hochgewachsene Tutsi, Angehörige des Staatsvolkes im benachbarten Ruanda, das etliche Jahre später Opfer eines grausamen Massakers werden sollte. Sie war eine schöne Frau mit Witz, Esprit und einer Haut wie schwarzer Alabaster. Ich nannte sie »Danchen« und sie mich »my little klabauterman«, weil ich nach Tutsi-Maßstäben eher zu den kleinen Kerlen zählte. Keine Ahnung, woher sie das Wort »Klabautermann« kannte, aus ihrem Mund klang es erotisch.
Am nächsten Vormittag beim Auschecken beugte sich der fette Rezeptionist weit über die Theke und stellte hämische Fragen. Ich sagte, er solle sich da raushalten, weil ich meinte, dass ihn meine Privatgeschichten einen Haufen feuchten Elefantenmist angingen. »Wie Sie wünschen«, sagte er, »aber der Chef könnte sich auch dafür interessieren, und den geht es bestimmt was an.«
Mit dem Chef meinte der Rezeptionist Big Daddy Amin. Was ich nicht gewusst hatte: Dana war die Sekretärin und angeblich eine ehemalige Konkubine von Feldmarschall Dr. Idi Amin, wie sie ihn hier nennen mussten. Amin war ein stadtbekannter Wüstling. Er hatte vier Frauen und eine Schar von ständig wechselnden Gespielinnen. Es hieß, er greife sich jede Frau, die nicht schnell genug auf die Palme kam. Dana war angeblich eine davon gewesen. Einer Frau, der sich Big Daddy balzend näherte, blieb keine Wahl, als sich ihm zu ergeben.
Ich sah ein, dass es besser war, die Beziehung zu Dana zu beenden, und gelobte mir selbst, schnell Schluss mit ihr zu machen. Zur Sicherheit für uns beide. Aber ich habe das Versprechen mehrfach gebrochen. Obwohl ich wusste, dass Amin nachtragend und besitzergreifend war, behalf ich mir mit der selbstbetrügerischen Ausrede, dass Danas Affäre mit ihm vorbei sei und er deshalb keinen Grund habe, auf mich eifersüchtig zu sein.
Idi Amin tickte nicht so. Wer seinen Mannesstolz verletzte, auch durch eine Beziehung mit einer Ehemaligen, der musste sich in Sicherheit bringen. Und die Ehemalige auch. Die Leiche von Kay Adroa, einer seiner vier Ehefrauen, die er einer Beziehung mit einem Minister verdächtigte, war im August 1974 tot im Auto ihres Frauenarztes gefunden worden. Der entstellte Thorax war in Plastikfolie eingeschlagen, die abgehackten Arme und Beine lagen lose in einem Karton. Kay Adroa hatte angeblich die anderen drei Frauen dazu aufhetzen wollen, in einen Lysistrata-Streik gegen ihren Gebieter zu treten.
Amin ordnete eine Obduktion an – und verkündete schon vorher das Ergebnis: Der Frauenarzt habe eine verbotene Abtreibung vorgenommen. Dabei sei ihm ein fataler Kunstfehler unterlaufen. Er sagte aber nicht, warum seiner Ansicht nach die Leiche in fünf Teile zerhackt worden war.
Der Rachsucht Amins fiel auch Oberstleutnant Michael Ondoga zum Opfer, ursprünglich einer seiner engsten Berater. Er war so tollkühn gewesen, mit Prinzessin Elizabeth Bagaaya anzubändeln, der Tochter des Königs von Toro in Süduganda, auf die auch der Staatschef ein Auge geworfen hatte. Nachdem unbekannte Männer Ondoga drei Tage zuvor aus seiner Wohnung entführt hatten, wurde seine Leiche angenagt von Krokodilen bei Jinja am Ufer des Viktoriasees gefunden.
Die schöne Königstochter wurde von dem labilen Ego des mörderischen Clowns Ende 1974 in eine tiefe Krise gestürzt. Offensichtlich um ihre Gunst zu erringen, hatte Amin sie Anfang des Jahres zur Außenministerin ernannt. Sie machte eine gute Figur auf dem internationalen Parkett. Neben Amin wirkte sie wie eine Gazelle neben einem Elefantenbullen.
Amin muss ihre Distanz wohl bemerkt haben. Ihre pompösen Auftritte, die ständige Schäkerei mit den weißen Kerlen, die ihr die Hand küssten, machten ihn eifersüchtig. Ende 1974 ließ er sie von einer Dienstreise aus Europa zurückkommen, nachdem die Kundschafter, die ihr ständig auf den Fersen waren, ihm eine »schwere Verfehlung« gemeldet hatten, wie er sagte. Noch bevor sie in Entebbe gelandet war, verkündete er ihre Absetzung.
In einer Kabinettssitzung machte Amin seine Vorwürfe öffentlich. Die Prinzessin sei auf einer Toilette des Pariser Flughafens Orly von seinen Agenten in flagranti dabei ertappt worden, wie sie sich einem »unbekannten Europäer« hingegeben habe. Einen Europäer als Lover, das fand er fast noch kompromittierender als den Vorgang an sich. Die Quelle seiner Informationen nannte er nicht. Natürlich war alles frei erfunden.
Die Pariser Flughafengesellschaft konterte die Vorwürfe mit einer minuziösen und hämischen Darstellung des Aufenthalts der Prinzessin in Orly. Erstens seien die Toiletten wegen ihrer räumlichen Abmessungen nicht für Begattungsakte geeignet. Zweitens habe die Zeit gar nicht gereicht, weil die Maschine der Uganda Airlines bereits knapp eine Stunde nach der Landung wieder gestartet sei. Und drittens sei die Dame in der ganzen Zeit von einem Schwarm Diplomaten und Journalisten umgeben gewesen.
Trotzdem wurde Prinzessin Bagaaya gleich nach ihrer Rückkehr unter Hausarrest gestellt. Vor den Kameras von Uganda TV musste sie live ihren Turban abnehmen und den Zuschauern zeigen, dass ihr von Amin keineswegs der Schädel geschoren worden war, wie die westliche Presse behauptete.
Bundesaußenminister Walter Scheel hat damals gegenüber seinen europäischen Amtskollegen die Möglichkeit erörtert, der Prinzessin mit einer gemeinsamen Demarche zur Hilfe zu kommen. Nach gründlicher Überlegung entschied er dann: »Wir lassen es besser, sonst kommen wir noch in falschen Verdacht.«
Drei Tage nach Bagaayas Absetzung flog ich nach Uganda, um die Prinzessin zu der angeblichen Sex-Affäre zu befragen. Ich kam nur bis in den Hausflur, dann schmiss mich der Butler raus. Einmal telefonierte ich noch mit ihr. Sie sagte, sie habe augenblicklich keine Zeit und würde mich zurückrufen, sobald sie ihre Angelegenheiten geregelt habe. Ein paar Tage später gelang ihr die Flucht nach Nairobi. Sie hat aber nicht angerufen.
Im Jahr darauf hatte ich noch einmal Kontakt zu Prinzessin Bagaaya. Sie hatte ihren Hamburger Anwalt beauftragt, die Berichterstattung über ihre Absetzung schadensersatzmäßig aufzuarbeiten. Mehrere große deutsche Blätter mussten blechen. Ich hing wegen meines Amin-Buches mit drin. Es war eine unerfreuliche und kostspielige Affäre. Ein nicht unbeträchtlicher Teil des Buchhonorars ging dafür drauf.
Die Auslandsausgaben meines Amin-Buches waren gut fürs Ego, aber sonst waren sie für beinahe gar nichts gut. Mein französischer Verlag, die Editions Charles Denue aus Savoi, hatten mich für eine Fernsehsendung von Nairobi nach Paris einfliegen lassen. Ich war stolz, als ich beim Buchladen in der Halle des Flughafens Orly eine Art Schubkarre stehen sah, die der Buchhändler mit meinen Büchern vollgeladen hatte.
Gleich am zweiten Abend trat ich in einer Talkshow im Fernsehen auf. Es war kein guter Auftritt. Mein schlechtes Französisch brachte Charles Denue zur Verzweiflung. Trotzdem ging die Buchauflage ab wie eine Rakete. Es brachte mir aber nichts, weil Denues Verlag vier Wochen vor der Abrechnung pleite ging. Die koreanische Ausgabe brachte auch nichts, weil Südkorea das internationale Copyright-Abkommen nicht ratifiziert hatte und deshalb nicht zahlen musste. Außer der deutschen verkaufte sich nur die dänische Ausgabe gut. Aber weil die Dänen ein kleines Volk sind, bringen Bestseller in Dänemark nicht viel ein. Immerhin war unter der Fanpost, die mich erreichte, auch ein Brief aus dem dänischsprachigen Grönland, was mich mit dem mageren Saldo ein wenig versöhnte.
Ein Vierteljahr nach dem Wirbel um Prinzessin Bagaaya war ich zusammen mit Kollege Siegfried Kogelfranz aus Hamburg wieder in Kampala, um mit Amin ein Spiegel-Gespräch zu führen. Als wir beim State House anklingelten, war nur Informationsminister Juma Oris da. Er sagte, der Chef sei im benachbarten Ausland unterwegs. Wir sollten in drei Tagen wiederkommen.
Wir verbrachten die Nacht im Kampala International, dem ersten Haus am Platze. Früher hatte es den Namen Apollo getragen. Es war nach dem ersten ugandischen Staatspräsidenten, Milton Apollo Obote, benannt worden, den Amin aus dem Amt gejagt hatte.
Nach dem Dinner gingen wir noch was trinken. Die Bar war rappelvoll mit lärmenden Soldaten und »Parrot Girls«, Papagei-Mädchen, wie in Uganda die Prostituierten genannt werden. Mir war es zu laut. Außerdem bekam ich Kastrationsängste, wenn ich sah, wie eine korpulente Dame im Babydoll mit ihren mächtigen Hauern den Kronkorken von der Flasche biss und ihn auf den Boden spuckte.
Am Montagfrüh um neun Uhr sollten wir uns bei Minister Juma Oris im State House melden. Er wollte uns dann einen Interview-Termin geben. Kurz nach acht holte ich mir am Kiosk neben der Rezeption eine Zeitung. Was ich las, traf mich wie ein Schlag mit der Wichsbürste.
Auf der ersten Seite stand eine Geschichte über zwei namentlich nicht genannte deutsche Spione aus Hamburg und Nairobi, die es auf die innere Sicherheit von Uganda abgesehen hätten. Sie seien als Journalisten eingereist, aber der State Security Service habe sie rechtzeitig als Saboteure entlarven können, um Schaden von Uganda abzuwenden. Man werde sie fassen und der Gerechtigkeit überantworten. Die deutsche Botschaft sei über das Treiben der zwei Konspirateure ebenfalls empört.
In Kampala gab es außer uns nicht mehr viele Ausländer. Im International jedenfalls waren Kogelfranz und ich die einzigen Weißen. Es war ganz klar, dass nur wir gemeint sein konnten. Eine halbe Stunde später jagten wir in unserem Mietwagen Richtung Jinja und von dort weiter nach Kenia.
Unsere Vorsicht war von Erfahrung unterfüttert. Der britische Universitätsdozent Denis Hills, der letzte Weiße, den die Amin-Administration als Staatsfeind vorgeführt hatte, war dem Galgen nur deshalb entgangen, weil Amin gerade keine Affäre gebrauchen konnte. Er wollte auf der bevorstehenden Gipfelkonferenz der Staatschefs zum »Präsidenten von Afrika« gewählt werden, wie er es nannte. Nach der Nominierung hätte er Hills hängen lassen können, doch dann bemühte sich der britische Premierminister James Callaghan persönlich nach Uganda, um sein Leben zu retten.
Der dicke Depp hatte ein Gedächtnis wie ein Elefant. Er pflegte eine ganz spezielle Wut gegen die Briten, weil die Erinnerung an die Demütigungen nie erloschen war, die er als Soldat der Queen’s African Rifles hatte erdulden müssen.
Ich hatte mich bis dahin in Uganda immer sicher gefühlt. Gegen die Deutschen hatte Amin grundsätzlich nichts einzuwenden. Nach einem Besuch in der Bundesrepublik hatte er sich zwar verstört darüber gezeigt, dass sie einem so großen Sohn wie Adolf Hitler keine Denkmäler errichtet hatten. Aber er verehrte sie trotzdem. Vor allem wegen ihrer großartigen militärischen Leistungen im Zweiten Weltkrieg, wie er sagte.
Amins primitive Germanophilie war für Deutsche schwer zu ertragen. Ein deutscher Grenzschützer war dabei gewesen, als Amin auf einer Party im Kreise von Lakaien bemerkte: »The Germans are very efficient. They have burnt a hundred thousand Jews on the soil of Germany.«
Botschafter Richard Ellerkman und mich verband ein in zweieinhalb Jahre gewachsenes Verhältnis, das man in Diplomatenkreisen als sachlich bezeichnet. Er war zur Gratulationscour bei Amin angetreten, als der sich selbst die Feldmarschallsepauletten auf die Schultern applizierte.
In einem nicht unwichtigen Punkt hatte Ellerkmann mit seiner Diplomatie gegenüber Idi Amin Recht: Die Greuelstatistiken, die in den westlichen Zeitungen verbreitet wurden, waren übertrieben. In Uganda wurde nicht eine halbe Million Angehörige von Minderheiten mit Hackmessern massakriert wie in Ruanda. Aber die bestialische Routine, mit der Menschen wie Ungeziefer getilgt wurden, hat Amin einen sicheren Platz im Gesamtklassement der afrikanischen Massenmörder gesichert.
Gut möglich, dass der nach Ellerkmanns Ansicht verbogene Geschmack von Siegfried Kogelfranz seinen Teil zu unserem schlechten Standing beigetragen hat. Am Tag nach unserer Einreise hatten wir der Botschaft einen Höflichkeitsbesuch abgestattet. Dabei trug Kogel seine schrillen Stiefeletten, die auch meiner Geschmacksempfindung nach eine Beleidigung für das männliche Geschlecht waren: gesteppte durchfallgelbe Treter mit pinkfarbenen Druckknöpfen. Ellerkmanns angewiderter Blick zeigte deutlich, dass er die hässlichen Klotschen eines Spiegel-Redakteurs für unwürdig hielt. Und so wurden wir auch behandelt. Es gab nicht mal einen Kaffee.
Auf der rund tausend Kilometer langen Fahrt nach Nairobi wurden Kogel und ich nicht behelligt. Vielleicht waren wir überängstlich gewesen. Aber ich hatte gerade eben die Dokumentation des Volksschullehrers gelesen, der im Makindye-Gefängnis in Kampala inhaftiert gewesen war. Allein das Wort »Makindye« löste Urängste in mir aus. Ich war mal besuchsweise eine Stunde drin gewesen. Es war schon in der Vor-Amin-Zeit ein Alptraum.
In dem Bericht des Lehrers hieß es: »Wir hatten Hunger, wir waren alle sehr erregt, und wir haben uns so geschämt. Aber da waren die Gewehre. Da mussten wir es tun. Einer der Soldaten kam und sagte, das Essen sei schon aufgetragen.« Und dann haben sie es getan. Sie haben einen ermordeten Mitgefangenen aufgefressen.
Der Lehrer hat auch berichtet, wie er und einige seiner Kameraden gezwungen worden waren, 27 halbverhungerten und von schweren Folterungen gezeichneten Gefangenen mit Schmiedehämmern die Schädel einzuschlagen. Er sagte unter Tränen: »Ich selbst habe drei umgebracht und ich schäme mich deswegen.« Der Befehl für die Hammermetzelei sei direkt vom Präsidenten gekommen.
Ich habe mich gefragt, warum das Problem Amin nicht einfach von einem Mietkiller gelöst wurde. Moralische Bedenken können der Liquidierung eines solchen Ungeheuers doch nicht entgegengestanden haben. Politischer Mord ist auch nach den Maßstäben der westlichen Wertegemeinschaft unter Umständen dispensfähig. Warum hat die CIA nicht eine von ihren fabelhaften Killerpillen oder ihre präparierte Hühnersuppe eingesetzt, mit denen ihre Agenten Fidel Castro so zugesetzt hatten. Es kann nur daran gelegen haben, dass CIA-Agenten nur dann gewalttätig wurden, wenn es ihnen politisch opportun erschien, aber nicht, wenn das Gesetz der Menschlichkeit es erfordert hätte.
Keine Frage, dass der Mörder Amins das gleiche Recht für sich hätte in Anspruch nehmen können wie Stauffenberg. Und Idi Amin umzubringen, das wäre kein so schwieriger Job gewesen. Er bewegte sich vollkommen ungezwungen und kaum geschützt in der Öffentlichkeit. Ich war ihm mehrfach so nah, dass ich es auch hätte tun können, zwei-, dreimal sogar ziemlich risikolos. Und ich müsste erst über die Antwort nachdenken, wenn mich jemand fragen würde, warum ich es nicht getan habe.
Ich habe auch das bessere Uganda kennengelernt – in Gestalt des späteren Staatspräsidenten Yoweri Museveni. Und zwar im D-Zug zwischen Osnabrück und Hamburg-Hauptbahnhof. Museveni war als Gast der Konrad-Adenauer-Stiftung in Deutschland zu Besuch. Er war damals für Uneingeweihte ein Nobody. Ich musste heftig in die Saiten greifen, um Spiegel-Auslandschef Dieter Wild ein Museveni-Interview zu verkaufen.
Museveni hatte auch einen Termin beim Afrika-Verein in Hamburg. Weil er schon am nächsten Tag nach Berlin weiterfahren sollte, musste ich ihm per Bahn entgegenfahren, um ihn zu sprechen. Das Gespräch war fruchtbar, weniger für den Spiegel als für mein persönliches Afrikabild. Museveni war einer der gescheitesten Afrikaner, die ich in vielen Jahren getroffen hatte. Irgendwo auf der Höhe von Rotenburg an der Wümme ergriff er meine Hand und sagte: »Schreiben Sie was Gutes über mich und mein Volk. Vielleicht hilft es mir dabei, Präsident von Uganda zu werden. Das ugandische Volk wird es Ihnen danken.«
Zwei Jahre danach war er tatsächlich Präsident. Doch Uganda brauchte noch etliche Jahre, um sich von den Folgen der Diktatur zu erholen. So, wie sich Museveni dann politisch entwickelte, hätte das Volk von Uganda auch immer weniger Anlass gehabt, mir dankbar zu sein, wenn ich denn wirklich Einfluss auf die Entwicklung gehabt hätte.