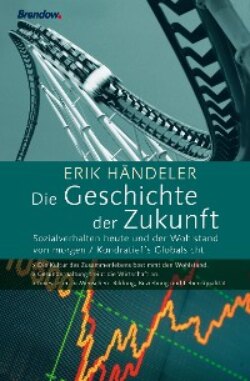Читать книгу Die Geschichte der Zukunft - Erik Händeler - Страница 9
Die Zukunft beginnt in der Vergangenheit
ОглавлениеWas die Geschichte über ähnliche Situationen wie heute erzählt
1. Kondratieffaufschwung
Wachstumsgrenzen überwinden
Eine Gesellschaft kommt an ihre Grenzen. Wenn es eng genug wird, setzt sie alle Ressourcen dafür ein, diese Grenzen zu sprengen. Deswegen lassen sich in den Engpässen von heute die Märkte und Strukturen der Zukunft erkennen. In der Vergangenheit ist es so gewesen: Nicht die Dampfmaschine löst den ersten Kondratieff aus, sondern das, was knapp wird – der Engpass an mechanischer Energie. Die englischen Unternehmer kommen nicht mehr hinterher, ihre Bergwerke zu entwässern oder Webstühle mit Wasser- oder Tierkraft anzutreiben. Die Nachfrage der Flotte, die sich fast ein Monopol im Welthandel erkämpft hat, die Nachfrage der Armee und des Exportes sind weit größer, als die Wirtschaft Waren produzieren kann.
Bergwerke unter Wasser
Es ist daher kein Zufall, dass die englischen Unternehmer James Watt beknien, doch bitte eine Maschine zu bauen, die Hitze in Dampf und Dampf in mechanische Bewegungskraft umsetzt. John Roebuck‘s Eisenhüttenwerk bekommt zuwenig Kohle, weil die Grube wegen des Grundwassers nicht genug liefern kann – Watts Maschine soll es herauspumpen und das Bergwerk produktiver machen. Für Matthew Boultons Metallbetrieb reicht die Wasserkraft nicht aus, um einen Blasebalg anzutreiben, der Luft in den Hochofen bläst, um höhere Schmelztemperaturen zu erreichen – Boulton sucht einen besseren Antrieb. Jahrelang tüftelt James Watt herum, bis er 1769 sein erstes Patent anmeldet. Zwischen den ersten Plänen, den Rückschlägen und der praktischen Anwendung vergehen zwölf Jahre.1
»Entdeckungen und Erfindungen finden in einer Richtung und in einer Intensität statt, die den Anforderungen der praktischen Wirklichkeit entsprechen«2, schreibt der russische Ökonom Nikolai Kondratieff in seinem ersten Aufsatz über lange Wellen. Zahlreiche Erfindungen seien deshalb an verschiedenen Orten gleichzeitig und unabhängig voneinander gemacht worden. Es reicht dann aber nicht, dass sie technisch machbar sind. Eine Basisinnovation bringt die Wirtschaft erst dann in Schwung, wenn sie wirtschaftlich geworden ist, weil die gesellschaftlichen Voraussetzungen stimmen wie in England Ende des 18. Jahrhunderts: Weil Schafsweiden lukrativer sind, vertreiben Gutsherren die Landbevölkerung von ihrem Ackerland – die sucht nun in den Städten Arbeit; Banken haben genug Geld, um die Dampfmaschinen der Unternehmer zu finanzieren, schließlich haben die gekaperten spanischen, dann französischen Schiffe, der Sklavenhandel und anderer Profit aus dem Welthandel inzwischen viel Kapital angehäuft. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts haben hohe Investitionen in Binnenkanäle den Transportaufwand pro Tonne Kohle schon etwa halbiert, zwischen Liverpool und Manchester oder Birmingham sogar um 80 Prozent verbilligt3. Binnenzölle wie in Deutschland und Frankreich sind längst abgeschafft. Während die deutschen Adeligen noch vom Rittertum träumen und auf die gewerbetreibenden »Pfeffersäcke« hinunterschauen, werden aus Britischen Lords Geschäftsleute.
Noch 1750, bevor die Industrialisierung beginnt, ist Großbritannien irgendein Felsbrocken in der Nordsee gewesen, der etwa 1,9 Prozent der Weltindustrieproduktion herstellt – das passt im Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Am Ende des ersten Kondratieffs um 1830 produziert es aber fast zehn Prozent der weltweiten Gütermenge.4 Das liegt nicht daran, dass die Löhne in England niedriger wären oder die Bank of England die Zinsen gesenkt hat oder aber der Staat so viel Geld ausgibt; auch treiben nicht etwa alle Branchen in gleicher Weise die Wirtschaft. Sondern es sind vor allem zwei Branchen, die ihre Produkte weit besser herstellen und billiger verkaufen können und Großbritannien damit wettbewerbsfähiger machen als jedes andere Land: Während die Wirtschaft im Boom nach 1790 mit etwa 2,5 Prozent im Jahr wächst – vor allem als Zulieferer für das neue technologische System und für den Konsum der zusätzlich beschäftigten Arbeiter –, wachsen die Eisen- und die Textilindustrien mit durchschnittlich 7 Prozent. Das hat nichts mit Geld zu tun, dafür aber eine ganze Menge mit Technik und den realen Vorgängen in der Fabrikhalle.
Schon vor der Dampfmaschine treibt Wasserkraft in großem Umfang die ersten Spinnmaschinen und mechanischen Webstühle an, die ständig verbessert werden. Das erhöht die Produktivität um ein Vielfaches, reicht aber nicht. Die Nachfrage wächst schneller, als die Wirtschaft mehr produzieren kann. Es dauert bis 1785, bis die ersten Dampfmaschinen Spinnräder zum Rotieren bringen. Ein historischer Quantensprung auf ein neues Wohlstandsniveau: In den 1820ern produziert ein Textilarbeiter, der mehrere Webmaschinen bedient, 20-mal so viel wie der Heimarbeiter, hat die dampfgetriebene Spinnmaschine die 200-fache Kapazität eines Spinnrades5. Auf einen längeren Zeitraum betrachtet – zwischen 1750 und 1830 – vervielfacht sich die Produktivität allein in dieser Branche um den Faktor 300 bis 400.6
Ein Jahr nach dem Spinnrad bewegt Dampfkraft auch den mechanischen Webstuhl. Andere Dampfmaschinen treiben Gebläse an, die Luftsauerstoff in Hochöfen pressen und mit den höheren Temperaturen aus dem Erz mehr Eisen als bisher herausschmelzen. Bergwerke können weit tiefer getrieben werden, wenn das einströmende Wasser nun per Dampfmaschine hochgepumpt wird. Eisen wird billig genug, um auf Hunderte neue Arten im Privathaushalt, in der Fabrik oder im öffentlichen Leben verwendet zu werden: Pferdebahnen mit Eisenschienen, die erste Eisenbrücke 1779 über den Fluss Severn, 1787 das erste mit Eisenplatten gebaute Schiff, Eisenträger für den Hausbau, Möbel, Maschinen, Waffen. Der Eisenausstoß verfünffacht sich zwischen 1788 und 1815, und die Preise sinken – und das sogar während der immensen Nachfrage während der heißesten Phase der Napoleonischen Kriege um 1810 – von 22 Pfund für eine Tonne Roheisen 1801 auf 13 Pfund 1815.
Ebenso kometenhaft ist der Aufstieg der Baumwolle. 1770 macht sie erst 2,6 Prozent der britischen Industrieerzeugung aus7. Vor dem Krieg ist sie noch immer ein völlig neuer Industriezweig. Mit den wasser- und schließlich dampfgetriebenen Spinnmaschinen und Webstühlen halbieren sich die Herstellungskosten für Baumwollgarn zwischen 1780 und 1790, bis 1795 ein weiteres Mal. Der Import von Rohbaumwolle verdoppelt sich alle paar Jahre, von 16 Millionen Pfund im Jahr 1783/87 über 29 Millionen Pfund 1787/92 und 56 Millionen Pfund im Jahr 1800. 1801 stellen Baumwollprodukte schon 17 Prozent der britischen Industrieerzeugung und sind bei Kriegsende zum größten Exportartikel Großbritanniens geworden.
Obwohl die große Nachfrage im Krieg insgesamt zu steigenden Preisen führt, sind die Produktivitätsfortschritte in der Textilindustrie so groß, dass die Preise für Baumwollgarn – wie beim Eisen – selbst während des Krieges weiter drastisch fallen. Ihre Produktion beansprucht immer mehr Maschinen, Dampfkraft, Kohle und Arbeit, benötigt neue Häfen, Binnenkanäle, Landstraßen. Nicht die Napoleonischen Kriege haben diesen Boom ausgelöst, aber der Druck des Krieges hat – wie später bei jedem weiteren Kondratieff – das Tempo beschleunigt, das Potenzial des neuen Strukturzyklus noch schneller zu erschließen.
Randalierende Arbeitslose, die Maschinen in den Fabriken zerstören, sind im ersten Kondratieff eine Anfangserscheinung, denn die Nachfrage nach Arbeitskräften explodiert bald: Der erste Kondratieff benötigt Menschen, die Kohle aus dem Untergrund (in England damals relativ nah unter der Oberfläche) ans Tageslicht befördern; er braucht Menschen, die Wasserkanäle ausgraben oder in den Fabriken dampfgetriebene Webstühle mit Baumwolle bestücken, und er braucht immer mehr Mechaniker, die Maschinen warten, dazu Seeleute für den Export.
Für diesen steilen Aufschwung sind gesellschaftliche Voraussetzungen nötig gewesen. Aber jetzt, wo der neue Strukturzyklus in Fahrt gekommen ist, mischt er die Gesellschaft auf. Anstatt auch bei der Arbeit auf dem Feld oder am Markt sich zu entspannen, zu tratschen, zu singen oder zu beten, werden Schlafen und Vergnügen nun von der Arbeit getrennt. Erholung richtet sich nach der Uhr. Die Arbeitsorganisation ist nicht mehr vom Wetter, der eigenen Kraft und Laune abhängig, sondern von Regeln, vorgegebener Disziplin und dem Zeitplan des Unternehmens. Schnell, regelmäßig, präzise und unermüdlich ist der Arbeitstakt der Maschine. Klagen über die betrunkene, faule und undisziplinierte Unterschicht, die sich nur zu störrisch dem neuen Rhythmus anpasst, sind zu dieser Zeit ein Allgemeinplatz. Schulen werden zu dem Ort, wo Pünktlichkeit gelernt wird, dazu ein durch Strafen erzwungener Gehorsam und Disziplin (kein Wunder, dass die Verhaltensmuster der Arbeitswelt ein Bild von Gott erzeugen, der durch Strafe Gehorsam erzwingt). Lokale Monopole und die letzten Binnen-Handelsschranken werden beiseite gefegt.
Die »Industrielle Revolution« ist zwar zunächst ein langsamer Prozess, sie betrifft nur bestimmte Branchen und ereignet sich in wenigen Regionen, die per Kanal und Schiff gut erreichbar sind. Je länger, umso massiver verteilt sich aber dann die höhere Produktivität, also der zusätzlich geschaffene Wohlstand – wenn auch ungleich – auf alle: Viel mehr Handwerker können sich bessere Werkzeuge kaufen, Maschinen werden erschwinglicher, der Stadtschreiber kauft sich einen zweiten Anzug. Sogar Arbeiter leisten sich Tee mit Zucker, obwohl diese beiden Waren hoch besteuert sind. In einigen Häusern der unteren Schicht liegt plötzlich ein Teppich oder steht vielleicht sogar ein Klavier. Eine ganze Volkswirtschaft lernt jeden Tag hinzu, wie sie Eisenerz besser verhüttet, Transportkanäle baut oder Wolle noch feiner weiterverarbeitet. Das betrifft zunehmend auch die Nachbarn.
Wer als Wirtschaftsmacht einen Kondratieffzyklus anführt, der entwickelt sich nicht separat von der Welt, sondern ist auf andere Länder angewiesen: als Exportland für seine Basistechnologie und als Zulieferer von Ressourcen. Die Briten holen damals Erz aus Schweden und Lebensmittel vom Kontinent, die Deutschen sind nach 1890 und in beiden Weltkriegen auf Lebensmittelimporte ebenso angewiesen wie auf Exportmöglichkeiten der chemischen und der Maschinenbauindustrie; die USA werden im fünften Kondratieff zum größten Schuldner der Welt, um ihre Investitionen, aber vor allem auch, um ihren Konsum zu finanzieren, und auch Japan wäre in den 1970/80er Jahren nie so erfolgreich geworden, wenn es seine Entwicklungskosten nicht ständig von kaufenden Europäern finanziert bekommen hätte. England wird damals reich, weil es seine Produktionskapazität besser auslasten kann: Der britische Export von Baumwolle nach Indien steigt von einer Million Yards 1813 auf 51 Millionen im Jahr 1830. Die Marktmacht ist so groß, dass Länder wie Indien, China und andere spätere Dritte-Welt-Länder de-industrialisieren – um 1750 sind sie pro Kopf dagegen noch etwa so industrialisiert gewesen wie Europa.8
Anders die Europäer: Auch wenn sie zunächst keine oder zu wenige Dampfmaschinen haben, profitieren sie vom ersten Kondratieffaufschwung. England muss Lebensmittel importieren, um seine Arbeiter zu ernähren – das treibt den Getreidepreis auf dem Weltmarkt hoch. Wie stark der erste Kondratieff keine englische Angelegenheit, sondern eng mit den benachbarten Volkswirtschaften vernetzt ist, zeigt die Kontinentalsperre, als es Napoleon 1808/10 fast gelingt, die Briten auszuhungern. In den Docks lagern ungeheure Vorräte an Handelsgütern. Sie drängen schließlich auf den iberischen Markt, wo die Engländer ihre Industrieprodukte gegen Lebensmittel eintauschen – ein Grund, warum Napoleon 1809 in Spanien einmarschiert.
Wird die britische Wirtschaft unter der Kontinentalsperre zusammenbrechen? Oder generieren die Produktivitätsgewinne des ersten Kondratieffs ein solches Maß an zusätzlichen Ressourcen, das alle Verluste mehr als ausgleicht? Das Kräftemessen gewinnt der Kondratieffaufschwung: Die britische Roheisenproduktion steigt von 60.000 Tonnen im Jahr (1780) auf bereits 244.000 Tonnen im Jahr 1806 und weiter bis auf 325.000 Tonnen im Jahr 1811. Zwei Drittel von dem, was zwischen 1760 und 1830 in Europa mehr produziert wird, stammt aus Großbritannien.
Die Engländer werden dabei höher besteuert, als es sich die Bürokraten des 18. Jahrhunderts hätten vorstellen können; die Staatsschulden verdreifachen sich während des Krieges. Aber durch den dampfvermehrten Wohlstand kann das kleinere England mit viel weniger Einwohnern den Krieg materiell überlegener führen (und 1813 die verbündeten Preußen, Österreicher und Russen mit 125.000 Gewehren und 218 Geschützen unterstützen) als das gesamte Napoleonische Reich, das den Krieg hauptsächlich dadurch bezahlt, dass es die besetzten Länder ausplündert. Dort stagniert der technische Fortschritt noch: Dass die französische Verwaltung die feudalen Grundherren durch eigenständige Bauern ersetzt, bedeutet ja noch keine landwirtschaftliche Revolution mit höheren Ernten. Die schlechten Verkehrsverbindungen auf dem europäischen Kontinent zwingen den Bauern noch immer, hauptsächlich für den lokalen Markt zu produzieren. Die Wirtschaft wartet auf die Revolution der freien Unternehmer, die 1789 in Frankreich beginnt und in Europa ein paar Jahrzehnte dauert.
Französische Revolution
»Kriege und Revolutionen fallen nicht vom Himmel und entspringen nicht der Willkür einzelner«, schreibt der Ökonom Nikolai Kondratieff 1926. Sie fänden regelmäßig gerade während des Anstiegs der langen Welle statt. Denn in dieser Zeit verschärft sich der Kampf um Rohstoffe und knapper werdende Produktionsfaktoren, das Tempo nimmt zu, die Anspannung des Wirtschaftslebens wächst – und entlädt sich schließlich in Auseinandersetzungen. Auch soziale Erschütterungen entstünden »am leichtesten gerade unter dem Druck neuer wirtschaftlicher Kräfte«.9 Kurz: Die Französische Revolution bricht 1789 nicht deswegen aus, weil die Massen Hunger haben und sich einer unfähigen Monarchie entledigen wollen – sie hatten früher noch größeren Hunger und die Monarchie war wahrscheinlich noch unfähiger. Im Gegenteil: Wenn auch ungleich verteilt, wächst die französische Wirtschaft zwischen 1783 und 1789 rapide.10
Was sich wirklich geändert hat: Zwischen König, Adel und Bischöfen auf der einen Seite und den Bauern auf der anderen Seite hat sich ein Mittelstand gebildet, der im beginnenden ersten Kondratieffaufschwung über einen wachsenden Teil des Bruttosozialproduktes bestimmt. Unternehmer haben inzwischen die Freiheit, sich Kapital aus jeder Quelle zu verschaffen, jeden zu beschäftigen, neue Produktionsmethoden auszutüfteln und anzuwenden, allen Konkurrenz zu machen und alles überall zu verkaufen. Ihre Firmen sind in der Regel klein, vermehren sich aber rasch: 1789 gibt es allein in Versailles 38 Seidenfabriken, 48 Hut-, 8 Glasfabriken, 12 Zuckerraffinerien, 10 Gerbereien.11 Die Textilindustrie, Bau und Bergbau sowie die Metallindustrie organisieren sich bereits in Großunternehmen in Form von Aktiengesellschaften. Der Bergbau gräbt seine Stollen schon 100 Meter tief unter der Erde, investiert eine Menge Kapital in Belüftung, Entwässerung und Transport. Die Firma Anzin beschäftigt während der Französischen Revolution 4000 Arbeiter, 600 Pferde und bereits 12 Dampfmaschinen. Die 300.000 Tonnen Kohle, die sie im Jahr fördert, heizen der emporschießenden Metallindustrie ein.
Dieser neue Wohlstand landet allein in den Taschen des neuen Mittelstandes, nicht oben in der Adelsschicht und erst recht nicht bei den Arbeitern. Während die Preise zwischen 1741 und 1789 um 65 Prozent steigen, steigen die Löhne nur um 22 Prozent. Wenn Arbeiter streiken, hungern die Unternehmer sie so lange aus, bis sie ihre Arbeit wieder aufnehmen – zu den Bedingungen der Unternehmer. Und wenn nicht (wie die Seidenarbeiter 1774 in Lyon), schlägt die Armee die Arbeiter in die Fabriken zurück. Ihr Hass richtet sich nun nicht mehr nur gegen ihre Arbeitgeber, sondern auch gegen die Regierung. 1786 beklagen sie, sie könnten selbst mit 18-stündiger Arbeit ihre Familien nicht ernähren. Die Massen, die 1789 ihr Leben riskieren, als sie der Staatsmacht trotzen, sind hungrig und wütend. Aber schon mit einer Brotpreissenkung wären sie zu beschwichtigen. Im Gegensatz zu den Bürgern und Unternehmern wollen sie, dass der Staat die Wirtschaft regelt, wenigstens beim Brotpreis. Damit sind sie ohne weiteres bereit, zum alten Regime zurückkehren, anstatt als Arbeiterklasse den Staat zu übernehmen. Politische Vertretung ist ihnen gleichgültig.
Anders als den Gebildeten aus den höheren Schichten. Diese überreden die besitzlose Masse, die Bastille zu stürmen (sie wird friedlich übergeben) und so den König daran zu hindern, das Militär gegen die Nationalversammlung einzusetzen. Damit gelingt es dem Mittelstand, die Unterschicht für seine Interessen einzuspannen: Ohnmächtig müssen die betuchteren Bürger im alten Königreich zusehen, wie Hof und Adel auf Kosten ihrer hart erwirtschafteten Steuern im Luxus leben, während ihnen jeder schnöselige Baron arrogant begegnet, sie politisch nichts bestimmen können und ihnen als kompetenten Bürgerlichen politische und militärische Ämter verweigert werden. Die paar schlecht bewirtschafteten Landgüter der Adeligen mit ihren ausgelaugt-ausgebeuteten Böden machen den »ersten Stand« wirtschaftlich zum zahnlosen Tiger. Er hat es versäumt, wie etwa die englischen Standesgenossen ins Unternehmertum einzutreten.
Auch sind die Zeiten um Jahrhunderte vorbei, als es für einen König die beste Wirtschaftsförderung bedeutete, Flächen an die Kirche oder Klöster zu übertragen, die daraus dann blühende Landschaften machen. 1789 sehen die Unternehmer den Klerus ein Drittel des Nationaleinkommens schlucken (wenn auch nicht nur für den Luxus der Bischöfe, sondern ebenso für soziale Aufgaben) und damit eine Theologie aufrechterhalten, die Gebildete schlicht als infantil empfinden. Die Ortspfarrer, in der Regel lauter und tugendhaft, müssen den größten Teil der Einnahmen an die adeligen Bischöfe abgeben und daher sowohl der Kirche dienen als auch ihren Lebensunterhalt selbst auf dem Feld erarbeiten. Viele von ihnen werden bei der Revolution den dritten Stand unterstützen, während die Bischöfe gegen gesellschaftliche Veränderungen sind. Es ist nicht die Schuld des Kirchenvolkes, wenn die Institution – und eng an ihr Zeugnis gekoppelt der Glaube an Gott – an Boden verliert. Die Zahl der Priester geht immer weiter zurück, alte Klöster zerfallen – zwischen 1766 und der Revolution sinkt ihre Zahl von 26.000 auf 17.000, manche nur noch mit wenigen Mönchen belebt.
Während die Dörfler gläubig sind – sie werden ihren Glauben in der Revolution gegen den aggressiven Atheismus der Pariser Zentralregierung mit Aufständen verteidigen –, glaubt in den Städten nur noch jeder zweite gebildete Mann an Gott. Die französische Kirche fordert daher 1770 eine Medienzensur und schickt dem König eine Denkschrift über »die gefährlichen Konsequenzen der Freiheit des Denkens und des Druckens«.12 Das ist keine gute Idee. Denn damit behauptet sie, sie hätte keine besseren Argumente, von dem persönlichen Beispiel der Kirchenfürsten ganz zu schweigen. Wer die Gewalt des Staates in Anspruch nimmt, um sich durchzusetzen (wie alle Staatskirchen), der verliert jede ideelle Unterstützung. Skeptizismus wird bei den Adeligen Mode. Und wenn sie sonntags in die Kirche gehen, dann nur, damit ihre Diener eine bessere Meinung von ihnen haben.
Ärgerlich daran ist für die Bauern und geschäftstüchtigen Bürger, also für den dritten Stand, dass sie alleine Steuern zahlen – Adel und Klerus sind befreit. Hinzu kommt, dass sich der König selbst das Recht verleiht, jederzeit zu erklären, der Staat sei bankrott und das vom Mittelstand geliehene Geld verloren. Nun spitzt sich Ende der 1780er Jahre die Situation zu: Der König ist bereits ausweglos verschuldet. Die Regierung will Staatsanleihen nicht mehr in fester Edelmetall-Währung, sondern nur noch in Papiergeld auslösen, dessen Wert durch Inflation aufgefressen wird. Die steuerzahlende Mittelklasse hat plötzlich Angst um ihr Erarbeitetes und ist nicht mehr bereit, sich ihren Reichtum von Arroganten und Unfähigen gefährden zu lassen.
Es geht den Bürgern also um ihre eigene Brieftasche und darum, wenigstens kontrollieren zu dürfen, wie die unfähige Staatslenkung das sauer erarbeitete Geld der Gewerbetreibenden ausgibt. Von den 26 Millionen Franzosen gehören über 25 Millionen weder dem Adel (erster Stand) noch dem Klerus (zweiter Stand), sondern eben dem dritten Stand an – aber jeder der drei Stände hat in der Generalversammlung dasselbe Stimmgewicht. Da die oberen beiden Stände mit der Monarchie stimmen, haben die Bürger von vornherein verloren. Ihnen bleibt gar nichts anderes mehr übrig, als sich zur eigentlichen politischen Macht, zum Repräsentanten der ganzen Nation, zu erklären.
Neues destabilisiert die Gesellschaft
Die Französische Revolution vollzieht auf der politischen Ebene nach, was auf der wirtschaftlichen und religiösen Ebene schon begonnen hat. Sie stürzt nicht nur einen Bereich der Wirklichkeit, sondern alle Systeme: Wirtschaft, Glaube und Staat. Technische Entwicklungen und die dafür nötigen institutionellen Innovationen haben freie Bahn. Die Dämme der bisherigen Gesetze, Bräuche und Frömmigkeit brechen schneller, als eine neue funktionierende Ordnung errichtet werden kann. Alle Emanzipationsbewegungen sind am Anfang destruktiv. Als die Konstituierende Versammlung nach zwei Revolutionsjahren die Macht erobert hat, schafft sie die Feudalherrschaft der Adeligen ab, konfisziert Kircheneigentum, legalisiert Organisationen und Zusammenschlüsse der Kaufleute und Fabrikanten, verbietet aber – von wegen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – alle Zusammenschlüsse der Arbeiter. Die chaotische Volksherrschaft mit massenweisen Hinrichtungen wird erst domestiziert durch die Rückkehr zu einem Alleinherrscher Napoleon, später dann durch eine funktionierende Gewaltenteilung. Das macht Hoffnung, daran zu glauben, dass die destruktiven Erscheinungsweisen eines befreiten Individualismus heute auch wieder domestiziert werden können – durch eine ausbalancierte Kooperationsfähigkeit.
Es ist jedoch glatt gelogen, darüber zu klagen, wie alles immer schlimmer wird, wo doch früher alles so gut und die Menschen so gesittet und friedlich gewesen sind. Wahr ist, dass technische Veränderungen die Gesellschaft durcheinander rütteln und die alten Verhaltensmaßstäbe und Organisationsstrukturen destabilisieren, sodass der nächste Kondratieffzyklus mit chaotischen Begleiterscheinungen beginnt. Damit neue Strukturen aufgebaut werden können, müssen alte zerstört werden. Das Problem daran ist, dass es nicht gelingt, beides gleichzeitig und langsam zu gestalten.
1. Kondratieffabschwung Feudalismus macht Deutschland arm
Dass Deutschland im ersten Kondratieff ein armes Land bleibt, hat daher aus Sicht der Kondratiefftheorie gesellschaftliche Gründe: Wenn seine Bewohner nicht die (Infra-)Strukturen für eine neue Basisinnovation bereitstellen, dann machen sie ein paar neue Dampfmaschinen allein eben auch nicht wohlhabender. Auch wenn es am Anfang noch danach aussieht: Deutschland erlebt den ersten Kondratieff im Krieg als Hochkonjunktur. Im Ruhrgebiet blüht die Industrie kurz auf, weil sie die Kontinentalsperre vor englischen Waren schützt; die Bauern erzielen dank der hohen Nachfrage gute Preise. Doch nach dem Krieg haben die Deutschen als kaum industrialisiertes Land keine Chance im Wettbewerb. Sie profitieren zuwenig vom Aufschwung und sind vom Abschwung der 1820er/30er Jahre doppelt getroffen.
Schuld daran sind nicht die Engländer, die ihre Dampfmaschinen-Technologie hüten und Ingenieuren verbieten, ihr Wissen ans Ausland weiterzugeben; es liegt an der deutschen Gesellschaft selbst, die nichts von dem vorbereitet hat, was dieser neue Strukturzyklus braucht: Arbeiter, eine Unternehmerschicht, Kapital, einen Binnenmarkt, Transportwege wie die Kanäle in Frankreich und England, und es fehlt an Ballungszentren als Absatzgebiet, die größere Ressourcen für Investitionen mobilisieren können. Die deutschen Adeligen schauen auf Geschäftsleute herab – sie lassen niemanden von ihnen in ihre Kreise einheiraten. Mutigen fehlen Anreize, Kohle und Erze im Boden industriell zu verwerten. Zünfte schränken gewerbliche Freiheit ein. Jedes Fürstchen kocht seine eigene Suppe.
Bauern sind je nach Region noch an ihren Boden oder als Leibeigene an den Feudalherrn gebunden. Das ändert sich, als Preußen 1806 bei Jena von Napoleon gründlich geschlagen wird: Der Staat sieht ein, dass er mit gepressten Söldnern keine Schlachten gewinnen kann, sondern nur mit freien Soldaten, die für einen Staat kämpfen, von dem sie zumindest glauben, dass er ihre Sache sei. Also kommt es in Deutschland zur Bauernbefreiung (bis das revolutionäre Frankreich besiegt ist – danach werden die Möglichkeiten, ein freier Bauer zu werden, wieder zugunsten der Grundherren eingeschränkt).
Aus Leibeigenen werden lohnabhängige Landarbeiter. Das hat auch einen Vorteil für den Grundherrn: Er ist nicht mehr verpflichtet, seine Bauern sozial zu versorgen – ihre Arbeit ist mit dem Tagelohn abgegolten. Und wenn es ihnen schlecht geht, weil sie oder ihre Kinder krank werden, dann ist das ihr Problem. Dort, wo Kleinbauern den Boden eines Grundherrn beackern und dafür bislang einen Großteil der Ernte abgeben müssen, wird es möglich, den Boden abzukaufen. Dafür nehmen viele Bauern einen Kredit auf, der sich auch gut bedienen lässt – zumindest während des ersten Kondratieffaufschwungs in den Napoleonischen Kriegen, als die Nachfrage groß ist: Die Preise, welche die Bauern für Lebensmittel erzielen, sind hoch, obwohl die Ernten steigen. Weideland und dörfliche Gemeinschaftsflächen werden mit der Bauernbefreiung in Äcker umgewandelt, Tiere kommen in den Stall. Statt Dreifelderwirtschaft (jedes dritte Jahr bleibt ein Acker brach liegen) kann der Boden dank wechselnder Fruchtfolge und Stallmist jedes Jahr bebaut werden. Der Markt saugt die gestiegenen Ernteerträge auf.
Aber nur, bis der Krieg vorbei ist und die große Nachfrage ausbleibt, welche die Dampfmaschinen in England und Frankreich nach sich gezogen haben. Die Kontinentalsperre hat vor 1813 verhindert, dass die Engländer Stoffe und Eisen auf dem europäischen Festland verkaufen können. Sobald sie aufgehoben ist, ist Deutschland der vollen Wucht einer britischen Industrie ausgesetzt, die ihr ein bis zwei Generationen voraus ist. Den Deutschen geht es wie heute Entwicklungsländern: Was sie produzieren, können die Engländer und auch Franzosen längst viel besser herstellen, mit viel weniger Kosten, einem höheren Gewinn und zu einem günstigeren Preis. Es ist das Wettrennen eines Fahrradfahrers gegen ein Auto auf der freien Landstraße.
Die kurze Blüte von Bergbau und Metallindustrie in Essen und Düsseldorf verwelkt. Während Städte weniger, oder zumindest viel langsamer als bisher Agrargüter nachfragen, wächst das Agrarangebot weiter. Die Preise für Getreide sinken. Das bringt die gerade erst befreiten, selbständigen Bauern in Not. Ihre Landstreifen, die sie dem ehemaligen Feudalherrn abgekauft haben, sind nicht groß genug, um wirtschaftlich zu sein. Viele Kleinbauern im Rheinland und in Südwestdeutschland haben für ihre eigene Scholle in der Hochkonjunktur Kredite aufgenommen. Nun ringen sie um ihr Überleben, weil während der Agrarkrise in den 1820ern die Preise fallen – wie immer in einem Kondratieffabschwung. Zwar leiden auch Handwerk und die kleine Industrie unter verschärftem Wettbewerb und weniger Umsatz bei gleichen Fixkosten, doch nirgends sinken die Preise so sehr wie in der damaligen »old economy«, der Landwirtschaft.13 Ein Bauer muss eine immer größere Menge an Getreide in die Stadt karren, um dafür ein Werkzeug aus Eisen zu kaufen. Viele können jetzt ihre Höfe nicht mehr halten. Die anderen aus der Leibeigenschaft befreiten Bauern, die jetzt als Landarbeiter leben, werden von den Grundherren einfach nicht mehr beschäftigt. Sie wandern aus oder suchen eine Lebensexistenz in den Städten. Eine Arbeiterschaft, die für die Industrialisierung nötig ist, entsteht in Deutschland also erst dann, als es im langen Abschwung an ausreichenden anderen Arbeitsmöglichkeiten fehlt.
Oder ist das alles nur ein deutsches Problem gewesen und es hat nie einen Abschwung des ersten Kondratieff gegeben? Wenn Wirtschaftshistoriker heute das britische Bruttosozialprodukt schätzen, zeigen die Zeitreihen über die 1820er und 1830er hinweg ständig nach oben. Und doch kommt es auch in England zu einer schweren Rezession mit fallenden Preisen und einer geschätzten Arbeitslosigkeit von 20 bis 30 Prozent der arbeitsfähigen Erwachsenen, wie es Romane von Charles Dickens, zum Beispiel »Hard Times«, überliefern. Das harte Leben im Gefolge der »New Poor Law« in den 1830ern folgt dem heutigen Muster, aus Geldmangel die Arbeitslosenhilfe zu kürzen oder deren Bezug zu erschweren. In der Kultur spiegeln Biedermeier und Romantik das Lebensgefühl der wirtschaftlichen Stagnationsjahre. Nein: Es hat einen Kondratieffabschwung gegeben, und zwar für alle.
Warum Arbeitslosigkeit ein Produktivitätsproblem ist
Die weltweite Agrarkrise bricht nicht deshalb aus, weil die Landwirtschaft so produktiv geworden ist, sondern weil die Gesamtwirtschaft – so wie heute – nicht ausreichend produktiver wird: Sonst könnten die Bauern in produktiveren Branchen arbeiten als auf ihrem kleinen Hof, den sie mangels Spezialisierung und mangelnder Größe ineffizient bewirtschaften. Das Elend der Bauern ist Ausdruck verdeckter Arbeitslosigkeit. Die Soldaten sind aus den Kriegen heimgekehrt und die Jugend stirbt nicht mehr auf den Schlachtfeldern. Erbteilungen verkleinern die Ackerfläche pro Bauer weiter. Deren Alternativen sind nicht verlockend: Elendshütte in der Stadt, nur mit viel Alkohol zu ertragen. Oder wochenlang auf einem Auswandererschiff unter Deck und frieren in der Fremde.
Aber die Krise der 1820er/30er muss kommen, weil man Menschen nicht so schnell ändert (oder heute auf einen kooperativen Arbeitsstil umstellt), wie man eine Dampfmaschine erfindet: Niemals würden die Bauern freiwillig ihren generationenlangen Lebensrhythmus verlassen und sich dem Takt der Maschinen unterwerfen, niemals würden die Fürsten den Bürgern Freiheiten gewähren. Nur wenn sich zu viele Menschen in den alten Branchen drängeln, deren Produktivität der jeweiligen new economy (hier Textil und Metall) völlig hinterherhinkt, wird der Druck irgendwann groß genug, den Beruf und damit das ganze private Umfeld so radikal zu verändern; nur dann stehen die Ressourcen bereit, den nächsten Strukturzyklus zu erschließen.
Der Kondratieffzyklus legt den Rückwärtsgang ein, weil Wirtschaft und Gesellschaft nicht mehr produktiver werden. Im Aufschwung ist die Produktivität gestiegen, weil man immer noch mehr vom Gleichen macht; im Abschwung dagegen sinkt die Produktivität gerade deshalb, weil man immer noch mehr vom Gleichen macht, aber das technische System jetzt seine Grenze erreicht hat. Kondratieff nennt das die »Realkostengrenze«, um zu verdeutlichen, dass es sich hier nicht um einen Mangel an Geld handelt: Während eines Strukturzyklus produziert der Mensch mit einer bestimmten Kombination aus Arbeitskraft und -kompetenz, Maschinen auf einem bestimmten technischen Niveau mit einer bestimmten Mischung aus Rohstoffen. Irgendwann wird einer dieser Produktionsfaktoren so knapp, dass sich weiteres Wachstum nicht mehr lohnt, weil er sich nicht einfach von einem Jahr auf das nächste schnell vermehren lässt. Fünf rechte und sieben linke Schuhe ergeben nicht sechs Paar, sondern eben nur fünf Paar Schuhe.
Am Ende wird der erste Kondratieff von einem Produktionsfaktor gestoppt, der sich nicht so einfach von heute auf morgen vermehren lässt: Der Transport von Erz, Kohle, Roheisen und Fertigprodukten ist bei diesen wetterabhängigen Straßenverhältnissen, störrischen Zugtieren vor dünnen Holzlastkarren und wenigen Kanälen so teuer, dass sich weiteres Wachstum selbst in England nicht mehr lohnt, obwohl dort schon lange in Bergwerken Erfahrungen mit von Pferden gezogenen Wagen auf Eisenschienen gemacht werden und 1825 die erste Dampfeisenbahn von Stockton nach Darlington fährt.
Um wie viel größer sind da die Transporthürden in Deutschland: 39 deutsche Kleinstaaten pochen auf ihre Souveränität mit eigener Währung, auf eigene Vorschriften und sogar auf Zölle für die bloße Durchfahrt von Waren. Wer als Unternehmer die Schwierigkeiten überwunden hat, wirtschaftlich zu produzieren, der kann seine Waren kaum weiterverkaufen. Es ist viel zu teuer, sie zu entfernteren Kunden zu bringen, und den Weg dorthin behindern Zollschranken. Die deutschen Unternehmer bitten daher 1819 die Bundesversammlung, die Zollschranken zwischen den deutschen Staaten aufzuheben. Nicht nur, dass die Bittschrift ohne Erfolg bleibt – sie erzürnt die hohen Herren sogar. Denn die Fürsten, Könige und Feudalherren wollen keine mündigen Bürger, die unternehmerisch selbständig und frei entscheiden, sondern gehorsame Bauern, die ihren Zehnten abliefern. Andererseits kann das neue technologische System, der neue Kondratieff-Strukturzyklus, nur mit flexibel agierenden Akteuren funktionieren.
Das ist der wirtschaftliche Hintergrund für den Kampf zwischen Demokratisierung und monarchistischer Herrschaft im 19. Jahrhundert. Und es ist ein Beispiel dafür, dass es zu langen Kondratieffkrisenjahren kommt, weil die gesellschaftlichen Institutionen ihre Stellung verteidigen, anstatt sich auf ein neues Paradigma einzustellen: Die Fürsten denken, sie lösen das Problem, indem sie den Verursacher dieser ärgerlichen, ihre Macht aushöhlenden Bittschrift von 1819 eliminieren: den jungen Volkswirtschaftsprofessor Friedrich List, der sich vehement und über alle damals verfügbaren Informationskanäle für die Zolleinheit einsetzt. Zuerst zwingen sie ihn, seine Professur niederzulegen. Als ihn das allein nicht mundtot macht, planen sie, ihn loszuwerden, indem sie ihn zur Festungshaft verurteilen und ihn vor die Wahl stellen, entweder im Verlies zu schmachten oder in die USA auszuwandern. Sie irren sich gewaltig, wenn sie denken, es kehre nun Ruhe ein, als List auf das Schiff in die USA verfrachtet wird. Denn List – nomen est omen – findet einen Weg, wie er als »unbesoldeter Anwalt des deutschen Volkes« für Zollfreiheit und Eisenbahnbau kämpfen kann, ohne dass ihn ein Monarch und seine Bürokraten daran hindern: Er kehrt 1832 als amerikanischer Konsul zurück und kann – diplomatisch immun – reden und schreiben, wie er will.
List weiß: Der Weg zu einem neuen Aufschwung ist nur frei, wenn Güter endlich über weite Strecken hinweg mobil werden – politisch unbehelligt und zu ökonomisch vertretbarem Aufwand. Die Kostengrenze des ersten Kondratieff erzeugt das große Investitionsbedürfnis für den nächsten Strukturzyklus, für den Eisenbahn-Kondratieff. Doch bis Deutschland mit einem ausreichenden Streckennetz bedeckt ist, bis es genug Schienenfabriken und ausgebildete Lokführer gibt, vergeht mehr als eine Generation. Das ist der Grund, warum Kondratieffzyklen so lange dauern.
2. Kondratieffaufschwung Freie Fahrt für die Wirtschaft
Wie weit die etablierte Wirtschaftswissenschaft von der Realität weg ist, zeigen Aussagen von Wirtschaftshistorikern, die sich an den üblichen mathematisch-monetären Denkmodellen orientieren: Die Eisenbahn habe mit dem großen Wirtschaftswachstum von den 1840ern bis 1873 gar nichts zu tun, weil sie nur zwei Prozent zum Bruttosozialprodukt beigetragen habe. Dabei geht es doch gar nicht um einfache Mengen- und Wertaufzählungen von Kohle, Eisen oder Schienenkilometern, sondern darum, wie sich Lebensqualität, Nutzen und Produktivität verändern, nachdem Menschen, Güter und Rohstoffe so einfach überallhin transportiert werden können.
Man stelle sich vor, wie beschwerlich es ist, Waren mit einem Ochsen- oder Pferdekarren über lehmige Feldwege durch eine typisch deutsche Mittelgebirgslandschaft zu schleppen: Je nach Wetter und Boden dauert es Wochen, Handelsware einige hundert Kilometer weit zu transportieren. Das Reisen in Kutschen ist eine Qual, und die Kapazitäten sind damals sehr gering. Der Sprung von der Landstraße auf die Eisenbahn ist ungeheuer. Der gewonnene Wohlstand besteht nicht aus zählbarem Geldwert, sondern aus materiellem »Realkapital« und eingesparten sozialen Kosten: Das sind die zusätzlichen Gütermengen, die ein Waggon mehr transportiert als ein Schiff oder Pferdegespann. Viel mehr Menschen können es sich jetzt leisten, zu Hause mit Kohle zu heizen – für den Konsumenten in London halbiert die Eisenbahn zwischen 1820 und 1850 den Preis für die Tonne Kohle von 31 auf 16 Schilling. Auch Eisen ist für jeden Kleinhandwerker immer einfacher zu erwerben, weil es dank Eisenbahn weniger kostet. Lieferungen werden pünktlich, zuverlässig, planbar. Haben Unternehmer vorher sicherheitshalber große Lager angelegt, kommen sie nun mit weniger Vorräten aus, was wieder Geld frei macht für produktivere Investitionen. Durch die täglich frischen Lebensmittel aus den ländlichen Regionen wird es jetzt möglich, große Industriearbeiterheere zu ernähren. Gedacht und gebaut für den Frachtverkehr, sind die Investoren überrascht, als auch Passagiere die neue Transportmöglichkeit überrennen. Der Horizont der Menschen weitet sich.
Im ersten Jahr nach Eröffnung der Eisenbahnlinie Liverpool-Manchester fahren diese Strecke 400.000 Menschen mit der Bahn. Das ist billiger als mit der Postkutsche – und komfortabler. Die Eisenbahn spart all die Zeit, die ein Händler sonst auf einem gefrorenen Kanal festsitzt, schenkt Arbeitszeit, die einem zusätzlich bleibt, weil man mit dem Zug viel schneller am Ziel ist, ja sie ermöglicht zusätzliche Lebensjahre, weil das Bahnreisen meine Gesundheit mehr schont, als wenn ich mich zu Fuß oder auf dem Pferd körperlich überanstrenge. Dazu die vielen Pferde, die nicht mehr auf Langstrecken verschlissen werden und nun dem örtlichregionalen Individualverkehr zur Verfügung stehen. Es ist unmöglich festzustellen, wie stark die Eisenbahn den Wohlstand der jeweiligen Volkswirtschaften vermehrt (was verdeutlicht, dass die Investitions-Multiplikatormodelle der etablierten Volkswirtschaftslehre reichlich albern sind).
Anstatt die investierten Geldbeträge erbsenzählerisch zusammenzurechnen, sollte die Wirtschaftswissenschaft dazu übergehen, sich im realen Leben anzusehen, wo investiert wird und mit welcher Wirkung: Die Krimifigur Sherlock Holmes des Schriftstellers Sir Conan Doyle erlebt ihre Abenteuer in der Eisenbahn. 1846/48 nimmt diese die Hälfte aller Investitionen in Großbritannien auf.14 Welchen Sprung die weltweite Infrastruktur im zweiten Kondratieff macht, veranschaulicht Jules Vernes Roman »In 80 Tagen um die Welt«: Der Ökonom Eric Hobsbawn errechnet, dass die Romanfigur Phileas Fogg 1848 noch mindestens elf Monate für dieselbe Reise benötigt hätte, die 1872 tatsächlich in 80 Tagen machbar erscheint.
Die Eisenbahn ist die Basisinnovation des zweiten Kondratieff-Strukturzyklus, sie treibt Wirtschaft und Gesellschaft voran. Sie ist nicht nur eine, sondern ein ganzes Bündel vernetzter Innovationen: eine Kombination aus einem bisschen Stahl für die Lokomotiven, ausreichend starken Dampfmaschinen, Neuentwicklungen wie dem Dampfhammer oder noch besseren Luftdüsen, um in gigantischen Mengen den Rohstoff für die Schienen zu produzieren: Eisen ist das wichtigste Material dieser Zeit. Je einfacher und billiger die Schienen werden, umso leichter lassen sich neue Strecken finanzieren. Um 1850 ist die Eisenbahn der größte Abnehmer der Eisenindustrie und der Kohlebergwerke. Einige Autoren, die Kondratieffs Theorie zitieren, irren, wenn sie den Stahl schon dem zweiten Kondratieff zuordnen. Bis 1870 wird der wenige und noch zu teure Stahl nur für ein paar besondere Maschinen verwendet – die Gleise der Eisenbahn sind damals tatsächlich noch aus Eisen.
Zwar rosten und verschleißen sie fünfmal schneller als später die besseren Stahlschienen. Aber das reicht für einen historisch einzigartigen Sprung auf ein neues Wohlstandsniveau: Mit der Eisenbahn sind Fabriken nicht mehr von Erz- und Kohlevorkommen abhängig – sie können nun in jeder Größe und überall dorthin gebaut werden, wo es einen Eisenbahnanschluss gibt und ein Flüsschen als Abflusskanal. Kohle, Eisen und alles erdenklich andere kann zu jedem bewohnten Ort transportiert werden – erst recht zu den neuen großflächigen Industriegebieten in London, Berlin und Paris. Auch auf See verändert das neue technologische System das Tempo: Mit ihren leistungsfähigeren und energieeffizienteren Antrieben verdrängen Dampfschiffe die Mastensegler. Immer weniger Kohle müssen sie für eine Fahrt mitnehmen, was mehr Raum für Ladung übrig lässt, immer größer können sie gebaut werden. Ihre weltweite Tonnage explodiert zwischen 1851 und 1871 von 264.000 auf fast zwei Millionen.15
Nicht während des ersten Kondratieffs, sondern erst jetzt kann die Dampfmaschine ihr Produktionspotenzial großflächig entfalten. Der Ökonom Hobsbawm dokumentiert16, dass die weltweit installierte Dampfkraft in den 20 stärksten Jahren des zweiten Kondratieffaufschwungs von vier Millionen PS 1850 auf 18,5 Millionen PS bis 1870 zunimmt. In diesen nur zwei Jahrzehnten vervierfacht sich die globale Eisenproduktion, das Weltbruttosozialprodukt steigt um mehr als das Doppelte.
Dabei ist eine vorherrschende Meinung, die Wirtschaft beginne in dieser Zeit wieder zu boomen, weil große Goldfunde gemacht worden sind: In Kalifornien bricht in den 1840ern der Goldrausch aus, neue Minen werden in Alaska und Australien gegraben. Kondratieff sieht in seiner umfassenden Wirtschaftstheorie dafür einen ganz anderen Hintergrund: Wenn die Wirtschaft sich wegen der massiven Produktivitätssteigerung wieder beschleunigt, braucht sie mehr Gold für den Zahlungsverkehr. Der Goldpreis steigt mit der Nachfrage. Jetzt wird es auch wieder rentabler, neue Goldfelder zu erschließen. Und die Techniken senken die Förderkosten und machen es wirtschaftlich, die bekannten Goldadern auszubeuten.17
Wie in jedem Kondratieff schwingt sich dann die Globalisierung zu neuen Höhen auf: Der Welthandel wächst zwischen 1840 und 1870 um 260 Prozent.18 Richard Cobden (1804 - 1865) ist der führende Lobbyist, der dafür sorgt, dass England keine Zölle mehr auf ausländische Waren erhebt. Die führende Wirtschaftsmacht überzeugt auch die anderen Länder von den Vorteilen des freien Welthandels, wobei sie ihnen zum Teil großzügig Schutzzölle einräumt.
England kann es sich leisten, denn wieder führt es den Strukturzyklus an: Nach der »railway mania«, dem Investitionsboom der 1830er, ist das Hauptnetz in den 1840ern bereits fertiggestellt und entfaltet eine wirtschaftliche Macht, die Paul Kennedy zusammenfasst19: Als das Vereinigte Königreich wahrscheinlich um 1860 seinen relativen Höhepunkt erreicht, produziert es 53 Prozent des weltweiten Eisens und 50 Prozent der Stein- und Braunkohle. Es verbraucht fast die Hälfte der ungesponnenen Baumwolle der Welt. Mit nur 2 Prozent der Weltbevölkerung und 10 Prozent der europäischen Bevölkerung hat das Vereinigte Königreich 40 – 45 Prozent des globalen und 55 – 60 Prozent des europäischen Produktionspotenzials. Es verbraucht fünfmal so viel moderne Energien aus Kohle und Öl wie die USA oder Preußen, sechsmal so viel wie Frankreich und 155-mal so viel wie Russland. Großbritannien alleine handelt ein Fünftel aller Güter der Welt und zwei Fünftel aller Industriegüter.
Bei diesem Wohlstand, so Paul Kennedy, sei es kaum überraschend, dass die Briten in den 1860er und 1870er Jahren davon überzeugt sind, dass sie »mit der Anwendung der Prinzipien der klassischen Nationalökonomie das Geheimnis entdeckt« haben, das sowohl »zunehmende Prosperität als auch den Frieden in der Welt«20 garantiert – das meinen übrigens die Ökonomen im langen Aufschwung immer.
Nach diesem Kondratieffzyklus, um 1880, stellt das Land mit 22,9 Prozent fast ein Viertel der Weltindustrieproduktion her – natürlich kann es sich ein gut ausgerüstetes Heer, eine große Flotte und ein Kolonialreich leisten. Aber noch mal: Die Engländer sind damals nicht deswegen reich und mächtig, weil ihre Löhne niedriger sind, oder die Notenbank die Zinsen gesenkt oder die Geldmenge erhöht hat, sondern weil sie die Strukturen des neuen Kondratieffzyklus und seiner Basisinnovation als Erste und mit Vorsprung erschlossen haben.
Deswegen sind sie in dieser Zeit auch der weltweit führende Hersteller von Lokomotiven – die sind ebenso ein Exportschlager wie Schienen und sonstige Bahnausrüstungen. Großbritannien exportiert um 1850 jedes Jahr Waren im Wert von etwa 30 Millionen Pfund ins Ausland, um 1870 etwa 75 Millionen Pfund. Nie sind die englischen Exporte so stark gewachsen wie in den sieben Jahren von 1850 bis 1857 – jedes einzelne davon ist stärker als jedes andere Jahr davor oder danach in der Geschichte des Landes.21 Die Zinsen und Dividenden, die meist gleich wieder im Ausland investiert werden, summieren sich auf etwa 50 Millionen Pfund im Jahr.22
Damit schwappt der Strukturzyklus auch in andere Länder: Die amerikanischen Eisenbahnen werden mit dem Geld gebaut, das zuvor in England verdient wurde. Die Reise von New York nach Chicago verkürzt sich von drei Wochen auf drei Tage.23 Das US-Netz wächst in den 1850ern und 1860ern um durchschnittlich 2000 Meilen jedes Jahr, in den frühen 1870ern sogar noch um 5000 Meilen.
Deutschland krempelt seine Gesellschaft um
Dagegen Deutschland: Vor der bürgerlichen Revolution von 1848 kommt der Eisenbahn-Kondratieff nur langsam ins Rollen. Noch fehlen der Wille und die Freiheit, die Basisinnovation anzunehmen. Der Schwung der ersten Industriepioniere wird vor allem von einer monarchischen Regierungselite gebremst, die alle dafür nötigen gesellschaftlichen Innovationen verhindert: ein funktionierendes Kreditwesen, Schienennetze über Fürstentumsgrenzen hinaus, einen Staat, der einem das Produzieren nicht ständig verbietet. Ingenieure der königlichen Bergämter im Ruhrgebiet überwachen noch immer die Bergwerke in allen Angelegenheiten, selbst den Preis setzen die Behörden fest. (Erst nach der eingeschlafenen Revolution mischt sich der Staat nicht mehr in die Preisgestaltung ein und nimmt sich zurück, bis er 1865 nur noch die Sicherheit überprüft.)
Auch in der Bevölkerung regt sich Widerstand gegen das neue technologische System. Die schlesischen Weber in Peterswaldau protestieren im Hungerjahr 1844 weniger gegen ihre miserable Bezahlung. Sie haben vor allem Angst, ihre dürftige Einkommensquelle ganz zu verlieren, wenn die dampfgetriebenen Webstühle sie vollends arbeitslos machen. Sie können sich nicht vorstellen, dass eine boomende Textilindustrie viele zusätzliche Arbeitsplätze schafft – in der Infrastruktur, dem Transport von Tuch und Kohle, dass die Hallen und Maschinen gewartet werden müssen. Zugegeben: Bis dahin werden sie wohl verhungert sein, wenn ihnen beim Übergang von einem Strukturzyklus in den nächsten nichts und niemand hilft. Jedoch bessert es die eigene Lage nicht, Maschinen zu stürmen oder weiterhin für Hungerlöhne zu arbeiten. Der einzige Weg aus der Not ist damals wie heute, alles daranzusetzen, das nächste technologische Netz (hier das Netz der dampfgetriebenen Webstühle) so schnell wie nur irgend möglich zu erschließen.
Doch niemand kann einem zu dieser Zeit genug Geld vorschießen, um längere Eisenbahnstrecken zu bauen. Nachdem den Christen im Mittelalter das Nehmen von Zinsen verboten war, fehlt es an Banken und Bankern. Anfang des 19. Jahrhunderts arbeiten vor allem Juden im Kreditwesen, weil ihnen seit dem Mittelalter die Zünfte (also nicht die gesichtslose Institution, sondern die Menschen dieser Handwerkszusammenschlüsse) die Mitarbeit in Handel und Gewerbe verweigert haben. 1846 sind in ganz Preußen nur 1100 Menschen in 442 Banken damit beschäftigt, Geld zu verleihen – in der Regel je ein Bankier und ein Gehilfe24. (Bis zur Jahrhundertwende steigt die Zahl auf 18.000 Beschäftigte an – sie verfünfzehnfacht sich, während die Bevölkerung nur um die Hälfte zunimmt.)
Bis neue Aktienbanken mit immer ausgedehnteren Filialnetzen die Groschen der kleinen Leute für die Industrialisierung einsammeln, die zuvor nutzlos in Sparstrümpfen versteckt gewesen sind, muss der Widerstand des Staates überwunden werden. Im Vormärz25 versucht der preußische Finanzminister Christian von Rother mit allen Mitteln, Bank-AGs zu verhindern. Denn die paar persönlich haftenden Privatbankiers hat die Regierung bisher leicht unter Druck setzen können. Aber zahlreiche anonyme Aktiengroßbanken? Dazu kommt: Der Berliner Finanzbürokratie ist das liberale Rheinland, das sich mit der Industrialisierung so stürmisch entwickelt, immer suspekt gewesen. Das alte Preußen mit seinen konservativen ostelbischen Rittergutsbesitzern fürchtet zu Recht, die Industriellen könnten innenpolitisch die stärkere Kraft werden.
Dafür geht es wenigstens im innerdeutschen Handel voran: 1834 tritt der Zollverein zwischen Preußen, Hessen-Darmstadt, Bayern und Württemberg in Kraft, dem sich in den nächsten Jahren die anderen Staaten anschließen – Bremen und Hamburg erst lange nach der 1871er-Reichsgründung 1888. Dass sie sich wirtschaftlich annähern, bedeutet nicht, dass sie sich gleichzeitig auch politisch angleichen: Der Zollverein hindert die deutschen Kleinstaaten nicht daran, 1866 an der Seite Österreichs gegen Preußen Krieg zu führen (ein Grund, heute die Europäische Union nach der wirtschaftlichen Einheit auch politisch weiter zu vertiefen).
Technologisch bemühen sich die Deutschen zunächst vergeblich, eine eigene Lokomotive auf die Schiene zu bringen: Der Prototyp des Konstrukteurs Friedrich Kriegar in der Königlichen Eisengießerei in Berlin taugt 1815 nur dazu, ein bisschen auf dem Fabrikgelände herumzufahren, zu schwach und unzuverlässig ist er für den kommerziellen Eisenbahnverkehr26. Auch die von L. C. Althans konstruierte Lok benimmt sich bei der öffentlichen Erprobung 1822 nach zeitgenössischen Berichten »wie ein bockiges Pferd« und wird schließlich verschrottet. Für Deutschland heißt das: Ob es auf lange Zeit ein zurückgebliebenes Entwicklungsland ist oder bald wieder im Konzert der Mächte mitspielen kann, hängt von einer Schlüsseltechnologie aus dem Ausland ab. Für die erste Strecke von Nürnberg nach Fürth importiert man die Lokomotive samt Lokführer aus England.
Jede Basisinnovation stößt zu ihrer Zeit auf Unverständnis und Widerstand: Grauen erfasst viele Deutsche beim Anblick des dampffauchenden Ungetüms mit seiner Wahnsinnsgeschwindigkeit von 35 Kilometern in der Stunde: »Die schnelle Bewegung muss bei den Reisenden unfehlbar eine Hirnkrankheit, eine besondere Art des Delirium Furiosum erzeugen«, soll das bayerische Obermedizinalkollegium angeblich in einem Gutachten gewarnt haben. Und wenn sich aber dennoch jemand in eine so »grässliche Gefahr« begeben wolle, dann müsse der Staat wenigstens die Zuschauer schützen, die schon vom Hinsehen dieselben Gehirnkrankheiten bekommen können – und zwar mit einem hohen Bretterzaun auf beiden Seiten. Prediger verteufeln die Bahn, weil, wenn Gott gewollt hätte, dass sich der Mensch auf Rädern fortbewege, dann hätte er ihm auch welche gegeben.
Im ersten Jahrzehnt bis 1845 werden nur 2294 Kilometer gebaut – kaum genug, um eine Branche anhaltend zu beschäftigen, und selbst die Investitionen scheinen sich zunächst nicht genug zu rentieren, weil es zu wenig Gewerbe gibt, das die Eisenbahn nutzen kann. Die Krisenjahre in den 1840ern erklären Wirtschaftswissenschaftler mit »Überinvestition«. Die Kondratiefftheorie präzisiert, dass sich die technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Systeme zwar parallel, aber nicht gleich schnell entwickeln und deswegen im Ungleichgewicht sind. Viele neu gegründete Betriebe sind in einer kritischen Lage, das Geschäft stagniert, das Geld ist knapp, es gibt wieder mehr Arbeitslose. Selbst der Lokomotivfabrikant Borsig muss in Berlin 400 Arbeiter entlassen. Kapital ist zwar billig, aber Prognosen für deutsche Verhältnisse zu optimistisch. Der Bau der Eisenbahn ist risikoreich (der Deutschen Bahn ergeht es beim Neubau der ICE-Strecken heute nicht anders): Niemand weiß vorher, wie teuer der Kauf der benötigten Flächen wird, da die Grundstückspreise explodieren, wenn durchsickert, wo die Trasse verlaufen wird. Auch die Bauarbeiten sind kaum zu kalkulieren, weil die Beschaffenheit des Geländes die Ingenieure immer wieder überrascht. Noch schwerer lässt sich abschätzen, wie viele Menschen später mit dieser Bahn fahren werden.
Und dennoch setzen die fertiggestellten Eisenbahnen die gesellschaftlichen Strukturen europaweit unter Druck: Allein in Deutschland werden 1847 mehr als 1000 Kilometer Schienenstrecke neu fertiggestellt, ohne dass sich die wirtschaftlichen Gängeleien lockern. Der Revolution, die seit 1848 von Paris kommend auf ganz Europa übergreift, geht es daher vor allem um bürgerlich-wirtschaftliche Rechte wie Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit, ja sogar um eine demokratische Staatsverfassung – also darum, seine Wirtschaftsinteressen in Lobbyverbänden vertreten zu dürfen, sich aus der Zeitung zuverlässig über ökonomische Vorgänge zu informieren und am Ende im Parlament darüber mitentscheiden zu können, wie Steuergelder für den Bau von Infrastruktur ausgegeben werden.
Wie schon 1789 in Frankreich geht es nicht um Arbeiterinteressen wie »Mehr Lohn« oder dass Unternehmer in bessere Arbeitsbedingungen investieren sollen – dafür gibt es in Deutschland noch viel zu wenig Arbeiter. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. erlaubt zwar eine unabhängige Justiz, die Pressefreiheit und ein Vereinsrecht, doch er weigert sich, seine Truppen aus Berlin abzuziehen. Es kommt zu Barrikadenkämpfen mit 183 Toten. Der König gibt nach, entblößt die Hauptstadt von Truppen und verneigt sich vor den Märzgefallenen. Die bürgerliche Revolution scheint ihre Ziele erreicht zu haben – indem sie die Arbeiterschaft für sich instrumentalisiert, die noch gar nicht weiß, dass sie eigentlich noch ein paar ganz andere Interessen hat als ein Fabrikant, Professor oder Handwerksmeister.
Am Ende gibt es zwar das erste demokratisch gewählte deutsche Parlament, aber keine Staatsgewalt, die seine Beschlüsse umsetzt – der preußische König lehnt die angebotene Kaiserkrone aus der Hand des pöbeligen Volkes ab. Das Parlament zerläuft sich, weil die Großbürger vor den immer radikaleren Forderungen der Arbeiter Angst bekommen. Als der Kaiser nicht kommt, gehen sie eben wieder brav nach Hause und vereinbaren mit ihren jeweiligen Monarchen einen unausgesprochenen Kuhhandel: keine Revolution mehr, dafür ab jetzt so richtig Bahn frei für exzessives Wirtschaften. Mit jedem weiteren Eisenbahnkilometer, der ab jetzt schnell gebaut wird, wachsen die Möglichkeiten, Waren zu kaufen, zu verarbeiten und zu verkaufen, entwickelt sich die Wirtschaft stürmisch. Bis 1855 werden in Deutschland weitere 6000 Kilometer Schienen gebaut, bis 1865 nochmals 6400 Kilometer. Und bis 1875 zum Höhepunkt des zweiten Kondratieffs kommen 13270 Kilometer hinzu.27
Neue Märkte verschieben das Machtgleichgewicht
Weil verschiedene Gesellschaften die Strukturen des neuen Kondratieffs unterschiedlich gut umsetzen, sind Länder wie Deutschland plötzlich zwei- bis dreimal so stark wie andere. Nach dem Wiener Kongress 1814/15 waren die Karten zwischen den Ländern erst einmal verteilt gewesen. Der erste Kondratieffabschwung hat das »Konzert der Mächte« stabilisiert. Doch mit dem nächsten langen Kondratieffaufschwung verschieben sich die Gewichte – darin sieht Nikolai Kondratieff28 die Ursache von bewaffneten Auseinandersetzungen. In den Aufschwungjahren des zweiten Kondratieffs kommt es zu Kriegen, bei denen jene Länder militärisch geschlagen werden, die den neuen Strukturzyklus nur zögerlich erschließen: Ihnen fehlen bessere Stahlgeschütze, Nachrichtenverbindungen entlang der Bahn sowie Kapazitäten an Transport und an Fabriken, um Nachschub zu produzieren, Truppen auszurüsten und zu versorgen.
Beispiel Krimkrieg 1853 – 1856: Die Russen fordern vom Osmanischen Reich, den orthodoxen Christen in Palästina Schutzrechte zuzugestehen; die Türken lehnen ab. Russland besetzt die Donaufürstentümer Moldau und Walachei, daraufhin erklärt die Türkei Russland den Krieg, den der »Kranke Mann am Bosporus« bald verlieren würde. Weil die Engländer nicht wollen, dass Russland so stark wird, schicken sie eine Expeditionsarmee – sie können sich das leisten. Die Franzosen träumen wieder davon, »Grande Nation« zu werden, und schließen sich den Briten ebenso an wie 15 000 Soldaten aus dem norditalienischen Staat Piemont-Sardinien, dem es weniger um die Türken geht als um seine eigene internationale Anerkennung.
Der Ausgang der Kämpfe ist von vornherein klar: Während England im frühen 19. Jahrhundert seine Eisenproduktion verdreiunddreißigfacht, kann zum Beispiel Russland seine Eisenproduktion in dieser Zeit nur verdoppeln.29 Da aber die meisten Russen nach wie vor in der Landwirtschaft arbeiten, wird das, was sie herstellen – Agrarprodukte –, meist sofort verbraucht. Sie erwirtschaften kaum einen bleibenden Mehrwert, der investiert oder in militärische Kraft umgesetzt werden kann. Die russischen Holzschiffe sind den mit Schrapnellkanonen bewaffneten Dampf-Kriegsschiffen der Engländer hoffnungslos unterlegen.
Vor allen Dingen haben die Engländer die Industriekapazität, schnell ein paar neue Kanonenboote zu bauen. Und die altmodischen Steinschlossmusketen der Russen, mit denen man vielleicht 80 Meter weit treffen kann, sind den zuverlässigeren Stahlgewehren der Alliierten unterlegen. 480.000 schlecht ausgebildete russische Bauernsöhne fallen. Der Krieg findet statt, weil ihn sich die Franzosen und Engländer im langen Aufschwung leisten können; aber wer ausgerechnet in der Hochphase der Konjunktur Kriegsanleihen ausgibt wie die französische Regierung, der konkurriert mit den Eisenbahnfirmen um Kapital und heizt die Preisspirale an. In Frankreich kommt es wegen der Inflation zu Volksaufständen.
Der amerikanische Bürgerkrieg 1861 - 1865 ist ein Krieg zwischen zwei Wirtschaftsgebieten, deren Strukturen sich nicht mischen lassen und die unterschiedlich schnell wachsen: Im Norden produzieren 1860 schon 110.000 Fabriken, im plantagenbewirtschafteten Süden dagegen nur 18.000. Die gesamten Konföderierten stellen nur 36700 Tonnen Roheisen her – das ist eine winzige Menge im Vergleich zu Nordstaaten wie Pennsylvania, das alleine 580.000 Tonnen im Jahr produziert.30 Die Nordstaaten gewinnen – wegen ihres größeren industriellen Potenzials. Dänemark denkt, seine Staatskasse sei gefüllt genug, das von ihm regierte Schleswig-Holstein 1863 ganz zu annektieren – Preußen und Österreich besiegen die Dänen 1864 in einem kurzen Krieg. Den Machtkampf zwischen Österreich und Preußen im deutsch-deutschen Krieg 1866 hätte keine Seite in wirtschaftlicher Krisenzeit vom Zaun gebrochen.
Die deutschen Staaten schlagen Frankreich 1870/71, weil sie – das ist in diesem Strukturzyklus entscheidend – längere Bahnstrecken haben, die vor allem in Preußen nach militärischen Gesichtspunkten angelegt worden sind. Deutschlands Eisen- und Stahlproduktion überholt gerade die Frankreichs, seine Kohleförderung ist zweieinhalbmal so groß, sein Energieverbrauch ist um die Hälfte höher. Moltkes Strategie und die Kruppschen Stahlkanonen geben den entscheidenden Ausschlag. Danach bricht erst einmal für ein Vierteljahrhundert ein durch wirtschaftliche Erschöpfung erzwungener Friede aus.
Gefragt sind neue Kompetenzen
Der Sieg über Frankreich verdeutlicht, dass ein Kondratieffzyklus keine Aggregation makroökonomischer Daten, sondern ein Kompetenzzyklus ist. Das militärische System ist nicht von der Gesamtgesellschaft abgekoppelt: Das hohe Niveau der Grundschulbildung in Deutschland bringt mehr Facharbeiter, kompetente Unteroffiziere und ausreichend Schreibstubenkräfte hervor. Als Sieger der Schlacht bei Sedan gilt der preußische Schulmeister. Die Franzosen sind durch die Niederlage gezwungen, große Bereiche ihrer Gesellschaft – Erziehung, Verwaltung, Wirtschaft – zu überprüfen und zu reformieren. Nach 1871 schicken sie ihre besten Studenten nach Deutschland, um an den Universitäten des Feindes zu lernen.
Jede Basisinnovation stellt eben neue Anforderungen an Menschen, wie Arbeit zu organisieren ist. Jeder Strukturzyklus hat daher seine eigenen betriebswirtschaftlichen Erfolgsmuster: Im zweiten Kondratieff lernen Manager, eine Großorganisation wie die Eisenbahn zu verwalten – mit gigantischer Kostenrechnung, Unterhalt von Bahnhöfen, Reparaturwerkstätten und Gleisanlagen. Sie lernen, Personal auf mehreren Kompetenzniveaus auszubilden, Investitionen langfristig abzuschreiben und unterschiedlichste Faktoren auf weite Sicht und pünktlich zu planen. Die Eisenbahn-Aktiengesellschaften sind die betriebswirtschaftliche Spielwiese für die Massenproduktion des dritten Kondratieffs. Entlang der Eisenbahnlinien verbreitet sich der elektrische Telegraf. Damit wird die Bahn nicht nur zum Transportmittel von Waren und Menschen, sondern auch von Informationen.
Das beste Beispiel, ökonometrische Modelle ad absurdum zu führen, die einem weismachen wollen, die Wirtschaft würde wachsen, wenn man Geld oder Investitionen quer Beet über die gesamte Volkswirtschaft gießt, ist der steile Aufstieg von Unternehmern und Unternehmen der Branchen, die den neuen Kondratieffzyklus ermöglichen. Alfred Krupp hält schon 1832 überhaupt nichts von der Vorstellung, der Markt würde sich irgendwie zufällig entwickeln und sei völlig unvorhersehbar. Schon als Zwanzigjähriger ist er sich sicher, dass dem Gussstahl die Zukunft gehört und dass ihm niemand seinen Vorsprung wegnehmen kann, wenn er nur immer besser und schneller ist als die Konkurrenz.31 Menschen in sicheren Positionen dagegen ändern nicht gerne etwas. Als Alfred Krupp dem preußischen Kriegsministerium (einen Kondratieffzyklus zu früh) Gewehrläufe aus Gussstahl schickt und ihm anbietet, nach demselben Verfahren auch Geschütze zu gießen, erklären ihm die Beamten, dass das Vorhandene allen Anforderungen entspräche und kaum etwas zu wünschen übrig lasse.
Mit dem Deutschen Zollverein vervielfacht sich das potenzielle Absatzgebiet. Krupp kommt von seiner zweiten großen Auftragstour durch Süddeutschland mit Aufträgen für zwei Jahre heim. Seine acht Arbeiter können das gar nicht bewältigen, erst recht nicht in Abhängigkeit von dem launigen Flüsschen Berne, das sein Hammerwerk meistens stillstehen lässt. Für eine Dampfmaschine fehlt das Geld. Und dem wenig solventen Unternehmer der damaligen New Economy geben die Banken keinen Kredit. Die Gutehoffnungshütte nimmt den Auftrag zum Bau einer 20PS-Dampfmaschine erst an, als Krupp die persönliche Bürgschaft eines stillen Teilhabers vorlegen kann. Die funktioniert dann zwar nur mäßig und mit höchstens zehn Pferdestärken, aber der Betrieb kann nun endlich ununterbrochen produzieren.
Sein Stahl ist in dieser Zeit noch kein Massenprodukt wie im dritten Kondratieff, aber dennoch wichtig für Maschinen und Lokomotiven, die besonders festes Material benötigen. Daher spiegelt sich in der Zahl der bei Krupp Beschäftigten auch der Verlauf des zweiten Kondratieffs wider (von wegen, es gäbe so etwas wie einen »natürlichen Wachstumspfad«, der die Wirtschaft jedes Jahr statistisch anderthalb Prozent wachsen lasse): Die Essener Stahlschmiede von Krupp beschäftigt während der Revolution 1848 gerade mal 100 Arbeiter. 1857 sind es 1000, 1865 dann 8000, und ihre Zahl verdoppelt sich weiter bis 1873. Die Kondratiefftheorie widerspricht damit der etablierten Wirtschaftswissenschaft vehement: Die Wirtschaft wächst vor allem deswegen, weil massiv in das neue technologische Kompetenznetz eines neuen Kondratieffzyklus investiert wird – in Ausbildung, Infrastruktur und Verhaltensweisen. Nicht mit Zeitreihen makroökonomischer Daten allein, sondern nur mit dem Blick auf soziale Veränderungen ist Wirtschaft zu verstehen.
Wieso früher die Zeiten weder besser, noch die Menschen christlicher waren
Zu den Opfern des neuen Strukturzyklus gehören die Handwerkszünfte und der von einer Familie bestellte Bauernhof. Die neue Wirtschaftseinheit – das sind jetzt der Einzelne und die Fabrik. Die Eltern verlieren die ökonomische Basis für ihre Autorität und moralische Funktion. Anstatt erst dann wirtschaftlich selbständig zu werden, wenn der Meister stirbt oder der Bauer aufs Altenteil geht, ist der Teenager der beginnenden Industriegesellschaft vom ersten selbst verdienten Geld an unabhängig. Bisher hat die wirtschaftliche Abhängigkeit von einem Moralkodex der Eltern und der Dorfgemeinschaft frühe Ehen verhindert – und damit auch mehr Geburten, als die Agrargesellschaft ernähren kann. »Die industrielle Gesellschaft gerät in ein amoralisches Interregnum zwischen einem Moralkodex, der auseinander bricht, und einem neuen, der noch keine Gestalt angenommen hat.«32
Wieder ist das freie Wirtschaften, ist der Liberalismus eine Emanzipationsbewegung, die zu Beginn destruktiv ist und erst 100 Jahre später durch die soziale Marktwirtschaft domestiziert wird. Viele Fabrikanten geben ihren Arbeitern kein Geld auf die Hand, sondern Gutscheine, mit denen sie zu überhöhten Preisen in dem unternehmereigenen Geschäft einkaufen müssen. Der saarländische Berg- und Hüttenwerksbesitzer Carl Ferdinand Freiherr von Stumm-Halberg verkündet lauthals seine mittelalterliche Auffassung vom Herrschen und Gehorchen.33 Eine Fabrik sei ein Gebilde, das militärisch, nicht parlamentarisch zu organisieren sei. Er ist der Herr-im-Haus: Sogar die Erlaubnis, ob jemand heiraten darf, maßt er sich an, oder ob ein Untergebener gegen einen anderen Betriebsangehörigen vor Gericht ziehen darf oder nicht. Arbeiter, die auch nur in ein Wirtshaus gehen, in dem sozialdemokratische Versammlungen stattfinden, werden entlassen. Er lässt seine Arbeiter bespitzeln, belohnt Denunzianten, bestraft jeden, der seiner Meinung nach vom rechten Weg abgekommen ist. Sie haben – zumindest was er darunter versteht – gottesfürchtig, gehorsam und dankbar zu sein. Und die meisten sind es auch, oder tun zumindest so.
In den Erzgruben Oberschlesiens herrschen Mitte des 19. Jahrhunderts Zustände wie bei der mittelalterlichen Leibeigenschaft: Wer nicht spurt, wird davongejagt, und wenn die Arbeiter aufmucken, bringt das Militär die Bergarbeiter unter die Erde – so oder so. Schließlich kommen genug Arbeitshungrige aus dem Osten nach. Die Magnaten sehen ihren Reichtum als gottgegeben an und unternehmen nichts, um die Zukunft der Region abzusichern, wenn das Erz abgebaut ist – so wie heute manche Ölscheichs. Ihre Renommierschlösser bauen sie in Sichtweite der Arbeitersiedlungen, in denen Zehntausende zusammengepfercht am Existenzminimum dahinvegetieren, während die »Herrschaft« von goldenen Tellern speist.
Trotz harter und fast ständiger Arbeit bleibt den einfachen Menschen zunächst wenig übrig: Unseren Vorfahren vor sechs Generationen werden nicht nur die Ressourcen für die aktuellen Investitionen in Eisenbahn und Infrastruktur (die wir heute noch nutzen) vom Munde abgespart, sondern auch noch die Mittel für die industrielle Aufholjagd des rückständigen Landes. Wir sollten Denkmäler für die errichten, die unter erzwungenem Konsumverzicht und um den Preis vieler Lebensjahre Gleisdämme geschaufelt und Brückenpfeiler vermörtelt haben.
Denn auf dem Höhepunkt des zweiten Kondratieffs wird ein Berliner Maurer im Durchschnitt 45 Jahre alt, ein Fabrikarbeiter 43,5 und ein Weber nur 32 Jahre. Häufigste Todesursache ist Tuberkulose.34 90 Stunden pro Woche beträgt die durchschnittliche Arbeitszeit für Erwachsene zwischen der Revolution von 1848 und der Reichsgründung, Frauen und Kinder schuften unter Tage. Kinderarbeit wird dann aber (leider) nicht deswegen gemildert, weil sich jemand der Kinder erbarmt. Wer sich als Erster dagegen wirkungsvoll wehrt, ist die preußische Armee, die mit den ausgemergelten, krummen Achtzehnjährigen nichts anfangen kann. Der preußische Kriegsminister von Horn macht sich große Sorgen darüber, dass das »Rekrutenmaterial« von Jahr zu Jahr schlechter werde.
Kein Wunder, liest man Briefe von Friedrich Engels, die er im März 1839 aus Wuppertal schreibt: »In Elberfeld allein werden von 2500 schulpflichtigen Kindern 1200 dem Unterricht entzogen und wachsen in den Fabriken auf, bloß damit der Fabrikherr nicht einem Erwachsenen, dessen Stelle sie vertreten, das Doppelte des Lohnes zu geben nötig hat, das er einem Kind gibt.« Selbst Kinder unter neun Jahren müssen bis zu 14 Stunden am Tag schwerstarbeiten. Ein amtlicher Bericht beschreibt die schweren Schäden an den minderjährigen Arbeitskräften: »Bleiche Gesichter, matte und entzündete Augen, geschwollene Leiber, aufgedunsene Backen, geschwollene Lippen und Nasenflügel, Drüsenschwellungen am Hals, böse Hautausschläge und asthmatische Zustände …, die sie in gesundheitlicher Beziehung von anderen Kindern derselben Volksklasse, welche nicht in Fabriken arbeiten, unterscheiden.« Auf Druck der Armee schreitet das »königlich preußische Fabrikregulativ« am 9. März 1839 dagegen ein: Kinder unter neun Jahren dürfen nicht mehr in Fabriken beschäftigt werden, Jugendliche bis 16 Jahre nicht mehr als zehn Stunden. Mit den Dorfstrukturen und den Familienbanden hat sich auch das Geschlechtsleben gelockert – von wegen, die 1970er Jahre wären die Zeit der sexuellen »Befreiung« gewesen.
Je rücksichtsloser die Industriegesellschaft voranschreitet, umso größer wird vor allem die Not der Frauen, die aus den verarmten Bauernhöfen oder lohnabhängigen Großgütern in die Städte strömen. Während ledige Mütter in Preußen nach dem »Allgemeinen Landrecht« von 1794 vom Vater des Kindes Alimente verlangen konnten, befreit 1854 ein neues Gesetz die unehelichen Väter von allen finanziellen Verpflichtungen. Unter den 17- bis 45-jährigen Frauen in Berlin geht 1846 etwa jede achte der Prostitution nach35, die allesamt der ärmeren hilflosen Klasse angehören.
Die unglücklichen Bürgertöchter, die seit ihrem 17. Lebensjahr zu Hause herumsitzen und darauf warten müssen, dass sie geheiratet werden, reagieren mit Prüderie bis Leibfeindlichkeit, auch um sich von der Unterschicht abzugrenzen. Das züchtig Zugeknöpfte, in Wirklichkeit ein Statussymbol des aufkommenden Bürgertums des 19. Jahrhunderts, übertrifft die bis dahin vorhandene religiös motivierte Vorsicht im Umgang mit Sexualität – man denke nur an die prallen Abbildungen in früheren Barockkirchen und daran, dass der eheliche Geschlechtsakt in der katholischen Kirche sogar mit einem Sakrament geheiligt ist.
Zwischen der neuen Arbeiterschicht und den Kirchen herrscht anfangs Sprachlosigkeit. Die einen leben aus der Sicht der anderen in ziemlich viel Sünde, auf die anderen jedoch verwettet Anfang des 19. Jahrhunderts niemand mehr einen Pfennig, denn die Institution Kirche ist nach der Säkularisierung erst einmal kraftlos. Es dauert, bis zahlreiche Laien die Ärmel hochkrempeln und etwas auf die Beine stellen. Kein Wunder, dass in dieser Zeit so viele Klöster oder Diakonissen-Schwesternschaften gegründet werden – sie sind eine Reaktion auf die soziale und daher vor allem auch seelische Not. Sie sind Initiativen von unten, bedrängt von ihrem Bischof oder ihrer Landeskirchenleitung, sich doch bitte endlich Statuten zu geben und sich um die kirchenrechtlich formale Einordnung zu kümmern. Dass heute kein Mensch mehr die Namen der damaligen Bischöfe, dafür eine Reihe von Ordensgründerinnen und einfachen Priestern kennt, legt den Verdacht nahe, auch heute die entscheidenden Initiativen nicht nur von den Bischöfen zu erwarten.
Es dauert auch im 19. Jahrhundert, bis eine Generation heranwächst, welche die neuen sozialen Verhältnisse und den Glauben zusammenführt. Adolf Kolping, 1813 in Kerpen bei Köln geboren, lernt als Schuhmachergeselle die Not der stellungslosen Handwerkergehilfen kennen, bevor er Priester wird. Er gründet jene Gesellenvereine, aus denen das bis heute lebendige Kolpingwerk der katholischen Kirche hervorgeht. Eine Ausnahme im Adel ist Freiherr Wilhelm Emanuel Ketteler: Als unvereinbar mit dem christlichen Glauben sieht er, Arbeiter ungerecht zu bezahlen und unzureichend zu versorgen. Bei der Beerdigung der bei den Volksaufständen 1848 ermordeten Abgeordneten General Hans Adolf von Auerswald und Fürst Felix von Lichnowsky trägt er in seiner Grabrede zum ersten Mal seine Gedanken zur christlichen Soziallehre vor. Zwei Jahre später wird er Bischof von Mainz und nimmt sich in diesem Amt der sozialen Frage an.
Das proletarische Bewusstsein, das sozialistische Theoretiker propagieren, will aber nicht so richtig aufkommen – trotz der Not von Frauen, Kindern und dem harten Arbeitsleben, trotz der Ausbeutung. Vom obdachlosen Tagelöhner bis zum unermesslich reichen Industriemagnaten: Die Industrialisierung hat die Gesellschaft so stark diversifiziert, so viele neue Rangstufen geschaffen, dass nun jeder danach trachtet, wenigstens bis zur nächsthöheren Schicht aufzusteigen. Statt einfach als Bauer, Handwerker oder Adeliger zugeordnet werden zu können, hat sich das öffentliche Leben zu einem Kastenwesen entwickelt, in dem jeder die Möglichkeit bekommt, sich als ein höheres Wesen zu fühlen. Selbst der Tagelöhner erster Klasse kann noch auf den Tagelöhner zweiter Klasse herunterschauen. Das ist so wie heute in Südafrika, wo zwar jeder in eine Kirche geht, dafür aber gerade unter Schwarzen ganz genau registriert wird, wie schwarz, wie weiß, also in welchem Maße gemischt jemand ist – davon hängt dann das gesellschaftliche Prestige ab.
Die deutschen Adeligen leiden zwar insgeheim darunter, dass sie von den sozialen Aufsteigern wie Krupp, Thyssen oder Borsig in der Regel an Geld, Wissen und Tüchtigkeit längst überholt worden sind. Aber sie finden einen genialen Trick, ihren höheren Rang mit formalisiertem Verhalten zu kitten: Geld und Tüchtigkeit reichen nicht – man muss die Etikette der vornehmen Verhaltensweisen beherrschen. »Vor der Raffinesse des höfischen Zeremoniells schrumpfen sie (die Neureichen) unversehens wieder aufs plumpe bürgerliche Normalmaß zusammen.«36 (Das wirkt noch heute überall dort weiter, wo die formale Höflichkeit wichtiger ist als die Höflichkeit des Herzens.)
Während in den USA derjenige ein toller Typ ist, der eine Fabrik aufbaut oder erfolgreich eine Bank führt, ist in Preußen jeder kleine Leutnant einem noch so erfolgreichen Geschäftsmann überlegen. Und ein brillanter Professor hat in der preußischen Hackordnung selbst gegen einen leicht verblödeten Major das Nachsehen. Künstler, Philosophen und Geschichtsschreiber wiederum verunsichern Geld- und Blutsadel damit, den höchsten Rang den Geistesgrößen zuzuschreiben – also ihresgleichen – und sich so selbst an die Seite der Mächtigen zu stellen. Eine kooperative, christliche Gesellschaft ist das wahrlich nicht, egal, wie viele Kirchen gebaut werden. Die Zeiten waren früher weder besser noch christlicher als heute. Allein die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin: Da wird eine Kirche nicht einem Heiligen oder der Auferstehung Christi geweiht, sondern dem obersten Hierarchen des diesseitigen Staates ein Heiligenschein verpasst – ein Trick, um die Kraft der Gottgläubigkeit für die eigene Macht auszunützen. Klar, dass später mit der Niederlage des Kaisers im Ersten Weltkrieg für manche auch der liebe Gott abdankt.
Nur ein langer Aufschwung verbessert die Situation der Unterschicht
Je länger dieser zweite Kondratieffaufschwung andauert, umso heißer läuft die Konjunktur. Abgesehen von schwierigeren Jahren 1857/60 geht es mit der deutschen Wirtschaft ständig bergauf. Damit werden alle Produktionsfaktoren immer knapper, auch Arbeit. In jedem Verlauf eines langen Kondratieffaufschwungs verbessert sich die Verhandlungsposition der Arbeiter – je mehr die Geschäfte der Unternehmer florieren, umso wirksamer ist ein Streik. Besonders im Krieg ist die Konjunktur bis zum äußersten angespannt – die ersten größeren Streiks finden statt im Kriegsjahr 1864 (gegen Dänemark), angezettelt von örtlichen Arbeitern. Und die Fabrikanten geben nach – was sie dank der Kriegskonjunktur auch können. Die höchsten Lohnsteigerungen setzen die Arbeiter in den Boomjahren 1870/73 durch. Da alle Branchen rotieren und täglich neue Aktiengesellschaften gegründet werden, wird der Faktor Arbeit knapp – trotz der Zuwanderung aus dem Osten. Einzelne Streiks, die auf Betriebe oder regionale Branchen beschränkt sind, erkämpfen in Einzelfällen 25 oder gar 35 Prozent mehr Lohn (ähnlich den 14 Prozent Lohnsteigerungen, welche die Gewerkschaften Anfang der 1970er Jahre durchsetzen).
Das ist nun so gar nicht nach dem Drehbuch von Karl Marx, der sein Werk vor allem unter dem Eindruck des ersten Kondratieffabschwungs geschrieben hat. Der Kapitalismus bricht nie zusammen, weil die Profitraten der Unternehmer eben nicht immer nur fallen, sondern im nächsten langen Aufschwung wieder saftig steigen. Der Marxismus ist damit schon obsolet, als sich der zweite Kondratieff entfaltet. Statt Konfrontation setzen die ersten deutschen Gewerkschaften wie die Barmer und Elberfelder Türkisch Rotfärber-Gesellschaft 1848 im Kondratieffaufschwung eher auf Kooperation mit den Arbeitgebern. Pragmatische Führer wie Ferdinand Lassalle wollen reale politische Macht gewinnen: Die Arbeiter sollen sich als politische Partei organisieren, die das allgemeine und gleiche Wahlrecht anstrebt. Nachdem die tägliche Arbeitszeit von 14 Stunden in den 1840ern auf zwölf Stunden sinkt, bleibt neben dem Schlaf erstmals freie Zeit, die eigenen Interessen zu organisieren. 1863 gründet Lassalle den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, der die Arbeiterbewegung sammelt. Nachdem er ein Jahr später bei einem Duell aus lächerlichem Anlass stirbt (seine Geliebte ist zu ihrem Ex-Verlobten zurückgekehrt), zerfällt der Arbeiterverein teilweise.
Wilhelm Liebknecht und August Bebel gründen 1869 in Eisenach die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, mit der Lassalles Anhänger 1875 unter dem Namen Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands zusammengehen. Nur leider sind jetzt mit den wirtschaftlich guten Zeiten auch die politisch guten Zeiten für die Arbeiterbewegung vorbei: In den Krisenjahren ist die Verhandlungsposition der Unternehmer stets besser (wie in jedem langen Abschwung). Dass es zum großen Gründerkrach mit anschließender lang andauernder Wirtschaftskrise kommt, ist jedoch keine Laune des Wetters oder der Finanzmärkte, sondern liegt daran, dass sich das technologische Netz des zweiten Kondratieffs allmählich erschöpft.
Was wir 2001 und 2008 aus dem Gründerkrach von 1873 hätten lernen können
Weil nicht der Staat, sondern die Privatwirtschaft den Eisenbahnzyklus vorantreibt, kommt das nötige Kapital aus der wohlhabenderen Mittelschicht: Wer Anteile kauft, verleiht sein Geld zu einem Zinssatz, den er nicht kennt, weil der davon abhängt, wie rentabel sich die Firma in Zukunft entwickeln wird. Schon in den 1860ern werden die Eisenbahn- oder Bankaktien für immer mehr Leute attraktiv. 1870/71 fallen die Aktienkurse zunächst – durch einen externen Schock: Den deutsch-französischen Krieg. Doch dann bricht ein beispielloses Aktienfieber aus: Mittlere Familienunternehmen werden in Aktiengesellschaften umgewandelt. Ein Finanzkomitee kauft dem bisherigen Besitzer die Firma zu einem weit überhöhten Preis ab, zweigt sich in Form von Spesen, Provisionen und Gebühren eine ordentliche Summe ab und gibt dann so viele Aktien aus, dass das Grundkapital zwei bis dreimal so hoch ist wie der tatsächliche Wert des ganzen Betriebes.
Gut aufgemachte Prospekte und sensationelle Zeitungsberichte treiben das zahlungsbereite Publikum zu. Sie erzeugen künstlich Knappheit, indem nur einige Banken die Aktien anbieten – und nur am ersten Tag noch zum Ausgabekurs von 100 Prozent. So suggerieren sie, nur der könne schnell reich werden, der sofort zugreift. Alle wollen möglichst viel verdienen und möglichst wenig dafür tun. Immer zahlreicher werden Finanzmakler, die in der Nachbarschaft Aktien anbieten. »Niemand machte sich mehr die Mühe, auf solide Art zu wirtschaften, alles musste möglichst schnell gehen und möglichst hohe Gewinne abwerfen«, schreibt der Journalist Günter Ogger in seinem Bestseller »Die Gründerjahre«.37
Die preußische Regierung reagiert am 27. Juni 1870 mit dem neuen Aktiengesetz auf die wachsende Nachfrage und räumt wesentliche Hindernisse aus dem Weg: Jetzt ist keine staatliche Konzession mehr nötig, um eine AG zu gründen, sondern jeder darf so oft und so viel gründen, wie er will; Geschäftsleitungen sind keiner Kontrollbehörde mehr unterworfen. Sind in den fast drei Generationen zwischen 1790 und 1870 nur 300 Aktiengesellschaften zum Börsenhandel zugelassen worden, so kommen in den beiden (!) Jahren 1871/72 über 780 neu hinzu – also im Schnitt eine am Tag.
»Enrichez-vous!« (Bereichert Euch!) wird zum kategorischen Imperativ der Gründerjahre und ähnelt damit den Sprüchen dubioser Management- und Motivationstrainer der späten 1990er Jahre. Reichtum erklären die Fabrikanten zur gerechten Belohnung für ein gottgefälliges Leben. »Der Reiche ist reich von Gottes Gnaden, der Arme aus demselben Grund – das war die Weltanschauung der Sozialdarwinisten«, schreibt Ogger38.
»Das Bürgertum kopierte damit im Grunde nur den Trick des Adels, der seinen Herrschaftsanspruch jahrhundertelang mit dem Gottesgnadentum verteidigt hatte.«
Am Kondratieff-Höhepunkt 1870/73 überschlägt sich schließlich die Wirtschaft: Mit dem Tempo, mit dem der Geldverkehr, die Börsen und der Warenverkauf zunehmen, strömt die Landbevölkerung in die Städte. Berlin verdoppelt fast die Zahl seiner Einwohner in drei Jahren von 500.000 im Jahr 1870 auf bald 900.000 im Jahr 1873. Es kommt zu Wohnungsnot und Mietanstieg (wie in München während der hitzigsten Jahre des Computeraufschwungs). Während eine normale Bürgerfamilie vor 1870 etwa ein Sechstel des Haushaltseinkommens für Miete ausgibt, sind es zwei Jahre später schon ein Viertel.
Wirtschaftshistoriker erklären die Börsenhausse samt anschließendem Crash 1873 mit den hohen Reparationszahlungen, die Frankreich nach seiner Niederlage am 28. Januar 1871 an Preußen zu zahlen hat: fünf Milliarden Goldfrancs innerhalb von drei Jahren – eine unvorstellbare Summe, die damals etwa dem jährlichen Volkseinkommen Preußens entspricht. Das Geld überschwemmt den Finanzmarkt, weil der preußische Staat damit nicht etwa eine neue Infrastruktur errichtet, sondern vor allem seine Schulden zurückzahlt. Das Geld, das die Bürger dem Staat in Kriegsanleihen und den Banken geliehen haben, steht nun plötzlich im Überfluss frei zur Verfügung. Weit mehr Geld wird angeboten, als sich Firmen oder Privatpersonen ausborgen wollen, obwohl doch der Preis für das geliehene Geld, der Zins, ins Nichts absinkt. Aus der Sicht der Kondratiefftheorie liegt das aber nicht an den französischen Reparationszahlungen, sondern daran, dass es im Höhepunkt des Zyklus kaum noch rentable Investitionsmöglichkeiten gibt. Hätte Frankreich seine Reparationen 1850 zu zahlen gehabt, das Geld hätte verhindert, dass im langen Aufschwung die Zinsen steigen, und wäre vom Eisenbahnbau und dem dadurch angeregten Unternehmertum aufgesogen worden.
So aber passiert, was auch ohne französische Geldspritze passiert wäre: Wer Geld hat, reagiert wie zu allen Zeiten (1927/29, 1973/74, 1996/2001 und 2005/2008), wenn mit festverzinslichen Anleihen nichts mehr zu verdienen ist. Sie kaufen Realwerte wie Rohstoffe oder jetzt eben vermehrt Aktien und spekulieren darauf, dass deren Wert in Zukunft stark steigt. Und das tut er auch. Aber nicht deshalb, weil die Firmen oder Rohstoffe nachhaltig an Besitz und Mehrwert zunehmen, sondern weil die anderen Marktteilnehmer gerade auch nichts anderes mit ihrem freien Geld anzufangen wissen, als es in spekulative Anlagen zu stecken. Und weil alle kaufen, steigt deren Wert. Je mehr sich herumspricht, dass man zumindest auf dem Papier mühelos reich werden kann, desto mehr Menschen steigen in das Geschäft ein. Bis selbst die untersten Besitzschichten wie Dienstboten ihren Spargroschen zur Bank tragen und darauf bestehen, irgendwelche Aktien zu erwerben. Bis 1870 haben sie kaum gewusst, was eine Aktie, geschweige denn die Börse, ist.
Schade, dass Generationen ihre Erfahrungen jedes Mal wieder mit ins Grab nehmen. Sie hätten die Aktionäre der »neuen Börsenkultur« des Jahres 1999/2001 vor Schaden bewahrt. Denn das Problem ist jedes Mal dasselbe (und es liest sich wie die Ereignisse auf den Weltfinanzmärkten 2008): Irgendwann sind die Kurse völlig überbewertet. Es braucht nur noch Anlässe, den Rückwärtsgang einzulegen. Am 7. Februar 1873 fliegen Schwindeleien des Eisenbahnkönigs Bethel Henry Strousberg beim Bau der Pommerschen Centralbahn und der Berliner Nordbahn auf – und sorgen dafür, dass jeder seine Strousberg-Aktien verkaufen will. Auch in den USA purzeln plötzlich die Eisenbahn-Aktien, was die Unruhe in Europa verstärkt. Als im Mai in Wien das Gerücht herumgeistert, zwei der größten Banken, darunter die Wiener Kreditanstalt, stünden vor dem Zusammenbruch (was stimmt), stürmen Sparer und Aktionäre die Schalter, um ihre Wertpapiere so schnell wie möglich zu verkaufen.
Die Kurse stürzen ab. Und zwar schließlich quer Beet durch alle Branchen. 61 Banken, 116 Industrieunternehmen und vier Eisenbahnunternehmen machen pleite. Hunderttausende verlieren ihre Ersparnisse, ganze Familien verarmen auf Generationen hinaus. Statt auf Reichtum sitzen manche auf Schulden, mit denen sie Aktien gekauft haben. Zeitungen drucken Tränendrüsengeschichten etwa vom gutgläubigen Agrarier, der sein Landgut verkauft, um in der Stadt als Rentner zu leben. Von dem Geld sowie mit einem Kredit kauft er Aktien einer erst zehn Monate alten »Centralbank für Bauten«, die zwar schon zehn Monate nach Gründung eine Superdividende von 43 Prozent auf den Nennwert der Aktie ausschüttet, der etwa ein Viertel des Kurses beträgt. Dieser beginnt jedoch plötzlich stark zu sinken, und nach nur einem halben Jahr ist das Vermögen aufgebraucht, der Restwert der Aktien reicht nicht, die Schulden zu begleichen.39 Die Selbstmordrate steigt 1873 so sprunghaft an wie später auch 1929.
An den Börsen sinkt der Aktienkurs ins Bodenlose und noch 1876 liegen die Kurse im Schnitt um 50 Prozent unter den Notierungen des Booms bis zum Februar 1873. Der Bankier Gerson Bleichröder, der die Krise glimpflich überstanden hat, schätzt damals, dass die Deutschen ein Drittel ihres Nationalvermögens verloren haben.
Auch die Immobilien-Blase bricht zusammen. Baugesellschaften machen reihenweise Pleite, weil ihre Grundstücke nur noch halb so viel wert sind wie zu der Zeit, als sie den Kredit bekommen haben. In Berlin stehen plötzlich Zehntausende Wohnungen leer (das ist zuvor undenkbar, angesichts des Wohnungsmangels), unzählige Hausbesitzer können ihre Bankkredite nicht mehr zurückzahlen. Was kommt, ist die schwerste und längste Wirtschaftskrise des 19. Jahrhunderts.
Es ist wie nach jedem Kondratieffhöhepunkt: Niemand will mehr kaufen, niemand mehr investieren. Die Firmen bleiben auf ihren Waren sitzen (reden vom »Käuferstreik« oder machen den Euro dafür verantwortlich), sie müssen den Preis zurücknehmen und sich von Gewinnen verabschieden wie die Aktionäre von Dividenden. Weil das auch nichts hilft, stagniert die Produktion im Kondratieffabschwung, immer mehr Menschen sind arbeitslos, es kommt zum Verteilungskampf, mit dem Ergebnis, dass die Löhne sinken.
Während der zweite Kondratieff in Europa 1873 den Rückwärtsgang einlegt, überschreitet er in den USA schon 1866 den Höhepunkt40 – im Jahr nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Unterschiedliche Wendezeiten, schreibt der Ökonom Nikolai Kondratieff, würden nicht seine Theorie in Frage stellen, sondern zeigten, dass die langen Strukturzyklen in verschiedenen Ländern zwar nicht identisch, aber doch ziemlich parallel verlaufen.41 Daher kann es auch keine mathematisch exakten Wendepunkte der langen Zyklen geben – nur ein Zeitfenster, in dem die Wirtschaft umkippt.
Die Krise nach 1873 ist vor allem eine Strukturkrise: Zusätzliche Eisenbahnkilometer machen nicht mehr wesentlich produktiver, es dauert immer länger, bis sich Investitionen amortisiert haben. Die Zahl der zusätzlich verlegten Schienenkilometer nimmt ab. Deutschland baut in dem Jahrzehnt bis 1885 nur 9690 und bis 1895 noch zusätzliche 8910 Schienenkilometer.42 Das gilt für jedes Land wie Großbritannien, die USA oder Deutschland: Addiert man die bestehenden Bahnkilometer zusammen, erhält man jeweils eine lang gezogene S-Kurve, die sich in den 1830ern/1840ern langsam entwickelt, dann in den 1850ern/1860ern stark ansteigt und sich in den 1870ern/1880ern wieder abschwächt. Diese Verlaufsform erklärt, warum lange Zyklen 40 bis 60 Jahre dauern, und sie erklärt den wirtschaftlichen Schwung dieser Jahrzehnte, der zuerst stotternd, dann mit Wucht die Konjunktur treibt und schließlich unvermittelt in langen Stagnationsjahren stehen bleibt: Der fallende Grenznutzen, also der sinkende Nutzen einer weiteren Investition, läutet den Kondratieffabschwung ein. Das heißt, ein zusätzlicher, neu gebauter Eisenbahnkilometer ist nicht mehr so rentabel wie bisher. Als man die großen Städte verbindet, bedeutet das einen großen Nutzen. Als man später von Kleinstädten noch Stichbahnen in die umliegenden Dörfer baut, nutzt das gerade den paar Bewohnern, deren Kapital in der Regel so gering ist, dass die Strecke schon sehr lange braucht, bis sie die Investitionskosten wieder eingefahren hat. Spekulative, aber unrentable Linien brechen zusammen.
2. Kondratieffabschwung Die große Depression
Historiker bezweifeln, ob es denn überhaupt eine Krise gegeben hat: Zwischen 1870 und 1890 verfünffachen die fünf größten Industrieländer ihre Eisenproduktion und produzieren am Ende 20-mal mehr Stahl. Doch subjektiv erleben die Menschen nach 1873 in ganz Europa eine Depression, fühlen sich ärmer als zuvor. Rückwärtsgewandt kultiviert die Kunst einen Baustil wie den Historismus, der in existenziell unsicheren Zeiten das Gefühl einer starken Trutzburg erzeugen will. Die Bayern haben das Gefühl, vor ihrem Beitritt zum Deutschen Reich 1871 (im langen Aufschwung) sei alles viel besser gewesen, was zwar stimmt, aber nichts mit den besserwisserisch auftretenden, schnodderigen preußischen Spitzenbeamten aus Berlin oder Essen zu tun hat. Ist die absolute Krisenstimmung mit apokalyptischen Visionen nur eine Massenpsychose? Nein: Die Preise, die Unternehmer pro Tonne Eisen erzielen, sinken, damit die Gewinne und im Gefolge auch die Löhne. Das Volkseinkommen geht in England von 1113 Millionen britischer Pfund 1875 auf 1076 Millionen Pfund 1880 zurück und stagniert bis etwa 1890. Die Nettoinvestitionen sinken inflationsbereinigt von 81 Millionen Pfund 1875 während der gesamten nächsten Jahre und erreichen 1890 einen Tiefpunkt mit 55 Millionen Pfund.43
Kein Wunder: Sobald ein halbwegs geschlossenes Eisenbahnnetz steht, konkurrieren Waren über eine Entfernung von Tausenden von Kilometern miteinander. Vor 1870 sind die wenigsten Bauern und Landwirte dem Wettbewerb ausgesetzt. Wer etwas mit großem Gewicht, aber relativ geringem Wert erzeugt – ein paar Tonnen Weizen –, dessen regionales Geschäft ist sicher, weil einem der Preis im Nachbarland egal sein kann, solange der Transport dorthin weit teurer ist als der Preisunterschied. Ab etwa 1870 spannt sich das Eisenbahnnetz weltweit um die Märkte: Der mittlere Westen und die Prärien der USA sind angeschlossen, bald auch die Kornkammer Ukraine, Argentinien, Australien und Kanada. Dampfschiffe können nun nennenswerte Lademengen mitnehmen. 1869 wird der Suez-Kanal eröffnet, was den Seeweg zwischen Europa und Indien/Asien dramatisch verkürzt.
Je mehr Anbieter durch die neuen Transportmittel beim Kunden mitbieten, umso intensiver wird der Wettbewerb, umso stärker werden die Gewinnspannen gegenseitig unterboten. Wieder (wie 1929 oder wie heute) suchen Unternehmen ihr Heil in der Überproduktion, um durch noch größeren Mengenausstoß die Kosten pro Stück weiter zu drücken und zu hoffen, dass sie dann gekauft werden. Es ist eine Krise der Ertragskraft. Während auch alle anderen Länder zu kämpfen haben, wächst England noch langsamer als der Rest. Sein Anteil an der Weltindustrieproduktion sinkt von 22,6 Prozent im Jahr 1880 auf 18,5 Prozent zur Jahrhundertwende.
Erst in der zweiten Hälfte der 1890er wird England wieder wertmäßig so viel exportieren wie in den 1870ern. Selbst die USA erleben trotz Wirtschaftswachstums zum ersten Mal ernsthaft Arbeitslosigkeit und eine Krise, welche die ganze Gesellschaft erfasst. Zeitgenossen nennen die 1880er die »große Depression«.
Auch in Deutschland erscheinen die Abschwungjahre 1873 bis 1896 vielen Zeitgenossen als eine erschreckende Abweichung von den historischen Erfahrungen. Die Preise sinken im Durchschnitt um 30 Prozent bei allen Waren. Seit Menschengedenken hat es eine solch drastische Deflation nicht gegeben. Auch der Zinssatz fällt so stark, dass die Wirtschaftstheoretiker an die Möglichkeit zu glauben beginnen, das im Überfluss vorhandene Kapital könne sich zu einem frei verfügbaren und kostenlosen Gut entwickeln. Die Profite schrumpfen zusammen. Für die damals Lebenden scheint sich die Depression unendlich lange fortzusetzen. Sie haben den Eindruck, das Wirtschaftssystem sei erschöpft.44
Das hat nichts mit Psychologie zu tun. Politiker irren, wenn sie meinen, sie könnten heute mit Psycho-Tricks und positivem Denken einen Aufschwung herbeireden. Ebenso halbwahr meint der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard in den 1950er Jahren, Wirtschaft sei zur Hälfte Psychologie. Natürlich hängt es von der Stimmung der Menschen ab, ob sie ihr Geld ausgeben oder im Sparstrumpf behalten. Aber Stimmung ist kein Hirngespinst, keine Einbildung, sie ist langfristig nicht mach- oder manipulierbar. Die Stimmung hängt von den realen Produktivitätssteigerungen ab, welche die Menschen hautnah spüren: Wenn sie für denselben Output weniger arbeiten müssen, für denselben Preis plötzlich viel bessere Waren einkaufen, oder umgekehrt, wenn sie für denselben Lebensstandard immer härter arbeiten müssen oder ihre Firma in Konkurs geht.
Die Gewinne der Unternehmen schmelzen so dahin, dass die kleinen Betriebe, welche die Industrialisierung getragen haben, die Krise nicht überleben – entweder, weil sie vom Markt verschwinden oder weil sie durch den ökonomischen Druck massiv wachsen: Bald zählen die Arbeiter bei Vickers in Barrow, Armstrong in Newcastle oder Krupp in Essen nach Zehntausenden. Es entstehen zwar wenige, dafür aber in jeder Branche immer größere Firmen, die untereinander die Preise absprechen und machtvoll Druck auf die Politik ausüben. Aber die Kartelle lösen gesamtwirtschaftlich keine Probleme, sie zementieren nur die schwache Konjunktur. Denn die Heimatmärkte stagnieren ja deswegen, weil es an Produktinnovationen und besseren Verfahren fehlt – Preisabsprachen verringern noch keine Herstellungskosten.
Das andere Überlebensrezept der Unternehmer im langen Abschwung ist die Flucht in noch größeren Massenausstoß, um die Stückpreise zu verringern. Doch der heimische Markt kann die vielen Güter gar nicht mehr aufnehmen. Das verändert die Politik: Während die Länder im Kondratieffaufschwung um Ressourcen konkurrieren, konkurrieren sie im Abschwung um Absatzmärkte. Deswegen kommen die Politiker nach 1873 unter Druck, Zölle und Handelsschranken zu errichten, damit ausländische Firmen den eigenen im Inland kein Geschäft mehr wegnehmen. Konservative Meinungsmacher, sonst fest hinter dem deutschen Reichskanzler Bismarck stehend, wettern gegen seine Freihandelspolitik, gegen den »angelsächsischen« Pragmatismus im Denken der deutschen Unternehmer und gegen den »Abfall vom Christenthum und den Rückfall in ein neues Heidenthum« (wie konfus die Vorstellung davon auch immer sein mag). Je länger die Krise dauert, umso mehr verlieren die Anhänger des Freihandels gegen die wachsenden Interessengruppen an Boden, die den Wirtschaftsraum Deutschland gegen Waren aus dem Ausland mit hohen Zöllen abschotten wollen.
Zuerst schließen sich die Stahlkocher zusammen, dann die Textilhersteller. 1876 gründet sich mit dem Zentralverband Deutscher Industrieller ein Vorläufer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Bei ihrer ersten Generalversammlung 1877 reisen 500 Unternehmer aus ganz Deutschland an, um Schutzzölle zu fordern. Auch die Landwirte und Gutsbesitzer marschieren gegen den Freihandel, um sich gegen die billigere ausländische Konkurrenz auf dem deutschen Markt zu wehren. Denn die Preise für Vieh und Getreide sind so stark eingebrochen, dass ihnen die mager entlohnten Landarbeiter davonlaufen und der durchschnittliche Hektarertrag sinkt.
Die Liberalen, vor 1848 noch eine Gefahr für das monarchistische Establishment, danach die führende politische Kraft in Deutschland, reiben sich angesichts ihrer Entmachtung ungläubig die Augen: nicht nur, dass sich ihre politischen Ziele nicht mehr durchsetzen lassen – wie freier Handel und eine billige, weil inaktive Regierung. Die Wahlen zum Reichstag zerstören ihre Illusion, ihre politischen Vorstellungen würden die Bevölkerungsmehrheit repräsentieren. Erstmals in Deutschland gilt jede (männliche) Stimme gleich viel (im Gegensatz zum preußischen Dreiklassenwahlrecht, wo die Wahlstimme nach Steuerkraft zählt). Damit erringen die Liberalen keine Mehrheiten.
Es macht keinen Spaß, in einem langen Kondratieffabschwung Politiker zu sein: Produktionsrückgang, Massenentlassungen, Lohnkürzungen oder der Streit gegen die liberale Wirtschaftsordnung zermürben den Reichskanzler. Denn der begonnene Abschwung des zweiten Kondratieffs erschwert nicht nur den Verkauf der eigenen Produkte – auch die anderen Länder, sogar das bisher führende Britannien, werden ihre Güter nicht mehr los.
Lange laviert Bismarck zwischen den Fronten, weiß er doch, was eine strikt an nationalen Interessen orientierte Wirtschaftspolitik für den Wohlstand bedeutet (er sinkt, weil komparative Handelsvorteile mit dem Ausland nicht mehr genutzt werden können). Als er nicht mehr weiterweiß, wird er krank, leidet an Rheuma und Gürtelrose und bittet im Mai 1875 den Kaiser, ihn aus seinem Amt zu entlassen. Wilhelm I. lehnt ab. Die Stimmung im Land wendet sich rapide zugunsten der Konservativen. Der Liberalismus hat in den Augen vieler abgewirtschaftet, das freie Spiel der Kräfte funktioniert offensichtlich doch nicht so gut wie behauptet, und deswegen soll jetzt der Staat mit starker Hand eingreifen. Deutschland erhebt 1879 Schutzzölle, die ausländische Waren, die Deutschland selbst teurer herstellt, an den Grenzen abwehren.
Erst Anfang der 1890er Jahre senkt der nächste Reichskanzler Leo von Caprivi die Schutzzölle allmählich wieder – also rechtzeitig zum dritten Kondratieffaufschwung.
Vom Überlebensrecht des Stärkeren
Aber wie sollen Politiker auch sonst auf eine große Wirtschaftskrise reagieren als zum Nachteil anderer Länder? Seit Dampfmaschinen Druckerpressen antreiben, müssen sich jetzt auch Politiker dem öffentlichen Druck beugen. Der Zeitgeist ist erfüllt von Charles Darwins Werk »Über die Entstehung der Arten«, mit dem heute nicht mehr so bekannten Untertitel: »Das Überleben der bevorzugten Rassen im Kampf ums Dasein«. Viele Nationalisten folgern höchst unwissenschaftlich daraus: Gerade ihr Volk sei die »bevorzugte Rasse«, die sich im »Kampf ums Dasein« zwischen den Völkern durchsetzen müsse. Das »survival of the fittest« denkt ein »non-survival of the less fittest« immer unausgesprochen hinzu. Intellektuelle, Tagespolitiker, aber vor allem Journalisten sprechen und schreiben vulgär sozialdarwinistisch von einer Welt des Kampfes, des Erfolges und des Versagens, des Wachstums und des Niedergangs.
Seltsam erscheint auf den ersten Blick, dass sich diese darwinistische Ideologie nicht in Kriegen entlädt. Das außenpolitische System bleibt in den Jahren des langen Kondratieffabschwungs stabil. Das hat nicht nur mit Bismarcks Politik zu tun, die dem Ausland signalisiert, Deutschland sei saturiert. Es gibt weiterhin Spannungen zwischen Deutschland und Frankreich, wie die »Krieg-in-Sicht-Krise« 1875, oder Kolonialkonflikte zwischen England und Frankreich. Aber sie entladen sich nicht in heißen Kriegen, so die Theorie von Kondratieff45, weil allen die Ressourcen fehlen, einen Krieg zu führen.
Sie kämpfen, indem sie sich alle gegenseitig unterbieten: Nachdem jede Nation ihr Heil in der Massenproduktion sucht, entsteht ein gewaltiger Verdrängungswettbewerb zwischen den Nationen um Märkte. Sie denken, diese seien begrenzt und könnten nur eine bestimmte Menge aufnehmen. Anstatt mit innovativen Produkten den Markt qualitativ zu erweitern, kämpfen sie im vorhandenen Markt der eingeführten Produkte um Mengenanteile. Den Verantwortlichen erscheint es, als könne die eigene Volkswirtschaft nur weiterexistieren, wenn sie diese Absatzmärkte selbst schaffen – in Kolonien.
Dabei haben englische Politiker im zweiten Kondratieffaufschwung noch darüber diskutiert, die bestehenden Kolonien zu unabhängigen, gleichwertigen Handelspartnern reifen zu lassen. Denn der Handel mit den unabhängig gewordenen USA bringt schon lange mehr Profit, als Amerika als Kolonie den Briten je erwirtschaftet hat. Englands Premierminister Disraeli nennt Englands »elende« Kolonien »Mühlsteine an unseren Hälsen«. Eine Unterhausdelegation empfiehlt eine Politik, die »bei den Eingeborenen die Eigenschaften aktiviert, die es uns ermöglichen – im Hinblick auf unseren späteren Abzug aus ihrem Gebiet –, nach und nach ihnen selbst alle Verwaltungsgeschäfte zu übertragen«46. Davon ist jetzt im langen Abschwung keine Rede mehr. England hat schon die meisten Kolonien, aber eignet sich im Wettlauf der 1870er/80er noch mehr als alle anderen Staaten an.
Denn die englischen Eliten denken nun, sie bräuchten sie, um ihre Überproduktion aufzunehmen. Diese kann im eigenen Land nicht mehr ganz verkauft werden und ist in anderen inzwischen industrialisierten Ländern immer weniger konkurrenzfähig. Das Konzept funktioniert aber nicht – es nimmt nur kurz den Druck von der britischen Industrie. Langfristig geht dabei die Wettbewerbsfähigkeit Englands endgültig verloren. Denn Konkurrenten wie das Deutsche Reich können ihre Massenproduktion mangels ähnlich ausgedehnten Kolonialreichs nicht so bequem absetzen. Deren Unternehmer sind eher gezwungen, effizienter zu werden und Innovationen zu suchen – was Deutschland weiter stärkt.
Doch die öffentliche Meinung ist irrational. Die Verzweiflung des Darwinismus, der Schwächere werde untergehen, entfacht unter den Europäern eine Gier nach den letzten weißen Flecken der Weltkarte in Afrika, Asien, Ozeanien. Wie sizilianische Mafiosi pressen sie China Sonderrechte, Schutzgebiete und Pachtverträge ab. Irgendwelche unbedeutenden öden Atolle, von den Europäern bisher ignoriert und für wirtschaftlich völlig uninteressant gehalten, werden zu heiß begehrten Zielen für in den Strand gesteckte Fahnenstangen. Deutschland rafft ohne strategischen Sinn und Verstand ein Sammelsurium pazifischer Inselchen an sich – es glaubt allen Ernstes, es gehe hier um die Wachstumsmärkte der Zukunft.
Dahinter stecken die innenpolitischen Folgen des Kondratieffabschwungs mit fallenden Unternehmensgewinnen, Verteilungskämpfen und Stagnation. Zwar können die Unternehmer den wirtschaftlichen Druck an die Arbeiter weitergeben, indem sie den Reallohn mit der Zeit absenken. Aber, so die Angst der Wohlhabenden, die ärmlichen Lebensverhältnisse der Unterschicht könnten ihnen gefährlich werden, wenn sozialistische oder gar marxistische Vorstellungswelten daran eine Revolution entzünden. Diese appellieren an das Bedürfnis des Einzelnen, seine Situation zu verbessern. Dazu muss er auf der Verstandesebene zu der Überzeugung kommen (oder von außen überzeugt werden), dass er sich mit anderen, die in derselben Situation sind, zusammentun, eine Gruppenidentität ausprägen und die gemeinsamen Interessen durchsetzen muss.
Mit Nächstenliebe hat der Kampf gegen die Kapitalisten ebenso wenig zu tun wie der psychologische Impfstoff, mit dem die Reichen das Proletariat gegen diese »linken Irrlehren« immunisieren wollen: Sie sprechen den Einzelnen über seine nationale oder rassische Gruppenidentität an, begeistern ihn für patriotische, imperialistische oder sozialdarwinistische Denksysteme. Die selbst erlebte Ungerechtigkeit seiner Lebenssituation wird von oben ausgeglichen, indem ein kollektivpsychologisches, pseudoreligiöses Bedürfnis befriedigt wird: Was sind wir doch für eine große und vor allem wichtige Nation, höherwertiger und haushoch dem Rest der Welt überlegen, wo uns doch überall auf der Welt Länder gehören und wir so eine starke Flotte haben. Über so viel Größenwahn kann man dann sein eigenes Los vergessen, die eigene Schufterei bekommt endlich einen übergeordneten Sinn. Führende Politiker polieren mit neuen Kolonien ihr Ansehen wieder auf, nachdem sie es mit Steuererhöhungen und niedergeschlagenen Streiks ramponiert haben. Kolonien dienen vor allem dazu, dass die innenpolitische Stimmung Dampf ablassen kann – auf Kosten der Menschen in den heutigen Entwicklungsländern.
Selbst der sich sträubende Bismarck hat gegen die öffentlich aufgeheizte Stimmung keine Chance, diesen Unsinn zu verhindern: In den Krisenjahren Anfang der 1880er kaufen sich deutsche Geschäftsleute auf eigene Faust ein paar Wüstenstreifen zusammen und zwingen nach ihrer Pleite das Deutsche Reich, sie als »Kolonien« zu übernehmen. Das kostet den Staat viel Geld und bringt keines ein. Selbst später im Aufschwung des dritten Kondratieffs nach 1890/95 erfüllen die Kolonien keinen ökonomischen Zweck: Im Jahr vor dem Ersten Weltkrieg leben in allen deutschen Kolonien zusammen – immerhin eine Million Quadratmeilen – nur etwas über 28.000 Weiße (also nicht nur Deutsche). Das ist nichts im Vergleich zu den Millionen, die aus Armut in die USA ausgewandert sind – Nationalisten hatten ja gerade deshalb Kolonien gefordert, damit deutsches Blut nicht mehr in fremden Kulturen aufgehe.
Auch der Handel mit den Kolonien ist verschwindend gering: Während das Deutsche Reich 1913 Waren für 10.039 Millionen Mark in alle Welt exportiert, kaufen die eigenen Kolonien dem Mutterland nur Waren für 57 Millionen Mark ab. Denn das, was der dritte Kondratieff braucht – Kohle, Erz, Fabrikarbeiter –, findet sich nicht im Pazifik oder in Kamerun, sondern in Deutschland. Die Kolonien erfüllen einen Zweck nur als innenpolitisches »Wir-sind-wieder-Wer« und zur eigenen Beruhigung, angesichts der Depression doch irgend etwas für die Zukunft getan zu haben. Es ist derselbe Grund, der die Menschen während des langen Kondratieffabschwungs nach einem Schuldigen suchen lässt.
Jede Wirtschaftskrise braucht ihre Sündenböcke
Niemand kann die plötzliche und so heftige Wirtschaftskrise begründen. Die Nationalliberalen meinen, Schuld an der Depression sei vor allem die Überproduktion der Industrie, und dieses Problem – so die Lehre der klassischen Wirtschaftstheorie – werde sich mit der Zeit von selbst lösen. Doch darauf warten sie vergeblich. Und weil sich auch die Zeitgenossen den Verlust ihres ein Leben lang ersparten Vermögens nicht plausibel erklären können, müssen eben dunkle semitische Mächte dafür verantwortlich sein: die Kapitalisten, und das sind in dieser Zeit aus historischen Gründen überdurchschnittlich viele Deutsche jüdischen Glaubens. Nirgends in Westeuropa leben so viele Juden wie im Deutschen Reich (700.000). Allein in Berlin gibt es mit 50.000 so viele Juden wie in ganz Großbritannien und mehr als in ganz Frankreich (40.000). Magnaten wie Rothschild, Oppenheim oder Bleichröder ziehen den Volkszorn auf alle Juden, egal, wie reich oder arm diese sind. Journalisten weisen bei Enthüllungsgeschichten zu Firmenpleiten immer wieder auf die jüdischen Wurzeln der Akteure hin. Die bejubelten Börsenmakler von 1872 sind auf einmal verachtete »Börsenjuden«.
In Wahrheit geht es den meisten darum, die jüdischen Mitbürger möchten doch bitte nicht ständig das Selbstwertgefühl der germanischen »Herrenrasse« in Frage stellen. August Bebel, die große Figur der Sozialdemokraten im 19. Jahrhundert, bezeichnet den Antisemitismus als »eine Art Sozialismus der dummen Kerls«. Es ist das »Stehkragenproletariat« der kleinen Angestellten und Beamten, das die Tüchtigkeit der Juden fürchtet, ebenso die kleinen Ladenbesitzer und Handwerker: 1885 sind zehn Prozent aller preußischen Studenten Juden – siebenmal so viel wie ihr Bevölkerungsanteil. In Berlin sind drei Prozent der Bevölkerung Juden, aber jeder zweite Unternehmer in der Hauptstadt. Mit der Zeit nimmt der Antisemitismus auch in der Oberschicht zu, dort dann esoterisch angehaucht. Selbst der evangelische Hofprediger Adolf Stöcker predigt gegen die Juden, weil er so politisches Kapital schlägt für seine Christlich-Soziale Arbeiterpartei, die vor allem unter Kleinbürgern Wahlerfolg hat. Antisemitismus und rechte Verschwörungstheorien werden gesellschaftsfähig. Sie werden die ganze Krisenzeit hindurch bis hinein in die Kinderjahre Adolf Hitlers in den 1890er Jahren wiederholt und leben dann in der Weltwirtschaftskrise erneut auf.
Georg Tietz aus der Dynastie der Hertie-Kaufhauskette erlebt schon damals in der Krise des zweiten Kondratieffs, was andere Deutsche jüdischen Glaubens genau einen Strukturzyklus später im Nationalsozialismus erleben: Je erfolgreicher er ist, umso verbissener wehren sich die im Wettbewerb unterlegenen Einzelhändler. Sie stellen Posten vor sein Münchener Kaufhaus am Karlsplatz, die den Kunden Flugblätter in die Hand drücken und sie vor dem Einkauf bei den »Juden« warnen.47 Ein anderes Mal zieht die Menge nach einer Einzelhandels-Versammlung zum Kaufhaus, wirft mit Pflastersteinen die Fenster ein und blockiert es. Corpsstudenten gehen hinein, belästigen die Verkäuferinnen, schlagen einen Mitarbeiter blutig, werfen die Waren durcheinander. Tietz ruft die Polizei, doch die lehnt es ab, gegen »Söhne der ersten deutschen Familien« einzuschreiten. Nur mit Hilfe eines befreundeten Bäckers und seiner Gesellen gelingt es ihm, die nationalistische Studentenschaft rauszuwerfen. Was sich hier Luft macht, ist die eigene wirtschaftliche Unzufriedenheit.
Soziale Probleme im langen Abschwung
Denn niemand ist von den geringen Gewinnspannen im langen Kondratieffabschwung so sehr betroffen wie die Unterschicht. Nach dem Gründerkrach fehlen in den wachsenden Großstädten bald wieder billige Mietwohnungen. Hunderttausende von »Schlafburschen« zahlen für ein paar Kreuzer einen Schlafplatz in einer Familie, zum Teil übernachten bis zu vier Personen in einem Bett. Dass Bismarck in den 1880ern Kranken-, Unfall- und (Arbeiter-)Rentenversicherung einführt (damit die Arbeiter nicht alle der SPD zulaufen), zeigt, dass die Not in diesen Jahren größer ist als zuvor – eben ein Kondratieffabschwung.
Den Unterschicht-Frauen geht es überall dreckig. Rechtlos, abhängig und niedrigst bezahlt, vermögen sie sich »in ihrer abhängigen Lage dem Herrn, dem Verwalter und dem Knecht gegenüber selten zu wehren«, stellt eine Studie des evangelischen Sittlichkeitsvereins von 1890 fest. Die Flucht in die Stadt ist nur ein Tausch der Unfreiheiten: Entweder sie arbeiten in einer Fabrik, was in der Regel ziemlich ungesund ist und mit drei bis sechs Silbergroschen weit schlechter bezahlt wird als etwa männliche Drucker oder Färber, die zwischen 15 und 25 Silbergroschen am Tag bekommen. Oder sie ergattern sich eine Dienstbotenstellung, in der sie rund um die Uhr den Herrschaften zur Verfügung stehen und mit etwa 30 Jahren verbraucht sind – 1882 gibt es rund 1,3 Millionen Dienstboten im Deutschen Reich. Viele Näherinnen, Kellnerinnen oder Fabrikmädchen dürften mit Prostitution ein Zubrot für ihr Überleben verdienen. In München wird 1890 jedes dritte Kind unehelich geboren.
Die Arbeiter sind mit Alltagssorgen so beschäftigt, dass es selbst die pragmatischen Sozialdemokraten schwer haben, unter ihnen Fuß zu fassen. Die Sozialistenführer Bebel und Liebknecht haben noch vor dem Gründerkrach ein Bündnis mit dem Bürgertum angestrebt – aber angesichts der Situation in den Krisenjahren nach 1873 scheitert es an sozialen Fragen wie Lohn und Arbeitsverhältnissen. Im langen Abschwung müssen sich die Arbeiter nach langen Streiks und Arbeitskämpfen geschlagen geben und für weniger Lohn arbeiten. Vom Bürgertum im Stich gelassen, vom Staat ausgegrenzt, reagieren die Sozialdemokraten auf die neuen strukturellen Verhältnisse im Mai 1875 auf ihrem Parteitag in Gotha mit einem marxistisch geprägten Programm, das der politischen Ordnung offen den Kampf ansagt.
Um sie in Schach zu halten, reichen Nationalismus und Kolonialgerassel allein nicht aus (siehe oben). Bismarck schiebt ein Attentat auf Kaiser Wilhelm I. den Sozialisten in die Schuhe und rechtfertigt damit am 21. Oktober 1878 das »Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie«. Versammlungen, Parteiarbeit und Druckschriften werden erschwert oder gleich ganz verboten. Die soziale Frage – im Kondratieffabschwung besonders brennend – beantwortet der Staat brutal und hart im Sinne der herrschenden Zirkel, um dem »Staatssozialismus einer revolutionären, nicht mehr steuerbaren Arbeiterbewegung« zuvorzukommen. Erst als sich mit dem Aufschwung des nächsten Strukturzyklus die Marktmacht der Arbeiter wieder verbessert, wird die 1891 in Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) umbenannte Partei stärkste innenpolitische Kraft.
Ebenso wenig zimperlich geht der Staat mit der katholischen Kirche um. Der Papst wendet sich schon 1864 mit der Enzyklika »Syllabus errorum« gegen den Liberalismus – das ist in den Hochkonjunkturjahren des zweiten Kondratieffs so ziemlich das Gegenteil des Zeitgeistes. Nachdem das neue Reich die Kirche auf vielen Gebieten als Konkurrenz empfindet (Eheschließung, Bildung, Zielvorstellungen des Lebens), verstößt der preußische Staat selber gegen liberale Grundsätze wie etwa den Wettbewerb der Meinungen und besten Ideen: Der »Kanzelparagraph« verbietet Pfarrern, staatliche Angelegenheiten anzusprechen. Alle Klöster in Preußen sowie alle Niederlassungen der Jesuiten in Deutschland werden verboten, nicht-deutsche Geistliche ausgewiesen, 1876 alle preußischen Bischöfe verhaftet oder ausgewiesen. Für Bismarck wird der Kulturkampf eine peinliche Niederlage: Das Kirchenvolk rückt umso enger zusammen, je mehr es vom Staat gegängelt oder der Freiheitsrechte beraubt wird, die katholische Zentrumspartei verdoppelt bei den Reichstagswahlen ihre Stimmen. In den 1880er Jahren lenkt Bismarck ein. Er hat genug anderen Ärger, zum Beispiel finanzielle Verteilungskämpfe mit dem Reichstag auszufechten.
Verteilungskampf: Bismarcks Staatsstreichpläne
Das hat damit zu tun, dass das junge Reich im Aufbau immer mehr Zuständigkeiten bekommt und Militär oder Botschaften stetig ausbaut, die Steuereinnahmen aber nicht so üppig eingehen. Wenn diese Zeit dagegen ein Kondratieffaufschwung wäre, der Reichskanzler hätte weniger Probleme, seine Rechnungen bezahlt zu bekommen. Während nach der Reichsgründung die Mitgliedsländer sozusagen einen Vereinsbeitrag zahlen, finanziert sich der Gesamtstaat ab 1879 aus Zöllen und Tabaksteuer. Und was über 130 Millionen Reichsmark hinausgeht, bekommen die Länder, die sich auch noch ihre bisherigen »Matrikularbeiträge« sparen. Bismarck scheitert mit dem Versuch, ein Tabakmonopol zu errichten und weitere indirekte Steuern zu erheben – das Reich muss Schulden machen.
Deswegen denkt Bismarck ab 1880 über einen Staatsstreich nach, weil man, so meint er, mit einem Reichstag nicht regieren könne, der aus allgemeinen und gleichen Wahlen hervorgegangen ist. Entweder die Einzelstaaten rufen ihre Vertreter aus dem Bundesrat zurück, einigen sich auf eine gleich lautende Landesgesetzgebung und überlassen der Reichsverwaltung Außenpolitik, Militär und Zölle. Oder die Fürsten kündigen das Reich von 1871 und gründen ein neues Deutsches Reich mit einem Reichstag, der nach dem preußischen Dreiklassenwahlrecht gewählt wird: Also nicht jede Stallmagd oder jeder Arbeiter hat mit seinem Wahlzettel ein ebenso großes Gewicht wie Thyssen oder Krupp, sondern es gibt drei Vermögensklassen, die gleichviel zu bestimmen haben: Die oberen paar Tausend so viel wie Millionen einfache Arbeiter. Bismarck scheitert mit seinen Plänen an der Außenpolitik, die ab 1885 einen Staatsstreich nicht zulässt.
Nichts hat also geholfen, die »große Depression« zu überwinden: weder die Schutzzölle, mit denen sich Deutschland vom Weltmarkt abschottet, noch Kolonien, die Sozialversicherung oder die Verfolgung von Sozialdemokraten und Katholiken. Selbst der angedachte Staatsstreich bringt keinen finanziellen Spielraum. Die Depression dauert bis in die 1890er. Als sich die Wirtschaft wieder erholt, stabilisiert sie sich nicht wegen der staatlichen Interventionen, sondern »weil die Unternehmer wieder Mut hatten, zu gründen und zu investieren«, so die vorherrschende Meinung.48 Doch niemand wird aus heiterem Himmel unternehmerisch tätig oder weil er eine Positiv-denken-Pille geschluckt hat. Die Kondratiefftheorie erklärt, warum es sich wieder lohnt, zu investieren: Neue Techniken und Kompetenzen machen die Fabriken wieder produktiver.
3. Kondratieffaufschwung Die unsichtbare Energie
Dampfmaschinen können sich nur kapitalkräftige Unternehmer leisten – für den normalen Handwerker sind sie ein unerreichbares Ziel. Und sie sind aufwändig: Eine Dampfmaschine benötigt Arbeiter, die Kohle heranschaufeln. Sie verbreitet Hitze, belastet das Gehör und ist unflexibel: Denn sie lässt sich nicht einfach an- und ausknipsen. Sie rotiert ununterbrochen, unabhängig davon, ob und wie viele Maschinen über Riemen an die Transmissionsstange gekoppelt sind. Die teure Energie verpufft dann ungenutzt. Und wenn die Dampfmaschine kaputt ist, steht die ganze Fabrik still.
Grundlegende Erfindungen stellen die ganze Gesellschaft auf den Kopf
Diese Wachstumsgrenze überwindet der dritte Kondratieff mit mobiler Energie. Elektrischer Strom – das ist Kraft für Maschinen, Licht für Städte, Kommunikation, ein Katalysator für chemische Prozesse, Wärme für den Haushalt oder Hitze für den Hochofen. Elektrischer Strom revolutioniert die Mechanik. Er verändert die Arbeitsorganisation, die Betriebsgröße und den Bau von Maschinen. Tragbare Bohrer oder fahrbare Presslufthämmer (zum Kohlehauen unter Tage) lassen sich überall nutzen, wo ein Kabel hinführt oder eine ausreichend große Batterie mitgebracht wird. Stromkabel lassen sich überallhin verlegen und machen Firmen ortsunabhängig von Kohlevorkommen. Fabriken werden mit elektrischem Licht heller, der Unterschied zwischen Tag und Nacht verschwimmt. Die Kapazität einer elektrifizierten Produktionsanlage ist größer als die der Dampfgetriebenen, die Qualität steigt. Energie wird dosier- und wandelbar. Hitzeenergie lässt sich über den elektrischen Strom in kinetische Energie umsetzen (zum Beispiel: Strom aus einem Kohlekraftwerk zieht einen Fahrstuhl nach oben) und umgekehrt (Strom aus einem Wasserkraftwerk heizt einen elektrischen Stahl-Hochofen). Wo sich Wasserkraft zum Beispiel wie bei den Niagarafällen in den USA nutzen lässt, entsteht elektrische Energie praktisch kostenlos.
Das alles braucht wie bei jedem neuen Strukturzyklus wieder gesellschaftliche Debatten über neue Gesetze und technisch abgestimmte Normen. Denn die Gesellschaft ist sich doch noch gar nicht darüber einig, wohin die Reise gehen wird: Als Edward Belamy 1888 sein Buch »Utopia: Looking Backward« ein paar Millionen Mal verkauft, prognostiziert er, bis zum Jahr 2000 werde der elektrische Strom alle Lichtquellen und Herdplatten befeuern. Das gilt als mutige Aussage, obwohl es in Wirklichkeit viel schneller so kommt. Die meisten Zukunftspropheten machen zu ihrer Zeit den Fehler, nur die gegenwärtige Entwicklung hochzurechnen, anstatt sich vorzustellen, wie stark sie sich beschleunigt.
Verständlich, wenn man sich überlegt, vor welchen ungeheuerlichen Investitionen eine Gesellschaft zu Beginn des neuen Strukturzyklus steht: Kohlekraftwerke erzeugen elektrischen Strom außerhalb der Fabrikhalle oder sogar draußen vor der Stadt. Kabel leiten elektrische Energie direkt an den Verbrauchsort. Dort verwandeln Elektromotoren den Strom sauber und geräuschärmer als die bisherigen Dampfungetüme in mechanische Bewegungsenergie, stanzen Bleche, lassen Spindeln rotieren, bohren Schraubengewinde. Elektrische Maschinen werden zu einem neuen Wirtschaftszweig. Glühlampen erhellen die Innenstädte, Theater und bald auch Wohnungen ungefährlicher als Gas- und Petroleumlampen. Die gewaltig gesteigerte Produktivität vernichtet keine Arbeitsplätze (wie Gewerkschaften und andere gesellschaftliche Gruppen in den 1970ern/80ern gegen Computer und Roboter eingewandt haben), sondern sie schafft einen schier unendlichen neuen Arbeitsbedarf: Kupfer muss in Bergwerken gefördert, Kabel, Masten und Dynamos müssen gefertigt und verlegt werden, um Strom und um Nachrichten zu übertragen. Technische Hochschulen bilden Ingenieure aus.
Eine neue Elektroindustrie stellt Produkte her, von denen man vorher noch nicht einmal geträumt hat. Strom ermöglicht Gespräche über das Telefon. 1890 sind 228.000 Telefone in den USA in Gebrauch, um 1900 sind es bereits fast anderthalb Millionen. In den Großbetrieben mit Zehntausenden von Arbeitern und verstreuten Dienststellen spart das viel Zeit. Auch die elektrische Schreibmaschine erleichtert die Büroarbeit. Vor allem löst der elektrische Strom das größte Problem der rapide gewachsenen Großstädte: Überall fahren jetzt elektrische Straßenbahnen, zum Teil schon unterirdisch wie in London ab 1887. In Deutschland verbreiten sich die elektrischen Straßenbahnen ganz besonders schnell: 1891 haben erst zwei Städte welche, im Jahr 1900 sind bereits 99 Straßenbahnen fertiggestellt, 28 weitere in Bau. Ebenso rapide entwickelt sich der dritte Kondratieff in den USA: 1890 haben erst 15 Prozent der amerikanischen Städte elektrisch angetriebene Trambahnen, 1904 sind es 94 Prozent.49 Damit beginnt, was das Auto später perfektioniert: Das Leben der Arbeiter und Angestellten verlagert sich aus der Nachbarschaft der Fabriken raus an den Stadtrand und in die Vororte.
Die Elektrifizierung versetzt die chemische Industrie in die Lage (zum Beispiel durch Elektrolyse oder celsiusgradgenaue Temperatureinstellung), chemische Stoffe aller Art in Masse zu produzieren. Das eröffnet unendlich viele Möglichkeiten, sie neu zu kombinieren und zu Produkten zu verarbeiten: neue Werkstoffe und Legierungen, Schwefelsäure, Farbstoffe. Glas, Papier, Zement, Gummi und Keramik werden Teil der chemischen Industrie. Auch Aluminium hängt von der elektrischen Industrie ab, ebenso das Herstellen von Chlor. Was elektrischer Strom in der Chemie möglich macht, wirkt auf die Elektrobranche zurück: Erst mit Hilfe der Elektrolyse lässt sich Kupfer in großen Mengen herstellen. Nie zuvor haben Wissenschaft und Produktion so eng zusammengearbeitet – zum ersten Mal geht es in einem Kondratieff um die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse, besonders um das Wissen über den Aufbau der Materie.50
Durch den elektrischen Strom beginnt erst jetzt so richtig das Zeitalter des Stahls, auch wenn schon vorher bessere Herstellungsverfahren die Grundkosten des Rohstahls senken (Bessemer-Verfahren 1856, Siemens-Martin-Verfahren 1864, Thomas-Verfahren 1879). Im selben Jahr stellt Siemens den ersten elektrischen Hochofen vor. Am Ende des Kondratieffs erzeugen sie Temperaturen, die für konventionelle Brennstoffe unerreichbar sind. Der Preis etwa für Stahlschienen sinkt in den USA von 107 Dollar pro Tonne im Jahr 1870 auf 18 Dollar 1898.51 Mit den höheren Temperaturen steigt auch die Qualität. Stahl wird auf unendlich viele Arten neu einsetzbar. Das löst eine Welle von Anwendungen im Gebäude- und Schiffsbau und erneut bei der Eisenbahn aus. Die Eisenbahn ist aber nicht mehr Wachstumsmotor, sondern hat im Staffellauf der Wachstumsmärkte den Stab an den elektrischen Strom abgegeben. Weil der den Wohlstand hebt, gibt es mehr zu transportieren. In dem Jahrzehnt bis 1905 kommen in Deutschland noch einmal 10420 Schienenkilometer dazu, danach bricht dieser Sektor mit nur noch 5430 zusätzlichen Kilometern schon vor dem Ersten Weltkrieg am deutlichsten ein und zeigt, dass die Wirtschaft auch ohne Krieg in den 1920er Jahren abgerutscht wäre.
Der dritte Kondratieff verändert auch den Schiffsbau völlig: Wird 1870 erst jedes zehnte aus Stahl gefertigt, sind es nur 20 Jahre später neun von zehn Schiffen. Sie kommen mit deutlich dünneren Platten aus. Stahlschiffe sparen so mehr Kosten, als es die fallenden Preise pro Tonne Stahl ausdrücken – das gilt für alle Bereiche, wo Stahl das bislang verwendete Eisen ersetzt (s. Grafik). An Stahlpfeilern hängen neue Brückenkonstruktionen, große Bahnhofshallen werden aus Stahlträgern errichtet. Bisher waren hohe Gebäude auf dicke, tragende Mauern aus Ziegelsteinen angewiesen, die nur wenige Fenster erlauben. Mit dem Stahlbau beginnt jetzt im völlig übervölkerten New York und Chicago die Ära der Wolkenkratzer. Auch dabei zieht sich wieder das technologische Netz gegenseitig nach oben: Elektrischer Strom ermöglicht einen sicheren Lift, das Telefon die Kommunikation über 20 Stockwerke hinweg. Andererseits verbessert der Stahl auch Anwendungen der Elektrotechnik, etwa für größere Generatoren. Mit der jetzt möglichen Massenproduktion in der Chemieindustrie werden neue Legierungen möglich, die den Stahl immer härter machen, was wiederum neue Werkzeuge generiert – zum Beispiel die Bohrköpfe, die den Panamakanal ausgraben.
Kupfer wird durch Elektrolyse gewonnen, ermöglicht andererseits aber erst die Massen-Elektrifizierung. Aus elektrischen Hochöfen fließt besserer Stahl, was den Maschinenbau beflügelt, der mit härterem Stahl Metalle exakter verarbeiten kann. Rostfreier Stahl regt die Rüstungsindustrie an. Blechdosen bestehen ab jetzt nicht mehr aus Zinn-Weißblech, sondern zu 98 Prozent aus Stahl – das verändert die Haushalte und das Leben der Soldaten im Ersten Weltkrieg. Fahrräder aus Stahlrohren werden in den 1890er Jahren erschwinglich. Und auch Gebrauchsgüter wie Essbesteck ersteht der kleine Mann für weniger Geld.
Nicht Makroökonomie, sondern der neue Kondratieff treibt den Wohlstand
Der Markt ist kein völlig zufälliges Geschehen. Die Elektroindustrie entwickelt sich, wie sich alle Basisinnovationen entwickeln: Ihre Beschäftigung, ihr Umsatz und ihr Anteil an der Gesamtwirtschaft explodieren. In nur 17 Jahren legt die Zahl der Mitarbeiter bei Siemens von 4000 im Jahr 1895 auf 57.000 im Jahr 1912 zu, bei der AEG von 550 auf 22.650. Die Hälfte aller in der deutschen Elektrobranche Beschäftigten arbeitet in »Elektropolis«, in Berlin. Auch innerhalb der deutschen Industrie bekommt die Elektrobranche größeres Gewicht: 1895 arbeiten 24.000 Menschen in der Elektroindustrie, das ist nur jeder 250. Industriearbeiter. 1925 sind es 449.000 – das ist jetzt jeder 25. Der weltweite Umsatz von Siemens steigt von 800.000 Britischen Pfund 1893 auf 23,6 Millionen Pfund, AEG ist mit einem Umsatz von 22,7 Millionen Pfund fast gleichauf. Jeder von ihnen produziert allein mehr als der wichtigste US-Konkurrent General Electric, der 17,8 Millionen Pfund auf die Waage bringt.
Die Elektrifizierung spiegelt sich auch in der Weltkupferproduktion wider: Sie steigt zwischen 1875 und 1900 von 130.000 auf 525.000 Tonnen. Welches wirtschaftliche Gewicht der elektrisch hergestellte Stahl bekommen hat, verdeutlicht sein Verhältnis zum Branchenumsatz des ersten Kondratieffs: Während die US-Wirtschaft 1901 Textilien für eine Million Dollar produziert, produziert sie im selben Jahr Stahl im Wert von einer Milliarde Dollar.52 Zwischen 1880 und 1913 steigt der US-amerikanische Stahlausstoß von einer auf 31 Millionen Tonnen, in Deutschland von 0,7 auf 18,9 Millionen Tonnen, in Großbritannien dagegen nur von 1,3 auf 7,7 Millionen Tonnen. 1903 ist der Stahlhersteller Krupp das größte Privatunternehmen auf dem europäischen Kontinent.
Dass kurz nach der Jahrhundertwende eine Elektrokrise ausbricht, ist kein Argument gegen die These, dass in diesen Jahren ein Kondratieffaufschwung stattfindet. Macht die Basisinnovation bei ihrer Bergtour eine Pause, dann stottert die Konjunktur, aber eben nur kurz. Das gibt es auch beim Eisenbahnaufschwung in den 1840ern und 1857 oder im Computeraufschwung um 1992: weil Investitionen nicht immer im selben Tempo von der Gesellschaft wirtschaftlich aufgenommen werden können, mit welchem sie errichtet werden. Deutlich nachzuvollziehen ist der dritte Kondratieff an der Zahl der Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen ins Ausland flüchten: In den zehn Jahren während des zweiten Kondratieffabschwungs zwischen 1881 und 1890 wandern 1.342.000 Deutsche in die USA aus, die zu dieser Zeit in Deutschland nicht ausreichend produktiv beschäftigt werden können. Das ist nicht nur ein Verlust an Menschen, sondern auch an Kapital. Denn sie nehmen im Durchschnitt vier bis sechs Jahreseinkommen eines Arbeiters mit. Trotz Bevölkerungsexplosion versiegt der Auswandererstrom, als Deutschland im dritten Kondratieff prosperiert: Zwischen 1901 und 1910 wandern insgesamt nur noch 280.000 Deutsche aus.
Zu welchem Zeitpunkt man genau anfangen sollte, die Geschichte des dritten Kondratieffs zu erzählen, lässt sich nur willkürlich bestimmen. Ein Strukturzyklus berührt zwar alle Ebenen des Denkens und der Gesellschaft, aber er berührt sie unterschiedlich schnell. Seine grundlegenden Erfindungen brauchen Zeit. Lange, bevor sie die Wirtschaft antreiben, müssen sie zahlreiche Hindernisse überwinden, technische Probleme lösen, soziale Voraussetzungen und Infrastruktur schaffen, misstrauische Zeitgenossen vom Nutzen überzeugen. Längst beansprucht das neue technologische System große Entwicklungsressourcen, verändert Bildungslandschaft und Organisationsmuster, bis es stark genug ist, die Wirtschaft auf ein neues Wohlstandsniveau zu tragen. Seine Strukturen überlappen sich mit denen des Vorgängers und des Nachfolgers, verlaufen parallel. Ein neues technologisches System entwickelt sich zuerst nur als Nische, Nutzer oder Zulieferer des aktuellen Strukturzyklus und mausert sich zu einem eigenen Kondratieff, bis es in seinem wirtschaftlichen Gewicht selbst wieder zum Lieferanten seines Nachfolgers absinkt.
Dass die USA so schnell auf der dritten Welle reiten, liegt an Thomas Alva Edison – und zwar nicht nur an seinen Erfindungen: Er überzeugt die Handelsorganisationen, seine Elektroausrüstung zu vertreiben. Die Deutschen müssen diesmal nicht in England spionieren, denn sie selbst treiben die Innovation voran. Der deutsche Erfolg im dritten Kondratieff hängt an zwei Personen: Emil Rathenau, der als Unternehmer in der AEG vor allem umsetzt, was andere erfinden, und Werner von Siemens, dem Pionier. Als Armeeingenieur entwickelt Siemens ein Elektrolyseverfahren, das Essbesteck wie Gabeln und Löffel vergoldet. Dann bastelt er an der Möglichkeit, Nachrichten mit elektrischem Strom zu übermitteln, und verbessert 1846 einen englischen Telegrafen. Von Anfang an ist aber auch er vor allem Unternehmer: Die Probleme, mit denen er sich beschäftigt, sucht er sich danach aus, ob jemand bereit ist, für die Lösung viel Geld auszugeben. Seine Firma ist 1847 ein Hinterhofgebäude in der Schöneberger Straße 19 in Berlin, in der Nähe des Anhalter Bahnhofs. Eine baufällige Treppe führt zu 150 Quadratmetern sparsamst eingerichteter Werkstatt.53 Dort schafft er die Voraussetzung für den Aufstieg der Elektrotechnik und den Wohlstand späterer Generationen: Da es noch nicht gelingt, Strom über weite Strecken zu leiten, weil die Kabel nicht gut isoliert werden können, erfindet Siemens eine Presse, mit der Kupferkabel nahtlos mit Guttapercha umhüllt werden können, einem gummiartigen Pflanzenprodukt. Mit zuverlässigen und billig isolierten Drähten ist der Weg frei für Telegrafen und die wirtschaftlich sinnvolle Verbreitung elektrischer Geräte.
1852 gibt es in ganz Russland nur 600 Kilometer Eisenbahn – gegenüber 10600 Kilometern im vergleichsweise winzigen England. In industrielle Größenordnung katapultiert Siemens der russische Auftrag, während des Krimkrieges eine Telegrafenlinie von Sankt Petersburg über Kiew bis zum Kriegsschauplatz auf der Krim zu bauen und die komplette Anlage zu installieren, einschließlich der Leitungen, Masten, Isolatoren und Relaisstationen. Dabei sieht es in der Werkstatt aus wie bei Handwerkern, nicht wie in einer Fabrik: Jedes Werkstück wird per Hand hergestellt, bis 1863 gibt es noch nicht einmal eine Dampfmaschine, die Drehbänke und Bohrmaschinen werden von Hand bedient.
Das Telegrafengeschäft kommt Ende der 60er Jahre ins Stottern: Es ist im zweiten Kondratieff gleichbedeutend mit Kabeln und Signalanlagen entlang der Bahntrassen. Siemens findet mit dem Dynamo 1866 als Erster einen Weg, mechanische Energie in elektrischen Strom zu verwandeln. Deswegen ist er führend in der Schwachstromtechnik, aber in der Starkstromtechnik liegt der amerikanische Erfinder Thomas Alva Edison vorne. Und der junge Konkurrent Emil Rathenau wird den alten Herrn von Siemens bald überflügeln, weil dieser ein eigenwilliger Gründer ist, der es nicht schafft, sich vom allwissenden Prinzipal einer Garagenfirma zum Manager einer Massenproduktion zu verändern. Siemens zieht sich 1890 aus dem Geschäft zurück und stirbt 1892. Es hat ein ganzes Arbeitsleben gebraucht, um den Elektrokondratieff vorzubereiten, der erst jetzt antritt, die Gesellschaft zu reorganisieren.
Der viel jüngere Rathenau setzt auf moderne Produkte und auf Marketing: Er rüstet das Münchner Residenztheater mit den von Siemens ignorierten Edison-Glühlampen aus – um so Bedarf zu wecken. Seine Geschichte macht uns heute Mut, weil sie zeigt, dass man sich während des langen Abschwungs anstrengen muss, um den neuen Aufschwung zu ermöglichen. Emil Rathenau steigt als junger Konstrukteur bei einer Maschinenbaufirma ein, die im Gründerboom in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wird. Er ist clever genug, seine Aktien vor dem Börsencrash zu verkaufen, zieht sich 35jährig mit einer dreiviertel Million Reichsmark ins Privatleben zurück und beobachtet die nächsten zehn Jahre, wie sich Technik und Wirtschaft verändern. Auf der Weltausstellung 1881 in Paris begegnet er Thomas Alva Edison, der seine Kohlefadenlampe vorführt. Rathenau setzt sich unter windigen Konkurrenten durch und erwirbt die alleinige Lizenz zur Produktion der elektrischen Glühlampe – auch er glaubt nicht an eine unvorhersagbare Zukunft, sondern weiß, dass die Elektrifizierung kommt.
Weil aber in der Wirtschaftskrise der 1880er Jahre dafür kein Kredit zu bekommen ist, gründet Rathenau eine Studiengesellschaft. Das erfordert kaum Geld, bringt ihm aber Luft, um Erfahrungen zu sammeln, und Zeit, die Werbetrommel zu rühren. Mit Bankern gründet er 1883 die Deutsche Edison-Gesellschaft für angewandte Elektrizität AG und ändert 1887 den Firmennamen in Allgemeine Elektrizitäts-Aktiengesellschaft. In wenigen Jahren setzt sich das elektrische System in der Wirtschaft durch.
Es verändert die Art, wie sich Unternehmen organisieren. Die Verwaltung in den Unternehmen wächst. Dieses Paradigma kann Deutschland viel besser umsetzen als andere Länder – weil der preußische Staat schon lange vor der Wirtschaft seine Bürokratie perfektioniert hat. In Deutschland ist das Vertrauen in Institutionen einfach größer – also auch in ein neu errichtetes Management. Aus den USA schwappt die Managementphilosophie des Unternehmensberaters Frederick Taylor über den großen Teich. Er lehrt hohe Spezialisierung in der Massenfertigung. In den kleinen Firmen haben sich die ausgebildeten Facharbeiter bisher mit der Geschäftsleitung identifiziert; jetzt übernimmt eine Managerbürokratie die Macht im Massenbetrieb mit Zehntausenden von Arbeitern. Der Taylorismus verlagert die Gestaltungsmacht weg von der operativen Ebene hoch in die Büros (das ist genau die Entwicklung, die jetzt im Übergang vom fünften in den sechsten Kondratieff wieder rückgängig gemacht wird). Mit der Elektrobranche bekommt der 1856 gegründete Verein Deutscher Ingenieure (VDI) Gewicht: Der VDI diskutiert theoretische Probleme, gibt praktische Erfahrungen weiter und setzt Normen.
Das neue technologische System spaltet die Unternehmerschaft – nach heutigen Begriffen in »old« und »new economy«: Die einen sehen sich in ihrer Firma autoritär-patriarchalisch als »Herr-im-Haus« und fordern vom Staat, Gewerkschaften zu unterdrücken. Zu ihnen gehören die Unternehmer der hoch kartellierten Schwerindustrie an Rhein und Ruhr (der beiden ersten Kondratieffs), die sich schon 1876 im »Centralverband Deutscher Industrieller« (CDI) zusammengeschlossen haben. Die jüngste, kapitalintensivere new economy des dritten Kondratieffs dagegen – Elektroindustrie, Chemie, also AEG, Siemens, IG Farben – gründet 1895 den »Bund der Industriellen« (BDI), der die neue Mittelschicht der Angestellten und »national« gesinnte Arbeiterverbände in den Staat integrieren will. Beide verschmelzen 1919 zum Reichsverband der Deutschen Industrie RDI, dem heutigen Bundesverband der Deutschen Industrie BDI.
Alle profitieren vom Elektroaufschwung nach 1890: Der Lebensstandard steigt. Facharbeiter können es sich als Erste leisten, keine Schlafstellen mehr an ärmere Arbeiter zu vermieten. Der Wohlstand erlaubt auch zunehmend schärfere Kinderschutzgesetze – und macht Kinderarbeit unrentabel. Damit hören Kinder mit dem dritten Kondratieff auf, wirtschaftliche Aktiva zu sein, was die Geburtenrate verändert und die Familienrollen. Kinder bekommen ab jetzt ihr eigenes Bett –»wie bei Kaisers«. Innenpolitisch wird die SPD in der Zeit des starken Wirtschaftswachstums zur stärksten politischen Kraft. Die Jugend rebelliert in der Jugendbewegung (ähnlich wie ihre Enkel bzw. Urenkel um 1970), der Jugendstil will anders sein und sich vom Historismus aus der Zeit des Abschwungs des zweiten Kondratieffs distanzieren. Die feineren Kreise sprechen von der Belle Époque.
Den sprunghaft steigenden Wohlstand investiert Deutschland nicht nur in Infrastruktur und technische Entwicklung, sondern auch in Menschen: Seine Bevölkerung steigt im dritten Kondratieffaufschwung von 49 Millionen im Jahr 1890 auf 66 Millionen bis zum Ersten Weltkrieg. Aber nicht allein die bloße Zahl der Köpfe, sondern die verhältnismäßig hohe Bildungsinvestition lässt Deutschland so prosperieren. Die für das boomende technologische Netz notwendigen Schultypen – Oberrealschulen, Polytechnikschulen und Technische Universitäten – gedeihen in Deutschland. In der Pisa-Studie zum Bildungsniveau hätte Deutschland vor 100 Jahren alle anderen Länder in den Schatten gestellt. Die amerikanischen »Institutes of Technology« sind den deutschen Technischen Universitäten vergleichbar.
Im Ersten Weltkrieg sind deutsche Truppen auch deswegen so effizient, weil die Grundschulbildung der Soldaten weit besser ist als in anderen europäischen Ländern (auch wenn man anmerken muss, dass sich ein großer Teil der hohen Bildungsinvestitionen wegen des vorzeitigen Heldentodes fast zweier Millionen deutscher Männer nie mehr hat amortisieren können): Während in Italien 330 von 1000 Rekruten nicht lesen können, in Österreich-Ungarn 220 von 1000 Rekruten Analphabeten sind und in Frankreich 68 von 1000, ist es in Deutschland nur einer von 1000 – kein Wunder, dass es den Deutschen besser gelingt, für den wachsenden Bedarf des dritten Kondratieffs mehr Laboranten auszubilden, Elektriker zu schulen oder Wissen über Düngemittel schriftlich an Bauern weiterzugeben. (Deutschland hat wegen seiner Chemieindustrie damals die höchsten Hektarerträge.)54
Warum so viele den Kriegsausbruch bejubeln
Damit wird das neue technologische Netz von unterschiedlichen Gesellschaften wieder unterschiedlich gut aufgenommen und umgesetzt. Wieder wächst das Produktionspotenzial in den Ländern unterschiedlich schnell. Wieder verschieben sich die wirtschaftlichen Machtgewichte, wieder mischt ein neuer Kondratieff die internationale Politik auf: 1870 produzieren die Deutschen erst ein Fünftel des britischen Eisenausstoßes, 1890 immerhin schon die Hälfte. 1910 haben die Deutschen mit 13 Millionen Tonnen die 10 Millionen Tonnen britischen Eisens überholt. Im selben Jahr gießen die Deutschen sogar doppelt so viel Stahl wie Großbritannien.
Gegenüber Frankreich ist der deutsche Machtzuwachs im dritten Kondratieff noch größer: 1880 hat Frankreich mit 25,1 Prozent des britischen Industriepotenzials des Jahres 1900 ein fast ebenso großes Gewicht wie Deutschland mit 27,4 Prozent.55 Weil sie die Basisinnovationen um Strom und Stahl aber besser beherrschen, verfünffachen die Deutschen ihr Industriepotenzial bis zum Jahr vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges auf 137,7 Prozent, die Franzosen können es nur wenig mehr als verdoppeln und kommen 1913 auf 57,3 Prozent der britischen Produktion des Jahres 1900. Die deutsche Kohleförderung steigt von 89 Millionen Tonnen im Jahr 1890 auf 277 Millionen Tonnen bis zum Ersten Weltkrieg – das ist fast so viel wie die britische Kohleförderung und mehr als doppelt so viel wie die französische, österreichisch-ungarische und russische Kohleförderung zusammen.
Die europäische Elektroindustrie wird von Siemens und AEG beherrscht. Deutsche Chemiekonzerne, angeführt von Bayer und Höchst, stellen 90 Prozent (!) der weltweiten industriellen Farbstoffe her. Deutschlands viel zitierte Kapitalschwäche hängt vor allem damit zusammen, dass Kapital von den Investitionen in Maschinen und Menschen schneller aufgesogen wird, als es erwirtschaftet werden kann. Zwischen 1903 und 1913 investieren die Deutschen 15,3 Prozent ihres Bruttosozialproduktes – das ist ein Spitzenwert, den sie vorher nicht erreicht haben und danach erst wieder im vierten Kondratieffaufschwung erreichen werden. Gemessen am Anteil an der Weltindustrieproduktion, erreicht Deutschland mit 14,8 Prozent 1913 seinen relativen Höhepunkt; Großbritannien steigt seit 1880 von 22,9 Prozent auf 13,6 Prozent der Weltindustrieproduktion ab, Frankreich von 7,8 auf 6,1 Prozent – am meisten nimmt der schlafende Riese USA zu, von 14,7 auf 32 Prozent der Weltindustrieproduktion.56
Warum sich die britische Produktivität verlangsamt, ist eines der bestuntersuchten Probleme der Wirtschaftsgeschichte: In den Studien geht es um Generationenunterschiede, Sozialethos, veraltete Fabriken, niedrige Produktivität, die vielen Arbeitskämpfe, mangelnde Verkaufstüchtigkeit und vieles mehr. Die Kondratiefftheorie bringt es auf einen Nenner: England verschläft schlicht die Elektrifizierung – und zusammen damit den Aufbau einer modernen Chemieindustrie. Es verliert Marktanteile und wird sogar im eigenen Land von ausländischen Produkten überrollt. Die Briten wehren sich zwar mit dem Brandzeichen »Made in Germany« gegen deutsche Produkte, aber es nützt ihnen nichts. Denn ein deutscher Unternehmer, der seine Fabrik elektrifiziert hat, ist nun mal bedeutend produktiver als ein Engländer, der noch immer daran festhält, mit einer – wenn auch ständig verbesserten – Dampfmaschine zu arbeiten, mit der schon sein Papa und sein Großvater so tolle Erfolge hatten.
1914 gibt es nur wenige kleinere Elektrofirmen in England – und diese gehören zum Teil den deutschen »Siemens brothers« oder sind Töchter des US-Giganten General Electric. Das britische Bildungswesen bringt zuwenig Ingenieure hervor, Banken und Unternehmer sind eher an kurzfristigen Renditen denn an langfristigem Engagement interessiert. Wirtschaftshistoriker schreiben, die Briten hätten eben mehr in ihrem eigenen Land investieren müssen, anstatt in aller Welt. Im Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg fließt die Hälfte ihrer Investitionen ins Ausland – aus Deutschland nur jede 20. Mark. Aber das ist ja keine Frage des Wollens, sondern ob die Investitionen rentabel genug sind. Weil die gesellschaftlichen Strukturen in England den dritten Kondratieff nicht fördern, gibt es dort auch wenig zu investieren.
Vor diesem Hintergrund wundern Spannungen und Flotten-Rüstungswettlauf zwischen Deutschland und England vor dem Ersten Weltkrieg nicht: Die Jahre, nachdem der »Lotse« Bismarck von Bord gegangen ist, bringen den Deutschen mit dem Wirtschaftswachstum das Hochgefühl der Wilhelminischen Ära. Aus der Perspektive der Kondratieff-Theorie ist es daher kein Wunder, dass Deutschland aufrüstet, seine wertlosen Kolonien ausbaut und sogar in blutigen Kriegen die dortige Bevölkerung dezimiert. Eine Gesellschaft, deren Wirtschaft im Vergleich zu früheren Jahren stark wächst, denkt, den konkurrierenden Nachbarstaat bald überholt zu haben und in die Tasche stecken zu können.
Marokko-Krisen, »Panthersprung«, Balkankriege, Spanisch-amerikanischer Krieg, Englischer Burenkrieg, Russisch-Japanischer Krieg und die japanische Expansion in China sind Ausdruck der wachsenden Spannung, die durch die Verschiebung von Macht und Ressourcen entsteht, weil die Staaten alle, aber unterschiedlich stark wachsen. Einige (wie etwa Frankreich) bekommen dabei Angst, gegenüber dem Nachbarn zu viel an Boden zu verlieren. Es wundert fast, dass der Erste Weltkrieg samt nachfolgender Revolutionen nicht eher ausbricht, und es scheint verständlich, dass so viele Zeitgenossen den Kriegsausbruch bejubeln, weil sie ihn als Erlösung von aufgestauter Spannung empfinden.
Was für ein unnötiges Säbelrasseln: Hätte Deutschland England im Imperialismus nicht herausgefordert, England wäre im Ersten Weltkrieg neutral geblieben, hätte als Schiedsrichter dafür gesorgt, dass Frankreich und Russland, die allein von Deutschland geschlagen worden wären, nicht zu sehr geschädigt werden. Die USA wären nie in den Krieg eingetreten, nach ein paar Monaten und nur Zehntausenden von Toten statt neun Millionen wäre alles vorbei gewesen. Aber so entladen sich die darwinistischen Vorstellungen im Stahlgewitter, gehen in Europa ein halbes Jahrhundert lang die Lichter aus. England schneidet Deutschland per Seeblockade von Rohstoffen und Lebensmitteln ab. Im Hungerwinter 1916/17 sterben Tausende Zivilisten. Jeder friert, weil in den Bergwerken zuwenig Männer Kohle fördern, und was sie fördern, verfeuert die Reichsbahn für den Truppentransport. Selbst Grundnahrungsmittel gibt es nur noch gegen Bezugsschein, das Leben wird noch ungleicher als im Kaiserreich.
Eigentlich müsste dieser Krieg gleich vorbei sein: Durch die Seeblockade kommt aus Chile kein Salpeter mehr ins Deutsche Reich, das die Deutschen brauchen, um daraus Dünger, vor allem aber Sprengstoff, herzustellen. Dank ihres Vorsprungs im damaligen Strukturzyklus gelingt es ihnen aber, durch das Haber-Bosch-Verfahren den Luftstickstoff zu nutzen. Deutsche Chemiker stellen Kautschuk synthetisch aus Kohle her oder züchten Nährhefe als Zusatz für Lebensmittel, Metallurgen entwickeln Legierungen mit weniger Kupfer für die Elektroindustrie – kurz: Was ihnen fehlt, können die Deutschen oft technologisch ausgleichen. Umgekehrt ist die französische Chemieindustrie massiv von deutschen Chemie-Importen abhängig. Kriegsführung wird ein wirtschaftlicher Wettlauf darum, wer seine Produktion schneller ausweiten kann. Ohne den Kriegseintritt der USA mit ihrem Industriepotenzial hätte das Deutsche Reich den Krieg gewinnen können (und wir lägen, um Erich Kästners Gedicht »Wenn wir den Krieg gewonnen hätten« von 1931 zu zitieren, noch heute mit der Hand an der Hosennaht im Bett).
Damit beschleunigt der Krieg das Tempo, mit dem dieser Strukturzyklus erschlossen wird: Alle Volkswirtschaften bauen ungeheure Produktionskapazitäten in der Chemie und in der Schwerindustrie auf, investieren in arbeitssparende Maschinen, treiben die Elektrifizierung der Fabriken voran. Materialschlachten verschlingen nie da gewesene Güterberge. Moderne Industrien tauchen plötzlich neu in bisher ländlichen Gebieten auf. Die besser zahlende Rüstungsindustrie zieht Menschen aus den Dörfern in die Städte, wo sie auch nach dem Krieg bleiben. Millionen von Frauen jeden Alters und fast aller Schichten ersetzen die Männer in den Fabriken und öffentlichen Stellen (das bringt ihnen dann 1919 in der Weimarer Republik die formale Gleichberechtigung und endlich das Recht, wählen zu dürfen). Hochbetagte in Altersheimen erinnern sich heute an das Vorhängeschloss, das sie damals an der Brotdose der Mutter fanden. Der Weltkrieg am Höhepunkt des dritten Aufschwungs beendet die Jahre, in denen auch die ärmere Mehrheit ihr Leben verbessern kann.
Warum er zu Ende geht und warum es auch ohne Krieg zu einer – wenn auch nicht ganz so schweren – Weltwirtschaftskrise gekommen wäre, zeigt die lange S-Kurve, in deren Form die Basisinnovation verläuft: Um 1920 sind die meisten amerikanischen Fabriken elektrifiziert (s. Grafik). Das technologische Netz, das die Produktivitätsfortschritte der vergangenen 30 Jahre geschaffen hat, kommt seiner maximalen Ausdehnung nahe. Seine Wachstumsraten werden zu gering, um noch die ganze Wirtschaft zu tragen. Damit sinken Preise, Gewinne und Löhne. In den Privathaushalten wie in den Firmen bleibt weniger Geld übrig – der Rückwärtsgang des dritten Kondratieffs wirkt mächtiger, als der nächste Strukturzyklus schon Beschäftigung aufbauen kann.
Als Nikolai Kondratieff seine Aufsätze Anfang der 1920er Jahre veröffentlicht, schaut er realistisch zurück auf einen vergangenen Auf- und einen bevorstehenden langen Abschwung. Ob es danach wieder einen neuen Aufschwung gebe, sei jedoch nicht zwangsläufig. »Wenn ein neuer Zyklus beginnt, stellt er keine exakte Wiederholung der vorhergehenden dar, denn die Volkswirtschaft hat bereits eine neue Stufe erklommen. Der Mechanismus bleibt jedoch im neuen Zyklus im wesentlichen derselbe.«57 Wenn das, was er da entwickelt habe, richtig sei, schreibt er am Ende des Aufsatzes über die Preisdynamik, dann seien »die Quellen des in der Weltwirtschaft … herrschenden Depressionszustandes noch keinesfalls ausgeschöpft«. Wie Recht er hatte, sollte sich im folgenden Jahrzehnt zeigen.
3. Kondratieffabschwung Die schlimmste Wirtschaftskrise unserer Erinnerung
Keine Weltwirtschaftskrise ist so stark im kollektiven Gedächtnis wie die ab 1929. Selbst Jahrzehnte danach »sind sich die Experten noch immer nicht darüber einig, worin die Ursachen der Depression lagen«, schreibt der Wirtschaftshistoriker Rondo Cameron58, immerhin Herausgeber des »Journal of Economic History«. Was die etablierte Wirtschaftswissenschaft dafür an Gründen diskutiert – Kriegsfolgen, Deflation, Agrarkrise, weltweiter Protektionismus und Verteilungskämpfe zwischen Arbeitern und Unternehmern – hat die große Weltwirtschaftskrise aber nicht ausgelöst. Das sind lediglich Symptome und Folgen eines erschöpften Kondratieffzyklus. Auch die Siegerpolitik beschleunigt die Depression nur, besonders in Deutschland.
Wieso soll auch ein Weltkrieg einmal für eine Depression und ein anderes Mal, nach 1945, für ein Wirtschaftswunder verantwortlich sein? Und auch der große Börsenkrach im Oktober 1929 hat keine Krise ausgelöst, sondern nur die schon bestehende weiter verstärkt – schon lange vorher, Mitte 1927, produziert die Industrie in gedrosseltem Tempo. Bei genauerem Hinsehen wird klar, dass die 20er Jahre nur »golden« sind, wenn man sie aus der Sicht der Kriegs- und Hungerjahre betrachtet: In Wirklichkeit hastet diese Zeit wie in jedem Kondratieffabschwung von Krise zu Krise.
Warum die Wirtschaft Ende der 20er Jahre schrumpft, erschließt sich einem, wenn man sieht, dass die meisten Fabriken jetzt elektrifiziert und die meisten Haushalte mit Strom versorgt sind (siehe Grafik S. 98). Weil die Produktivität nicht mehr im selben Tempo wächst, wirkt der Mechanismus des Kondratieffabschwungs: Die Gewinne schmelzen dahin, die Preise fallen, die Unternehmen flüchten in Überproduktion, die keiner braucht. Wirtschaftliche Verteilungskämpfe senken die Löhne und zerstören den Rechtsstaat. Die Zinsen sinken. Und weil es sonst keine rentablen Investitionsmöglichkeiten gibt (und die neuen Wachstumsmotoren noch nicht stark genug sind), fließt das Geld wie 1873 in die Spekulation mit Aktien. Die Kurse schießen so unrealistisch nach oben, dass sie hinterher umso tiefer fallen. Der Rest sind Begleiterscheinungen des langen Abschwungs: Kurzfristige US-Kredite werden aus Deutschland abgezogen, die geliehene Konjunktur fällt auf den Boden der Realität zurück, es mangelt an Liquidität, Banken und Firmen brechen zusammen, protektionistische Zölle unterbinden den Welthandel noch stärker, die Absatzkrise verschärft sich, die Arbeitslosigkeit explodiert. Aber der Reihe nach.
Die sozialen Erscheinungsweisen des Kondratieffabschwungs sind sehr gut in den Kinderbüchern von Erich Kästner nachzulesen: Die Krise verstärkt die Straßenkriminalität, Alleinerziehende überleben sehr mühsam (»Emil und die Detektive«), Ehescheidung, verdeckte Arbeitslosigkeit und von außen erzwungene berufliche Belastung zerstören Familien (»Das doppelte Lottchen«), die unteren Schichten sind von der Krise stärker betroffen, die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander, und gerade Kinder müssen früh in die Lücken springen, weil Eltern aus wirtschaftlichen Gründen mit dem Leben nicht mehr fertig werden und Krankheit in den wirtschaftlichen Ruin führt (»Pünktchen und Anton«). Wir werden diese Bücher jetzt wieder brauchen. Weil sie Kinder ermutigen, nicht zu resignieren, sondern sich untereinander und den Erwachsenen zu helfen. Außerdem beschreiben sie eine lang andauernde Strukturkrise ebenso real wie akademische Geschichtsbücher.
Nachkriegs-Rezession oder Kondratieffabschwung?
Zum einen – ja: Der Krieg schwächt die europäischen Länder. 1919 müssen in Deutschland sechs Millionen Soldaten wieder ins Arbeitsleben integriert werden. Die Landwirtschaft erntet nur zwei Drittel der Vorkriegsmenge und die Industrie erzeugt 38 Prozent von 1913. Der Versailler »Vertrag« nimmt den Deutschen einige Grundlagen ihres Wohlstands: Sie müssen alle Handelsschiffe über 1600 Bruttoregistertonnen abliefern, dazu 5000 Lokomotiven und 150.000 Waggons. Patente und Lizenzen, die vor 1914 die deutsche Zahlungsbilanz aufgebessert haben, ziehen die Alliierten ein. Mit Elsass-Lothringen, erst 1871 annektiert und jetzt wieder an Frankreich angeschlossen, verliert das Reich drei Viertel seines Eisenerzes sowie ein Viertel seiner Kohleproduktion – damals die Basis für fast alle Wirtschaftszweige und damit so wichtig wie später Erdöl oder heute Computerbausteine.
Außerdem hat Deutschland Reparationen an die Sieger zu zahlen. Mit einem bis vier Prozent des jährlichen Bruttosozialproduktes (in Höhe von 50 Milliarden Reichsmark) sind diese aber eher ein psychologisches denn ein wirkliches Investitionshemmnis. Das ist nur etwa so viel, wie die Deutschen nach dem Ölschock 1973 für ihr Rohöl mehr bezahlen müssen und damit kein Grund für eine schwere Rezession. Das Problem sind also nicht die Reparationen, sondern das veränderte Weltwirtschaftsklima: Vorher, während des langen Kondratieffaufschwungs, haben die Deutschen Devisen im Export gut erwirtschaften können. Das ist jetzt im Abschwung für die Nachbarn ein Problem: Schon wieder würden sie Marktanteile an deutsche Firmen verlieren, deren wirtschaftliche Konkurrenz sie doch gerade erst in einem verlustreichen Krieg niedergekämpft haben. Ihre eigene Arbeitslosigkeit würde weiter steigen. Sie fangen an, ihre Grenzen für ausländische, erst recht für deutsche Waren zu schließen.
Weil die Deutschen die Reparationen jetzt nicht mehr im Export verdienen können, bieten sie Frankreich und Belgien an, die im Krieg zerstörten Ortschaften direkt wieder aufzubauen – mit eigenen Arbeitern und selbst geliefertem Material. In einem langen Kondratieffaufschwung, wenn Produktionsfaktoren wie Arbeiter und Material knapp sind, hätten diese das deutsche Angebot gerne angenommen. Aber so ist es wie früher in den 1880ern: In einem langen Kondratieffabschwung konkurrieren die Akteure eben nicht mehr um Ressourcen, sondern um Märkte. Das Überangebot an Produktionskapazität, ausgebildeten Fachleuten und sonstigem Kapital kann gar nicht ausgelastet werden – die Preise sind unter Druck. Deswegen stößt das deutsche Angebot, Dörfer und Städte in ihrem Land selber aufzubauen, auf den Widerstand innenpolitischer Lobbys – auch das ist Konkurrenz für die eigenen Firmen.
Deutschland kann 1924/25 nur 57,5 Prozent des Handelsvolumens von 1913 exportieren. Seine Handelsbilanz bleibt stets negativ – das heißt, Deutschland kauft zum Beispiel im Jahr 1925 ein Viertel mehr im Ausland ein, als es umgekehrt ins Ausland verkaufen kann. Die Lücke in Höhe von drei Milliarden Mark finanziert das freie, weltweit nach Anlagemöglichkeit suchende amerikanische Fremdkapital – was Deutschland so anfällig macht für den Moment, als die Amerikaner in der Weltwirtschaftskrise ihr kurzfristig verliehenes Kapital aus Deutschland abziehen.
Aber auch die Nachbarn stehen finanziell auf wackeligen Beinen: Ihre Kriegsausgaben haben sie mit US-Krediten finanziert. Weil es lange Zeit so ausgesehen hat, als wenn Deutschland siegen würde, haben die Amerikaner um ihr Geld fürchten müssen und sind auch deswegen in den Krieg gegen Deutschland eingetreten. Danach bitten Frankreich und England die USA, ihnen einen Teil ihrer Schulden zu erlassen – was die USA kategorisch ablehnen. Anders als später im Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie keine Ressourcen zu verschenken. Das ist der Grund, warum Frankreich so unerbittlich Reparationen von Deutschland fordert. Um dem Nachdruck zu verleihen, marschiert es 1923 ins Rheinland ein und löst damit eine Hyperinflation aus.
Normalerweise wird Geld vor allem am Ende eines langen Aufschwungs weniger wert, wenn in der Hochkonjunktur alle Produktionsfaktoren knapp sind und die Preise steigen. Die Inflation von 1923 dagegen – zu Beginn des langen Abschwungs – ist künstlich: Schon während des Krieges hat der Staat vier von fünf Mark, die er ausgibt, auf Pump finanziert; 1919 immerhin noch die Hälfte. Als das Reich während des Ruhrkampfes die Gehälter der Beamten im französisch besetzten Rheinland weiter bezahlt, finanziert es 90 Prozent seiner Ausgaben einfach dadurch, dass die Reichsbank eben mehr Papiergeld druckt. Die nicht durch reale Güter gedeckten Ausgaben entwerten die Reichsmark rapide. Der Mittelstand verliert seine Ersparnisse, seine Kapitallebensversicherungen, seine Renten. Zusammen mit einem Haufen anderer konservativ-nationalistischen Kräfte versucht Hitler in diesen Wirren das erste Mal, die demokratische Regierung wegzuputschen.
Aber nicht nur der deutsche Handel wird behindert: Nach dem Krieg gibt es in Europa nicht mehr 14, sondern 27 verschiedene Währungen und 20.000 Kilometer zusätzliche Grenzen, die Fabriken von ihren Rohstoffen trennen, Stahlwerke von ihren Kohlegruben und landwirtschaftliche Gebiete von ihren Märkten. Der Krieg hat den Welthandel unterbrochen, aber der Waffenstillstand belebt ihn nicht wieder. Versuche zu Beginn der 1920er, zum Freihandel zurückzukehren, scheitern daran, dass plötzlich überall die Preise sinken (wofür eben nicht der Krieg, sondern die nachlassenden Produktivitätsfortschritte im Kondratieffabschwung verantwortlich sind).
Einige Länder subventionieren Exportgüter, um sie im Ausland überhaupt noch verkaufen zu können. Das hilft jedoch nicht der eigenen Ausfuhr, sondern verschwendet die eigenen Steuergelder ebenso wie die der anderen Staaten, die dasselbe tun (das haben wir 2009 mit der Auto-Abwrackprämie erlebt). Außerdem kämpfen alle darum, den Devisenkurs ihrer Währung am schnellsten abzuwerten – damit sie ihre Produktion noch billiger verkaufen können (zu diesem Zweck drucken die USA heute Dollar in großen Mengen ohne entsprechenden Gegenwert). Das Konzept scheitert an der Gegenreaktion des Auslands. Der Welthandel schrumpft. Komparative Handelsvorteile – ein Land kann Produkt A besser herstellen als Produkt B, im Nachbarland ist das genau umgekehrt – verfallen ungenutzt. Dadurch stagniert die Produktivität nicht nur, sie sinkt sogar, weil man mit mehr Ressourcen aufwändig etwas herstellt, was andere eigentlich viel besser können. Wohlstand und Beschäftigung gehen zurück.
Typisch für den Kondratieffabschwung, fangen auch die Amerikaner an, Zollwände zu mauern, obwohl sie doch während des Krieges so erfolgreich die Märkte der anderen (vor allem der Deutschen) besetzt haben. 1921 verbieten sie kurzerhand, deutsche Farbstoffe zu importieren, um die eigene Farbindustrie zu schützen. Die gab es bis 1914 gar nicht, sie entstand erst im Krieg mit Hilfe von einkassierten deutschen Patenten. 1922 folgt ein Gesetz mit den höchsten Außenzöllen in der Geschichte der USA. Sich selbst autark zu versorgen, ohne auf andere Länder angewiesen zu sein – am meisten wird Nazi-Deutschland darum (erfolglos) kämpfen. Doch auch hier gilt, dass Hitler nur konsequenter fortsetzt, was schon vorher üblich gewesen ist.
Auch die Landwirtschaft leidet in den 20er Jahren weltweit. Während die Preise für Lebensmittel und für Ackerland in den USA im Krieg hochschnellen und selbst bisher nicht genutzte Gebiete etwa in Lateinamerika bebaut werden, fallen die Preise danach wieder rapide. Amerikanische Landwirte, die sich Böden dazugekauft haben, gehen bankrott (das ist derselbe Mechanismus wie im ersten Kondratieffabschwung, als die Bauern ihre Kredite nicht mehr bezahlen konnten, die sie im Aufschwung ihren ehemaligen Grundherren abgekauft hatten). Einige Länder versuchen, das Überangebot einzuschränken, indem sie es gar nicht erst auf den Markt bringen. Brasilien – damals stellt es 60 bis 70 Prozent des Kaffees der Welt her – schüttet ihn tonnenweise ins Meer. Das hebt aber nicht wie erhofft den Preis, sondern ermutigt andere Anbieter, ebenfalls Kaffee auf den Markt zu bringen.
Fazit: Reparationen, Handelskriege, sinkende Preise, Zinsen fast bei null und Überkapazitäten – die Weltwirtschaftskrise ist keine Folge des Ersten Weltkrieges, sondern die Folge eines erschöpften Kondratieffzyklus. Die hohe Arbeitslosigkeit entsteht also nicht, weil die Zinsen und Löhne zu hoch sind oder die Geldmenge zu niedrig, sondern weil das Produktivitätswachstum stagniert und es daher an Investitionsmöglichkeiten und Beschäftigung fehlt. Der technische Fortschritt in den altbekannten Branchen macht nur mittelfristig immer mehr Arbeiter überflüssig. Anders als später beim Computer begrüßen die Gewerkschaften der 1920er Jahre den technischen Fortschritt: Maschinen ersetzen die schweren, gesundheitsschädlichen und abstoßenden Arbeiten an Hochöfen, in der Fabrikhalle oder unter Tage. Für Arbeitervertreter ist der technische auch der Schlüssel zum gesellschaftlichen Fortschritt.
Beispiel Bergbau: Hauten die Bergleute 1913 noch fast alle Kohle mit Hand und Hacke oder vorbereiteten Sprengungen aus dem Untergrund, arbeiten sie zunehmend mit elektrischen Presslufthämmern: 1925 werden schon über ein Drittel und 1929 über 90 Prozent der geförderten Kohle mit Presslufthämmern gehauen. Dementsprechend weniger Bergleute sind für die Nachfrage nötig: Ihre Zahl geht von 545.000 (1922) auf 353.000 (1929) und 190.000 (1932) zurück. Typisch für eine Erschöpfungszeit ist auch, dass die Arbeitszeit kürzer wird, weil es ein Überangebot an Arbeitssuchenden gibt: von 57 (1910/14) und 50,5 (1925) auf 41,5 Stunden in der Woche (1932). (Im langen Aufschwung, wenn gar nicht genug produziert werden kann, steigt die Arbeitszeit – wie in den 1950er Jahren und in den New-Economy-Berufen der 1990er Jahre des fünften Kondratieffaufschwungs.)
Die Menschen werden aber nicht deshalb arbeitslos, weil die Wirtschaft jetzt so produktiv geworden ist – die Produktivität pro Arbeitsstunde steigt zwar weiter, aber viel langsamer als im Kaiserreich und in den ersten 20 Jahren der Bundesrepublik, als die Volkswirtschaft boomte. Die Arbeitslosigkeit der 20er Jahre entsteht, weil das neue technologische System noch nicht produktiv genug ist, um Hunderttausende von Arbeitskräften ausreichend effizient einzusetzen. Deswegen investieren die Unternehmen selbst in den relativ gefestigten Jahren 1925 – 29 auch nur 10,5 Prozent des Nettosozialprodukts – im Kondratieffabschwung fehlen Investitionsmöglichkeiten. Das ist im langen Aufschwung vor 1914 und in den 1950ern ganz anders gewesen: Damals werden netto 15 Prozent des Sozialproduktes investiert.
Was in den 1920er Jahren neu erfunden wird – Fernsehen, das Radio wird populär –, schafft noch keine wirklich große Beschäftigung. Auch das Fließband, von Henry Ford 1913 im Autobau eingeführt, läuft 1930/31 erst in zwei bis drei Prozent der deutschen Betriebe. Wer bei Ford in Berlin eine Stelle am Band erhält, verdient zwar den Traumlohn von bis zu 20 Mark am Tag – so viel wie andere Berliner Metallarbeiter in einer Woche. Nach drei bis zehn Monaten ist er allerdings körperlich so kaputt, dass er aufgeben muss und vom nächsten ersetzt wird. Wer älter ist als 35 Jahre, wird gar nicht erst eingestellt.59 Eine breite Schicht von Arbeitern lässt sich bei diesen Verhältnissen noch nicht beschäftigen.
Die geringen amerikanischen Arbeitslosenraten von um die fünf Prozent legen nahe, die 20er Jahre seien in den USA schon Teil des vierten Kondratieffaufschwungs. Zwar arbeitet noch immer jeder vierte Amerikaner in der US-Landwirtschaft, aber die USA und Kanada produzieren in den 20er Jahren zusammen 90 Prozent aller Autos der Welt (obwohl die wichtigsten Innovationen des vierten Kondratieffs aus Europa stammen). Doch während im langen Aufschwung der Arbeitsplatz sicher scheint, leiden jetzt die Beschäftigten gerade in dem neuen technologischen System rund um das Auto unter den ständigen Marktschwankungen, einem dreimal häufigeren Stellenwechsel als 1899/1913 und noch öfter unter vorübergehender Arbeitslosigkeit.
Die frühe Automobilindustrie entwickelt sich nicht wie heute ein paar Prozent rauf oder runter, sondern sprunghaft mit heftigen Ausschlägen. 1921, 1924 und 1927 fällt die Auto-Produktion in den USA dramatisch. Und als sie 1928 um 28 Prozent und 1929 um 23 Prozent steigt, erreicht sie dennoch erst wieder den Output von 1926 in Höhe von über vier Millionen Autos.60 Der Export von Autos fällt von über 600.000 vor dem Börsenkrach auf 65492 im Jahr 1932. Alle Zulieferer sind betroffen vom Einbruch der Autoverkäufe. Das heißt: Das neue technologische Netz entwickelt sich zwar rapide, ist aber noch nicht stark genug, die Wirtschaft zu tragen. Die Produktivitätsfortschritte der schon etablierten Branchen führen im Kondratieffabschwung aber nur mittelfristig zu Arbeitslosigkeit. Langfristig dagegen ist das die Voraussetzung dafür, dass dem nächsten Strukturzyklus ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen.
Da ist die instabile Konjunktur in Deutschland kein Wunder: Nach der überschießenden Inflation führt die Reichsbank die »Rentenmark« ein und verknappt die Geldmenge – das löst zum Jahreswechsel 1923/24 eine Stabilisierungskrise aus. Über 28 Prozent der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter (eine amtliche Statistik führt der Staat erst seit 1928) werden arbeitslos. Auch im Sommer 1924 und Ende 1925 bricht die Wirtschaft ein – in diesem Winter verliert jeder vierte Beschäftigte seine Arbeit, jeder weitere vierte muss kurzarbeiten. Aus dieser Rezession können sich die Deutschen schnell befreien, weil die Engländer Verteilungskämpfe ausfechten: Um in der internationalen Abwertungsspirale billiger im Ausland verkaufen zu können, werden die Löhne dort um etwa 10 Prozent gesenkt. 40 Prozent aller britischen Gewerkschaftsmitglieder sind bei Generalstreiks landesweit im Ausstand. Die deutsche Wirtschaft kann die fehlenden Güter kurzfristig liefern. 1928/29 produziert die Industrie endlich wieder so viel wie eine halbe Generation zuvor 1913, da sackt sie in sich zusammen.
Der »unerklärliche« Börsencrash 1929
Nachdem das elektrische System weitgehend implementiert, aber das Auto noch nicht stark genug ist, wird nicht ausreichend in die Realwirtschaft investiert, die Zinsen erreichen Tiefststände. Wie schon im Spekulationsfieber Anfang der 1870er fließt das Anlagekapital an die Börse in virtuelle Werte. Die rasant steigenden Kurse reizen immer mehr Privatleute, Aktien zu erwerben – zunehmend auch auf Kredit. Schon im Sommer 1928 ziehen amerikanische Banken und Investoren Kapital aus Europa ab, um damit die Hausse an der New York Wall Street zu finanzieren. Ein Jahr später spürt Europa bereits an der stockenden Konjunktur, wie ihm das amerikanische Geld fehlt. Auch die US-Wirtschaft schrumpft schon vor dem Crash. Während Deutschland, England und Italien in die Depression rutschen, sinkt auch die amerikanische Autoproduktion von 622.000 Stück im März 1929 auf 416.000 im September (und wird nach dem Crash auf nur noch 92.000 Autos im Monat Dezember abstürzen).
Obwohl die Wirtschaft schon schwächelt, haussiert die Börse weiter. Die amerikanische Notenbank ist in einer schwierigen Situation: Soll sie die Zinsen senken, um Investitionen rentabler zu machen und so die amerikanische Realwirtschaft wieder anzukurbeln (was aber auch wieder mehr Geld für Luftbuchungen an der Börse frei macht), oder soll sie die Zinsen erhöhen, damit die Kurse eben nicht mehr weiter so völlig unrealistisch steigen (und die Wirtschaft abwürgen, weil das Investitionen verteuert)? In vier Schritten hebt sie bis August 1929 die Zinsen von 3,5 auf 6 Prozent an, ohne dass die Kursrallye endet – dafür wird die Wirtschaft weiter ausgebremst.
Anfang September 1929 endet die Hausse. Allmählich beginnen die Kurse zu fallen, aber noch denken die Anleger (und da können sich die Anleger des Jahres 2000 gut hineinfühlen), das sei eben wieder nur eine Atempause, bevor es weiter aufwärts geht. Am 15. Oktober 1929 prognostiziert Irving Fisher, Professor an der Yale-Universität: »Die Kurse haben ein dauerhaft hohes Niveau erreicht. Ich erwarte, dass die Kurse in wenigen Monaten ein gutes Stück höher als heute stehen werden.« Am 24. Oktober stützt ein Bankenkonsortium die wichtigsten Kurse ab, doch die Verkauforders häufen sich. Panik erfasst die Aktionäre. Ihre Informationen sind oft schon einen Tag alt oder älter, wenn sie diese erhalten; die geringeren Kommunikationsmöglichkeiten sind ein Grund, warum die Börse nach dem dritten Kondratieff viel heftiger abstürzt als jetzt nach dem fünften Kondratieff (→ Börsen-Kapitel, S. 346).
Noch ein Grund für den schnellen Absturz: Damals müssen Investoren nur zehn Prozent des Aktienkaufs bar bezahlen, den Rest können sie leihen. Wer Aktien auf Kredit gekauft hat, für den verkauft die Bank die Papiere auch ohne seine Zustimmung, sobald der Kurswert gerade noch den Kreditanteil deckt – das beschleunigt den Abfahrtsslalom. (Heute darf nur die Hälfte des Betrages kreditfinanziert sein, mit dem jemand in den USA Aktien kauft – auch deswegen verteilt sich die Korrektur der Preisblase auf mehrere Jahre.) Am 28. und 29. Oktober 1929 verliert der Dow Jones-Aktienindex 40 Prozent. Anleger stürzen sich von Wolkenkratzern in den Tod. Es wird bis 1954 dauern, bis er wieder das Niveau von 1929 erreicht hat. (Glauben Sie es also Ihrem Finanzberater nicht blind, wenn der Ihnen erzählt, Aktien wären immer die bessere Anlage.)