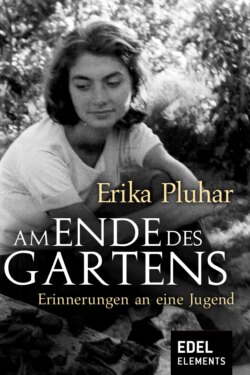Читать книгу Am Ende des Gartens - Erika Pluhar - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеEines Tages jedoch mußten sie Wien erreicht haben, obwohl diese Strecke, für die man heute mit dem Auto einige Stunden benötigt, kaum überwindbar schien.
Man hatte ihnen die Döblinger Wohnung weggenommen, weil der Vater Nazi war. Er befand sich in Kriegsgefangenschaft, sie hatte sich in all der Zeit nicht um ihn geängstigt, kaum an ihn gedacht. Nur wenn anfangs Päckchen mit Rosinen und getrockneten Feigen aus Griechenland kamen, fiel ihr die Abwesenheit des Vaters auf – aber recht angenehm.
Die Mutter war also weiterhin auf sich gestellt und mußte eine Unterkunft finden. Ihre älteste Schwester erklärte sich bereit, sie samt den Kindern vorübergehend bei sich aufzunehmen – und die zwei kleinen Kabinette bei der »Tante Minnie« sind die nächsten Erinnerungsbilder. Die Zimmerchen so mit Möbeln vollgeräumt, daß nur schmale Durchschlüpfe blieben. Die Mutter, eng an eine Küchenkredenz geschmiegt und mit Heißhunger ein Schmalzbrot nach dem anderen verschlingend, die Augen wie abwesend vor Gier. Sicher hatte sie, um die Kinder zu ernähren, selbst lange Zeit gedarbt. Sie hatte Strapazen hinter sich, sie mußte das Leben der Familie fest in die eigene Hand nehmen und hatte gelernt, selbständig zu sein. Und sie war hungrig. Aber was das Mädchen beobachtete, war noch ein anderer Hunger, und der verwirrte es. Nur ein sekundenschneller Eindruck. Als hätte es die Mutter bei etwas Verbotenem überrascht.
Aber das Mädchen mochte das Leben in der Wohnung der Tante. Der zugehörige Onkel war ein etwas unfreundlicher, ständig belehrender Mann, aber das störte die Mutter mehr als die Tochter. Sie spielte mit ihren beiden Cousins. In Peter, dem jüngeren, fand sie wieder einen willfährigen Kameraden, der begeistert ihre Spiele übernahm und auf jede ihrer Ideen einging. Und die bestanden sehr bald in Geschichten, die entweder gezeichnet oder dargestellt werden mußten. In dieser Wohnung, im letzten Stock eines Eckhauses in der Gymnasiumstraße, in den hohen, kleinbürgerlich eingerichteten Zimmern, hier begann sie, mit der Phantasie zu spielen. Hier fehlten Wald und Hügel, die ländliche Weite, also schwärmte sie in erdachte, erträumte Landschaften aus.
Als es Herbst wurde, kam sie endlich zur Schule. In die erste Klasse der Volksschule in der Köhlergasse. Ihre Lehrerin war eine kleine, rundliche Frau mit gewellten weißen Haaren, die im Nacken geknotet waren, und einem freundlichen, rosigen Gesicht. Als Schülerin hatte sie das Glück, gleich zu Beginn eine so liebenswürdige Lehrperson zu erfahren – und dieses Glück blieb ihr treu. Nie hat sie unter Lehrern gelitten, viele von ihnen sogar geliebt und bewundert. Sie hat die Schule nie gehaßt. Anfangs litt ihre Umgebung sogar unter ihrer glühenden Begeisterung. Sie verlangte ihr Frühstück zwei Stunden vor Schulbeginn, um eine Stunde vor Schulbeginn beim noch geschlossenen Schultor stehen zu können, aufatmend und in der Gewißheit, nicht zu spät zu kommen. Die Wege durch das Cottage – baumbestandene Straßen zwischen Villen – lief sie trotz der frühen Stunde und genoß dann die Wartezeit vor der Schule, meist noch lange allein.
Sie lernte fast andächtig. Schreiben und Lesen. Damit wurde ihr der Schlüssel zu ihrem weiteren Leben in ihre Hand gelegt, das wußte sie sofort. Dafür nahm sie auch das Rechnen in Kauf.
Nachmittags saß sie in einem der schmalen Kabinette und machte ihre Aufgaben. Sie liebte diese Ruhe und Konzentration, liebte die Buchstaben und die Möglichkeiten, aus ihnen Worte zu erschaffen. Es entzückte sie. Keiner mußte sie drängen, das Lesen zu üben. Nachdem sie erkannt hatte, daß aus Büchern Geschichten fließen, sobald man sie entziffern kann, wollte sie nur noch Meisterin im Lesen werden. Sehr bald schrieb sie kleine Märchen auf gefaltetes Papier, damit es aussähe wie ein Buch, illustrierte sie mit selbstgezeichneten bunten Bildern, und der Cousin Peter tat es ihr nach. Tante Minnie, eine herzliche, mollige Frau, die seit eh und je silbergraue Haare hatte – »seit ihrer Jugend«, sagte ihre Mutter –, war von dieser künstlerischen Tätigkeit entzückt und lobte deren Einfluß auf ihren Sohn.
Der Cousin tat zwar nichts aus eigenem Antrieb, aber er schloß sich an. Als Kind war sie auf unbekümmerte Weise autoritär. Ihre Intensität schien sich auf andere zu übertragen und Interessen zu wecken. Sie hatte so viel Lust an dem allen, daß sie anderen davon abgeben konnte.
Eines der Märchen aus diesen illustrierten Büchlein beginnt so:
Es lebte einst auf einem hohen, von tausend scharlachroten und himmelblauen Blumen übersäten Berg eine wunderschöne Zauberprinzessin mit langen rabenschwarzen Locken und einem prächtigen Kleid. Mit einem goldenen Szepter regierte sie über das Land, und alle Tiere und Blumenelfen im weiten Tal kamen zu ihrem Thron, um sich Rat zu holen. Aber nur ein wenig zu stolz war sie, und jeder, der sich nicht ihrer Hoheit unterwarf, mußte seinen Kopf unter dem Schwerte lassen. Und überall, wo ein Blutstropfen hinfiel, wuchs eine blutrote Blüte empor. Aber sie beschenkte auch viele. Und wo ihre Freudentränen hinfielen, wuchsen zartblaue Kelche in lieblichen Büschen. So entstand der Berg des Stolzes und der Demut ...
Wenn sie am Tisch saß, ein Blatt Papier vor sich, das sie sorgsam faltete, mit dem Lineal den gewünschten Raum für die Illustration festlegte und dann zu schreiben begann, erfüllte sie Zufriedenheit. Das mit Bleistift gezeichnete Bild bemalte sie mit Buntstiften. Diese Buntstifte hütete sie, es gab sie damals nur begrenzt zu kaufen. Alles gab es nur begrenzt. Das heißt, es gab von allem fast nichts. Trotzdem kann sie sich nicht erinnern, an irgend etwas Mangel gelitten zu haben. Sie wurde satt, sie durfte zur Schule gehen. Und der Krieg war vorbei.
Etwa zwei Jahre verbrachten sie bei Tante Minnie. In diesen beiden Jahren nach dem Krieg lernte sie ihre Großeltern kennen, oder besser, sie traten ihr ins Bewußtsein.
Die Eltern ihrer Mutter lebten nicht sehr weit entfernt in der Schulgasse. Durch eine große Toreinfahrt gelangte man in einen Hinterhof, der ländlich weit wirkte wie ein Dorfplatz und um den mehrere Häuser lagen. Im Parterre des mittleren Hauses befand sich die Wohnung der Großeltern, aber im rückwärtigen Teil dieses Hauses gab es noch ein Untergeschoß, in dem die Werkstatt des Großvaters untergebracht war. Und von dort gelangte man in einen tiefer liegenden Garten mit Kiesplatz, Wiese, Obstbäumen, einem kleinen Hügel voller Ribisel- und Himbeerstauden und einem »Salettl« unter Kastanienbäumen. In diesem hölzernen Gartenhäuschen fand so manches Spiel mit den Cousins statt, es bot Raum für Geschichten und Erfindungen. Vor allem, wenn auf dem Kiesplatz der Tisch gedeckt war und eine der unvermeidlichen Familienjausen stattfand, deren Langeweile die Kinder schnell entflohen, Kuchenstücke in der Hand.
Die Mutter hatte drei Schwestern, und so gab es neben Tante Minnie auch noch eine Tante Trude und eine Tante Hedi, drei dazugehörige Onkel und einige Cousins, die alle meist bei den Großeltern zusammentrafen. Der Großvater war ein gutaussehender, schnauzbärtiger Mann von kleiner Statur und zu dieser Zeit Wiens bekanntester Glasmaler. Da so viele Kirchenfenster zerstört waren, florierte sein Betrieb, sogar für die Stephanskirche schuf er bunte Glasfenster mit religiösen Motiven, oder ist das eine der Übertreibungen jeder Familienchronik? Jedenfalls gehörten der Geruch nach geschmolzenem Blei und die immer leicht verstaubten, bunt geätzten Glasteile, aus denen Madonnenblicke sie trafen oder ein Christus mit blutiger Stirne seine Augen senkte, zu diesen Großeltern wie die weißen Kaninchen in den übereinandergebauten Holzställen und die Frage der Großmutter, ob man des Sonntags auch sicher in der Kirche gewesen sei. Sie war eine freundliche kleine Frau mit frischem Teint und unerbittlicher Religiosität. Vor ihren blauen forschenden Augen wurde reichlich gelogen, weil niemand zur Kirche gehen, aber auch keiner ihr Gezeter anhören wollte. So brachte ihre Frömmigkeit eine Menge Ketzerei, ihr Wunsch nach Gottgefälligkeit viel Lug und Betrug hervor. Sie terrorisierte die ganze große Familie. Ansonsten war sie durchaus eine Großmutter, die man gern hatte – sie hieß »Omama«, genauer »die kleine Omama«. Das mußte sein, um sie von der anderen zu unterscheiden.
Und die hieß Oma. »Die große Oma«.
Die große Oma wohnte im achten Bezirk. Man mußte mit der Straßenbahn fahren, wenn man sie besuchen wollte, beim großen dunklen Gebäude des Landgerichts aussteigen, dann die Florianigasse hinaufgehen und links in die Schlösslgasse einbiegen. Die macht an ihrem Ende einen Knick und führt auf einen kleinen Platz. Das Haus der Oma lag vor dieser Biegung, linker Hand.
Mit der Straßenbahn zur großen Oma zu fahren war nicht allzu kompliziert, und sie lernte früh, sich selbständig auf den Weg zu machen. Die hölzernen Wagen rumpelten dahin, und sie schaute durch das Fenster auf die vorüberziehende Stadt. Daß überall Schutt herumlag, zwischen ganzgebliebenen Häusern immer wieder Ruinen standen und seltsame Durchblicke schufen, sei es in den Himmel oder in die nächstliegende Straße, daß ganze Häuserfronten von Einschußlöchern gezeichnet waren und der Staub eines großen Krieges dunkelgrau und schmutzig die Stadt bedeckte – es kam ihr wie das Normalste der Welt vor. Aber als eines Nachmittags ein anderes Kind neben ihr im Straßenbahnwaggon stand und einen enorm großen, hellgrünen Apfel verspeiste, immer wieder krachend in ihn hineinbiß, da hätte sie gerne einen Mord begangen, um diesen Apfel an sich zu reißen. Sie starrte jedoch nur hinüber, und ihr Mund füllte sich mit Speichel. Obwohl sie nie Hunger gelitten hatte, gab es dennoch diese Gier. Sogar auf dem Weg zur großen Oma, die nichts anderes tat, als sie zu füttern und sich Leckerbissen für sie auszudenken.
Wenn sie beim Landgericht die Straßenbahn verließ, lief sie immer möglichst schnell an diesem Gebäude vorbei. Es war so riesig, so bedrohlich, die Mauern dunkel, fast schwarz, und man hatte ihr gesagt, daß es voll gefangener Menschen sei, ein Gefängnis also. Jahrzehnte später, als sie gezwungen war, dieses Gebäude zu betreten und einen Gefangenen zu besuchen, der ihr sehr nahe stand, dachte sie an diesen Eindruck ihrer Kindheit zurück. Sie war als Kind vorbeigerannt, an einer dunklen Ecke der Welt vorbei, die sicher nie etwas mit ihr selbst zu tun haben würde. Als Erwachsene lernte sie, dieses Gefangenenhaus mit einiger Gelassenheit zu betreten, und nicht nur dieses.
Eilig bog das sechs-, siebenjährige Mädchen in die Schlösslgasse ein und zog dann an der Wohnungstür der Großeltern die Türglocke. Meist saß der Großvater gleich hinter dieser Tür, am Vorzimmerfenster, und rauchte seine lange, geschwungene Pfeife. Er mußte dort sitzen, weil die große Oma in den anderen Zimmern den Pfeifenrauch nicht duldete. Und weil sie ihn haßte, glühend und unerbittlich. Den Grund für diesen Haß erfuhr das Mädchen Jahre später an einem Weihnachtsabend, als es lesend – und bald atemlos lauschend – in der Nische hinter dem Tannenbaum kauerte und die große Oma, wohl vom Wein oder einer seltenen Herzlichkeit gelockert, ihren Eltern zu erzählen begann. Ihre große Oma war eine junge, schöne Hedwig gewesen, Wirtstochter in einem böhmischen Dorf. Ihre Eltern schickten sie jedoch nach Wien auf eine Klosterschule, und dort erhielt sie eine ungewöhnlich gute musische Ausbildung. Vom rauhen Leben wußte sie wenig, als sie als gebildete junge Dame in das dörfliche Wirtshaus zurückkehrte und der dortige Stationsvorstand um sie freite. Das war der Großvater. Mit Sicherheit ein sehr derber Mann, dem der feine Körper des jungen Mädchens gefiel, der aber mit dessen feiner Seele und Kultiviertheit nichts anzufangen wußte. Sie sei ihm dreimal davongelaufen, erzählte die große Oma an jenem Weihnachtsabend, dreimal nach Hause gelaufen, und jedesmal hätten ihre Eltern sie wieder zurückgeschickt. Also fügte sie sich, gebar dem Mann vier Söhne und haßte ihn fortan.
Was damals, in den Nachkriegsjahren, sichtbar wurde, war jedoch nur ein wortkarger Großvater, wuchtig, weißhaarig und mit Pfeife, den alle »Otta« nannten, der in einem Alkoven ohne Fenster schlafen mußte, von der großen Oma tyrannisiert wurde und niemals aufmuckte. Den zu brechen ihr gelungen war. Sie, die große Oma, war zu einer rauhen, abgearbeiteten Frau geworden, die »böhmakelte«. Auch der Otta natürlich. Diese Großeltern waren exemplarische Gestalten der großen Monarchie, die, als sie nach Wien zogen, noch den Kaiser von seinem Balkon in der Hofburg hatten herunterwinken sehen und ihren tschechischen Akzent nie verloren.
Wenn sie also geläutet hatte und allein vor der Tür stand, wurde sie von der großen Oma mit Jubel begrüßt und ihrer Selbständigkeit wegen gelobt. Und dann kam die unausbleibliche Frage: »Und was, glaubst du, gibt es heute?«, gefolgt von ihrem eigenen unausbleiblichen Triumphschrei: »Germknödel!!« Und es gab Germknödel, sie wußte es, weil Germknödel zu dieser Zeit ihre Leibspeise waren, die große Oma sie unvergleichlich gut zubereitete und Freude an ihrer Freude hatte.
Es gab bei ihr sämtliche Gerichte der böhmischen Küche, die alle zu Liedern oder Kabarettnummern inspiriert haben und als »bemmisch« in den Wiener Dialekt eingezogen sind: Powidltatschkerln, Liwanzen, Zwetschkenknödel ... Aber die großen, flaumigen Germknödel, mit Powidl – Pflaumenmus – gefüllt, mit Mohn und Zucker bestreut und heißer Butter übergössen – nichts erfüllte damals ihre kulinarischen Sehnsüchte mehr.
Die große Oma hinkte und hatte Schmerzen. Später starb sie sogar an diesem Leiden, das sich in unseren Tagen durch eine Routineoperation beheben ließe. Ihre Hüfte war kaputt und schädigte schließlich den ganzen Körper. Aber sie klagte kaum, und ihr energisches Herumhinken, ab und zu von einem rauhen Fluch begleitet, war jedem Selbstverständlichkeit, es gehörte zu ihr. Wie die Hände mit den großen braunen Altersflecken und das lange eisgraue Haar, das ihr bis zur Taille reichte. Immer trug sie es kunstlos aufgesteckt, manchmal ließ sie sich »frisieren«, setzte sich geduldig hin, und die Enkelin durfte mit Kamm und Kinderungeschick in dieser Haarfülle wühlen.
Als sich die große Oma später entschloß oder dazu überreden ließ, das lange Haar abzuschneiden und die »praktischere« Dauerwelle einer Kurzhaarfrisur auf sich zu nehmen, war auch die Zeit des »Frisierens« vorbei, und diese Veränderung fiel der Enkelin nicht sonderlich auf. Aber die große Oma bleibt für sie eine alte Frau mit langen grauen Haaren, die sie in vielem nachhaltig beeinflußt hat.
In der Wohnung in der Schlösslgasse wohnten – oder nächtigten zumindest – immer viele Menschen. Sie war nicht allzu groß, hatte jedoch geräumige, hohe Zimmer und allerlei Nebenräume. Außer Ottas dunklem Alkoven gab es hinter einem Vorhang eine Art Badezimmer, in dem ein uralter Badeofen das Wasser langwierig erhitzte, weshalb baden zu dürfen eine kostbare Seltenheit bedeutete. Es gab ein großes Wohnzimmer voll schwerer altdeutscher Möbel, ein Schlafzimmer mit einer seidenbespannten Deckenlampe, die einen Saum langer Fransen trug. Und hinter der Küche – einer unvergeßlich gemütlichen alten Küche, reich an Nischen, mit einem einzigen Fenster zum Lichthof hinaus – lag das Kabinett, in dem die große Oma schlief.
Wenn die Enkeltochter dort übernachtete, schlief sie ebenfalls in diesem Kabinett und im selben Bett. Sie erhielt den Platz zur Wand hin, und wenn das Schnarchen der alten Frau sie nachts weckte, hoben sich die Umrisse der großen Oma gegen das hellere Fenster ab, schützend wie ein dunkler Hügel. Dann fühlte sie sich friedlich behütet. In diesem kleinen Zimmer roch es wie in einer Speisekammer, denn die große Oma lebte auch in einer Speisekammer. Neben dem Bett füllte ein riesiger Tisch diesen Raum, dicht von Vorräten und Essensresten bedeckt. Da standen Pfannen und Töpfe, denen bittere, würzige Gerüche entstiegen, kalt gewordene Knödel, Gurken, Schmalz, Zwetschkenkuchen, Speckseiten und Powidlgläser. Manchmal sah sie den Morgen aus dem Lichthof hereindämmern, fühlte sich warm vom schweren, erschöpften Atem der großen Oma und von unerschöpflichen Essensvorräten umgeben. Eine Weile hielt sie die Augen geöffnet, schaute zufrieden ins Dunkle hinaus und schlief dann schnell wieder ein.
Hier lebte auch die schöne, große Cousine Liesi. Uneheliches Kind einer Schwester des Vaters, der Tante Ritschi, war sie bei der großen Oma aufgewachsen und deren ganzes Glück. Sie war älter als ihre ältere Schwester, ein feinhäutiges, stattliches Mädchen mit großen hellen Augen und dunklem Haar, groß gewachsen, in der Schule immer die Beste, ein wenig verwöhnt und von allen bewundert. Die Tante Ritschi kam nur selten vorbei, hatte große Zähne, wenn sie lachte, und konnte fünfzehn Zwetschkenknödel hintereinander essen.
Wer bevölkerte die Wohnung noch alles? Immer war irgend jemand da. Zum Beispiel jenes wahnsinnig gewordene Dienstmädchen, das, als man die Klotür aufriß, dort im Schein unzähliger Kerzen, mit aufgelöstem engelsblondem Haar und weißem Hemd vor Heiligenbildern kniete, das Gesicht ekstatisch erleuchtet. An den Anblick des strahlend erleuchteten Klosetts, dieser verzückten Frau mit den nackten Schultern erinnert sie sich ganz genau. Es gab Aufruhr, man bezichtigte die Betende einer verbotenen Handlung, hatte sie wohl schon öfter in diesem Zustand entdeckt. Das Kind wurde weggeschickt, und später holten weißgekleidete Männer das Dienstmädchen ab.
Neben dieser Gestalt, die ihr wie das Bild aus einem Traum erscheinen will, zogen höchst reale Menschen durch die Wohnung, Verwandte, Bekannte, alle mit gutem Appetit gesegnet, und alle von der großen Oma verköstigt. So knapp nach dem Krieg Nahrungsmittel in diesen Mengen aufzutreiben war nicht leicht. Deshalb fuhr die große Oma wiederholt aufs Land, nach Sittendorf am Rand des Tullnerfeldes. Sie blieb dann längere Zeit bei einer Bauernfamilie auf deren Hof und nähte und flickte den ganzen Tag alles, was an Wäsche und Kleidung auszubessern und umzuändern war. Als Gegenleistung konnte sie mit einem Rucksack voller Eßwaren wieder nach Hause fahren, mit Eiern, Fleisch, Obst, allem, was in der Stadt nicht aufzutreiben war.
Auch nach Sittendorf hat die große Oma sie einige Male mitgenommen – oder nur einmal? In der Kindheit vermehrt sich Zeit. Später fließt sie eilig davon. Es gefiel ihr in Sittendorf. Die stille Dorfstraße, Holundersträucher an den Scheunenwänden. Und jener Abend, an dem sie müßig die Mücken beobachtete, die im goldenen Licht spielten, während die große Oma in der späten Sonne ein Gurkenfeld aufharkte. Rundum stand eine so große und friedliche Ruhe, daß sogar die regelmäßigen Schläge der Harke sich in ihr aufzulösen schienen. Und wo schon der Schatten des Abends lag, erhob sich ein kühler Geruch nach Erde und feuchtem Gras, strich zu ihr her, die noch in der warmen Sonne stand.
Aber das Leben auf dem Bauernhof bedrückte sie auch. Wenn sie sich den Tieren zuwandte. Und das geschah häufig, denn zeit ihres Lebens muß sie sich Tieren zuwenden, wenn sie ihnen begegnet. Erstmals erfuhr sie so das Leid der Kreatur – wie der Mensch mit ihr umgeht, sie nicht wahrnimmt oder nur zu seinem Nutzen wahrnimmt. Nicht nur das Schlachten der Tiere bestürzte sie, auch die fühllose Haltung den Haustieren gegenüber. Daß einfach keiner mit dem Hofhund sprach, dessen Augen unaufhörlich Antworten der Liebe erheischten. Wie man die Katzen verscheuchte und die Kühe herumstieß. Immer sah sie die Augen der Tiere und darin die stumme, trauervolle Frage nach Sinn und Bestimmung. Wenn sie mit ihr darüber zu sprechen versuchte, sagte die große Oma ohne viel Mitgefühl: »So ist das bei den Bauern«, und hob den Kopf nicht von der surrenden Nähmaschine. Auch das erschien ihr bedrückend, daß die große Oma unaufhörlich zu arbeiten hatte. Die Bauersleute waren sicher freundlich – dennoch war es, als bedienten sie sich einer Sklavin. Die große Oma als Sklavin, das war unvereinbar. Aber sie saß in der dunklen Stube und nähte oder half auf dem Feld und schuftete. Kann sein, daß sie es freiwillig tat, sich selbst versklavte im Gefühl, etwas schuldig zu sein – das Kind an ihrer Seite litt darunter. Manchmal saßen sie bei Most und Speckbroten beisammen, dann schnitt die große Oma diese Brotscheiben für sie in handliche Schnittchen, wie sie es immer tat, lachte mit den Bauersleuten ihr rauhes Lachen, ruhte sich aus und war dicht neben ihr. Dann war eine Weile alles gut.
Aber es gab diesen einen langen nächtlichen Weg zum Bahnhof. Sie mußten an einem Bach entlanggehen, der finster rauschte. Auch die Bäume rauschten im Nachtwind, außer ihnen beiden schien auf Erden niemand mehr unterwegs zu sein. Die große Oma trug einen riesigen, zum Platzen vollgestopften Rucksack, er drückte ihr den Oberkörper nach vorne, sie ging gebückt und keuchend. Schließlich griff sie nach der Schulter des Kindes, bohrte die Finger tief ein, um sich abzustützen, und begann, unflätig zu fluchen. Gleichzeitig sagte sie immer wieder Beruhigendes wie »Is’ nix« oder »Gleich hamma’s« oder »Mach dir nix draus«, aber das Kind, das die verzweifelte Klammer dieser Hand auf ihrer Schulter fühlte, wußte plötzlich, unter welchen Schmerzen die große Oma durch ihr Leben ging. Die schwere, fluchende Frau, die einsame Finsternis rundum, die Geräusche nächtlicher Natur wurden ihr unheimlich, sie hätte gerne geweint.
Irgendwo kamen sie jedoch schließlich an, sei es in einem erleuchteten Wartesaal oder in einem erleuchteten Bahncoupé, es gab wieder Helligkeit und andere Menschen, irgendwo konnte die große Oma sich niedersetzen, den Rucksack ablegen, dem Kind aufmunternd ins Gesicht lächeln und über die Wange streichen, und es vergaß schnell und bereitwillig, was es dunkel angerührt hatte. Viele Jahre später, als die große Oma starb, machte die Enkelin sich Vorwürfe, weil sie niemandem von dieser Erfahrung berichtet hatte.
Andere klare Bilder aus dem Leben der großen Oma begleiten sie. Da ist der Bäcker Pflamitzer auf dem kleinen Platz hinter der Schlösslgasse, bei dem man die knusprigsten Kipferln kaufen konnte. Da sind die Bänke im Rathauspark, auf denen die alte, hinkende Frau bei ihren Spaziergängen gern ausruhte und die braungefleckte Hand hob und über die Ringstraße zu einem großen zerstörten Gebäude hindeutete, das in Bretter und Planken gehüllt war. »Das war das Burgtheater«, sagte die große Oma feierlich und langsam, als dürfe man dies nicht einfach mitteilen. Als Klosterschülerin hatte sie das Theater besucht, und wenn sie davon erzählte, wurde ihr Gesicht mädchenhaft und spiegelte die fernen Träume ihrer Jugend wider. Gewiß haben diese Erzählungen und Träume in dem Kind Wurzeln geschlagen, gewiß förderte die Theaterbegeisterung der großen Oma seine Neigungen. Gemeinsam besuchten sie später Vorstellungen im Raimundtheater, wo die Sängerin Ljuba Welitsch »Meine Arme sind schmiegsam und weiß« sang und gleichzeitig zwei ungeheuer weiche weiße Arme, entblößt und ein wenig wabbelig, um sich schwang. Welch beeindruckende Koinzidenz! Auch ins Kino gingen sie häufig, kamen immer zu früh und saßen als erste Besucher in leeren Foyers. Wenn sich das Kind in seinem Sessel bewegte oder in normaler Lautstärke eine Frage stellte, kam sofort ein »Pschsch!!!« heruntergezischt, die Oma saß feierlich und regungslos da, sie begab sich in Theater- und Kinosäle wie in Kirchenräume. Etwas von dieser Ehrfurcht muß das Kind übernommen haben, denn es revoltierte nie dagegen. Nichts liebte es leidenschaftlicher, als vor einer Bühne oder Kinoleinwand zu sitzen und in fremde Geschichten einzutauchen, und die Feierlichkeit der großen Oma schärfte seine Konzentration und Aufnahmefähigkeit. Sie beide waren ein zutiefst einiges, fast verschworenes Paar, sprachen bei diesen Besuchen wenig miteinander, ließen das sprechen, was sich vor ihnen abspielte, »gingen darin auf«, ohne den anderen mit Kommentaren oder Kritik zu belästigen.
Als sie in die zweite Volksschulklasse ging, horchte sie eines Morgens auf. Sie lag noch im Bett, in einem der kleinen Zimmerchen bei der Tante Minnie. Sie hörte die Türglocke, Stimmen, die plötzlich erregten Schritte ihrer Mutter. Etwas Einschneidendes würde sich ereignen, das war ihr schon klar, bevor die Mutter das Kabinett betrat, sich über sie beugte und sagte, der Vater sei aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen, sie würden ihn heute noch wiedersehen.
Als der Vater dann wirklich kam, bärtig und verwildert, schien für sie alle ein Fremder heimgekehrt zu sein, Umarmungen und Küsse konnten die Befangenheit nicht mildern. Das Mädchen starrte diesen dunklen, mageren Mann an und fragte sich, welchen Platz er wohl in ihrer aller Leben einnehmen würde. Aber sachlich und ohne Furcht stellte es diese Frage und ließ sie vorläufig unbeantwortet. Nichts störte das Gleichmaß ihres Lebens. Nur war sie an dem Tag, als der Vater heimkehrte, gezwungen, zur Schule zu laufen, mit Herzklopfen dahinzuhasten, und das ärgerte sie – mehr als die Rückkehr des Vaters sie freute.
Doch nun ertrug die Mutter es nicht mehr, zur Untermiete in der Wohnung ihrer Schwester zu leben. Immer häufiger gab es Streitereien mit dem quengelnden Onkel und verdüsterte Gesichter, von denen Schwaden erboster Gedanken auszugehen schienen. Die Eltern bemühten sich verzweifelt um eine eigene Wohnung, das war unzähligen Gesprächen zu entnehmen, die sie bei Tisch oder vor dem Einschlafen umspülten, ruhige oder erregte Wortbäche immer gleichen Inhalts. Der Vater arbeitete vorläufig in der Glasmalerwerkstatt des Großvaters. Und die innere Nervosität der Mutter fiel sogar dem Kind auf, das in seiner eigenen Welt aufgehoben war. Die höhere Stimme der Mutter, enge Augen und verächtliche Mundwinkel – sonst sporadische Anzeichen von nahendem Unmut – zeigten sich nun immer häufiger. »Die Situation wird untragbar«, lautete ein bestimmender Satz dieser Zeit.
Und es kam der Tag, an dem sie mitgenommen wurde, die »neue Wohnung« zu besichtigen. Die Straßenbahnfahrt schien kein Ende nehmen zu wollen, sie stiegen wiederholt um, fuhren auf einer großen Brücke über einen großen Fluß. »Schau, die Donau«, hieß es. In der Ferne begrenzten Hügel den grausilbernen Fluß – »der Kahlenberg, siehst du? Und dann der Leopoldsberg.« An diesem heißen, staubgelben Sommertag schaute sie zum ersten Mal von der Brücke aus über die Donau und zu den Hügeln hin, fuhr sie zum ersten Mal nach Floridsdorf, dem Randbezirk von Wien, in dem sie von nun an ihre Jugend verbringen sollte.
Die Straßen wurden immer ländlicher und staubiger. Jedenfalls die eine bestimmende Straße, die schnurgerade Brünnerstraße, die aus der Stadt hinausführte. Zuletzt kamen sie am Gelände einer Lokomotivfabrik vorbei, eine Bahnlinie überquerte auf schmaler Brücke die Straße, sie sah den grasbewachsenen Bahndamm und Schrebergärten. Dann, linker Hand, drei aneinandergebaute mehrstöckige Häuser, eine eigenartige steinerne Insel. Das letzte dieser Häuser schien neueren Datums zu sein, grüngestrichene Balkons starrten auf die Straße hinunter. Und dorthin strebten die Eltern jetzt, was in ihr selbst Widerstreben auslöste. Ein häßliches Haus, dachte sie.
Aber sie gelangten in einen Hof, in dem Schwertlilien blühten und der sich zu Gärten hin öffnete. Bei einer Teppichklopfstange standen mehrere Kinder und starrten herüber.
Die neue Wohnung war ein Schlauch aneinandergereihter Räume – ein schmaler Korridor mit Klo, Bad und Küche, ein erstes und ein zweites Zimmer und eine kleine Veranda mit Glasfenstern, die in einen dichtbelaubten Lindenbaum hineinragte. Die Wohnung war zu klein für eine fünfköpfige Familie, aber es war eine Wohnung. Und die Veranda im Lindenbaum gewann sofort ihr Herz. Sie schaute hinunter, sah neben der Linde die Klopfstange und die Kinder, die auf ihr herumturnten. Ein größeres, fülliges Mädchen mit blonden Haaren, die zu dünnen Zöpfchen geflochten waren, winkte ihr zu. »Kumm oba!« rief sie einladend und lächelte zu ihr hinauf. Da die Eltern mit Metermaß und schweren Überlegungen durch die Zimmer schweiften und keinen Blick für sie hatten, ging sie hinunter.
Aber der Weg vom Haus bis zur Klopfstange wurde ihr schwer. Die Gruppe der Kinder hatte aufgehört zu spielen, man schaute ihr unbewegt und prüfend entgegen. Wieder dieses beklemmende Gefühl, fremd zu sein, ähnlich den Empfindungen im Haus des Gouverneurs in Polen – aber hier noch um einiges drastischer, denn diesen Kindern war sie wirklich fremd. Die meisten von ihnen waren barfuß und trugen spärliche und schmutzige Kleidung. Sie schienen in ein verbindendes Wissen um diesen Sommertag und seine Spiele, um das gesamte Leben in diesem Vorstadt-Mietshaus eingehüllt. Sie trat ihnen entgegen wie nackt. Im Hof des Gemeindebaus, auf dem Weg zur Klopfstange, dem Zentrum einer Prüfung, während die Augen der Kinder sie kalt erwarteten, dachte sie an Flucht. Setzte sie nur noch automatisch einen Fuß vor den anderen.
Und dann kam ihr dieses eine größere Mädchen entgegen und blieb vor ihr stehen. Ein helles Gesicht mit kleinen, blondbewimperten Augen sah sie an, der übermäßig volle Mund öffnete sich zu einem Lächeln von so unmittelbarer Herzlichkeit, daß sie sofort zurücklächeln mußte. »I bin die Hilde Bruckmüller«, sagte das Mädchen, »aber alle sag’n Hilla zu mir. Und wie haßt du?«
Sie nannte ihren Namen, und eine Freundschaft war besiegelt.
Von den anderen Kindern schien ein Bann abzufallen; was ihr stumm und feindlich entgegengeblickt hatte, verwandelte sich wieder in eine Schar turnender und lärmender Spielgefährten, sie nahmen sie in ihren Kreis auf, indem sie sie nicht mehr sonderlich wahrnahmen. Was die Herzlichkeit eines einzigen halbwüchsigen Mädchens zu bewirken vermochte, hat sie bis heute nicht vergessen und diese Hilde, die Hilla aus Floridsdorf, nie aus den Augen verloren. Eine stattliche Frau wurde aus ihr, die kinderlos blieb, aber unzähligen Neffen und Nichten mütterliche Wärme schenkte. Noch heute ist ihr Gesicht, wenn sie sich nähert, so hell, ihr Lächeln so herzhaft wie damals.
Die Volksschule, in die sie nun ging, befand sich noch ein wenig weiter stadtauswärts. Es gab die Möglichkeit, auf der Brünnerstraße geradewegs zur Schule zu gelangen, vorbei an Häusern und unbebautem Gebiet, auf der Fahrbahn die damals höchst seltenen Autos, die Fuhrwerke und Fahrräder, und daneben die Straßenbahnschienen. Aber wenn keine Eile not tat, also fast immer beim Nachhauseweg, ging sie über die Felder. Damals hatten die Randbezirke Floridsdorf und Jedlersdorf noch dörflichen Charakter. Die Ausläufer der Stadt mit ihrem Durcheinander an alten einstöckigen Häusern, wild hinzugebauten Nachkriegsschäbigkeiten und ersten Ansätzen zu Industriebauten erstreckten sich entlang der großen Ausfallstraße. Dahinter fand sie zu ihrem Entzücken Landschaft – ausgedehnte, zum Teil landwirtschaftlich genutzte, zum Teil sich selbst überlassene Landschaft. Sie konnte auf sandigen Wegen an raschelnden Kukuruzfeldern vorbeigehen, es gab schmale, von Obstbäumen gesäumte Landstraßen, und in grasigen Senken konnte sie Hasen beobachten. Dazwischen waren völlig ungeregelt Gärten entstanden, in denen Gemüse und Blumen wuchsen. Sie liebte ihren Schulweg.
Aber auch die Schule selbst hatte für sie nichts an Anziehungskraft verloren. Wieder hatte sie eine Lehrerin, der sie und die ihr Zuneigung entgegenbrachte, eine noch junge schwarzhaarige Frau mit Kurzhaarschnitt und dunklem Teint, deren Aussehen sie trotz der etwas herben Gesichtszüge beeindruckte. Sie trug oft einen hellen Staubmantel mit Gürtel, die Haare wehten ihr locker und ungekünstelt um den Kopf, all das gefiel der Schülerin auf seltsam eindringliche Weise. Sie hatte den Eindruck, einer selbständigen und selbstverständlichen Frau zu begegnen, einer Frau, der keiner ein Leben vorschrieb, die ihr Leben selbst bestimmte.
Der stattliche Schulbau mit seinem hellgrünen Dach und dem Türmchen lag direkt an der Brünnerstraße, und er ist auch heute kaum verändert. Wenn sie vorbeifährt und sagt: »Hier bin ich zur Schule ge –«, dann winken ihre Freunde bereits ab, und sie verstummt ein wenig beschämt. Aber als achtjähriges Mädchen war sie stolz auf dieses würdevolle Schulgebäude, betrat es erhobenen Hauptes und im Gefühl, auserwählt zu sein.
Als Religionslehrer hatten sie einen jungen Mann, der in seinem schwarzen Priestergewand sehr romantisch auf sie wirkte. Er sprach einfach und mit Klugheit zu den Kindern. Eines Tages sollten sie das göttliche Auge in ihr Heft zeichnen. Ein Dreieck, darin, es füllend, der Kreis – sie bemühte sich, ein vollendetes Rund zu schaffen. Und davon ausgehend drei starke Strahlen, die in die Tiefe wiesen. Der Religionslehrer sprach vom Heiligen Geist, und sie hörte zum ersten Mal, daß etwas GEIST hieß und mit Gespenstern nichts zu tun hatte. Sofort wurde ihr der Geist der liebste von den dreien, die angeblich das Eine ergaben, das GOTT hieß. Dabei blieb es, und viele Jahre später bestärkte ein anderer Priester sie darin auf klügere und wissendere Weise.
Als Kind jedoch nahm eine innige Religiosität von ihr Besitz. Auf einem Foto von ihrer Erstkommunion steht sie vor der Gertrudkirche in Währing, trägt ein langes, weißes, rüschenbesetztes Kleid und weiße Blümchen im Haar. Fest umklammert sie eine hohe Kerze, und ihr Gesicht wirkt entleert vor Hingabe. Ihre Tante Ritschi, die so viele Zwetschkenknödel verspeisen konnte, muß damals die Besorgnis geäußert haben, das Kind könne einem religiösen Wahn erliegen. Sie hatte der Erstkommunion beigewohnt und diese bei Kindern nicht häufig anzutreffende Verzückung beobachtet. Vielleicht trieben auch die Erfahrungen mit dem wahnsinnigen, das Klo mit Heiligenbildchen füllenden, ekstatisch betenden Dienstmädchen die Familie zu solch düsteren Prognosen.
Sie erlag jedoch keinem religiösen Wahn, hatte bloß eine kindliche und vertrauensvolle Beziehung zu diesem dreigeeinten Gott, von dem man ihr erzählt hatte und an den sie von Herzen gern glaubte. Ihm konnte sie vor dem Einschlafen, wenn sie bereits im Bett lag, flüsternd offenbaren, was ihr an Hilfe oder Schutz not tat. Indem sie diese Bitten aussprach, entledigte sie sich ihrer Sorgen, drehte sich dann zur Seite und schlief wohlig ein.
Ihr Bett stand im elterlichen Schlafzimmer, auch das der jüngeren Schwester. Die ältere wird wohl auf dem Sofa im Wohnzimmer geschlafen haben.
Anfänglich hat sie an dieser räumlichen Enge offenbar nicht übermäßig gelitten, die quälenden Erinnerungen daran setzen erst später ein. Allerdings bestand sie bald darauf, im Sommer auf der kleinen Veranda nächtigen zu dürfen. Eine schmale Liegestatt, ein Schrank – überall standen Schränke –, dazwischengezwängt ein kleiner Tisch und wenig Platz zum Aufrechtstehen. Trotzdem schwelgte sie in dem Gefühl, sie bewohne ein eigenes Zimmer, für sie das Grandioseste, wonach man trachten konnte.
Davon schenkte ihr die kleine Veranda in der warmen Jahreszeit einen Vorgeschmack. Sobald der Lindenbaum in Blüte stand, überschwemmte er sie mit seinen Düften. Nachts, bei rundum geöffneten Fenstern, hatte sie den Eindruck, inmitten der Baumkrone und ihrer Blüten zu schlafen, in den leichten Windstößen, die das Laub aufrauschen ließen. Immer hörte man Züge, ihr Schnaufen, ihre Pfiffe, ihr Dahinrattern. Der Häuserkomplex war von Bahngleisen umzingelt, die nahe Lokomotivfabrik tat ein übriges – aber sie gewöhnte sich nicht nur an diese Geräusche, sondern begann sie mit der Zeit zu lieben, wurde von ihnen gewiegt wie von fernen Gesängen.
An dem kleinen Tisch saß sie, ließ die Blicke ab und zu in den Baum schweifen und schrieb erste Gedichte.