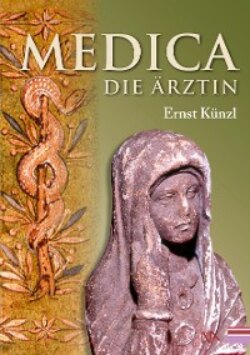Читать книгу Medica - Ernst Künzl - Страница 11
Krieger und Ärzte vor Troia
ОглавлениеDas zweite Jahrtausend v. Chr. ist im modernen Geschichtssystem die Bronzezeit der Ägäis, die Epoche der kretisch-mykenischen Kultur. Für die Griechen war der Kampf um Troia bedeutende Geschichte, keine Legende, und es war – wie wir heute dank der Ausgrabungen Heinrich Schliemanns und seiner Erben wissen – der historische Kern in der Tat real. Troia war ein die Meerengen zwischen dem Schwarzen Meer und der Ägäis kontrollierender Staat, der mit den Mächten Griechenlands in Konflikt geriet und ihnen unterlag.
Die beiden Epen Homers, die Ilias mit dem Kampf um Troia und die Irrfahrten des Odysseus in der Odyssee, entstanden im 8. bis 7. Jh. v. Chr., geben also eine Welt wieder, die seit vielen Jahrhunderten versunken war. Bei Homer vermischen sich Elemente, die aus der Vorzeit des 2. Jahrtausends stammen, mit solchen aus seiner Zeit. Die in der Ilias häufig sehr drastisch geschilderten Kriegsverletzungen wird man zum Mindesten auf ein Interesse des 8. Jh. v. Chr. an solchen Dingen beziehen dürfen.
Der Kampf um Troia war ein Dauerthema der griechischen Kunst. Auf einer bemalten Keramik aus Athen in den Jahren um 500 v. Chr. erscheint Achilleus, der im Lager vor Troia eine Oberarmwunde seines Freundes Patroklos verbindet (Abb. 2). Es ist eine der ältesten medizingeschichtlichen Darstellungen der Geschichte. Achilleus legt einen kunstvollen, schneeweißen Verband an; die Wunde war eine sicher sehr schmerzvolle Pfeilverletzung: Der Pfeil wird links neben Patroklos’ Knie gezeigt.
Hier handelte es sich um Kameradenhilfe und wir dürfen davon ausgehen, dass es wie zu allen Zeiten die erste Hilfe war, die ein Verwundeter auf dem Schlachtfeld bekommen konnte. Homer kennt freilich auch schon den Arzt als einen Berufsstand. Von Frauen ist dabei noch nicht die Rede; es sind Männerberufe, wie der Zimmermann, der Seher und der fahrende Sänger (Rhapsode). Der Arztberuf als Handwerk erscheint zuerst in der Odyssee Homers, wo ganz selbstverständlich „ein Arzt gegen die Übel“ in einer Reihe von Berufen aufgezählt wird.
Abb. 2 Achilleus verbindet den von einem Pfeil getroffenen Patroklos, bemaltes Innenbild einer Keramikschale des sog. Sosiasmalers. 500/490 v. Chr. Dm. 17,8 cm. Berlin, Staatliche Museen, Antikensammlung.
Dass der Kriegschirurg besondere Leistungen bieten musste, ergibt sich auch daraus, dass Homer als Ärzte an der Front vor Troia zwei Göttersöhne nennt, Machaon und Podaleirios, die Söhne des Heilgottes Asklepios. Asklepios‘ Tochter Hygieia trat erst später in Erscheinung, als man dem weiblichen Element größere Aufmerksamkeit widmete. Die meisten bei Homer in der Ilias geschilderten Kampfverletzungen waren tödlich, andere konnte man noch behandeln. Erwähnt wird die Pfeilwunde des getroffenen Menelaos, die der Arzt Machaon versorgt; in einem anderen Fall ist es Patroklos, der sich um die Pfeilwunde seines Kameraden Eurypylos kümmert.
Eine prominente Frau mit medizinischen Kenntnissen bei Homer war keine Ärztin von Beruf, sondern Königin: Helena, Auslöserin des Krieges um Troia, kannte aus Ägypten ein kummerstillendes Heilmittel (phármakon). Dem wegen seines Vaters Odysseus bekümmerten Telemachos, der das Königspaar Menelaos und Helena in Sparta besuchte, gab sie ein Mittel gegen seinen Seelenschmerz. Helena mischte eine Droge in seinen Wein, welche ihn für eine Zeitspanne alles vergessen ließ, ein Mittel, welches man ihr aus Ägypten mitgebracht hatte, jenem Ägypten, „wo die Fluren gute wie schädliche phármaka in Mengen erzeugen“ (Homer, Odyssee 4, 229–230). „Dort (in Ägypten) ist jeder ein Arzt und übertrifft an Erfahrung alle Menschen“, behauptet Homer in der Odyssee (4, 231–232). Die hohe Meinung der Griechen von der Medizin der Ägypter war sprichwörtlich.
Mit Helenas ägyptischer Droge im Wein für Telemachos hat Homer im Übrigen auch das bis heute erfolgreiche Motiv des Giftes in Frauenhand in die Literatur eingeführt; der Dichter hatte das Thema schon in der Ilias berührt, als er von Agamede erzählt, der Tochter des Königs Augeias (Augias), welche alle Heilmittel (phármaka) auf Erden kannte. Zusammen mit Medeia (Medea), der Prinzessin aus Kolchis, und der göttlichen Kirke auf ihrer Zauberinsel gaben diese mythischen Frauen das Vorbild für die unendliche Reihe von Drogenkennerinnen und Giftmischerinnen.