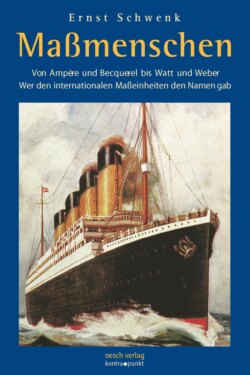Читать книгу Maßmenschen - Ernst Schwenk - Страница 7
Ein findiger Wirrkopf
ОглавлениеAndré Marie Ampère (1775–1836), Mitbegründer der Elektrodynamik
André Marie Ampère, französischer Physiker * 22. Januar 1775 in Lyon † 10. Juni 1836 in Marseille
Immer wenn in der Welt eine Sicherung durchbrennt, wird seiner gedacht. Für wieviel Ampere war der Stromkreis abgesichert? Aber kaum einer fragt heute noch, woher dieser terminus electrotechnicus kommt und wer der Maßeinheit Ampere den Namen gegeben hat.
Der Blick zurück auf das Leben des fast vergessenen Namengebers führt in eine dunkle Periode der Geschichte. In der Jugendzeit von André Marie Ampère waren in Europa noch die Monarchen an der Macht. Es herrschte Willkür und Feudalismus, die Menschen waren bettelarm, dauernd wurde irgendwo Krieg geführt. Dunkel war es aber auch nächtens auf den Straßen, in den Zimmern der Bürgerhäuser. Das trübe Licht der Ölfunzeln gehörte bereits zum gehobenen Wohnkomfort. Elektrizität war nur das, »was die Froschschenkel zum Zucken bringt«. Ampère sollte einen wichtigen Beitrag dafür liefern, daß 100 Jahre später die elektrische Kraft Maschinen antrieb und Glühbirnen zum Leuchten brachte.
Wer war der Mensch, nach dem heute die Maßeinheit der elektrischen Stromstärke benannt ist?
Die SI-Einheit Ampere
Ampere ist die Basiseinheit der elektrischen Stromstärke.
Definition: Das Ampere (A) ist die Stärke eines zeitlich unveränderlichen elektrischen Stromes, der, durch zwei im Vakuum parallel im Abstand 1 Meter angeordnete, geradlinige, unendlich lange Leiter von vernachlässigbar kleinem, kreisförmigem Querschnitt fließend, zwischen diesen Leitern je 1 Meter Leiterlänge die Kraft 2 x10–7 Newton hervorrufen würde.
Anmerkung: Das auf dem Personennamen liegende Akzentzeichen è fällt bei der SI-Einheit weg. Gelegentlich wird zur Vermeidung von Verwechslungen auch die Abkürzung »Amp« anstelle des Zeichens A verwendet.
Als Sohn des wohlhabenden Seidenhändlers Jean-Jacques Ampère kam André Marie am 22. Januar 1775 in Lyon zur Welt. Als der Junge sieben Jahre alt war, zog die Familie in ihren luxuriös eingerichteten Landsitz im Bergdörfchen Poleymieux. Weil es in der Umgebung keine Schule gab, kümmerte sich der Vater um die Bildung des Sohnes. Er unterrichtete ihn in Sachkunde, Philosophie und Religion. Lesen und Schreiben brachte sich der intelligente Junge selbst bei. Bereits mit zwölf Jahren lernte er die Gesetze der Algebra aus eigener Initiative. Unermüdlich las er alle wissenschaftlichen Bücher, die ihm in die Hände kamen. Einen besonders nachhaltigen Eindruck machte auf ihn die fünfunddreißigbändige Enzyklopädie von Diderot, in der alle damals bekannten Wissensgebiete in Wort und Bild ausführlich beschrieben waren. Noch im Alter kannte er ganze Kapitel dieses Werkes auswendig.
Mit dreizehn Jahren verblüffte André Marie die Académie de Lyon mit einem Lösungsvorschlag für die Quadratur des Kreises. An diesem Problem hatten sich schon ganze Generationen von Mathematikern die Zähne ausgebissen. Zwar stellte sich Andrés Lösung später nach eingehender Prüfung als unrichtig heraus, doch hier zeigte sich schon, aus welchem Holz dieser Junge geschnitzt war. Die lateinische Sprache erlernte er in wenigen Wochen ohne fremde Hilfe. Weil der 14jährige Schwierigkeiten mit der Integration partieller Differentialgleichungen hatte, nahm er Privatunterricht an der Universität von Lyon. Nebenbei belegte er Vorlesungen in Physik und Biologie und entwarf eine Universalsprache auf logischer Basis, ein Vorläufer des Esperanto.
Tod auf dem Schafott
So schien der Lebensweg des jungen André Marie eigentlich schon vorgezeichnet: Er würde die Universität besuchen und später ein stiller Gelehrter werden, der sein Leben zwischen dicken Büchern und verstaubten Herbarien verbringt. Doch das Schicksal wollte es anders. Die Funken der französischen Revolution sprangen auch nach Lyon über. Vater Ampère setzte sich in der ehrenamtlichen Funktion eines Friedensrichters für die königstreuen Girondisten ein und sorgte dafür, daß dem Führer der aufständischen Jakobiner der Prozeß gemacht wurde. Doch plötzlich waren es die Jakobiner, die in Lyon die Macht übernahmen. Der angesehene Seidenhändler wurde verhaftet, vor das Revolutionstribunal gezerrt und nach kurzem Prozeß auf dem Schafott hingerichtet.
Der 18jährige Sohn erlitt einen schweren Schock. In der Trauer um seinen Vater verfiel André in völlige Apathie. Ein ganzes Jahr lang las er keine einzige Zeile mehr, statt dessen spielte er stundenlang wie ein Kleinkind im Sand. Erst durch die Lektüre der Oden von Horaz wurden seine Lebensgeister wieder geweckt – und durch die Liebe zu einem Mädchen aus dem Nachbardorf, das er beim Blumenpflücken getroffen hatte. Drei Jahre warb er um seine Julie, er besang sie in italienischen Versen und widmete ihr seine schwärmerischen Tagebuchnotizen. Doch Julie Caron, Tochter aus gutem Hause, durfte ihn nicht erhören, solange sich der junge Mann nicht zu geregelter Arbeit aufraffen konnte. Erst als Ampère die Stelle eines Privatlehrers für Mathematik übernahm, durfte Hochzeit gefeiert werden. Ein Jahr später wurde ein Sohn geboren. Die glücklichen Eltern gaben ihm den Namen des hingerichteten Großvaters: Jean-Jacques.
Die Ecole Polytechnique in Paris (beim Besuch von Napoleon 1815). Hier hatte Ampère eine schlechtbezahlte Stelle als Hilfslehrer inne
Feuersglut im Herzen
Schon ein Jahr später – Ampère war inzwischen Professor für Physik an der Zentralschule in Bourg-en-Bresse geworden – starb die junge Frau an Tuberkulose. Verzweifelt und mutlos wollte der erst 28jährige André aus dem Leben scheiden oder in ferne Länder auswandern. Auf gutes Zureden der Familie nahm er schließlich die Stelle eines répetiteur an der Ecole Polytechnique in Paris an, die erbärmlich schlecht bezahlt war. Diese Arbeit füllte ihn bei weitem nicht aus, doch ließ sie ihm wenigstens Zeit, sich mit Fragen der Philosophie und der Religion zu befassen. Auch von ungelösten Problemen aus den Fachgebieten Biologie und Chemie, aus der Astronomie und Psychologie wurde er wochenlang gefesselt. Immer wieder überwältigt von neuen Ideen, aber unfähig, sich auf eine Sache ganz zu konzentrieren, ließ er sich von einem Thema zum anderen treiben. Nächtelang brütete er über einer mathematischen Formel, stundenlang erklärte er andern das Weltsystem. Freunde sagten von ihm, er habe stets »eine Feuersglut im Herzen« gehabt. Ein Biograph beschrieb Ampères Naturell so: »Sein gewaltiger Geist war wie ein bewegtes Meer, plötzlich türmten sich die Wellen empor, schwimmende Korken und Sandkörner wurden gen Himmel geschleudert …«
Wenig erfreulich gestaltete sich das Privatleben. Eine zweite Ehe, im Jahr 1806 mit der lebenslustigen, etwas liederlichen Jeanne Potot geschlossen, erwies sich als Katastrophe. Nach wenigen Jahren war er wieder allein. Die Aufgabe, für den Sohn aus erster und die Tochter aus zweiter Ehe zu sorgen, überforderte den grüblerischen und in praktischen Dingen völlig hilflosen Gelehrten. Mutter und Schwester kamen nach Paris und übernahmen die Haushaltsführung.
Zerstreuter Professor
Mit der Ernennung zum Generalinspekteur der Universität Paris im Jahr 1808 waren wenigstens die drängenden materiellen Sorgen behoben. Die mit dem hohen Amt verbundenen Verpflichtungen erfüllte der zerstreute Professor mehr schlecht als recht. Seinem Wesen entsprechend beschäftigte er sich mit Dutzenden von Fragestellungen gleichzeitig: mit dem ungelösten Problem des Parallelenaxioms, mit der Anwendung der Variationsrechnung in der Mechanik, mit der Integration partieller Differentialrechnungen. Arbeiten über die Atomistik, den Bau der Kristalle, die Theorie der Gase und das Boyle-Mariottesche Gesetz schlossen sich an. Mit dem englischen Chemiker Sir Humphry Davy (1778–1829) führte er jahrelang einen Briefwechsel über die chemische Natur der Halogene Chlor, Fluor und Jod und ihre Einordnung in eine homologe Reihe. Eine Zeitlang verschrieb er sich der spekulativen Philosophie, in der Hoffnung, auf diesem Wege schwierige naturwissenschaftliche Probleme besser lösen zu können. Die Vielzahl seiner Interessen und der wenig effektive Arbeitsstil verhinderten zunächst, daß er in irgendeiner Disziplin herausragende Leistungen erzielen konnte.
Mit diesem Instrument wies Ampère 1822 die elektromagnetische Induktion nach
Dies sollte sich mit einem Schlage ändern. Im Juli des Jahres 1820 erfuhr Ampère beiläufig von der Beobachtung des dänischen Physikers Hans Christian Ørsted (1777–1851), daß eine Magnetnadel durch einen stromdurchflossenen Leiter abgelenkt wird. Dieses nebensächliche, von anderen Physikern bis dahin kaum beachtete Phänomen faszinierte den versponnenen Gelehrten so sehr, daß er alle anderen Arbeitsgebiete vernachlässigte und sich nur noch mit einer Frage beschäftigte: Welche Wechselwirkung besteht zwischen Magnetismus und elektrischem Strom? Er machte Hunderte von Versuchen, um ganz sicher zu sein. In größter Hast – diesmal wollte er endlich der erste sein, der eine wissenschaftliche Neuigkeit verbreitete – schrieb er zwei Aufsätze, die sich mit der bewegten Elektrizität als Quelle der magnetischen Wirkungen befaßten. In einem Vortrag vor der Französischen Akademie der Wissenschaften berichtete Ampère am 25. September 1820 über die Wechselwirkung zweier stromdurchflossener Leiter: Gleichgerichtete Ströme ziehen sich an, entgegengesetzt gerichtete stoßen sich ab. Er zeigte, daß sich eine stromdurchflossene Drahtspule wie ein Stabmagnet verhält, und bewies damit, daß die bewegte Elektrizität den Magnetismus erzeugt. Ampère stellte zum erstenmal einen Zusammenhang her zwischen zwei physikalischen Erscheinungen, die man bis dahin für völlig unabhängig gehalten hatte.
Die von Ampère aufgestellte »Schwimmer-Regel«: Ein Schwimmer, der mit dem Strom schwimmt, zeigt mit der rechten Hand in die Richtung, in die der Nordpol des Magneten abgelenkt wird
Den Elektromagnetismus erforscht
Volle sieben Jahre hielt ihn dieses Phänomen gefangen. In dieser Zeit entwickelte der Wissenschaftler, dem Elektrizität und Magnetismus bis dahin ziemlich fremd gewesen waren, ein völlig neues und bedeutendes Teilgebiet der Physik: das theoretisch und experimentell abgesicherte Gebäude des Elektromagnetismus.
In diesen sieben fruchtbaren Jahren stellte Ampère eine Fülle von Theorien auf, so die Hypothese der »Ampèreschen Molekularströme«, wonach jedes Molekül von ringförmigen Strömen umgeben sein sollte, deren mikroskopisch kleine Wirkungen sich zum makroskopischen Magnetismus addieren. Diese Annahme war zunächst sehr umstritten. Mehr als hundert Jahre später war jedoch der Beweis erbracht, daß Ampères Vorstellungen prinzipiell richtig waren: Der Ferromagnetismus setzt sich aus den Spinmomenten der Elektronen zusammen. Große Bedeutung gewann ein von Ampère entwickeltes Meßinstrument, bei dem eine frei beweglich angebrachte Magnetnadel die Stromstärke anzeigte. Es wurde später in verbesserter Form als Galvanometer bezeichnet und ist noch heute eines der wichtigsten Meßinstrumente der Elektrotechnik.
In seinem großen, abschließenden Werk Über die mathematische Theorie elektrodynamischer Erscheinungen, allein aus dem Experiment abgeleitet entwickelte André Marie Ampère 1826 eine umfassende Theorie der elektrischen Erscheinungen. Hier formulierte er erstmals die noch heute gültigen Begriffe »Strom« und »Spannung«, hier beschrieb er die Wirkungsweise des Galvanometers und des Elektromagneten. In Anspielung auf Newtons Grundlagenwerk über die Mechanik Principia erhielt Ampères Werk später den Ehrentitel Principia der Elektrodynamik.
Die gequälte Seele
So sah sich Ampère selbst
In den letzten Jahren seines Lebens kehrte der unruhige Geist zu seinen alten Gewohnheiten zurück. Sein Arbeitsstil wurde wieder unsystematisch. Von plötzlichen Eingebungen gepackt, wechselte Ampère sprunghaft von einer Fragestellung zur anderen. Unter dem Eindruck von Emanuel Kants Kategorienlehre Kritik der reinen Vernunft setzte er sich mit er kenntnistheoretischen Betrachtungen auseinander. Ein Zeitgenosse charakterisierte den wunderlichen Gelehrten so: »Leidenschaftlich in seinen Überzeugungen und Zweifeln, bietet Ampère stets das Bild einer mystischen und gequälten Seele.« Immer weniger gelang es ihm, sich seinen Mitmenschen verständlich zu machen. Darüber verfiel er in tiefe Melancholie. Mehr und mehr wurde der liebenswürdige, sensible und poetisch veranlagte Gelehrte zur Zielscheibe des Gespötts. Zahlreiche Anekdoten ranken sich um seine Zerstreutheit. Man amüsierte sich darüber, daß Ampère im Feuereifer seines Vortrags vor der Französischen Akademie den direkt vor ihm sitzenden Kaiser Napoleon nicht erkannt und ihn keines Grußes gewürdigt hatte. Der Kaiser nahm es ihm nicht übel, sondern lud den berühmten Gelehrten für den nächsten Tag zum Mittagessen ein. Napoleon wartete umsonst: Über seiner Arbeit hatte Ampère die Verabredung vergessen.
Die letzte große Aufgabe, die Ampère im Jahr 1834 in Angriff nahm, war der Versuch, die Gesamtheit der wissenschaftlichen Kenntnisse in ein umfassendes Ordnungsschema zu gruppieren. Das an sich wohldurchdachte philosophische Alterswerk fand bei der Fachwelt jedoch keine Resonanz, im Gegenteil: Von seinen Kollegen erntete der Autor nur Spott und ablehnende Kritik. Die letzten Lebensjahre waren geprägt von Armut und Krankheit. Auf einer Reise in die Provence, von der er sich eine Besserung seines »Lungenkatarrhs« versprochen hatte, verschlimmerte sich sein Zustand. Während eines Besuches der Universität von Marseille starb Ampère am 10. Juni 1836, erst 61 Jahre alt, nach einem plötzlichen Fieberanfall. Dreißig Jahre später wurde sein Sarg nach Paris überführt und unter großen Ehren auf dem Friedhof von Montmartre beigesetzt. Das Elternhaus in Poleymieux wurde zu einem »Ampère-Museum« umgebaut.
Ein Denkmal der besonderen Art wurde Ampère im Jahr 1881 von den Teilnehmern des in Paris tagenden »Electrischen Congresses« gesetzt. Auf Vorschlag des deutschen Physikers Hermann von Helmholtz (1821–1894) wählte man für die Einheit der elektrischen Stromstärke die Bezeichnung »Ampere«. So wurde der Name des unsteten, vom Glück verlassenen französischen Forschers zu einem in aller Welt bekannten Terminus technicus.
Das ungenießbare Mittagsmahl
André Marie Ampère war geradezu der Inbegriff eines zerstreuten Professors. Immer in tiefen Gedanken versponnen, ständig mit physikalischen Problemen beschäftigt, nahm er sein Umfeld oft kaum noch wahr. Eine hübsche Anekdote illustriert dies:
Nach einer Vorlesung wurde er einmal von einem befreundeten Professor eingeladen, bei dessen Familie zu Mittag zu speisen. Als sich das Mahl etwas verzögerte, nutzte Ampère die Zeit, um in seinem Notizbuch eine Formel nachzurechnen.
Noch ganz in Gedanken, setzte er sich zu Tisch, aß einige Bissen, schleuderte die Serviette auf den Tisch und schimpfte: »Das Essen ist ja wieder einmal nicht zu genießen! Wann wird meine Schwester endlich einsehen, daß jede Köchin, bevor man sie einstellt, erst eine Kostprobe ablegen muß?« Ampère hatte völlig vergessen, daß er nicht zu Hause speiste, sondern zu Gast war bei einem Kollegen.