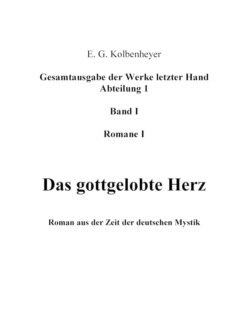Читать книгу Das gottgelobte Herz - Erwin Guido Kolbenheyer - Страница 3
I
ОглавлениеDer heilige Bischof Ulrich kommt aus dem Schlaf auf, das fühlt Margarete deutlich an sich, als läge sie bei ihm in seinem Himmelbette zu Augsburg. Die ihn geweckt hat, ist Sant Afra, strahlend von Angesicht. Aus Karmesinseide ist ihr Rock, und der Schleier steht in steifen Falten um ihre Wangen, um Schultern und Arme. Der Vater hat ihn aus Venedig mitgebracht, es ist Baldechino, zum Brechen schwer und mit Goldfäden durchflitzt. Doch der Rock wirft leichtere Falten als der Schleier, und Sant Afra schürzt ihn hoch, bis ans Knie hinauf, als sollte der heilige Bischof die Korduwanstiefelchen sehen. Da sie den Schleier unter die Brust gerafft hat, muß sie den Rock unziemlich mitgefaßt haben. Das geschieht Sant Afra. Der Mutter Gottes geschähe es nie. Und die Männer haben einen losen Zug um den Mund, wenn sie von der Heiligen sprechen. Die blutjunge Margaret hat es nicht einmal nur beobachtet. Schuhe aus rotem Korduwan, die hätte sie auch gezeigt, jedem, nur nicht so hoch wie die Heilige …
Sankt Ulrich muß sich erheben und dem Wink seiner Weckerin folgen. Margaret fühlt, wie sich ihre Seele loslöst. Sie schwebt mit auf das Lechfeld, wo der Zwölfbot Sankt Peter sitzt. Viele Bischöfe und Märtyrer stehen um ihn. Sankt Peter langt in seinen Bart und zieht zwei Schwerter heraus wie der Schwertschlucker und Feuerfresser auf dem Andrämarkt im Herbst. Das eine Schwert hat keinen Griff und müßte ihn schneiden, wäre er kein Heiliger, denn er ballt die Faust fest um die Klinge. Das andere Schwert hebt Sankt Peter am Griff hoch hinweg über alle Heiligen und über Sankt Ulrich; der Arm wächst in den Himmel. Und es wallen Schrei und Klage ringsum auf, die Glocken gellen hell und wogen dumpf, und es schwillt eine Röte von der brennenden Erde am Himmel hoch aus dem Qualm der Dörfer …
Da öffnet Margaret die Augen. Die Hornplatten des Fensterladens leuchten in feuerrotem Schein. Es stürmt gell und dumpf, keine Matutinglocke – die klingt dünn und einsam in der Nacht. Das volle Geläut stürmt. Und es ist auch der rote Morgen nicht vor dem Fenster. Die Sonne geht seit Ostern dort nicht mehr auf. Margaretes Herz schlägt. Sie preßt die Hände dagegen. Im Färbergäßchen klirrt es und schreit es, sie laufen in Waffen.
Gute Mutter Gottes und lieber Herr Heiland! Sie liegt unter dem Dach, und Werde brennt! Sie springt aus der schmalen Lade, streift das Gewand vom Schemel, zieht den Schemel ans Fenster, das hoch in die Schräge eingebaut ist; sie bringt den Riegel kaum auf. Dann sehen die großen, starren Kinderaugen in die blutrote Nacht. Es brennt im Ried. Die Fronfischer brennen. Das Färbertor steht schwarz gegen die Helle mit dem steilen Schindeldach.
Die schmalen Finger legen sich vor die Lippen, und sie möchte weinen, aber die Furcht hält sie, als dürfe sie nicht vernehmlich werden vor dem, was da unten geschieht. Des römischen Kaisers Leute sengen die Riedfischer. Der Kaiser ist bei ihnen, das haben sie am Tage die Mauer heraufgeschrien, einer im Waffenrock, zwei Posaunen bei ihm. Werde soll sich vorsehen und öffnen, die Majestät stünde in eigener Person vor den Toren, und davor müsse Werde fallen.
Auch Margaret weiß, was es heißt, wenn eine Stadt lange geschlossen war und mit Gewalt aufgetan wird, stürmender, sengender, schützender Hand.
Und der Vater liegt bei der Scheppbacher Freundschaft in Hochstätt, er muß die Röte am Himmel sehen, muß wissen, daß Werde brennt, und kann nicht heim, kann nicht zu der Agnes-Mutter in ihrer schweren Stund.
Da tropfen ihr die Tränen langsam aus den weiten Augen. Sie muß denken, daß die Not den Vater auf die Knie gezwungen hat, und daß er weicheren Sinnes betet und betet, denn er muß meinen, daß seine Stadt brennt. Er sieht nur die Röte, er weiß nicht, daß es nur die Fronfischer sind, bei denen es aufgeht.
Der Gedanke, ihr Vater erlitte große Qual, macht Margaret besonnen, sie wischt sich langsam über ihr Gesicht. Sie soll nicht länger auf dem Schemel stehen und schauen. Es muß eins fertig sein und gewärtig der strengen Dinge. Die anderen sollen sich nicht kümmern müssen um sie. Margaret rafft sorgsam das lange Hemdlein, das sie gegen das Abdecken im Schlafe trägt, denn sie ist noch ein Kind und darf nicht nackend liegen. Sie steigt herab und trägt den Schemel zurück an seinen Ort. Sie schlüpft ins Kleid und nestelt es zu, fährt in die Schuh. Da stutzt etwas in ihr. Sie sieht die Schuhe fremd an: unscheinbar und gelb sind sie … nicht … rot. Margaret sucht eine Weile, als müsse sie an rote Schuhe denken. Wie von Wärme und Brandruch, den ein Windstoß durch das Fenster haucht, wird ihr Trauminneres angefacht für eines Augenblickes Weile. Dann schrecken sie der Geruch und die unzeitige Hitze in die Wirklichkeit: Es weht stadtwärts. Die Wörnitz ist wohl zwischen dem Ried und der Stadt und die Mauer, und dann ist noch das Färbergässel herauf, aber steil genug ist es und voll Häuser. Strohdächer sind darunter, kein Funke darf hinein.
Behutsam schleicht sie auf den Gang und ruft: „Ann, bist do?“
Niemand antwortet. Der Verschlag der alten Magd, die sie am Abend mit hinaufgenommen hat, daß sie unten nicht abseits liege und nicht immer wieder versucht sei zu horchen, ist leer, die Lattentür nur angelehnt. Margaret steht in der Finsternis und lauscht in das Haus nieder. Da hört sie es auch, die Mutter schreit immer noch. Agnes-Mutter, so still sonst, daß es zuweilen scheint, es sei aller Laut von ihr genommen! Die Mutter hat eine schreckliche Stimme in ihrer Not, und das Gesicht ist ihr blaß und hohl geworden ober dem schweren Leib. Margaret weiß, daß in der Mutter das Kindlein liegt, nicht erst seit gestern weiß sie es. Sie haben alles gerichtet, sie hat es gesehen, Windeln, Kissen, Schnürbänder; die Wiege ist neu gefüttert und ausgebettet – darin sei auch sie gelegen, haben sie erzählt. Auch sie. Wie war sie dort hineingekommen? Auch das Kind muß noch kommen. Kommt es wie sie? Wie wird es kommen? Der Mutter ist weh, und das Kind ist in ihr.
Die Frauen waren gestern bis in den späten Abend da. Die Kathrin-Muhm, die Höchstätterin, die immer mit dem Schleier wedelt und so laut lacht, aber sie ist behutsam gewesen und hat nicht gelacht, die alte Trugenhovin, die Elsbeth-Muhm, die Barwichin – die ist ihr von allen Frauen die liebste, sie hat immer ein Wort, das nicht aus der Höhe herniederfällt, sondern eingeht und mitgeht. Die Münzmeisterin war auch da, und gleich mit einem Korb voll Eiern, viel zu früh. Sie sind immer wieder gekommen und gegangen, gestern und vorgestern. Gestern hat die Barwichin der Mutter Bilsenkraut auf die linke Seite gebunden. Margaret hat es selber geholt. Und es ist ein giftiges Kraut, sie hat darnach die Hände mit einem nassen Tuch wischen müssen. Es hat im Haus nach Lorbeer gerochen, es riecht noch darnach, wenn man genau hinunterschnuffelt. Die Ann hat den Topf siedigheiß aus der Küche gebracht, der Lorbeer war darin.
Die Ann war aber unzufrieden. Sie hat beim Heraufgehen gesagt: ein Paternoster in Sankt Margaretens, ihrer Heiligen, Namen umlegen, das sei das Beste in Kindsnot. Sie solle doch ihre Heilige bitten für Kindsnot. Und das hat Margaret lange und von ganzem Herzen getan, der Heiligen auch fleißig das Wunder Gottes vorgehalten, durch das sie hat heilig werden dürfen: wie sie der Drache verschlungen hat, wie dem Drachen mit Gottes Hilfe der Bauch geplatzt ist, daß die heilige Margaret als wie ein Kindlein wieder hervorgegangen ist. Die arme Agnes-Mutter muß leiden. Daß Gott bald an ihr lasse die gleiche Gnad geschehen, wie sie an dem Drachen und der heiligen Margaret geschehen ist!
Sie steht in dem finsteren Gang und horcht. Es geht wieder eine Tür, vielleicht sind es die Frauen. Margaret weiß nicht, was sie soll. Die Glocken lassen sie nicht in ihre Bettlade zurück. Sie hört die Mutter, und es fällt ihr der Vater ein. Der Brand hat ihn sicher aufgejagt, und er kann nicht lang auf den Knien und dort bei der Freundschaft liegen und für Werde beten, das brennt. Er sieht den Schein, und dann hält ihn nichts mehr. Vielleicht reitet er schon, und die Höchstätter haben ihn aus dem Tor gelassen, weil er ein Ebner ist und man ihn kennt. Und der Vater sieht nur das Feuer, wüßt’ er erst von der Mutter!
Vor Wochen zwei oder vier ist er fort, selber im Geleit seiner Frachtwagen; es ist ein großes Gut gewesen. Er muß den Gleven des Kaisers, die waren im Anritt, gerad noch entkommen sein. Und jetzt sitzt er Tag um Tag in Hochstätt. Wär nicht der Roßbub als ein heimlicher Bot niederseit der Burg durchs Kaibachpförtl eingeschlichen, sie wüßten nichts vom Vater.
Da er mit dem Wagenzug fort ist, hat er geschworen, es müsse ein Bub werden, und die Agnes-Mutter möcht Zusehen. So es kein Bub sei, wäre ihm das Leben leid und all die Mühsal. Das Geschlecht sei im Niedergang, die Ebner zu Werde!
Er ist hinaus, und es war kein Trost in ihm. Des Kaisers Span mit dem Herren Rudolf waren offenkundig, das Geleit bei den Wagen ungewiß und gering, kaum einer hat mitwollen. Die Margaret hört den Vater noch über die Stiege hinunterstapfen und die Sporen klirren. Die Mutter ist niedergesessen und hat die Hände kreuzweis über den Leib gelegt. Sie hat ohne einen Laut vor sich gesehen, nur ihre Lippen sind unter einem Gebet gegangen. Das könnte Margaret in aller Dunkelheit greifen wie ein leibhaftiges Bild, so deutlich ist es ihr geblieben.
Sie wimmert leise vor Ratlosigkeit und möchte zur Mutter. Sie darf nicht hin, das darf nur die Alheid, die darf zu der Agnes-Mutter und helfen. Sie haben gesagt, weil die Natur in der Alheid schon erwachsen sei. Margret wittert, was sie meinen. Soll sie nun bleiben, auf dem Gang, in der stockfinsteren Nacht? Oder soll sie zurück in die Bettlade und unter ihren Kolter, den sie mit hinaufnehmen hat dürfen. Alle denken, daß sie im Bett sei, und wollen weiter keine Sorge um sie tragen. Und die Glocken läuten kein Feuer. Sie läuten den Männern; sie hört die Männer von der Kammer her, wo das Fenster offensteht. Wärs Feuersnot, sie hätten sie längst geholt. Sie tastet leise an der Wand zurück, dann aber wendet sie sich doch von der Kammer und hockt auf der Stiege nieder. Sie lehnt sich matt an die Mauer und will nur aufpassen. Sie hört die Mutter. Von unten aus der Küche bringen sie etwas. Die alte Trugenhovin hat gestern in der Tür zu der geschworenen Frau gesagt, sie wüßte schon eine Hilfe, aber die sei nur für eine Hochgeborene, und da möchte die Ebnerin doch zu gering sein: den Löffel und den Gürtel der heiligen Elisabeth. Dazu wäre aber auch die Zeit nicht mehr, so oder so, es müsse bald dahingehen. Die geschworene Frau hat geantwortet, Myrrhen sei in ihrem Lädlein, die wolle sie geben, gestoßen und in Wein. Da ist sie von der Trugenhovin im Türwinkel gesehen worden.
„Was solls mit dir, Gretle? Siech zuo, daß es ein Büeble sije. Din Muotterle hat dich Gott gelobet an, daß es ein Büeble sollt sin, du Worm in diner Ohnmacht!“
Die alte Trugenhovin hat eine Nase wie ein Vogel und sie stößt den Atem bös aus und tut giftig, und dann ist es in ihr, als lache sie hinter den klemmen Lippen in sich hinein. Die soll nur spotten! Margret weiß, daß sie angelobt ist. Und so gering ist keiner, daß er nicht zu der Heiligen Elisabeth fänd! Und wenn nur eine hochgeborene Frau zu dem Löffel der heiligen Elisabeth kommen soll, dann will sie es dem lieben Herrn Jesus selber anmuten, der über allen ist, hoch und gering. Sie will Zusehen, daß es ein Büeble sei, auch ohne die alte Trugenhovin. Der heilig Ulrich muß ihr beistehen, denn sie ist angelobt; er wird es vor den Herrn Jesus bringen, noch in dieser Stund, er ist der nächste Heilige in Werde.
Das ist der Entschluß, auf den sie angespannt war. Sie schleicht selbstgewiß die Stiege hinunter, an der armen Agnes-Mutter vorbei, zu der sie nicht darf, weil die Alheid schon zu der „Natur“ gekommen ist und sie noch nicht. Schrei nit, nu soll dir geholfen sin!
Sie huscht über die Warendiele, die jetzt fast leer liegt, aber noch nach den Gütern duftet, zieht das Tor auf, das der Frauen wegen nicht verriegelt ist. Da überfällt sie erst das Geläute und der Lärm. Sie will schräg über den Markt zum Einlaß auf den Kirchhof und in die Kirche springen, aber die rennenden Männer scheuchen sie eine Weile zurück.
Die laufen von den Färbern und der Münz herauf über den Markt gegen den Bäckenberg zu, scheppern in der Wehr, halten den Spieß quer, die Armbrust, die Axt, den Kolben, etliche auch ein Schwert, und sie erkennt keinen unter den Sturmhauben, trotzdem die Nacht hell ist, nicht nur von dem Feuer. Es brennen die Körbe an den Ecken, auch an dem Ebnerhaus hängt einer, und das Pech tropft und flackert durch die Luft nieder aus dem Feuerkorb wie fallende Zungen. Da hält einer im Lauf vor ihr.
„Gang ins Hus, Gretle! Was willtu unter dem Gelöff! Gang in!“
Das war des Barwich-Ohm Stimme, der ist der Ammann und darf in Kriegsläuften allen befehlen, wohin sie sollen, auch dem Burgvogt des Pfalzgrafen Rudolf. Der Herr Ohm hat den Arm aufgehoben, und sein Schwert gleißt unter dem rotbrennenden Pech. Er winkt zwei Fuhren zu, die Wurfsteine den Markt herauf führen:
„Uff die Bäcken abe! Sie stürment die Bürg!“
Dann ist auch er unter den anderen und im Schatten verschwunden. Es folgen nur wenig mehr, der Barwich-Ohm muß die Männer von der Riedseiten zurückgetrieben haben. Sie müssen alle auf die Mangoldburg, die wird gestürmt, und die Glocken hallen es aus.
Jetzt kann auch sie tun, was sie vorhat, aber ehe sie hinüberläuft, tritt sie noch schnell ein Feuerlein aus, das niedergetropft war, sorgsam, als könne sie damit den großen Brand stillen, der hinter ihr im Ried und vor ihr über dem Mangoldstein tobt, den Brand des Elements und den der Zwietracht.
Sie geht gegen den Kirchhof zu. Vor den Toten hat Margret keine Furcht. Sie hat schon viele gesehen. Sie weiß, daß die meisten arm und schwach sind und der Lebendigen bedürfen. Denn selber können sie nicht mehr beten, das ist mit der Stunde des Absterbens vorbei, und die arme Seel kann sich kein Seelgerät mehr schaffen, sie ist an ihren Ort gekommen.
Margret geht sehr gesammelt durch die Mauerpforte und zwischen den Gräbern hindurch. Beim Sankt Ulrich in der Kirch ist es hell, und sie möchte fast nicht, daß es so hell sei: viel Kerzen, viel Anliegen: er wird nicht alles auf einmal können. Ein Haufen Leute knien beim Altar. Sie hatte es sich einsam und allein mit dem heiligen Bischof erhofft. Die Glocken gehen so stark über sie hin und läuten eine Decke zwischen Himmel und Erde. Die Kerzen blinzeln auf den Opferstöcken und lenken den Heiligen ab. Und die Knieenden da vorn fangen ihr alle Gnaden weg.
Das darf nicht geschehen, die Agnes-Mutter hats eiliger als alle die, und das Kind soll schnell kommen. Sie nimmt den ganzen Mut zusammen und zwängt ihre zehn jungen Jahre durch die Menschen hindurch ganz vor an den Altar. Eine große Verantwortung ist ihr aufgeladen in dieser Stunde.
Und vor dem Altar hallt das Geläute zusammen, als ließen sich Engel mit weichem Fittichschlag hernieder; Margret spürt es tief ins innerste Herz hinein. Als wenn ein Schwarm Tauben auf das Erdreich kommt. Staub und Spreu weht zur Seite, und nur, was ein Gewicht hat, bleibt. So ist es. Und ein Büeble muoß es sin, heiliger Ulrich. Ruof als ouch die heilig Margret herzuo, heiliger Ulrich, und helfet der Agnes-Mutter mit ürer Bitt vor unserm lieben Herrn Jesus! Der ist als ouch in der Krippen glegen und hät der Welt Sünd und Marter genommen an. „Min Agnesmuotter hät mich dir globet an, und min Vater reit’ uf Werde zuo … daß es ein Büeble sije, wenn der Vater inkummt in Werde … daß ein End sije mit deme bluotigen Gschöll, und der Herr Kaiser ein End mach mit dem, und bi denen Fronfischeren, daß ein Brunstfüer gstellt sije, heiliger Ulrich, heilig Margret, min Fürbitterin, und heilig Afra!“
Sie versinkt im Wortfall der Opfergebete, des Vaterunsers, des englischen Grußes und des Glaubens. Wie in einem wärmenden Strom wird sie getragen. Die Härte der Steinfliesen fühlt sie nicht mehr, noch deren feuchte Kühle, nicht mehr, daß andere hinter ihrem Rücken knien. Sie ist allein mit den drei Heiligen, die auf den wachsenden Stufen ihrer Fürbitte emporschreiten zum höchsten Thron.
***
Um die fünfte Stunde in die Nacht schlug der Türmer über Hochstätt die Brandrote an. Er legte die weinerlich hohe Stimme der Sturmglocke, drei Schläge und immer wieder drei, in den dicksten Schlaf der Bürger und Herren. Die wurden alle wach, zuerst, die ihres Tages Sorgen unter die Schlafdecke mitgenommen hatten, ihrer nicht wenig. Der Türmer hatte die Laterne gegen Mitternacht ausgesteckt. Jenseits der Blindheimer Bodenwelle wuchs der Gluthauch; keiner konnte wissen, ob die Belagerer Werde aufgegeben hätten und donauaufwärts zögen nach Hochstätt her. Es war des Türmers Amt, er warnte und weckte seine Stadt.
Heinrich, der Ebner, war einer der ersten aus den warmen Laken, er war auch, herzklopfend, kurzatmig, der erste auf dem Turm. Er spürte, daß es Werde sei. Mit seiner verschwalchten Hornlaterne fand er dann, als er gesehen hatte, nicht rasch genug die Holzstiege hinunter. Fluchen half nicht weiter, und er durfte Hals und Bein nicht aufs Spiel setzen. Es hieß, bei gutem Schwung zu bleiben. Lange war alles für diesen Augenblick bedacht. Da kamen sie ihm von unten entgegen, sie hatten Fackeln und brachten Licht. Er rief ihnen im Hinuntersetzen den Namen seiner Stadt zu. Dann über den Platz ins Scheppacher Haus, über den Hof in den Stall, den Jungen aus der Wolle geschüttelt. Sie konnten ihn nicht mehr halten, Besorgnis hin, Bereitwilligkeit her. Nur daß die beiden feisten Felleisen und zwei Pferde zurückblieben.
Man gab ihm an Stelle des Helms einen Eisenhut, wie ihn Troßknechte trugen, und ein rostblindes Eisenhemd. Er hatte es gesagt, er wolle eindringen, sei’s mit dem stürmenden Feind. Sein Schwert behielt er, es war leicht, eine spanische Klinge. So kam er rasch in die Bügel, und der Junge führte die beste Laterne des Hauses an einem kurzen Stecken mit, um das Licht im Reiten über dem Boden zu halten.
Der alte Konz Scheppach hatte sie dann noch selbst an das Tor gebracht, daß man es dem Ebner getrost auftue. Die Pferde waren anderthalb Wochen bis an den Bauch im Haferstroh gestanden, hatten längst nicht mehr hingeschnuppert, überständig und ausgefuttert. Vor dem lichten Tag konnten sie an der Wörnitzfurt ober den Bleichen sein. Ein Glück, daß es nicht mehr über die Donaubrücke galt, daß sie diesseits waren und blieben.
Glück! Vor ihm der brandig angeleckte Himmel! Aber doch gut, daß er reiten konnte, daß es endlich in Schwung gekommen war. „Tüfelspest bi Liegen und Lauren! Vierzehn Täg. Huppla, Rusche, hüet dich! Hänsle, du verschlaufen Lur, heb’ die Luzern ab dem Arsch!“ Hänsle spreizte die Laterne und ließ sie, so tief es ging, über dem Boden schweben. Es war ein Weg, daß die Sprunggelenke knackten. Den Schimmel, den der Junge ritt, traf ein Gertenhieb über die Ruppe, daß er wie ein Bolzen abfuhr, und der Ebner setzte nach. Aber der Junge nahms nicht unlustig, er saß gut im Sattel, der beste Bereiter auf des Ebner Roßhof zu Scheffstall. Auch den verschlafenen Luren nahm er nicht krumm. Er wußte, daß er in allen seinen Beständen wacher war als der fluchende Ebner, der längst nicht so weich im Sattel saß, als er tat, graue Schläfen an der Glatze und schlaffe Säcke unter den Augen hatte.
Die frisch beschlagenen Hufe spritzten Funken aus den Steinen und platschten den Dreck bis ins Gesicht der Reiter. Der Eisenhut des Ebner am Sattelknopf schlug Satz für Satz gegen den Schwertgriff, und die Scheide klackte gegen den Bügel. Donauweiden strichen nahe vorbei und verhuschten in der Nackt. Ein grobes Zaungeflecht rutschte neben dem Wegrain ab, dahinter für einen Augenblick, schief aufgemutzt, das Strohdach einer Sälde und wieder Weide, Hang, ein Äckerlein, größere Äcker, ein Baumgarten, Zaunlatten und das Eck einer Hofstatt, Kleibwerkmauern und ein überhängender Giebel, dann etliche Häuser tiefer im Schatten versteckt. Eine niedrige Mauer, dahinter ein Steinhaus.
„Des Flaiminger Spät sin Hofraiten … Guet ist, Hänsle, wir hänt Gremhoim! Zuo! Rusche! Rusche! Zuo!“
Vor ihnen stand die Röte höher, immer höher stand sie auf. Sie sahen über die Donau weg, die Donau zog einen weiten Bogen, dessen innere Lände sie ausreiten mußten.
Wie war es vor etlichen Wochen zu dem hitzigen Handel gekommen. Heinrich, der Ebner, hatte durch den Andres Wernitzer aus Nürnberg Wind gekriegt, daß der römische König den Landvogt Dieteggen auf Werde spannen lasse und auf sonstiges konradinisches Erbgut. Und vor vierthalb Monat hatte ihm Luitfried, der Vetter, von Augsburg her durch einen Boten gesteckt, daß Herr Albrecht den Reichsfürsten und ihrem Sprecher nicht nur kein williges Ohr leihen, sondern ins Bairische fallen werde, um den Pfalzgrafen Rudolf für ein Ansinnen zu strafen, dessen Eingeber und Mund der Baier war: Fürstengericht über ihn selbst, den erwählten König.
Da hatte der Ebner die Mittewalder Rückfuhre nicht länger abgewartet. Sie war überfällig, hatte sich aus der Frisinger Grafschaft nicht mehr ins Bairische getraut. Er hatte eigene Wagen beladen, sie mit eigenen Rossen bespannt und war unter dem schwachen Geleit, das überdies mit eigenen Leuten hatte aufgefüllt sein müssen, selbst nach Mittewald geritten. Die Fracht war längst ihre Zeit in Werde gelegen, und es stand neuer Zuzug bevor, wenn nicht der König dazwischen kam. Und obendrein: das meiste Gut war sein Eigentum, es sollte auf der Rottstraße nach Bozen hinein und weiter nach Mailand, ehe aller Zuzug von Schwaben und dem Rhein her auf Monate stockte. Säume, Ballen, Fässer mit Gewand, Barchent, Tuchen, Bursat, Camelin aus Aachen, Köln, Frankfurt, Löwen, England. In Truhen Buchskämme und Paternoster. Fässer voll Kupferdraht, Luchsfellen und Köpf’. Darunter versteckte Lädlein mit „Abenteuer“: Gold, Silber und Hefteln. In Ballen gebundenes Tafelmessing, darunter kleinere Lägel voll Haarbändern, Nadeln, Fingerhüten, und zierlich behefteten Messerchen. Es waren drei Wagen, ein gut Teil seines Vermögens. In Mittewald niedergelegt und dann von den Rottleuten Tirol einwärts verbracht, war es vor den Zugriffen so gut wie sicher. Denn es lebten freie Bauern in den Bergen, kaum eine Burg bestand im Land, und hinter Bozen brauchte man sich der bösen Zufälle nicht ängstlich zu versehen. In Mittewald aber wußte er den alten Hertwich, immer noch Richter und ein bewährter Freund. Der hatte ein Aug auf der Sach.
Dann, in Mittewald, war die Fuhr gut an den Sifried Schwab gelangt. Er konnte nunmehr zurück mit den leichten Wagen und unbeträchtlicher Ladung. In Augsburg unsicher gemacht, stellte er das Gefährt aber doch für eine bessere Gelegenheit ein. Zweieinhalb Gespann waren dort schon auf dem Hinweg zu Verkauf besehen worden – der Roßhof zu Scheffstall war geschätzt, und die Gäule hatten durch den Weg nidtts eingebüßt – ein sicherer Handel.
Das fahrende Gut war also gut bewahrt, aber das Liegende daheim stand in Not, das wußte er seit Augsburg. Er war zu spät aufgebrochen und konnte nicht mehr glauben, daß er heimfände, ohne die Donaubrücke zu umgehen. So ritt er denn, zwei Jungen und fünf Pferde bei sich, von der Reichsstraße quer über die Höhen zur Höchstätter Furt und konnte dann in Hochstätt bei den Scheppachern, ein weitschichtiges Vetterleswesen von seiner Mutter, der Binswangin, her, liegen und lauern, indes der alte, sauertöpfische Konz für Futter und Pflege sein freundschäftliches Anrecht auf künftige Gegenleistung Tag über Tag zu Wucher schlug. Den einen Jungen aber hatte er vorgeschickt, wußte nur nicht, ob er das Pferd glücklich auf den Roßhof und die Botschaft durch das Kaibachpförtl eingebracht hatte. Es war keine Gegenzeitung gekommen. So stand der überhitzte Handel bisher.
Die beiden Reiter hielten schon eine Weile auf das Licht zu, das der Türmer in Donaumünster brannte. Die Kirche lag dem Ufer nahe, und das Häusergenist unter ihr schien still. König Albrecht hatte also den Plünderzug über Ingolstadt auf Werde gewiesen. Sie umritten die Münsterer Pfahlgräben. Die Donau vor ihnen war in vielgewundene Arme zerspreitet, und die Straße lief am Hangrande der Oberhölzer. Er wollte auf die Höhe über den Rüedlinger Huben und sehen, wie es stand. Dahin war noch eine Weile.
Er versuchte sich abzulenken, rückwärts zu denken. Was kommen sollte, es wurde je näher, je bänger. Und an dem, was im Rücken der Reiter lag, wären Haken genug gewesen, flatternde Erinnerungsfetzen zu verfangen: Mailand, dorthin gehörte er von Rechts und Geschäfts wegen für etliche Wochen. Dann der gute alte Zorn auf Venedig! Er holte ihn nach und nach ein, denn er versuchte, einer der ersten, den stracken Weg nach Mailand, fand neuen Handel und Wandel und kochte der steuersüchtigen, hochnäsigen Lagunensignoria einen dicken Ärger ein, weil dem Ebner auch schon andere Kaufleute folgten – aber die Himmelsröte vor ihnen gewann es heftiger über ihn und immer lebendiger die Sorge um seine Hauswirtin, die er kindsschwer zurückgelassen hatte. Da schwieg all das andere.
Sein Augenblicksplan – gewiß eines Ebner wert und freudig ausgedacht, hinterdrein auch ein Aufsehen, keine geringe Probe auch: versteckt unter dem Gerenne und gleichsam stürmender Hand in die eigene Stadt einbrechen zu wollen! Einbrechen. Er wußte, daß der König keinen Spott davontragen durfte, und Werde, die Stadt, war nicht fest genug. Die Brandrote – das war der Fall der Stadt! Konnten sich aber seine guten Mitbürger aussuchen, auf wen sie Steine und Bolzen niederließen? Ganz abgesehen davon, daß ihn keiner unter den Stürmenden erkennen durfte, überhaupt niemand, ehe er nicht unter seinem Haustor stand.
Es wurde ihm eng unter dem verrosteten Ringgeflecht. Sporenstreich und hochgerissen! Heinrich, der Ebner, hats mit straffen Worten und einem hitzigen Ritt angesetzt. Manches war ihm gelungen, nur weil er sich selber vom Anbeginn in der Quetsche hatte. Er kannte das wie der Fuchs die Hühnersteige: sein Herz mußte inmitten der Fahrt gewonnen sein, wenn nichts mehr zu wenden war. Dann hielt er auch durch und gewann seinem eigenen Mut den Vorschuß wieder ab.
So kaute und schluckte er an dem prallen Wagnis, auf das er losgaloppierte, und fand, je näher sein Ziel, je weniger Glück bei rückschweifenden Gedanken. Man hatte in den Scheppacher Pfühlen um diese nachtneblige Zeit allzu trefflich und von keiner Ehr- und Gewissensnot bemüßigt geruht. Nun wollte er also sehen, von da oben, von der Rüedlinger Höhe aus, wollte er sehen, schnell und beherzt. Das wollte er.
Daß die Rüedlinger Huben vom Feind leer seien, konnte er nicht erwarten, wenn auch alles Volk vor die Mauern rannte, vielleicht schon in die Mauern drang. So ritten sie einen Bogen querein zum Fohlhof, und die heißen Pferde konnten den Hang Schritt für Schritt nehmen. Noch deckte der Wald den Ausblick, während sie langsam mit gelöschter Laterne auf Werde hinzottelten; aber sie erkannten durch Stämme und Äste die Brandstätten im Ried. Die Stadt selbst lag ohne Feuersbrunst in ihrer wachen Nacht, sie sahen die Schattenzähne der Türme und Giebel vor einem milderen Schein. Und da sie ober Rüedlingen am Waldrand hielten und eine sanftgesenkte Schweige die Heimat freigab, entschlüpfte dem Ebner doch das bebende Seufzerlein des Dankes. Demnach wird der König Werde nicht brennen. Nur die Rieder Fronfischer haben dran glauben müssen. Torheit wärs auch gewesen, die Stadt zu brennen, die goldene Brückenpforte des weiten Landes diesseits und jenseits Werde mußte gewonnen sein, nicht gebrannt.
Heinrich, der Ebner, setzte den Eisenhut auf – es wäre noch Zeit gewesen, aber der Eisenhut drückte die Mütze fest an die Ohren: Sicherheit, Gegendruck. Nun galt es.
Das Kaibachpförtl lag auf der Mitternachtseite im Rücken der Stadt. Dort lag auch die Burg, und über der Burg lag hellerer Schein. Der Schellenberg jenseits des Kaibachs, höher als Burg und Stadt, das war der Ort für das Gewerfe des Königs, und von dort mußten sie hinan. Wer den Mangoldstein hat, hat die Stadt. Sein Plan blieb gut. War das Kaibachpförtl nicht zu gewinnen, so lag vielleicht schon eine Bresche offen. Vom Ried aus berannten sie die Stadt nicht, Werde stünde längst in Lärm und Flammen. Auch das ließ den welterfahrenen Mann über die Absicht des Königs ruhiger werden. Auf der Burg im Rücken der Stadt lag der Vogt des Pfalzgrafen Rudolf. Der sollte getroffen sein und mochte getroffen bleiben.
Sie preschten aus dem Wald, ritten um die Rüedlinger Zäune, in weitem Bogen um Werde und um das Königslager. Die Wörnitzfurt ober den Bleichen lag frei. Noch einmal waren die Pferde heiß geworden, sie stoben erregt durch das Wasser.
Hinter den Burger Höfen, aus denen der Troß lärmte, saß er ab und gab seinen Hengst an die Hand. Der Junge sollte auf den Roßhof zuhalten und selber sehen, er aber schlich um die Ziegelgruben an den Kaibach und hinüber in den Wald. Da konnte er unbemerkt vorwärts.
Sie hatten vom Steinbruch her eine Schneise geschlagen. Das Astwerk lag zu beiden Seiten, dabei halb zugehauene Stämme und, er merkte es an einem jähen Riß, benagelte Stämme, also für das Hochgewerf schon zugerichtet. Im Waldboden zogen die tiefen Rillen der Lastschleifen. Es hatte lange und ausgiebig geregnet. Er sank zuweilen bis ans Knie ein. Der Wald lag still. Etliche Dutzend Schritte vor dem Rand standen die Wagen im weiten Ring hintereinander.
Der Ebner setzte den freien Hang hinunter in den Schatten der Wagen und duckte sich. Auch da in aller Nähe kein Laut mehr. Er schlich dicht hinzu, hielt sich an der gestrafften Kette zwischen zwei Wagen und starrte über den Bach hinüber. Es verschlug ihm doch den Atem: Werde, die Stadt … gedacht, erwartet, angesetzt tut das anders als gesehen … dort an der Burg- und Mauerbrust wirbelte, lärmte das Gerenne. Pechkränze auf langen Stangen, darunter huschende Fackeln. Aus den zertrümmerten Dächern der Burg quoll es dick und schwer, und der Wind trugs herüber. Leitern, die sich aufrechten, schwankten, anprellten, etliche wurden berannt und bogen sich und wippten unter der Last. Von oben her noch Schutt, dampfendes Wasser, Flammenbälle. Zwei „Katzen“ waren bis an den Fels vorgeschoben, dort legten sie Stufen, unter den Schutzdächern geborgen. Und dort aus der Nähe spielte auch noch das niedere Gewerfe, Steine, Pfeile. Nicht weit vor ihm streckte ein Tribock den langen Schleuderarm gegen die Burg. Er stand verlassen, Felstrümmer und Balken lagen daneben. Man fürchtete den eigenen Sturm zu treffen. Da stieg neben dem Mangoldturm von der Burgzinne her das Geschrei hoch. Leitern wuchsen aus dem Boden, taumelten von allen Seiten hinzu. Aus dem spitzen Turmdach brach die lichte Lohe. Dort hatten sie es.
Der Ebner kroch unter der Kette weg, sprang zum Kaibachweiher hinunter, dessen Staudamm zerrissen war, und kauerte hinter einem Busch diesseits der Schlammulde. Sie hatten die Bresche geschlagen und sie drangen ein. Das schmale Burgnest mußte bald voll sein. Die zersplitterten Dächer gingen rotqualmend auf. Der Vogt des Pfalzgrafen hat immer zu wenig Leute gehabt, und der Sifried Barwich wird brav die Tore und Mauern der Stadt halten. Soll die Vogtburg fallen! Tut einer wohlbestellten Stadt die Vogtburg im Nacken gut? Werde, der Stadt, war sie längst zum Verdruß geworden. Vielleicht hat der König auch das bedacht. Wieder kein schlechtes Zeichen! Die Rieder Fronfischer haben brennen müssen, daß der Burgvogt hinters Licht geführt sei. Die Stürmer stießen und drängten einander vor und verschwanden. Demnach: sie fanden kaum Widerstand.
Er versuchte durch den Schlamm und hinüber zu kommen. Die Sporen verfingen sich im Kalmus. Er schnallte ab und besann sich noch einmal. Drüben ein verglimmendes Feuer. Er rieb die Hände an einem Kohlenstück und wischte den Schweiß von Stirn und Wangen. Sein Schwert ließ er in der Scheide, aber einem Toten zog er im Aufspringen einen Sauspieß unter dem zertrümmerten Schädel hervor und lief unter den letzten an eine Leiter: Brüder, die es nicht eilig befunden hatten und dem Auge des Weibels entgangen waren. Zum Schätzen kamen sie hinterher immer noch recht, und in der Stadt gab es Seitenschluffe genug, durch die man vorwärts fand. Dann nicht beim Kleinen hängen bleiben, weiter und hübsch in die breiten Gassen! Hinauf also und acht auf die dreckigen Fersen vor der Nase! Da brach links neben dem Ebner eine Leiter. Fluchend, schreiend sanken die Männer, und von der Tiefe: Aufschlag, Brüllen und Ächzen. Es waren immerhin anderthalb Dutzend Ellen in die Höhe. Die vor ihm stutzten, auch seine Leiter bog sich, da die anderen nachdrängten. Das Herz stockte, und der Sauspieß glitt aus der Hand. Von unten schoben die Flüche mit. Es kam glücklich wieder in Gang, Bedachtsamkeit in allen Gliedern.
Kein übles Ding, wieder auf festem Boden zu stehen! Aber die vorne mochten aufgehalten sein, man schob auf den Burghof, eine dicke Masse, Schritt für Schritt gegen das Innentor. Von den Dächern schlurften und sprangen glühend heiße Ziegel, und die wenigsten Leute hatten Schilde, sich zu decken. Man mußte durchkommen, ehe der Dachstuhl einbrach.
Der Ebner ließ Mann um Mann voraus und kam unter die letzten. Nur die Schreie der Getroffenen waren zu hören und das Schürfen der Stiefel auf den Katzenköpfen. Kein Widerstand mehr, aber das Tor war zu eng und der Raum war zu klemm, sie schielten auf die lodernden Dächer und schoben vor. Der Ebner sprang seitwärts ab unter das Kapellenerkerlein.
Die Wehr in der Faust, setzten etliche aus den Burghäusern auf den Hof zurück. Sie hatten die Häuser durchrannt und leer gefunden, nicht einen einzigen schleppten sie mit. Sie hatten Feuer gelegt, das ging auf. Da klangen aus der Stadt herein die Hörner des Königs und wurden mit Geschrei begrüßt. Der Barwich mußte aufgetan haben. Der Burghof war fast geleert, nur unter den Bogen der Freiung, zwischen der Innenpforte und dem Außentor also, staute es sich noch, als das Dach ober dem Ebner einbrach und der Sturz von Stein und Brand über das Erkerlein hinweg niederprasselte.
Es hatte etliche erwischt, die sparten ihre Lungen nicht, einer löste sich, sprang brüllend rückwärts, zwei schlugen, ihn zu löschen, mit den Schildflächen auf ihn ein. Er brannte, sie warfen ihn zu Boden, wälzten ihn und erstickten die Flammen. Dicht vor dem Ebner jenseits des Brandschuttes wimmerte er. Der Ebner hatte unter einem dumpfen Antrieb sein Schwert gezogen, er stand breit gegen die Mauer gelehnt, vor ihm die umzüngelten Balken, der qualmende Unrat und über das Geschrei hinweg der Sammelruf der Hörner. Nur mehr die Freiung des Torturms stand voll.
Es hauchte ihn erstickend an, seine Augen irrten nach einem Ausweg über den brennenden Schutt hin. Im Rücken die Stockwerke standen lichterloh in Flammen, ringsum der Hof rot von der Glut. Er spreizte vier Finger in die Höhe und stieß hervor: „Sant Florian … Herre min … wächsinKerzen viere, armsdick, von Stund in vierzehen Tagen!“ Und damit setzte er über Balken und Steine, und da er mit geschwungenem Schwert auf das Tor zulief, wichen sie vor ihm, als sei er einer der Kühnen und Ersten gewesen und habe eben noch sein Leben aus dem Brande gerettet. Solch einen nutzbaren Glauben erwittert man auch in hoher Not und hat nichts dagegen.
Heinrich, der Ebner, wandte sich nicht wie die meisten von der Burg ins ’Ölgässel, aus dem die Hörner zu rufen schienen, er lief unter den Bäcken hin gegen das Rote Tor, um hinter Sankt Ulrich zu kommen. Die Gleven des Königs mochten sich auf dem Markt zusammenziehen.
Vor dem Roten Tor aber beugte er die Knie und bekreuzte sich für ein Paternoster. In seinem Herzen brannte der Dank. Hinter dem Tor vor der festen Stadt lag das höchste Heiltum von Werde im Kreuzkloster, wohl gefügt und kostbar gefaßt: die heiligen Späne des allerheiligsten Kreuzes, von dem ersten Mangold eingebracht, dessen Burg jetzt brannte, die Burg, darin ein unschuldiges Blut vergossen war. Sie brannte zur Sühne für ihre dunkelste Stunde. Im Rücken des Ebner das Schallen der Trompeten, das Rollen der Trommeln. Er kniete allein. Es war seine erste Minute.
Da er das kurze Gebet schloß und die Stirn bekreuzte, stieß er mit dem Daumen an den Eisenrand seiner Haube, das brachte ihn aus dem Dämmer des Verschnaufens zu Zeit und Gegenwart. Er raffte sich auf, sah um sich, bog abwärts ein hinter Sankt Ulrich, drückte sich in den Schatten der Kirchhofsmauer und riß im Weitergehen den Eisenhut ab und zerrte das Ringhemd vom Leib, warf alles über die Mauer; nur seine Kappe barg er im Wams.
Es faßte den müden und hochbefreiten Mann eine fast jungenhafte Lust. Er sprang gegen den Zehenthof hinab und hinüber ins Färbergässel. Dann stand er vor den drei steilen Stufen des Hinterpförtleins, vor seinem Haus … Dach, Mauer, Schutz, Freiheit, Geborgensein. Seine Lippen zitterten. Gotts Dank und der Heiligen Jungfrau! Er schnob und spürte die Stufen, als er sie nahm. Das Pförtlein war wohl geschlossen. Vom Obermarkt scholl der Rumor in den grauenden Morgen. Sie traten vor ihrem Kriegsherrn zusammen, und es sollte das Schicksal der Stadt entschieden sein, ehe noch die Waffen aus den Fäusten kamen.
Der Ebner pochte am Törlein und pochte auf seine Weise. Lang blieb er ungehört, er wagte nicht Lärm zu schlagen. Aber endlich erlöste seine fiebernde Ungeduld doch ein Schein, und ein Augapfel glänzte hinter dem Lugloch. Noch ein unterdrückter Laut, und der Riegel ging.
„Herr … kummt, kummt eilends … Herr! Ein Büeble!“
„Ann!“ Er packte die alte Dienerin beim Arm und schüttelte sie, daß die Lichtzunge wehte und das Unschlitt spritzte. „Was ist?“
„’s Büeble, Herr, uf diese Stund …“
„Potz Wunden und aller Heiligen! Stohts guet mit der Frou?“
„Guet, Herr … ganget no, ganget no!“
Er wußte nicht, wie er die Stiege hinaufkam. Eine Magd sprang ihm voraus. Sie rief in die Tür: „Der Herr, der Ebner ist do!“
Und es hielt ihn mit zitternden Knien und keuchender Brust unter der Tür. Er sah die Frauen alle, die seinem Weibe in Kindsnöten zustatten gekommen waren, sie standen still bei Bett und Tisch. Es war, als hielten die Kerzen auf Tisch und Wandbord den Atem an. Und sittig standen die Weiber, leicht vorgeneigt, und sie legten die Hände zusammen, sahen nieder und wehrten so seiner Raschheit: die Trugenhovin, die Münzmeisterin, die Höchstätterin, die Barwichin. Der Himmel weiß, ein Aufwand zu diesen stürmenden Zeiten! Von ihnen aber gewartet und bewahrt, lag seine Hausfrau. Die Hände, wächsern fast und müd, hielt sie ober dem Kolter gefaltet.
Und da hoben sie es, die Alheid und die geschworene Frau, aus dem dampfenden Schaff, und es begann sein Geschrei. Das zuckte dem Vater in das Herz, und er schlug sich mit beiden Händen schallend auf die gespreizten Knie und lachte und rief:
„Agnes min … ’s Büeble! ’s Büeble host ’bracht!“
Die Frauen, wohl bewußt, was Maß und Unmaß sei, hielten eine Hand vor dem Mund, das Lachen vor diesem verrußten, verschwitzten, freudebleckenden Mannsbild zu verstecken.
Und der jüngste Ebner wäre fast um die Würde seiner Darbietung und Aufnahme gekommen, wenn nicht die geschworene Frau gewahrt hätte, was ihr und dem Hause, dem sie zu dieser Stunde diente, gebühre. Sie wickelte das krebsrote Wesen in warme Windeln und in sein Kissen, umschlug das Bündel mit einem Tuch aus schwerer Seide, das ihr von der Wiege her gereicht wurde, und Heinrich, der Ebner, sammelte sich an diesem bedachten Gebaren. Er stapfte, etwas steif und merklich mitgenommen, in das Zimmer. Die Wehmutter trug das Menschenkind an das Bett, Frau Agnes bekreuzte es im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit, und dann wurde der Sohn auf den Estrich vor des Vaters Füße niedergelegt. Ein Paternoster lang mußte er liegen. Die Frauen waren im Kreise nähergetreten und hatten die Hände gefaltet.
Heinrich, der Ebner, hob den Sohn auf zum treubezeugten Zeichen, daß er sein Kind sei und Erbe des Namens und des Gutes, die beide er, Heinrich, nunmehr der alte Ebner, in Ehren erhalten und gemehrt hatte. Doch ließ man das Kindlein nicht lange in seinen Armen, und er konnte zu ihr, und sie wartete seines Grußes in frommer Sattheit. Er küßte sie auf Mund, Augen und Stirn und sagte:
„Guet ist, Agnes. Du host mir den Sohn ’bracht in dinem drißigst und sechsten Johr, des solltu von mir hoch gelobet sin.“
Die Frauen hörten die gemessenen Worte beifällig, auch die alte Trugenhovin schien zufrieden. So langte der Ebner in sein Wams, zog die Mütze hervor, warf sie beiseite, zog weiters ein Beutelchen heraus, dessen Schnur er vom Halse riß, denn er wollte sich vor den Weibern nicht entblößen. In Mittewald hatte es mancherlei Kaufgelegenheit gegeben. Er trat nahe an eine Kerze und grub, tief zum Licht gebeugt, mit einem bedächtigen Finger in dem Ledersäcklein; das klirrte leise. Und es schien, als wolle dem Manne nichts köstlich genug sein. Endlich griff er einen Ring heraus und ließ Gold und Steine in dem Lichte spielen. Die Weiber reckten die Hälse hinzu, die Barwichin, als die Vornehmste und des Ammann Weib, ließ hinter der schmalen Hand ein langgezogenes Ouh! höchster Anerkennung vernehmen. Auch die Hauswirtin hatte aus aller Mattigkeit den Kopf so hoch, als sie konnte, gereckt und hindurchgeblinzelt, da die Frauen sich eng um das Kleinod geschlossen hatten. Der Ebner streckte in einer vornehmen Haltung den Ring vor sich, trat mit breiten Schritten hinzu und legte die Kostbarkeit der Hausfrau in die beiden dargetanen Hände. Er sagte nicht ohne innere Schwebung:
„Dies Fingerlin soll sagent, du sigest von mir als ein wohlgefällig Gemachei in dem Kindsbette befunden. Des will ich gedenken mit dem Spruoch:
Es grünet mir in dem Herzen min Als uf der Ouen,
Des weiß ich dir ze danken,
Min Lieb, ohn allen Wanken!“
Die Frauen reckten ihre Ohren. Er war ein höfischer Mann, der Ebner, und sein Eheweib, die Ilsungin, brauchte nicht so leidig zu tun; zu dem, er mochte etliches überstanden haben, wie er dastand voll Dreck und mit dem rußigen Gesicht. Die alte Trugenhovin, längst über das Wundern um ein Mannsbild hinaus, brach das Schweigen:
„Nu gang, Ebner, und wäsch dich, kleid dich als ouch, dann es möcht nit lang währent, und das Glöckel lüt ze Rate.“
Was sollte er anderes? Ein Kindsbett richtet Frauenregiment auf. Er stieg sein Haus hinab in die gemauerte Stube. Daß der Wasserkessel heiß war, wußte er und dankte es seinem Söhnlein.
Kaum aber war der Herr in der Tiefe verschwunden, noch schallte sein Tritt, trat die alte Ann aus dem Schatten des Söllers; sie hatte mit Ungeduld gewartet, daß er ginge. Einen langen Wacholderzweig trug sie hinein und entzündete ihn an einer Kerze. Die Frauen zogen sich von Wiege und Bett zurück, sie wehrten ihr nicht, sie bekreuzten sich nur.
Die Alte schwang den Zweig, seine Flamme erlosch, aber wach blieb die Glut, und das Zimmer begann von dem weißen Rauch zu duften. Sie schwang den Zweig gegen Fenster und Tür, sie ging um die Wiege, sie ging um das Bett, ihre Schritte glitten, sonst schlappten und traten sie humpelnd. Sie flüsterte:
„Buone robbe, buones choses …“, das hatte sie in Burgund erlauscht, wohin sie im Dienst des alten Konz, des Ebner, gekommen war. Der hatte eine burgundische Frau gehabt. Und sie flüsterte:
„Mare solls nüt tragen,
Trud nüt züchen,
Mare nüt reiten,
Nindert beschreiten,
Alb mit diner krumben Nasen Sollst das Büeble nüt anblasen …“
Als der Segen gesprochen war, das Zimmer aber voll des läuternden Duftes stand, sank die Alte wieder in ihre emsig gebeugte Haltung zurück. Sie warf das Reis in das Badschaff und sagte zur Frau:
„Muoß abe und luegen, Frou, ’s Margretle ist ußer.“
Die Mutter reckte sich hoch, daß die Frauen hinzueilten und sie auf die Kissen zwangen.
„Margretle … gang, Ann, ruofs Gretle, gang … unter denen Reisigen! Tuet die Laden uf!“
Als sei sie dann näher bei dem Kinde und brauchte es nur zu rufen. Die Alte aber winkte ihr, zu schweigen, sie ging und öffnete die Fensterladen, der graue Morgen drang ein, er hatte es noch nicht über die Brandrote gewonnen. Sie hörten das Klirren und das Schwirren herauf. Die Männer warteten in Waffen ungeduldig des Kriegsherren. Es fiel die Frauen an, wiewohl sie vom Ammann her gute Nachricht kannten. Sie kreuzten ihre Hände vor der Brust, sie bedeckten das Gesicht, der Schrecken überkam sie neu. Die alte Dienerin sagte trocken, während sie den Laden des zweiten Fensters befestigte:
„Froue, bis still … ’s Margretle hat ein sundern Engel bi ihr.“
Lind dann schlurfte sie hinaus, unberührt von der marktläufigen Zeit und nur auf das Haus bedacht. Sie hatte die Hulden von des Sohnes Wiege gebannt, sie hatte am zweiten Abend, da ihrer Frau Schoß die Frucht unter großen Schmerzen nicht lassen wollte, beim Wachszieher ein Wachsdöcklein gekauft und war nach Sankt Ulrich gelaufen, hatte das Bildnis im Namen des Vaters, des Sohnes und Geistes aus dem Weihbrunn getauft und unter der Altardecke versteckt. Und jetzt wollte sie noch das Gretlein finden, sie ahnte wohl, wo es sei.
***
Auch in einer Brust, kindhaft noch und von der Sehnsucht unbeschwert, die aus dem tagharten Leben steigt, kann das letzte Geheimnis des Gebetes blühen, das sich jenseits der Bewußtseinshelle hervor aus einer dunklen Inbrunst hebt. Ein Geheimnis, wie es lockend im Tonreigen eines Organum oder Modetus lebt, und gleich dem, das in der Tiefe Orgelbrausens, im hallenden Wohlklang der Harfe und im Laut der Flöten durch die Seele schwingt – Abseitiges, Übersinnliches.
Margarete bleibt dessen immer bewußt, daß sie eine Angelobte des himmlischen Herrn ist, seit sie aus den Erklärungen der Klosterfrau Klara ihre Berufung erkannt hat. Aber sie ist noch zu jung, gegen alle Natur aufzukommen. So ist es ihr geschehen, daß sie an den Paternosterperlen allmählich tiefer und tiefer hinabgeglitten war, fast zu den Bodenfalten des Altartuches, und endlich lehnt sie am Altäre und schläft, die Schnur der Buchskügelchen des Rosenkranzes durch ihre Finger geschlungen und den Mund des an die Brust gesunkenen, blassen Gesichtes auf die oberste Perle gepreßt.
Inzwischen ist der Glockensturm verklungen, die Königsfanfaren haben Besitz von der Stadt genommen, und ihrem Hall nach sind die Belagerer eingedrungen. Sie haben den oberen Markt bezogen. Inzwischen auch hat der Vater einen scharfen Ritt getan. Die drei Heiligen aber haben die Bitte des schlafenden Kindes vorgebracht.
Und unter den Trompeten sind die Leute aus der Kirche gelaufen. Sie hätten Grund genug gehabt, zu bleiben, auf den Knien näher zu rutschen. Denn Wüsten, Brechen, Plündern und Gewaltigen sind bittere Läufe, davor Gott seine Hand halte. Allein es hat keinen und keine mehr, noch so alt, außer Haus in der Kirche gelitten.
Da wird Margarete wach, sieht den grauen Morgen in den runden Fensterbögen, zu denen der verarmte Kerzenschein nicht mehr hinaufreicht, sie sieht auch die Röte in den Fenstern auf der anderen Seite und im Tor. Sie ist allein, das Kirchenschiff ist weiter als sonst, dämmriger, drohender. Von draußen herein braust und klirrt die Ungeduld. Mit stockendem Herzen, langsam, redet sie sich auf, als dürfe sie mit keiner Bewegung das Lauernde wecken, das ringsum nur geschlafen hat wie sie. Sie erinnert sich, weshalb sie hierher gekommen ist. Es durchrieselt sie kalt, die Leut sind fort … etwan … es sind keine Leut gewesen!
„Muotti … Agnes-Muotti … Muotti, Muotti …"
Sie läuft auf das Tor zu, hinter ihr die eigene wimmernde Stimme, als würde sie ereilt, umschlungen, erstickt. Sie kommt unter den Bogen, sieht über der Kirchhofmauer den Markt vom Fackelqualm rot, den Himmel zur Linken rot vom Brand, sie huscht zwischen den Toten durch … die liegen jetzt wieder unter der Erde … und da sie aus dem Mauerpförtlein über die Stufen will, wird sie von der alten Ann aufgefangen. Die nimmt sie mit ruhigen Worten und stillt sie, faßt ihre Hand fest, zieht sie längs der Mauer hin, hinter einem hohen Stuhl vorbei; der ist auf ein Gerüst gestellt: Lägel und Bretter, ein Teppich darüber. Vor dem Gerüst drängen sich die Männer im Harnisch; Schildbuckel und Glevenspitzen blitzen. Die Ann und das Kind können nicht quer hinüber über den Markt.
„Gretle, was host ton? Alleinig ußer Hus! Bi stürmender Zit!“
Aber das Kind kann nicht antworten, es zittert an Arm und Bein, und die Zähne schnattern im Munde.
Sie drücken sich den oberen Häusern entlang, und die Alte redet auf sie ein, daß das Büeble gekommen sei, daß der Vater gekommen sei mitten im Lärm, und daß es gut stünde. Die Agnes-Mutter aber vergehe vor Angst um sie. Margarete hört das Schwatzen durch eine Benommenheit hindurch, sie spürt die Nähe der Männer deutlicher fast, als sie sieht, und ihre Beine laufen weiter, als liefen sie für sich allein unter ihr weg. Daß das Büeble da ist, daß der Vater da ist, hätte die Ann nicht zu sagen brauchen, erst recht nicht so glucksend vor Neuigkeit. Das weiß sie längst, und sie hat es von den Heiligen.
Sie kommt in die Stube hinauf vor das Bett. Die Agnes-Mutter betastet sie, als sie hört, wo sie gewesen sei. Die Agnes-Mutter fragt nicht so töricht, die weiß, warum. Die Mutter ist nur voll Sorge, denn von dem Kinde läßt der Frost nicht. Die Alheid ist noch da, sonst keine mehr, und die Alheid läuft mit der Ann, Kolter und Kissen Margaretleins herunterzuholen. Jetzt soll sie wieder daneben schlafen, denn das Büeble ist da, und die Agnes-Mutter schreit nicht mehr.
Allein mit der Mutter, flüstert sie:
„Der heilig Ulrich häts ton und die heilig Margaret … die hat din dicken Bouch zerrissen als dem Drachen sin Bouch, do ist das Büeble kummen.“
Die Hand der Mutter streichelt über die schmale, heiße Stirn und die flammenden Augen. Die Augen der Mutter sind weit, sie ist im tiefsten Herzen erschrocken.
„Bis still, Margret … bis still.“
Margaret löst sich vom Bette, sie leidet es nicht, gestreichelt zu sein, auch nicht wenn sie vor Frost zittert. Sie schleicht auf den Zehen zur Wiege, wo es schläft, und sie sieht das kleine Runzelgesichtlein, das von feinem Linnen umfaltet ist; gemalte Heiligenbilder gegen die Freisen sind in das Linnen eingebunden. Und das Gesichtlein liegt in sich und seinen Schlaf vertieft. Sie nickt dazu, sie weiß ihr Teil daran und ists zufrieden. Scheu betrachtet die Mutter das unkindliche Gehaben.
„Kumm, Margretle, Gretle, kumm.“
Die Kleine winkt nur.
Man bringt sie fiebernd und lallend ins Bett. Die alte Ann wäscht später den zarten glühenden Leib mit Essig und gibt den dürstenden Lippen Welschwein, darin Zitronensaft, Nägelin, Zimmt und Honig gesotten sind, dann – als Friede ins Haus gekommen ist und man eines Kranken warten kann.
***
Heinrich, der Ebner, hat aus den noch flatternden Worten des Kindes abgefangen, daß es in dieser bewegten Nacht mit ihm gewesen sei. Dann folgt er eilig dem Ruf der Ratsglocke. Er muß ans untere Ende des Marktes.
Der König war zunächst vor die Ratsstube geritten und hatte den Rat einläuten lassen. Heinrich, der Ebner, trat als der letzte in den Saal. Die Ratsverwandten machten runde Augen auf ihn, denn sie glaubten ihn zu Hochstätt.
Es traf sich alles fast zufällig noch und ungefüge. Der König saß in der Brünne, und auf dem Ratstisch standen Krug und Becher, eine irdene Schüssel mit gesottenem Fleisch, ein Holzteller mit Käse und Brot. Der Koch war noch nicht zur Stelle, und es sollte der erste Hunger gestillt sein nach der rumorigen Nacht. Zwei Junker warteten ihm auf, Ministeriale und Ritterschaft standen dahinter.
Er war ein Herr von blühendem Leib und gesunden Farben, das rostbraune, krulle Haar klebte ihm an den Schläfen, und in seinem Barte hingen etliche Perlen Weins. Er kam vorerst nicht zum Reden, musterte, mit vollen Backen kauend, die zwölf, in ihrer Mitte die drei Bürgermeister. Der Ammann Sifried von Auchseßheim, der Barwich, stand daneben, denn er war von Reichs wegen.
Der König ließ sein linkes funkelndes Auge hin und wider blitzen. Es lag tief und hatte ein sonderbares Leben, weil das rechte nur stumpf seinen Bewegungen folgte. Wußte man, daß es blind war, ertrug man den geschärften Blick unter den Buschbrauen leichter. Ein Neuling wurde befangen. Der König mochte auch sonst von einer sonderlichen Lustigkeit sein, der nicht in allen Lagen zu trauen war. Und hätte es ihm nicht offensichtlich geschmeckt, dem Rate von Werde würde noch bänger geworden sein. Das Häuflein wagte sich gleichwohl, je länger, je ungewisser des Schicksals der Stadt, kaum zu regen. Denn den Magister Reinwardus, als er mit seinem besten Latein beginnen wollte, hatte der König niedergewinkt und damit alles schallende Mundwerk eingestellt. Aber nun schien der letzte Fleischbissen an das Messer gespießt, in Salz und Pfeffer getaucht, auch das letzte Brotstück eingeführt. Der König spreizte die Arme seitwärts auf den Tisch, leckte die Zähne hinter den Lippen, sog und schnalzte noch ein wenig nach. Er sah unter einer gekräuselten Stirn vor sich nieder, als sei er des ersten Wortes nicht schlüssig. Dann blinkte er auf.
„Weller ist der Boumeister von euch?“
Herr Sifried von Trugenhoven trat vor. Er war in jungen Jahren bei Hof gewesen und wußte seiner dürftigen Gestalt einen geübten Schwung zu geben.
„Sifried von Trugenhoven“, erklärte der Barwich, da der König die höfische Verbeugung mit dem Erheben einer Hand bedankt und den Ammann fragend angesehen hatte.
„Du mogist wohl den Schlüssel han, Trugenhoven?“
„Üer küniglich Hochwirdigkeit, der Stadtschlüssel … denselbigen hät der Barwich genommen an, derwil Uer Gnaden unser Stadt stürment.“
„Den gehr ich nüt meh. Du bist der Boumeister, mich dunket, du habest den Schlüssel, den ich will.“
Die zittrigen Hände des Trugenhoven hasteten unter sein Wams, und er zog an einer langen Kette den Schlüssel hervor, mit dem der „Stein“ zu öffnen war. Im „Stein“ lagen neben den Briefen, dem Salbuch der Stadt und anderem wichtigen Pergament und neben dem Pitschiersiegel leider auch Silbergetriebenes zu festlichem Aufwand, zwei Beutel mit Goldfloren, venezianischen Dukaten und Solidi, ein stattlicher Haufen Mark Silberschmelze für die Münze, eine Masse Messing und, was am wehesten tat, drei Stangen lauteren Goldes. Sifried von Trugenhoven hatte brav zusammengehalten. Der Rat wollte das Rote Tor aufheben und das Kreuzkloster in die Mauern einziehen. Auch das Rathaus mußte neu erstellt werden. Alles war lange vorbedacht. Und wäre der alte Kasten nicht so wackelig gewesen, der König hätte das Stadtregiment anders empfangen. Planen, Bauen! Nun aber hatte der König den Schlüssel.
Und er winkte nur, gab den Schlüssel einem Ritter, der ihn samt der eingerafften Kette etliche Male auf der flachen Hand tanzen ließ, ehe er ihn in die Tasche schob.
„Ihr sullt wissen“, sagte der König, strich sich den Bart, merkte die Nässe des Weins, sah seine flache Hand an und wischte sie am Tischlaken trocken, „ich will diese Stadt Werde nicht lossen durchloufen mit dem Schwert schätzende – us Gnad. Allein Gnad ze lossen ohn aller Tugende, das könnte alleinig der allvermügend Gott. Ihr sullet meiner Gnad und großen Milde recht werdin gewahr und billig us euern Pfennigturn ustätigen, darin mein Gnad und Milde gefangen leit. Als hab ich den Schlüssel zuo dem Turn willig von euch empfahen und hofentlich. Doruf ich hoff, er möge gar eben und nicht gering sein, der Wucher in deme Pfennturn der Stadt Werde, und daß es glangt.“
Das war eine über Erwarten lange Rede und so gepfeffert sie schmeckte, sehr gnädig. Darauf war nichts zu erwidern. Die Ehrsamen verneigten sich tief und hofften das gleiche wie der König, nur bangen Herzens, denn es lag eine schöne Sach in dem „Stein“. Gott helf zu Genügen!
Der König stand auf.
„Ammann, du gohst zu dem Abten uf das Kloster. Die Süllen einen Ufzug oder Prozeß stellen ufs höchst an Gwand, Gerät, daß es wohl seie, und sullen das heilig Kreuzholz mit ihn’n führen. Daß sie gewärtig sein in der kürzesten Frist! Es wird gläut’ mit allen Glocken. Der Abt und der Convent sullen kommen, wenn ich das Gläut befehl ufs würdigest und mit Singen. Gang!“ Sifried von Auchseßheim verschwand. „Der ehrbar Rat sull alsbald zu unserin Stuohl gon, ze obrist uf dem Markt, und unser wartin.“
Er war ein Herr und stand auf strammen Beinen. Der Rat von Werde, obgleich es ihn durchfahren hatte, als des unschätzbaren Heiltums, das alle Welt begehrte, erwähnt wurde, verzog sich, so eilig es die tiefen Bücklinge zuließen, im innersten Herzenswinkel doch von Hoffnung und Freude durchzittert, daß dem König der „Stein“ fruchtbar genug dünke. Und sie fanden rücklings so treffend aus der Tür, als hätten sie ihre Augen sitzen, wohin der Lichtstrahl des Tages nur selten fällt.
Der König Albrecht wartete auf die Truhe. Die Pferde standen vor den Ratsstufen. Nach seiner Einkleidung ließ er blasen, ließ sich auf den Zelter heben. Einen prächtigen Mantel hatte man ihm umgeworfen, den breiteten sie über die pralle Kruppe des Pferdes aus, daß Gold, Perlen und Stein im Morgen blinkten. Der König trug aber den Helm, und von den Heiltümern des Reiches führte er nur das Zepter mit. Er hielt es auf seinen Schenkel gepflanzt, es winkte leise bei dem wiegenden Gang des Zelters. Vor ihm die Fahne mit dem Wappen und an der Spitze vier Herolde mit Posaunen. Da wichen die Reisigen ungenötigt, und König Albrecht zog durch die Gasse marktauf.
Die Fenster waren voll Leute, die Frauen hatten sich in der Eile mit ihrem Besten angetan, sie winkten aus den Fenstern. Nur vom Ried her roch es, und nicht nach Freudenfeuer. Aber der Tag war da, und eine Brandrote wäre nicht mehr zu merken gewesen. Gleichwohl hatten die Männer von Werde auf der Burg und im Ried tapfer zu dämpfen und zu hüten.
Es war schnell umgekommen, daß der König die Stadt in Gnaden nicht wolle mit dem Schwert durchlaufen lassen. Auch die Kriegsleute hatten es gehört und schlugen, da er durch sie hindurchritt, nicht mit Lanze und Schwert gegen die Schilde. Sie trauten ihm mancherlei Untreue zu. Er hatte vor dem Sturm großes Heil und ein gewaltiges Gut verheißen. Da wollten sie abwarten, wie weit die Gnade um Werde stünde. Oben bei der Kirchhofmauer war der Königsstuhl aufgerichtet: Sie waren gerufen, es stand etwas im Werke. Ein Gemurmel mochte da und dort aufkommen, und wären die Frauen nicht klug gewesen und hätten Korb um Korb aus den Speichern und Rauchfängen, Kanne um Kanne aus den Kellern auf die Gasse geschickt, vielleicht hätte das Säumen auf dem Rathause zu lang gedauert.
Doch der König ritt langsam durch sie, und er war behelmt. Das hieß Kriegsrecht. Von seinem Mantel funkelte der Zauber, auf seinem Schenkel stand das Zepter, das war geweiht und zuoberst dreifältig zugespitzt. Wehe jedem, auf den das Heiltum des Zepters zürnenderweise gerichtet wurde: die Augen versteinten im lebendigen Angesicht.
Den Platz um den Stuhl füllten Ritterschaft und Leibwachen, auch der Rat stand dabei. Sie hoben den König von dem Roß, er bestieg das Stuhlgerüst. Still wurde es auf dem Platz. Der König saß aufgereckt und sah weit hinaus, er wartete, bis alles zum Stehen gekommen war. Und es legte sich auf die Herzen.
Der König winkte dem Herold und ließ ihm von einem der Ministerialen das Blatt reichen. Der Herold trieb das Pferd an die Seite des Gerüstes. Er las weithin schallend:
„Ehrbar Ritter und Knecht, mein reisigs Volk allegemeine, als wir gesprochen und wir verheißen, ehe dann diese meine Stadt Werde hat das Tor uftan: ihr sullet groß Guet haben von dieser Stadt, uf daß ihr billig entgolten seiet aller Arebeit in diesen vergangenen dreien Wochen, und lot euch gefallin. Dann wir an diese Stadt kommen sind und habent dieselb Burg und Stadt genommen mit Hilf des allmächtigen Gotts. Also stoht unser Muet, ihres besten Guets zu nießen und es nehmen an.
Doch so euer Muet daruf stoht, dieselb Stadt Werde, so sich gefüeget wohl und nindert wider uns ist gelegen in ungetrüer Huet, ze strafen und ze nöten härter, danne ist geschehn in dieser Nacht uf z’letzt, so tunt wir euch, ehrbar Ritter und Knecht, also ouch dem Volk allinthalbin ze wissende: Fürwar es stoht nach unserm königlichen Muet und Befehl, das obrist Guet dieser Stadt Werde ze gewinnen nicht mit Wüsten, Brennen, Zerbrechen, Vermeilgen, noch einigerlei Schaden zuefügen mit Roub unde Gewalt! – Diese unser Stadt Werde wirft ein guete Münz us, doran sull eur Bruochgürtel ein jeglicher nit manglen billiglich, daß ihr ein Fröid habet an dem und euch wohl seie.“
Da hob eine Ritterschaft Lanze und Schild, und sie schlugen Wehr und Waffen über den Köpfen zusammen, das Volk folgte, wenn auch zögernd und in den ferneren Reihen nicht ohne Gemurmel. Der König aber hatte das Zeichen gegeben, denn das Geläut begann vom Pfarrturm aus und wurde von den Klöstern aufgenommen. Der Herold mußte seine Stimme aufs äußerste erheben:
„Mein reisigs Volk allegemeine, euch seie aber ze wissende: Das obrist Guet dieser Stadt Werde leit nicht in diesen Muren, so ihr es suechet, es leit ußenthalb für dem Tor, das ist Kreuztor genannt oder das Rot’. Dasselb Guet sullt ihr empfahen uf diese Stund und ist uf Erdenrich kein höcher Gwalt des Guets ninder nicht. Davor will ich ze dieser Stund dies Zepter in Demuet neigen unde fallin uf die Knie, dann es ist das Kreuz, das heilig Kreuz Gottes des Sohns, davon ist in diesem Kloster ein merklichs Partikul. Und es soll obir uns und euch obirscheinen mit der großen Macht und Stärken, so das Kreuz obir euch hingoht, als ganget der Herr Christ obir euch. Wir habent euch entboten uf diese gemeine Freiung, do sullt ihr des Guets sein teilhaftig und aller Sünd frei, die euch hät geminderet an Leib und Seel. Höret das Gläut, es wird euch die göttlich Gewalt obirkommen.“
Der König hatte sich erhoben, und der Helm wurde ihm abgenommen. Er stand seitlich gewendet und sah gegen die Pfleggasse. Der Gesang war unter den Glocken vernehmlich geworden. Und sie kamen im Ornat mit Silbersdiellen, Lichtstangen, Weihrauch und allen Reliquien, zuvorderst aber – von Konrad, dem Abt, an einer Kette um den Hals getragen und hoch vor das geneigte Gesicht gehoben – das Kleinod aus Byzanz, die heiligen Partikel. Vor dem Abte zogen dieTogaten im Ordenskleide, sie sangen das Kreuzlied der Passionshoren:
Crux ave benedicta!
Per te mors est devicta,
In te pependit Deus,
Rex et Salvator meus.
O arborum Regina,
Salutis medicina,
Pressorum es levamen Et tristium solamen.
Dum Crucis inimicos Vocabis et amicos,
O Jesu, Fili Dei,
Sis, oro, memor mei.
Und mancher Bürger hörte nicht nur den fremden, feierlichen Laut aus einer anderen Welt. Er vernahm es in seinem Herzen nach deutscher Zunge:
O heiligs Kruiz, gegrueßet si,
Von dir seind allen Tods wir fri,
An dich muoßt Gott gehangen sin,
Der Heiland und der Künig min.
Vor allen Böumen königlich Bringst du die heilend Frucht für mich,
Ein Freiung nach der Kettenlast,
Nach Elendfahrt ein milde Rast.
Des heiligen Marterholzes Pein
Ruoft Fründ- und Feindschaft in die Gmein,
Als ruof ouch mich, us Gottes Schoß Herr Jesus, und der Sünd mich los’.
Uber sie alle ging sie hin, die Sprache des himmlischen Heeres, machtvoll und voll Geheimnis.
Der König Albrecht lag auf den Knien, sein Volk mit ihm. Hinter den Fenstern der Häuser knieten die Frauen, Greise und Kinder.
Abt Konrad trat zum Gerüst und reichte der Majestät die Kreuzpartikel zum Kusse. Dabei jauchzten die Silberschellen, und die Weihrauchfässer schwangen weiße duftende Wolken aus, hell tönten die Stimmen der Togaten in den Glockenschwall.
Und wie der Abt sich abwärts wandte, um durch das kniende Kriegsvolk hindurchzuschreiten, daß jeder der Nähe des Heiltums teilhaftig sei, erinnerte sich ein jeder des hellen Klanges der Königsstimme, die ihnen vor dem Sturm verheißen hatte:
„In dieser Stadt leit des Siegs ein Zeichen und ist obir alle Widersacher ufgericht’ in Zeit und Ewigkeit. Dann der Herr Christ hat den Teufil zerworfen und den Frieden vollbracht an dem heiligen Guet, das in der Stadt leit.“
Kein Mann unter dem Glockenklang und Schellengang und unter dem duftenden Gewölk, der es gewagt hätte, dem großen Heiltum Gottes mit frechem Blick zu begegnen. Sie bekreuzten sich und fühlten bei sich, was an ihnen geschah.
Heinrich, der Ebner, kniete unter den Ratsverwandten und er dankte, daß sein Haus bewahrt bleibe, und betete für das Kind, das der hitzige Ritt überkommen hatte.
„Heilig Kruiz, gnade üns allsamt: dem Büeble, miner Husfrou, dem Gretle! Heilig Kruiz, erbarm dich ober üns!“