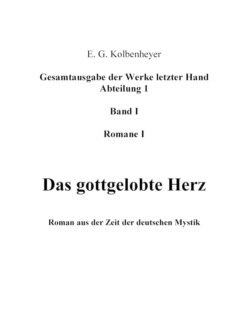Читать книгу Das gottgelobte Herz - Erwin Guido Kolbenheyer - Страница 4
2
ОглавлениеMargret steht unter dem spitzen Torbogen und zieht den Gugelrand tiefer ins Gesicht, sie hat zwei Finger dafür, die anderen müssen die Laterne halten. Es weht ihr die Schneegraupen gegen die Augen. Gugel und Kragenmantel sind mit weichem Lammsfell gefüttert. Nur den einen Arm kann sie aus dem Schlitz nehmen, ihr linker ist voll beladen: zwei große Holzscheite, die Tafel, eine Kerze. Die Scheite verhängen sich in der Wolle, das flaumige Futterhaar gibt ihnen mit tausend feinen Fängen Halt.
Sie sieht über den Markt hinüber, winkt mit der Laterne, wartet ein wenig. Dann springt sie die Stufen hinunter, der Schmutz spritzt noch. Sie winkt, aber die Schulbuben drüben bleiben nicht stehen, die warten nicht auf ein Mädchen. Der Hertlin muß es sein mit dem Rüssel-Peter, sie kennt den Pfiff. Auf den sie gepfiffen haben, der steht mit seinem Lichtlein schon oben am Markt. Pfeifen kann sie nicht, und könnte sie, so wollte sie nicht. Buben – wenn auch der Hertlin, der junge Barwich, ihr Vetterle ist. Sie steigt von Stein zu Stein, erst an der Kirchhofmauer wird der Boden fest. Die drei sind schon hinter der Mauer. Der Obermarkt ist leer, unten aber gegen das Rathaus zu geht das Leben auf. Schaukelnde Lichter blinken und verschwinden, man hört das reisige Zeug, etliche Wagen queren den Platz: Salzfuhren. Die kommen vom Stadel und wollen durch die Bäckengaß zum Obertor. In den Häusern leuchtet da und dort ein Fenster, oder es glüht durch die Ladenritzen. Das macht den Morgen so heimlich.
Der schmale Steig zwischen der Kirchhofmauer und der drübigen Zeile ist hochgeschottert, da braucht sie nicht mehr auf die Schuhe zu achten. Über den Kieseln bleibt der Schnee. Nicht viel, aber doch Schnee.
Der Hertlin und die anderen beiden laufen schon durchs Tor. Das Katzenpförtl geht. Margarete winkt, jetzt wird sie gesehen, denn der Keichend-Märtel will nicht alle Augenblicke von seinem Gluttopf in den Zug, und es saust und stöbert durch das Katzenpförtl, und sie läuft, den Alten nicht warten zu lassen. Sie weiß von ihm mehr, als er ahnt.
Er hat lange auf den Straßen gelegen. Für einen Topf Hafermus und einen Weck hat er dem Pförtner das ungute Frühgeschäft abgenommen. Er schläft auch im Torturm, wird oft, was ihn irr macht vor Zorn, unnütz herausgetrommelt. Aber kommt das Kloster in die Mauern, das hat der Vater gesagt, dann hat er sein Hafermus und den Unterschlupf verloren und kann sich nicht mehr über dem Speiwerk entladen, das man seinem Amt antut. Sie sagen, sein Kopf läuft in der Jähe auf, und er kriegt das Zittern, er schnappt nach Luft, als müsse er an dem ersticken, was er Galle in sich geschlagen hat, und dann bricht es aus: Schwur und Flüche. Gottslästerlich soll es sein. Mancher ist vor ihm gestanden, der ihn am kecksten getratzt hat, und hat sich nicht mehr rühren können, vom Fluch gebannt. Der Keichend-Märtel hat seine Schwür schon mit drei Fingern büßen müssen. Am Ohrenstock sind ihm die Finger abgehackt worden. Doch Margarete kennt sein künftiges Schicksal. Sie grüßt ihn fromm, trotz seiner Gottslästerlichkeit. Er brummt sie nicht freundlicher an als die Buben, die ihn zecken, um seine Flüche zu hören, wenn er nicht gerade die Schlüsselgewalt führt. Gott wahr dem Keichend-Märtel seine Zung!
Dann sind nur noch wenige Schritte hinüber ins Refectorium.
Sie sitzen auf den Schemeln und den Bänken um den breiten Ofenbau, der aus hundert hohlen, braun-glasierten Kachelaugen in den dämmrigen Raum glotzt. Der Magister Reinward lehnt steif im Katheder.
Der Gugelmantel des Margretlein, von den Holzscheiten aufgespreizt, trippelt befangen hinzu. Er geht auf den Zehen und schwingt wie eine Glocke. Sie hat die Gugel noch nicht zurückgeschlagen, man sieht nur die Füßlein. Ein Mädchen noch sitzt in der Schule, Uta, die Vetterin. Die sieht lieber nicht hin auf die Ebnerin-Margret. Das anderthalb Dutzend Buben verbeißt sein Gelächter. Auch auf die darf man nicht sehen, sonst platzt es einem aus.
„Globt seis Jeses Christ, hochgelahrt domine magister Reinwarde“, klingt es unter der Kapuze hervor. In dem hageren Greisengesicht zucken die Mundfalten. Der Magister blitzt sie aus den dunklen Augen an und zeigt auf den Holzhaufen, der neben dem Ofen liegt.
„Nunc et semper et in saecula saeculorum“, antwortet er.
Sie darf die Scheite zu dem anderen Holz legen, sie tut es vorsichtig und leise. Dann schlüpft sie zu ihrem Schemel, der dicht bei dem Magisterthron steht. Sie schält sich aus, zündet ihre Kerze beim Nachbarn an und hockt nun unter dem Haufen der Donatisten, der Fortgeschrittenen. Es sind ihrer ganze sechs. Die anderen, die Tabulisten, kämpfen noch in den Niederungen der Wissenschaft auf ihren Tafeln mit Griffel und Wort.
Im Augenblicke wohl scheint die Ordnung umgestoßen. Die Donatisten haben die Wachstafeln auf den Knien und schreiben ab, was auf den Wandbrettern neben dem Katheder kunstvoll von der Hand des Magisters gemalt steht. Die Tabulisten sind unmittelbar unter die Fuchtel geraten.
Alle Kerzlein brennen, etliche werden in der linken Hand gehalten, andere sind auf die Bank gepflanzt. Margarete hält das ihre und kritzelt mühsam die angeschriebene Sentenz auf die Tafel, die auf den fest aneinander gepreßten Knien liegt.
Der Magister ruft: „Domine – o Herre“, und zückt die Gerte gegen den grünen Haufen.
Der fällt mit hellen Stimmen ein: „Domine, o Herre!“
„Exaudi – hör an.“
„Exaudi – hör an.“
„Orationem meam – die Bitt min.“
Dann folgt ein ganzer Satz: „Et clamor meus ad te veniat – als ouch min Gschrei sull dringen für dich!“
Da quirlen die Stimmen durcheinander. Der Magister schlägt auf den Katheder, zunächst einmal Takt in den Strudel zu bringen. Nach langem Aufwand klärt es sich, und der Schwall gewinnt sein Maß. „Et clamor meus ad te veniat, als ouch min Gschrei sull dringen für dich.“ Noch ein dutzendmal, dann steht die Sache soweit. Aber sie steht nur im Chor, sie muß an den Mann und wird verfänglich.
Die Gerte fährt aus: „Der Mengenwart!“
Ulrich, der Mengenwart, dehnt sich auf und geht mit seinem Lichtlein in die Reichweite.
„O Herre“, fällt es zu ihm nieder.
„Domi … domi … dominus … o dominus“ , stammelt es auf.
„O … o!“
Die Kerze fackelt, der Ulrich blinzelt und ruft laut: „O“, befangener setzt er „Dominus“ hinzu.
„Was bedüt’ O?“
„O bedüt’ … der fufzehent Buochstab.“
„O asinee, meh dann fufzehn Esel! Asinissime! Was bedüt’ O?“
Der Magister blitzt über die Tabulisten hin, und keiner weiß, was O bedeutet. Es wird still, auch die Donatisten lauern, es könnte eine Seitenfrage geben.
„Din Huof!“
Ulrich, der Mengenwart, hält seine Linke hin, ober der rechten weht das Lichtzünglein und tropft Angst. Der Hieb sitzt, er war von der milderen Sorte, ein Gedächtnis zu erfrischen.
„O bedüt’ den Anruof, den Zuruof, du ghürnter Rammei.“
„O bedüt’ den Anruof, den Zuruof“, stößt es aus dem Ulrich durch, und er atmet auf.
„Und der Anruof machet us dem Dominus ein’ – ?“
„O domine", entfährt es licht.
Der Magister nickt, er schwingt über alle aus: „Insgemein! Was bedüt’ O?“
„Den Anruof, den Zuruof“, schreien alle.
„Was machet der Anruof us deme Dominus? Insgemein!“
„Domine“, schallt das Refectorium.
Margarete ist sehr befriedigt, der Mengenwart ist gut davon gekommen. Sie hat inzwischen ihrer Tafel die Sentenz einverleibt. Die Donatisten stehen die Köpfe zusammen und beraten darüber.
Ubi plures sunt opes, plures sunt cosumunt eas.
Im Rat der Donatisten hört man Margaretes Stimme willig. Aber sie werden nicht klug, denn „sunt“ und „consumunt“ sind zwei Tätigkeiten auf einmal und in einem Satz, und daß kein Wort zuviel sei, das wissen alle.
Von den Tabulisten ist der Rüssel-Peter vorgelangt, und das Spiel der Fragen und Antworten hat merklich an Laut gewonnen. Die Donatisten fahren zusammen, denn der Magister verläßt den Katheder und hat auch schon mit einem Griff die Hosen des Rüssel-Peter gepackt und gespannt. Kein Trommler paukt hurtiger und sicherer. Der Rüssel-Peter ist rot, aber er schreit nicht. Margarete preßt ihre um den Griffel geballte Hand auf das Knie. Wenn er nur schon! Alles kann sie sehen, auch Blut, nur soll sich keiner verhalten. Es steigt ihr in den Hals, als müsse sie für den Rüssel-Peter schreien. Die anderen wissen das: Ihr Gesicht nimmt einen Ausdruck an, vor dem die anderen stumm werden, neugierig und befangen zugleich. Manche schauen nur auf sie und nicht dorthin, wo die Zucht geübt wird, wohin sie des Beispiels halber eigentlich sehen müßten.
Es fällt ihr wie ein Nebel vor die Augen, wenn sie zu lange auf den Schmerzensschrei warten muß. Und der Rüssel-Peter ist so einer. Der wird nur rot und gibt keinen Laut. Das macht auch den Magister wild. Sie sieht den Magister vor ihren offenen Augen nicht mehr. Es ist der fahrend Schüler, der Wendlein, der hat eine Zeitlang an des alten Reinwards Statt Schule gehalten. Da hat sie auch zum erstenmal in der Schule Blut gesehen. Der Wendlein hat sie alle das Veni Creator singen heißen, daß man draußen das Wehgeschrei nicht vernehme. Es ist Konz, der Grüß, gebunden auf der Bank gelegen, und der Wendlein war mit seiner Gerte über ihm …
Da hört sie den Rüssel-Peter. Seine Seele ist entbunden, gelobt sei der Heiland! Ihre Tränen tropfen auf die Wachstafel und funkeln im Kerzenschein wie Sternscheibchen über die Sentenz hingestreut. Der Peter geht heulend in den Winkel: „ad … te … verdat … ad te verdat …“
Magister Reinwardus besteigt nach hochgeübter Zucht den Lehrstuhl, er sagt, noch ein wenig benommen:
„Derselb do! Alls verhärt’ in dem unde verstocket ganz!“ Seine Stimme wird wieder voll und gemessen: „Dannocht so ist deme von Gott geben ein’ Zucht us sins Meisters Hand, die sull er empfahen ungeschmächt!“ Er sieht, daß die Wangen der Ebnerin naß sind. „Jedannocht so ihr nit mügent das Wort nießen der Weishet us minem Mund“, das ist ganz deutlich auf sie hingesagt, „als ganget in die Schuol ze Werde. Do habent sie uf z’letzt ein Schuolmeister bstellt, der wird üch lernen brun und blou, daß ihrs an ürem Leib zu Hus tragent, nützlich unde kräftiglichen!“
Sie wissen, was diese Drohung bedeutet. Der Alte war bis vor kurzem der Einzige gewesen, und nun ist eine Schule von der Stadt aufgetan worden. Keiner möchte dorthin, von dorther wußte man andere Dinge.
„ Donatistae, jetzo ze üch. Was for ein Sentenz habet ihr in üer Täfelin ingraben“, fragt er und fügt beiseits hinzu: „Tabulistae, ihr sullt schriben, was ihr behalten hänt.“
Er wartet. Es regt sich keine Hand.
„Daß ihr wisset“, meint er ermunternd, „dies ist ein Spruoch und us des Salomonis Weishet. Ist üch nit ingangen? Ebnerin?“
„Sunt und consumunt sänt zween“, haucht es zu ihm auf, „und wir nit wissen, wohin“.
Die Donatisten sind zufrieden, daß es die Ebnerin war. Die bringt die längste Kerze mit und wirft dann den größten Stumpf in das Körbchen, das dem Magister gehört, wenn der Tag durch die hohen Fenster herein alle Kerzen blendet. Die Ebnerin bringt auch immer zwei Scheite und oft einen eidienen, der lang nachhält und angesehen ist vor den Buchenscheiten. Sie hat noch wenig Pfoten bekommen und ist am geschicktesten voran, wenn es gilt, über einen Text mit dem Alten einig zu werden.
Und lange geht es über die Weisheit Salomonis hin. Der Magister Reinward gibt nichts frei, er weiß, wie man eine Sentenz zerschlägt, durchpflügt, leimt und stülpt und wieder zerpflückt, um sie endlich silbenweis wie Paternosterperlen aufzufädeln. Er ist ein großer Meister, weit berühmt, und kann aus jedem Wort die gefährlichsten Lehrgänge walken. Da vergeht eine Zeit, und wehe jedem, der nicht dabei bleibt mit seinem ganzen Verstand.
Endlich kommt selbst der längste Sinn Salomonis an seinen Ort. Er hat auf dem Wege nicht allzuviel Zucht abgesetzt, auch sind schon über dem Rüssel-Peter die morgendlichen Kräfte des Magisters nahe an den Rand gebracht worden.
„Nu merkent ihr wohl, was Weishet es bedüt’. Das wellent wir in ein’ Reim satzen.“
Der Magister Reinward erhebt sich, und die gelehrten Donatisten mit ihm. Es muß feierlich genommen werden, was der Alte in einem Reim bringt. Sie wissen, daß nach Jahren noch ihre älteren Brüder und auch ihre Eltern abgefragt werden, wenn es eine fröhliche Gelegenheit ergibt. Er schlägt den Takt:
„Salomo besaget in dieser Sentenz:
Wer groß Guot bsitzet, derselb Mann Muoß als ouch manich Zehrer han.“
Das schallt aus allen viele Male, die Tabulisten müssen mit. Hoch steht die Weisheit Salomonis bis an die Decke des Refectoriums, unter der noch ein Rüchlein der ausgekniffenen Lichtstümpfe schwebt.
Um die Weihe nicht zu kränken, die Gottes Allmacht aus der Weisheit Salomonis in die Herzen einer aufgehenden Weltlust senken möge, läßt der Magister den Unterricht für eine Weile ruhen, nicht aber die Zucht. Sein Blick geht von einem zum anderen und steht gleichwohl über allen wie das böse Gewissen. Sie dürfen nur flüstern. Zuletzt trifft der Blich den in der Ecke.
„Kumm, sündhaftig, verstocket Kreatur!“
Der Rüssel-Peter weiß, daß er nichts mehr zu fürchten hat, er setzt aber seine Füße einwärts einen vor den anderen und dreht seine hangenden Hände nach außen, als müßten sie bereit sein, nach hinten zu fahren und aufzufangen; er fängt auch mit den Lippen zu zucken und zu spielen an, als müsse der Jammer seiner gemarterten Seele ausbrechen. Der alte Reinward ist damit zufrieden. Treib allerweg dein Gugelwerk, Büeble, bist du nicht weich im Herzen, so gib dich und lern aus einer Gebärden der Demut. Es ist schon manches Bäumlein an einem hölzernen Pfahl strack aufgewachsen. Nur wenig, die in Gnade stehen, können aus sich selber werden, die anderen treiben den Gebärden nach. Stell schrittweis einen Fuß vor den anderen und einwärts in Züchten, Büeble!
Der Rüssel-Peter blinzelt hie und da auf und hat das Gefühl, daß der Alte, ohne ein Wort zu sagen, mit ihm spricht. Er weiß gut: der hat ihn am gestrigen Tag raufen sehen, am Kirchhof, über den Gräbern dazu. Jetzt weiß er es, gestern hat er gehofft, daß der Alte doch nicht hingesehen habe. Er steht vor dem Katheder, und der Magister läßt seinen ruhigen Blich an ihm auf und nieder gehen, als sei er aller Ecken und Enden voll Dreck. Gestern ist ers gewesen. Da verzieht der Magister seinen Mund ein wenig, und der Brust des Rüssel-Peter entringt sich ein tiefer Seufzer. Der Alte zuckt mit dem Zeigefinger gegen den Platz hin, ein wenig nur, und der Rüssel-Peter springt davon. Die anderen haben aufgehört zu flüstern, nun schwillt das Geschwüre wieder an.
Die Schule nimmt ihren Fortgang. Die Donatisten mit den ersten Ansätzen des Abwandeins und Biegens, und später die Tabulisten, nur mehr im Paternoster und Credo erprobt. Aber endlich schlägt der Türmer eins in den Tag, und alle können in die helle Frühe. Mit Schlag drei sind sie auf Sankt Ulrich vor den Kantor bestellt, der ist des Magisters Feind, er führt die Stadtschule, dort dürfen sie schon ein wenig jücken, wo sie der Hafer sticht.
Die Buben stürmen voraus. Margarete hat nur mehr die Tafel mit der Sentenz unter dem Arm. Sie geht wie immer als die letzte fort. Es hat aufgehört zu schneien, und alle Erwartung, daß es hell und weiß auf Weg und Dächern liege, ist unerfüllt. Sie zögert. Vor ihr geht Uta, die Vetterin, und die soll warten. Die Uta hat einen Mantel mit einem Saum, beinahe eine Spanne breit, und der Mantel ist an den Lenden gefältelt. Dagegen ist die baumwollene Gugel mit dem Lammsfutter nichts, und weil die Gugel nichts ist, muß die Uta in dem schönen Mantel, der wie neu aussieht, warten. Sie wird, denn ihr großer Bruder, der Matthies, das burgundisch Vetterle – so heißen sie ihn, weil er sehr höfisch ist – darf seit Mariä Himmelfahrt im Ebnerhaus aus und ein. Es ist wegen der Alheid. Und der Vater Ebner trifft mit dem Vater der Uta, dem alten Hans, dem Vetter von der Ilgen, zusammen. Sie wollen wegen der Aussteuer reden. Das hat Margaret herausbekommen. Es wäre aber auch noch der Konz von Katzenstein, ritterbürtig, da, und sie brauchten nicht auf den Mattthies zu spannen, wenn er auch ein Vetter von der Ilgen ist und nicht vom Panther. Die Vetter von Panther sind das mindere Geschlecht und nicht ratsmäßig. Die Alheid aber ist eine Ebnerin, und das muß gemerkt sein.
So geht Margretlein verhalten und abwartend. Es ist der Familie wegen. Lieber ginge sie schnell, denn sie hat ihr Mus nicht mehr aufessen können. Wo es auf das Rote Tor einbiegt, bleibt die Uta stehen, und Margaret kann voran.
Sie zotteln zunächst schweigend nebeneinander. Die Uta hat auch Handschuhe an und streicht mit der Rechten über die Mantelfalten hinunter, lupft den Saum ein wenig und wendet ihn. Sie spitzt hinauf zur Margaret und sagt:
„Karmesin-Siden, die ist von miner Muotter ihrm Sorkett.“
Margaret bekommt wieder ein weißes, hochmütiges Näschen.
„Min Vater hat der Muotter dri Ellen Maramat mitbracht, der ist ein Siden mit gülden Fäden ingspunnen – vor Ärmel. Davor ist die Siden an dinem Mantel gring, als ein Rupfen.“
So hat die Uta ihre Lehre. Sie sieht auch verstockt drein, denn ihr Vater, wiewohl ein Handelsherr und hochangesehen wie der Ebner, hat nichts mit Tuch zu tun; die Margaret ist ihr um hundert prachtvolle Namen und Kenntnisse voraus.
Margaret fährt weiter im Text: „Die tragent jetzo ze Mailand Ärmel, die sänt mit Gluften ans Kleid gheft’t, wit unde lang, und hangent abe bis uf die Füeß, sänt als ouch gelappet und gefuderet mit Ormasin-Siden, etwan Camocato …“
Uta reißt die Augen auf: unheimlich, was die weiß. Dann aber schlägt doch etwas aus den Vettern von der Ilgen durch, und sie wird rot. Ohne den Mantelkragen Margaretes eines Blickes zu würdigen, meint sie:
„Din Gugel ist von dem schäffen Futter bockstif und ist als ein Glocken; so du inkummst, do müssent es all verbeißen, daß sie nit helluf lachent und der Alt merkets.“
Die Uta erschrickt vor der eigenen spitzigen Stimme. So weit hat sie nicht vor wollen. Die Ebnerin wird losfahren, und gegen die Ebnerin kommt sie nicht auf. Aber Margaret senkt ihren Kopf tief nieder, sieht zu Boden, schließt fast die Augen und schweigt.
Es ist ihr zugleich mit der Uta heiß aufgestiegen, als sei sie mit ihrem Reden sündfällig geworden. Sie hat nicht gelogen, und doch ist ihr bang vor Schuld. Die Worte der Uta treffen sie zurecht. Sie ist angelobt, und der heilige Martin, an dessen Kirchhof sie vorübergehen, will sie durch den Mund der Uta strafen. Ganz leise und demütig kommt es über ihre Lippen.
„Ich wellt, sie lacheten öffentlich min.“
Uta, die Vetterin, bleibt ratlos stehen. Sie war auf alles mögliche gefaßt gewesen, nur darauf nicht. Margarete bleibt sanft und leise.
„Kumm, Uta, mich hüngert.“
Uta geht, wie ihr geheißen ist, bestürzt, befangen, sie läuft einfach mit, sie ist nicht viel jünger als die Ebnerin, es ist ihr, als liefe sie neben der Priorin von Sankt Ursel, wohin sie beide ins Nähen und Sticken gehen.
Das wissen schon viele: man kann mit der Ebnerin nicht gut allein sein. Sie sagt oder tut immer etwas, und man kann nichts dazu tun und möchte am liebsten entlaufen.
Sie kommen zum Kirchhofeingang. Die Buben sind wieder über den Gräbern und suchen. Die beiden Mädchen springen die Stufen hinauf. Der Rüssel-Peter ist immer der wildeste, fährt dahin und dorthin und bringt alle durcheinander wie der Eber den Sauhaufen, wenn der Ecker schon ausgefressen ist und die Schweine noch einmal über ihn nachgetrieben werden. Wo etliche glauben, etwas blinken zu sehen, fährt der Rüssel-Peter dazwischen hinein.
Nur wenig arme Seelen haben in diesem Jahr am Allerseelentag einen Heller auf ihr Grab geworfen. Der Umbreit hat einen gefunden, der Joß Schorp und der Ott Gogel, des Herrenfischers Ältester, der ihnen allen über ist, auch dem Rüssel-Peter. Mit dem Schorp sind sie alle zum Probstbäcken gezogen, und der hat drei Seelenzöpf für den Heller gegeben. Die Zöpf haben sie verteilt. Der Schorp ist ein guter Kerl, und nur der Hertlin hat nicht mitgegessen, obwohl er mitgezogen war. Und alle haben sie vergessen, für die Arme Seel zu beten, den Heller aber haben sie verzehrt. Das hat die Margret dem Hertlin zu verstehen gegeben, und der ist mit ihr nach Sankt Ulrich zurück, weil er ein Barwich ist und des Ammanns Sohn, und er hat mit ihr drei Paternoster gebetet, um den Seelenheller zu entgelten.
Die Uta stößt sie in die Seite, denn der Rüssel-Peter geht schon wieder den Mengenwart an. Der ist heute zu gut weggekommen, und er, der Rüssel-Peter, hat die Hiebe einstecken müssen. Aber der Mengenwart ist ein geschmeidiges Büeble, er huscht hinter die beiden Mädchen, der Rüssel-Peter will zwischendurch. Die beiden haben einander schnell an den Händen gefaßt und halten ihn auf. Das Margretlein blickt den Rüssel-Peter zutraulich an, daß der Bengel stutzt, und der Mengenwart entkommt über die Staffeln.
„Loß gähn …" flüstert Margret.
Die andern Buben stehen dicht dabei. In dem Rüssel-Peter steigen Zorn und Schande hoch, denn er ist von den beiden Zärteldocken um seinen Willen an dem Mengenwart geprellt worden.
„Nunnaschliefle! Schinbarlichs, heilichs Gluetwörmle!“
Er steckt seine Fäuste in die Hosentaschen, zieht die Schultern hoch und trollt sich durch die anderen, knurrend und murrend, und bleibt dann abseits stehen, mit der Fußspitze im nassen Rasen wühlend.
Margarete wendet sich langsam zurück, sie sieht die anderen nicht mehr an, auch Uta, die Vetterin, nicht, sie schleicht davon. Der Rüssel-Peter weiß nicht, daß sie an diesem Morgen alle seine Hiebe gespürt hat, als seien sie an ihr geschehen.
Auf dem kurzen Weg hinüber ins Ebnerhaus verschluckt sie das Weinen und wird wieder leicht und froh. Was vorbei ist, ist dahin, und es ist doch alles so gut geworden, wie es hat werden können. Der Rüssel-Peter unter den Streichen hat endlich geschrien und ist von dem Mengenwart abgestanden. Etliches Speiwerk über sie hinterdrein – aber das fühlt sie kaum mehr. Und auch die Vetterin ist still geworden und mitgezogen. Und jetzt kommt das Müesle, die Ann wird es gewärmt haben, und Hertlin, das kleine Männle daheim, wird wach sein und krähen.
***
Der späte Herbst stand vor den Mauern warm auf, als solle das Jahr seine Kraft nicht legen. Zu Allerheiligen hatte es geschneit, aber die Brust war noch der letzten Sonnenwochen voll. Dem ersten Winteratem war kein Raum geblieben, er war vergessen. Das Pelzwerk hing wieder an der Stange. Sonnenwärme, leichte, laue Ostluft, und es ging auf den Christmond zu! Die Kupferkronen der Buchenwälder, laubrund und voll, leuchteten vor den Mauern der Stadt Werde in Mannesröte.
Heinrich, der Ebner, spürte die Kraft der freudigen Farbe wie einen Blutzauber. Gewonnene Zeiten, geschenkte Wochen. Sie brachten ein, was der Fürstenhader verschleppt hat. Nur daß um Mittag eine Sonnenschräge die dunkle Porphyrplatte streifte, auf der Heinrich, der Ebner, rechnete; das wies die Späte des Jahres. Sonst glühten schon weißbeflockte Holzkohlen in dem Kalfakter neben ihm, wenn der Sonnenstrahl auf dem Rechentisch diese Jahreszeit wies.
Die Stube hatte ein schmales, hohes Fenster auf den Markt hinaus, ein breites in den Stapelgaden des Hausinnern. In der Bogenspitze des Schmalfensters war eine Raute gefaßt, lauter, als wäre sie geschliffenes Bergkristall. Der Ebner hatte das Stück Glas in Venedig gekauft. Das übrige Fenster war blasig, trübe und grün. Die Mittagssonne spielte auf seinem Rechentisch durch die Raute die letzte Woche des Wintermonds in die ersten Tage des Christmonds hinüber. Der Ebner wärmte seine Hände an ihr; es konnte Vorkommen, wußte er sich allein, daß er die hohlen Hände aneinanderschloß und das Strahlenbündel wie ein Brunnenwasser auffing. Er rechnete sonst klug und kühl, auf seinem Wesensgrunde aber lag der Träumer, und der wußte das Späte und Seltene dieses Sonnengusses gerade deshalb zu genießen, weil ihn eine Raute aus Venedig einfing und über die Zahlen ausschüttete, die einen Teil seines Lebens bedeuteten. Denn er, der Ebner, hatte gewagt, sein Gold ungesiebt von Venedig und unbeschnitten, als sei Venedig solch ein gläsernes Nichts, von Mailand und weiterher aus dem Süden unmittelbar einzuholen.
Der Ebner blinzelte zu der hellen Luke hinauf. Vor einem Dutzend oder fufzehn Jahren hatten ihn die Visdomini des Fondaco namens der hohen Signorie zu dreißig Pfund Silber und zwölf Solidi verknurrt, weil von ihm etliche Pfund Safran ungeschätzt ausgeführt worden waren. Der Ebner spie verächtlich zur Seite. Ein Gerenne und Geschiebe war das gewesen über die beiden Notare hin bis zu den Konsuln der Kaufmannschaft, und hatte einen Brocken gekostet, bis ihm der Hohe Rat gnädigst die Strafe erließ. Wo in aller Fremde war um diese Zeit ein Deutscher trüber gezwungen, enger gehalten, tiefer ausgesäckelt als zu Venedig im Fondaco der Deutschen! Dreißig Piccoli für die Nacht, daß einer in seiner Kammer und nicht, wie die meisten, auf dem stinkenden Gang oder unter dem Tor auf den Wollsäcken schlafe. Und jeder zur Stund auf dem Quartier! Sonst war das Tor gesperrt, und man hat hinter dem Gitter gelegen, wenn einen die Sbirren nachtschlafender Zeit außer Haus faßten. Zahlen, zahlen! Ein kleines spöttelndes Lachen hinter geschlossenen Lippen schütterte die behäbige Rundung des Ebner unter dem Steppwams. An der Rückwand der Stube, der Verwahrung wegen und auch um trockengehalten zu sein, reihten sich, Wandbord über Wandbord, fast vier Schock Pfundsäcklein Safran. Es duftete leicht nach dem köstlichen Gut, und es duftete nach Apulien, kam über Mailand her, frisch und unbenommen von den stinkenden Lagunen.
Ein Seitenblick: es war der letzte der drei Wagen gewesen, der letzte auch dieses Jahres, nun blieben dem Jahr nur noch gezählte wächtenfreie, unvereiste Tage, in denen nichts Weiträumiges zu schaffen war; auch der Safranwagen war schon nicht mehr erwartet worden. Der alte Jockele mit seiner spürigen Schwabennase hatte ihn eingebracht, für alle Fälle nicht allzuschwer beladen, leicht auch, wenn man das teure und stattliche Geleit bedachte, das ihm die Rottleute mitgegeben hatten, aber gleichwohl des Gutes wert. Und das Gut hat runde Zahlen abgeworfen. Die deckten den glatten, dunklen Stein des Rechentisches, von dem der letzte Sonnenrest der venezianischen Uhr auf den Boden abglitt.
Der Jockele war beschenkt und gerechtfertigt. Rechter Hand auf der Tischecke standen drei Säcklein. In der Eisentruhe mit dem Marmelschloß, wohin die drei kommen sollten, schimmerten Spulen Mailänder Goldfäden. Draußen auf der Stapeldiele, daß es die Dreds- und Schneezeit überruhen könne, lag das Südgut und wartete gegen Nürnberg und gegen Würzburg zu: Baumwolle, Papier, Kaninfelle, Rotholz, auch Spezereien in Säcken und Truhen. Aber das Beste verwahrte der Söller in lavendelduftenden Eichenladen: jene Stoffe, deren kostbare Namen Margretlein ausspielte, wenns Not tat, eine Üppigkeit in Zaum zu halten und eine gute Kapuze zu verteidigen. Auch dort Mailänder Seidenzeug, das dem venezianischen den Rang abzulaufen begann.
Heinrich, der Ebner, hatte an diesem Morgen nicht ungern abgerechnet. Er ließ die drei Säcklein noch eine Weile stehen, überfuhr noch einmal die Zahlen und verglich sie in seinem geheimen Buch. Das Jahr stand wohl. Gewagtes war geraten, das Söhnlein war ins Haus geboren, und das Haus lag voll Guts. Werde, die Stadt, war ungesengt und ungeschatzt geblieben. Hatte der deutsche König auch gezogen und gepreßt, das Ebnersche war um ein Vierteil seines Bestandes gemehrt, und es tat wohl, ein vorbedachtes Gemüt bei diesem Schlüsse zu erquicken, stärkend war es, den milden Zauber von all dem ruhenden Gute wie ein Behagen einzuziehen und also den eigenen Mann und Menschen in Sicherheit zu wissen – denn für diesen Tag nach Mittagszeit war, ratsverwandt und ehrbar, Hans, der Vetter von der Ilgen, schräg über den Markt und etliche Häuser niederwärts, angesagt. Ein Roß sollte besehen und gekauft werden, draußen auf dem Roßhof zu Scheffstall; er wolle sich das Stück selber wählen.
Der Roßhof zu Scheffstall war ja nur der Kern. Die Waldung, das Hofland und etliche Seiden reichten hinunter bis an die Mertinger Vogtei, darauf jetzt der Reichspfleger saß. Und es ist dem jungen Vetter, dem Matthies, unverfänglich eingegeben worden, daß die Alheid ein Vierteil des Gutes Scheffstall zubringe. So kam es denn und schien ein erstes Zeichen, daß die Vettern von der Ilgen das gute Roß vor Winters brauchten, ob es gleich verständiger gewesen wäre, es zu besehen, wenn die Salzfuhren wieder frei wurden. Man sollte nur kommen und die Augen auftun! Scheffstall und Roßhof vertrugens, die Alheid desgleichen. Nicht minder im Bestand, hoch, breit, kräftig an Brust und Hüften trug sie sich, die junge Ebnerin. Schien ihr Antlitz nicht so weich und lieb wie das des Margretlein, war auch ihre Nase von der ausragenden Art, vorn ein wenig gespalten, und ihr Mund eher eines Jünglings straffes Lippenpaar: sie war ein Frauensmensch in Saft und Trieb, sie hatte es an sich, neben dem jungen Vetter, dem Matthies, zu bestehen, der in Besanjon von dem läppigen burgundischen Wesen zuviel angezogen hatte. Allein die Vetter von der Ilgen waren Leute, sie trugen sich fast rittermäßig, und es wäre dem Ebner nicht leicht angekommen, wenn es sich der alte Hans hätte zu knapp anmerken lassen, daß auch er wisse, was die Ebner seien.
Die Zahlen stimmten, der Ebner sank in das Lederkissen zurück. Unter dem Fenster hielt der Reitbursch mit den beiden Rossen an der Hand. Es war so still, daß hie und da ein ungeduldiger Hufschlag hereinklackte, daß selbst ein leises Klirren der Gebisse, die die Gäule abkauten, zu vernehmen war.
Er wäre an diesem Tag jedenfalls auf den Roßhof geritten, des Schemming wegen, seines besten Zweijährigen. Er traute keinem, wenn es auf die Pferde ankam. Und der Schemming sollte einen Beschäler geben, besser als der Rüsche zu seiner besten Zeit. In ihm war Spaniolblut, ein Konstabelroß, seine Brust und das Geschröt heut schon hengstmäßig, und sein Fell wie das Kupfer der Wälder draußen, wenn es noch taunaß ist und die erste Sonne spiegelt. Aber beide Drüslein im Hals waren dem Fohlenhengst entzündlich angeschwollen, und das mochte nicht geschwunden sein; der Reitbursch hat geschluckt und gedruckt und nicht mit der Rede herausgewollt, die unliebsame Nachricht nicht büßen zu müssen.
Der Ebner stand auf, schritt eine Weile klirrend hin und wieder. Wenn die klare Raute von Murano nicht oben in der Fensterspitze gesessen hätte! Einen Blick gegen den Markt schräg über und etliche Häuser niederwärts hätte er doch gerne verstohlen getan. – Die von den Ilgen! Und wenn sie erst noch eines Handels wegen kamen! Sie mußten längst die bereiten Pferde stehen sehen, vielleicht war der alte Vetter just deshalb so unbemüht, weil er die Pferde sah. Der Ebner warf das Buch in die Lade. Es war in rotes Juchten gebunden und enthielt nur die verschwiegenen Zahlen, die jahraus, jahrein das Handelsgeschick seines Lebens begleiteten: das Rotbuch. Er hatte noch ein schwarzes und ein weißes.
Uber die Kreidezahlen des Rechentisches wischte er einmal mit der Hand hin und klatschte dann die Kreide an der anderen Handfläche ab. Es sollte nicht scheinen, als wäre etwas zur Schau gehalten. Und er griff mehr zum Zeitvertreib nach der Goldwaage und dem Gewichtsatz, zog den kleinsten, schwersten Beutel heran, knüpfte ihn auf: Goldfloren. Er ließ die Lilie eines Stückes im Lichte funkeln, und dann den Täufer Johannes, das Gegengepräge. Er stieß den runden Beutel ein wenig an, und die gelben Schuppen flössen auf den dunklen Stein. Da hörte er die Stimme des Vetters unter dem Fenster. Er raffte die Münzen zurück, knüpfte zu und warf die drei Säcklein in die Eisentruhe. Die beiden Truhenschlösser knackten straff, und die Schlüssel konnten gerade noch in die Wandlade poltern, als das Haustor wieder zufiel. Die ganze augenfällige Zurichtung wäre ihm doch zu dick gewesen. Er faßte auch den Wischhader und fuhr noch einmal mit ihm über den Stein weg.
Hans, der Vetter, trug sich ein wenig steifer, fast gebrechlicher, als es Alter und Kräften nach hätte sein müssen. Ein langer, schmaler Mann, den weißgemengten Spitzbart auf französische Art gestutzt, aber die Kleidung schlicht und gediegen.
Der Ebner rief über den Tisch hin, während er den Lappen fortwarf:
„Willkommen, der Vetter! Gott helf Uch!“
Der Vetter flüsterte kaum vernehmlich:
„Dien adjut, Ebner! Sänt die zween Roß vor uns? Ihr goht scharf zue, hänt fröidig Pferd, ich aber hab ein’ ziehnden Fluß im rechten Schenkel.“
„Der Üer ist ein Zelter fast, so sanft, hat ein burgundisch Bluet, als Üch wohl gefällt, do möchtint Ihr gewieget sin unter dem Ritt und der züchenden Flüß nit meh denken.“
Sie umarmten einander. Der Ebner war breiten Ganges, lachend und mit offenen Armen auf den Vetter zugegangen.
„Wir wollen uf den Söller: ein’ Trunk, eh dann wir reiten!“
„Grand merci, ein’ Schluck will ich tuen und uf dem Söller, Uer Husfrou griießen.“
Unter der Tür blieb er und deutete auf die Rückwand.
„Safren …?“
Der Ebner nickte beiläufig.
„Vor zween Tägen … vor dies Jahr das letzt … us Apulja.“
„Der heilig Florian wahr Üer Dach, Ebner. Es kam einer witumb und find’t nit derglichen.“
Anerkennung also. Heinrich, der Ebner, gewann Haltung und Maß, blähte die Brust kaum und meinte nur:
„Gott mügs hüeten, halt’ ze Dank! Das goht mit dem Lenz uf Köln. Ist alls min.“
Sie stiegen drei Stufen in den Stapelgaden nieder. Hans, der Vetter, sah langsam schreitend um sich und tat auch diesem ordentlich und dicht gelegten Gute merkliche Ehre an. So mochte der Ebner eine Ahnung gewinnen, wenn er sie nicht an dem vorzeitigen Roßhandel schon gewonnen hatte. Natürlich kannte der Vetter die Waren an der Packung, zuweilen auch am Zeichen, obwohl er nur mit Salz handelte, aber er fragte da und dort des würdigenden Aufenthaltes wegen und ließ seine Zufriedenheit so freimütig merken, daß der Ebner die Deftigkeit nicht mit vollen Backen auszublasen brauchte und, je eingehender er gefragt wurde, desto kürzer und fast bescheiden werden konnte. Er hätte gute Gelegenheit gehabt, dem anderen eins aufzumutzen.
Sie nahmen die schmale Holzstiege zum Söller, der sich durch die ganze Tiefe des Hauses streckte, gegen den Markt und das Höfchen durch verglaste Fenster belichtet. Vier niedrige Eichentüren waren gleich Nischen von dem Ladengerüste umbaut. Hier konnte der Ebner die Linnenvorhänge mit einem gewissen Schwung zurückwerfen, ohne bei seinem Gast Widerwillen befürchten zu müssen. Auch dem Ebner kamen die kostbaren Namen gern über die Lippen: Friset, Maramat, Ormasin, Camocat – er nannte schon nur mehr das, was schimmernd in die Augen stach. Der Ilgen-Vetter fand sein aufrichtiges Wohlgefallen nicht nur an dem kostbaren Vorrat, auch bei dem anderen Aufwand. Er wußte, daß sich der Ebner vor dem burgundischen Gehaben des Matthies nicht allzu erbaut anstellte, der wallische Schwall seiner Waren aber schien dem Ebner doch zu gefallen. So hatten die beiden Kaufleute Vergnügen aneinander, und das mochte nicht nur den Roßhandel leichter gestalten.
Sie traten ein. Frau Agnes, die Ilsungin aus Augsburg, den Vettern seit uralter Zeit befreundet, saß bei der Wiege, und auch sie hatte Seide angetan. Sie erhob sich, neigte den Scheitel und legte die Hände unter dem Gürtel zusammen, während der Vetter in entgegenkommender Eile seinen Mantel ablegte, den Hut zog und auf den Mantel warf. Als er den Dolch abgürten wollte, wurde er vom Ebner höflich behindert. Sie möchten ja doch nicht lange weilen. Der Vetter schritt durch das Zimmer auf die verharrende Hausfrau zu.
„Gott helf Üch, Ilsungin.“
„Danks Üch Gott und vergelts, Vetter von der Ilgen. Üer Husfrou …?“
„Grand merci, die hät mir gseit, daß sie Üch uf diesen Morgen bi denen Frouen ze Sant Ursel in der Kapellen angetroffen.“
Frau Agnes hob jetzt erst kurz den Blick und nickte lächelnd. Sie raffte anmutig den Rocksaum und schritt langsam an den Tisch, wo bei einem Krug und zwei Silberbechern eine Schale mit kandierten Früchten, Rosinen, Mandeln und etwas Lebkuchen stand. Sie schenkte ein und trat bescheiden zurück, wies einladend mit kaum bewegter Hand auf das Kredenzte. Die beiden Männer waren in Zurückhaltung ihrer Sorgfalt gefolgt. Hans, der Vetter, trat rasch an den Tisch, hob einen Becher und trank der Hausfrau zu, die ihm mit einem Blick dankte und dann ihren Platz vor der Wiege aufsuchte, wo sie, als seien die Männer nicht mehr zugegen, ihre Nadelarbeit nahm.
Die beiden Kaufleute fühlten sich geziemend entlassen. Sie standen mit dem Rücken gegen die Frau, tranken langsam und langten einen Bissen von der Schale. Sie sprachen, um die Aufmerksamkeit der Frau nicht zu befassen, von Dingen des öffentlichen Lebens: Das Rathaus werde mit dem Abbruchstein der Burg aufgebaut, was der König selbst geraten habe, und so sei gut, denn man wisse nicht, und es könne der Baier doch wieder Gewalt gewinnen. Er nehme sich wohlgeneigt an, der Herr Albrecht, sehr geneigt bis in alle Winkelsorgen, und es möchte ihnen, den Reichsstädtern, nunmehr vortrefflich anstehen, sich im Innersten der Stadt umzutun, da Werde, der Reichskammerstadt, außenthalb gerade noch der Forst und der Galgenberg und der Ziegelstadel gelassen worden sei. Auf allem anderen sitze der Reichspfleger, der Nachbar des Ebner zu Mertingen, und das andere sei nicht gering gewesen: Rüedlingen, Asbach, Bäumenheim, Auchseßheim, Nordheim, von Mertingen zu schweigen und von den Greisbacher und Höchstätter Gelegenheiten. Dafür hätten sie eine reichsstädtische Polizeiordnung bekommen, und der von Trugenhoven solle Zusehen, wie er seinen ausgeschatzten „Stein“ wieder vollkriege, denn Rathaus bauen und Mauern ausweiten, das Kreuzkloster einziehen, sei gut und schaffe Arbeit ins Volk. Und Baustein habe die Burg gnug, und es sei dann gar und aus mit dem verrufnen Nest.
„Vetus rumbula, als der alt Reinward die Bürg heißt“, meinte der Vetter.
„Es tuont an vier oder sechs Kellen not vor das Rathous, die Kellen ze vier und fünf Murern, darzuo die Pfleglüt unde die Zimmerlüt, und so einer von denen Murern mit sechszehen oder zwenzig guet Haller uf die Woch usglöhnt wird, und das sänt nur die gringen ohnangesehen der Meister – darzuo das Müesli, Fleisch, Brot – do sollt der Trugenhoven zuosehn, und wir wöllent etlich Stüer gewärtigen.“
Der Vetter lächelte.
„Wir hänt ze Scheffstall“, fügte der Ebner bei, „vor des Meigers Hus bi Wochener sechs im Frühejahr fünf Kellen g’hät, die hänt alleinig Bier fünf Tonnen zwungen unter der hützigen Arbeit, das gibt zween Mark und etlich.“
Der Vetter nahm den Wink auf: „Scheffstall, als Ihr seit, wir wöllent uns zuo schicken.“
Er legte den Mantel um, ergriff den Hut.
Die beiden Männer wandten sich noch einmal gegen die Hausfrau, die sich zum Gruß erhoben hatte.
Der Ritt war in einem halben Stündlein getan. Sie sprachen nicht viel, der Junge ritt dicht hinterdrein, und der Vetter wurde von seinem Gaul doch merklich gewiegt, er mußte die Zähne zusammenbeißen und kam in Hitze. Der Ebner aber, des Sattels froh, ließ hie und da sein Pferd tanzen, auch um dem Vetter zu zeigen. Und sonst war er mit den Gedanken anders voraus. Der Schemming lag ihm an. Im übrigen sollte der Vetter in Ruhe überschlagen, was er gesehen hatte, und sich dessen bereithalten, was ihm noch gezeigt werde, und seinen Fürspruch überdenken. Die Ebner waren wohl im Stand, und sie hätten auch anders wohin langen können. Die Sonne schien gut und warm, sie stimmte die beiden, trotz mancherlei Gedanken.
Auf dem Roßhof wies der Ebner den Kaufgast an seinen ältesten Knecht. Er solle Stall und Gehege, ungetrieben und von keiner Höfischkeit beengt, besehen. Doch nannte er vorsorglich zwei Vierjährige, die liefen tüchtig im Geschirre, beide dänischen Schlags, wie die meisten seines Hofes. Er selbst nahm den Roßmeier mit sich zu dem kranken Hengstfohlen.
Abgetrennt von den anderen, in einem dunklen Winkel stand der rote Schemming. Er hielt das Maul hoch und offen, die Nüstern gebläht. Unter den Kinnbacken war die Geschwulst zu sehen. Hohl ging ihm der Atem und schwer. Er war abgefallen, nahm seit Tagen nicht Trank noch Nahrung. Schaum hing an den matten Lefzen. Dem Ebner wurde bang um das Tier, er ließ es ins Freie führen.
„Sin Zung ist vollgeloffen und schworz. Meiger, das Gschwürig muoß zitig sin. Host ihme den Salniter unter das Mehl ton und Honig?“
„Er widert alls.“
„Er ist fast geschwächet und hützig im Bluet, allein es muoß sin, und wir müessent ihme die Gmeinadern lossen, und das glich; die Zit ist guet. Du sollst es zuorichten, ich gang derwilen zuo der Silberstuoten. Hot sies guet gnommen an?“
„Guet, Herr, es sougt guet unde ist fröidig.“
„Die Bürtel ist ihr guet abgangen und kein Zeichen an ihr?“
„Alls guet, Herr.“
„Und bring als ouch ein Wein und Salniter mit dem Laßzüg, wir wöllent an dem Schemming ein Houptpurgaz tuon, so wir ihm die Ader glossen.“
Die Silberstute schnoberte ihn freundlich an, sie kannte ihn. Er gab ihr den Brotranft, der ihm vom Stallburschen gereicht worden war. Das Fohlen, zwei Tage alt, stand, hoch und kräftig gestelzt, neben dem Muttertier, zeigte wache Lichter und ließ die Ohren spielen. Friedvoll kauend sah die Stute zu ihm nieder, und als der Bissen genossen war, stieß sie dem Fohlen mit dem Maul zart in die zotttigen, braunen Weichen, und das Junge bog den Hals, reckte die Lefzen an und fand seinen Quell.
Der Ebner sah es ruhenden Blickes. Als wollten sie seine Sorge nehmen und ihn bedeuten, daß alles Leben in guten Kräften stand auf dem Roßhof! Eine kurze Weile überkam es den Mann, als stünde die Stute und das saugende Fohlen, nicht anders als die Hausfrau und das Büeble daheim an seiner Frauen Brust, in einer anderen Welt, die nicht dem Angriff des Alltags offen lag. Gott hat das Junge bei Tier und Mensch noch nicht aus seinem Frieden entlassen, und die Mutter ist von dem Kinde in den Herrgottsfrieden aufgenommen. Davor steht der Mann fremd, hat in Tag und Nacht den Umtrieb, wird durch die Menschheit gehetzt, und er steht, schaut auf die säugende Mutter, als sehe er in ein hohes Schneegebirge oder über das Meer … und ist als ein sanftes Hauchen im Gemüt, da einer die frierenden Händ wärmt, und daß er auch einsteils den Frieden finde. Schemming! Er ging langsam zurück und fand den Meier mit dem Laßzeug bereit.
Sie schnürten den Hals des Hengstfohlens eine Spanne unter der Kehle mit einem Strick, und der Ebner, der den Wams abgeworfen und einen Schurz umgebunden hatte, tastete zu der Ader hin; die schwoll durch die Schnur auf. Er verschob die Haut über der Ader, so weit es ging, und drückte sie ein, daß sich die Ader prall füllte, dann schlug er sie und ließ sie kräftig ausbluten; es sollte die üble Feuchte auslaufen und nicht mehr das Geschwürig nähren.
Der Meier hielt den Schemming beim Maul, und die Roßbuben stemmten sich zu beiden Seiten an das Tier, dessen Flanken stürmten, sie hielten den fieberheißen Leib mit einem Gurt, der sich um die breite drängende Brust spannte. Als die Ader ausgeblutet hatte, wurde die Drossel gelöst. Die Haut glitt zurück, der Meier reichte die Laßbinde, und der Herr verband die kleine Wunde selbst.
„Nu geruhiget ihn, daß er die Purgaz annehm. Etwan löset sich das Gschwürig unter der Purgaz, dann ich min, es müeßet ufgohn. Die Zungen ist ihme schümig und hanget us, und schmerzent ihm die Drüslein, als man sicht, und sänt hart als ein Stein.“
Er mischte, während er so redete, selbst den Salniter unter den Wein, füllte die Schweinsblase damit und band ein Holunderröhrchen in die Blase. Im Eifer merkte er nicht, daß Hans, der Vetter, von weitem stand und ihn beobachtete.
Der Schemming wurde zugeführt. Sie banden ihm die Vorderhand ober den Fesseln, daß er nicht ausbreche, und legten ihm einen Strang ins Maul, den Kopf hoch und zurück zu zwingen. Da standen die geblähten Nüstern wie Trichter aufwärts. Drei Männer hatten zu tun. Das Tier war kaum zu halten. Und der Ebner spritzte die volle Schweinsblase, so schnell er konnte, in die Nüstern.
Als sie den Halfterstrang fahren ließen, stieg das Hengstfohlen atemringend hoch, brach, aus der Steile sinkend, trotz seinen Fesseln in die Knie, streckte den Hals hustend und keuchend vor. Da flössen ihm Blut und Eiter von den Lefzen.
Und der Ebner schüttelte den Meier beim Arm.
„Als ich gseit hab … Meiger … is guet … is guet! Meiger, nu wird er fri, und das Lüngel zücht den kalten Luft in und kühlet sin Herzbluet, dann das Bluet ist erhützet von dem, daß sin Lüngel nit kunnt den kühlen Luft inziehen, do die Drüslein den Luft hänt erhützet uf dem Weg zuo sinem Herzen.“
Er war vor Freude rot und konnte sich kaum genug tun an kennerischer Betrachtung der Krankheit und seiner Kur. Man entfesselte das Fohlen und führte es, das matt ging und keuchte, vor den Herrn.
„Du sollt die Drüslein nachreifen lan, Meiger, daß sie nit ze gach abfallen und der bösen Flüß etlich verhalten dorinne. Die Flüß allgemach ustreten lan! Koch ihme ein Kölchkrout, an dem Tag zweenmal, und binds ein und legs über, als warm als du es halten künntst andinerWang. Und gib ihm Gerschtmehl mit Honig dorinne, als ouch Gerschtwasser unde Honig, dann der Honig heilet und zücht. Und Salniter drein, als du künntst zwüschen dinen Fingeren halten über den Eimer. Dann nu wird er uf nehmen, das solltu sehn, Meiger!“
Sie umhüllten den Hals des Tieres, das zitternd stand, feucht vom Schweiß, aber es hielt seinen Kopf nicht mehr so steif, es bog den Hals wieder ab. Der wildeste Schmerz mußte ihm gelöst sein.
Ein wenig befangen kam Hans, der Vetter, hinzu, als der Ebner seine Hände in einem Schaff wusch. Man wußte, daß der Ebner Dinge tat, die aus der Reihe fielen; es war nichts nach der Gewohnheit um ihn, man mochte sich vorsehen. Aber der Ebner nahm seine Heilkunst weiter nicht großartig:
„Es ist min Lust bi denen Kavalien“, antwortete er auf eine erstaunte Äußerung. „Und ich hab suster Sorg gnuog.“
Er trocknete seine Hände am Schurz des Meiers.
„Schaff uns ein’ Imbiß.“ Er zeigte auf den Meierhof.
Und während er sich den seidenen Steppwams zunestelte und spreizbeinig auf seinem guten Boden stand, zwinkerte er dem Gast zu:
„Habet Ihr gsehen, Vetter von der Ilgen?“
„Der Brun ist guet.“
„Der Brun – guet? Derselb ist baß dann guet, der ist ein Kast’lan und sollt im Schellenzuig unter eim Ritter gohn. Allein er hat sich demüetiglich ins Gschirr geschicket und loßt sin Herrn die ehrsam Kouffahrtei nit entgelten.“
„Der Brun ist kein Klepper nit“, gab der Vetter lächelnd zu, „vor ein’ Rittermäßigen ist sin Rucken ze kurz, der müeßt ein harter Gang han unter dem Sattel.“
„Der Rucken kurz, dasselb war nit letz vor ein Roß im Zuog“, meinte der Ebner.
Sie schritten langsam gegen den Meierhof, wohin der Meier vorausgeeilt war, und blieben unterweilen stehen. Betrachtungen über die wechselnden Pferdepreise ließ der Vetter einspielen, der Ebner aber wußte zu berichtigen, daß rittermäßige Hengste auch dieser Täg an die hundert und mehr Gulden Wert seien. Er war fröhlich, daß er es an dem Schemming getroffen hatte, also kitzelte er den Vetter in freundlichem Übermut. Und der Vetter merkte die spielende Laune eines Mannes auf gutem Grund und Boden. Er wollte es kurz machen, ehe ihn selbst ein Unwille ankäme, und nannte eine runde Summe, die zeigen mochte, was die von der Ilgen leichterhand hingeben konnten, wenn sich etwas ins Haus schicke. Dabei wurde der Ebner ernst. Er sah dem an zehn Jahre Älteren klar in die Augen.
„Es soll sin als unter Brüederen, Vetter von der Ilgen.“
Er unterbot das Angebot um ein beträchtliches. So konnte der Vetter merken, er werde mit allem anderen willkommen sein. Sie drückten einander die Hand.
Noch rückte die Meierin an der Zurüstung des Tisches, und ihr Mann stellte einen stattlichen Krug auf. Die beiden Kaufleute legten ab, traten heran. Und da die Meierin nicht abließ, voll Eifer an dem Zwillich zu zupfen, den sie quer über den Tisch gebreitet hatte, schlug ihr der Ebner mit der flachen Hand aufmunternd auf ihre strammste Rundung, daß alle drei Männer auflachten und die junge Frau errötend zurückfuhr, ihnen einen Knicks zu machen.
„Nu gang, Meigerin! Guet ists zuegricht, Meiger. Und es soll uns gsegnet sin.“ Er wies den Vetter auf die polsterbelegte Bank und wendete sich nochmals dem Weibe zu: „Was tuets Büeble, Meigerin? Der min’ ist wohluf.“
„Bhüet ihn Gott, Herr, und min’ als ouch. Der ist im Zahnen.“
„Muoßt ihme mit Hennerschmalz inreiben. Ich will ihme etlich Süeßholzstengle schicken, der Roßbue sollt midi anreden drumb ze Werde.“
„Vergelts Gott, Herr.“
Sie aßen zunächst schweigend und wußten die kräftigen Dinge zu würdigen. Dann lobte der Vetter den Roßhof und das Gut Scheffstall. Er meinte, daß es zusammengehalten werden müsse.
„Ze miner Lebzit wohl“, gab der Ebner zu. Aber er glaube, daß sein Gestüt das Jahr über gute Gulden barer Münze brächte, wenn auch das Gut selbst fast ganz an die Erhaltung des Gestüts gewendet werden müsse. Natürlich würfen die Gilten auch ins Hauswesen nach Werde ab, was not tat: etliche Malter Korn, etliche Quart öl, Gefiedertes für Fastnacht und zur Herbstzeit, Eier, Butterschmalz, Kohl und Rüben. Was aber aus dem Roßhof zufiel, das konnte immerhin geteilt und es konnte ein Erbe für die Zeit des Absterbens verbrieft werden.
„Gott geb Uch allzit sin Gnad, und der heilig Jörg schütz den Roßhof vor Sucht und üblen Flüessen, so, sich usbreitent, ein Gstüt verzehren.“
„Sant Jörg b’hüet, Vetter! Allein wir sänt all in des Herrgotts Händ, und Üer Salz kunnt als ouch darneben fahren und ungewarneter Sach ein’ andern Ort finden, als Ihr meinet, do Ihr es geladen. Ein Vierteil Scheffstall, das ist ein gueter Brocken. Darzuo an fahrend Guet ein Broutlohn, daß sich keine Ebnerin müeßet schämen.“
Damit war von dem jüngeren Mann das Gespräch auf den Kern gebracht, dem Vetter von der Ilgen zu rasch und zu hart. Er fühlte sich genötigt, wo er in aller Stille Vordringen sollte, denn er wußte noch nicht, was das Vierteil abwerfen konnte.
„Der Matthies ist an der Zit unde hat den Füereimer ufs Füerhus ton sider Jahren vier, ist als ein Bürger ze Werde. Der will sin eignen Rouch schmecken und soll hintan der Ilgen in das Hus uf die Bäckengaß zuo. Hat er sin Husstand, als teil ich den Handel mit ihme. Do sitzet sin Ehfrou in ein gueten Stand und sollt uf ihr Morgengab und Wittum sehen in Fröiden und ohnbekümmeret.“
„Dies ist wohl gesprochen, Vetter von der Ilgen, und do kunnt eins getrost’ sin. Allein, es ist guet vor all Zuofäll, so das Wittum als ouch gebriefet sije, nit anders dann das Erb von miner Sit.“
„Das kunnt b’schechen, Ebner, und soll gemessen sin glich dem Erbguet und nit geringer.“
Der Ebner lachte, denn nun saß er in der Zwickmühle. Aber er war am Zug.
„Wohl gesprochen desglichen, Vetter. Allein, Ihr hänt gsehn und wissent, woruf das Erb ist gründ’t, do ist alls unverborgen, als Ihr gsehn hänt.“
Auch der Vetter lächelte.
„Als Ihr wisset, Ebner, ich han uf dem Markt fufzehen Brotbänk und der Fleischbänk acht. Die werfent Zins und künnten unter Brüederen bi sechshundert Pfund gelten, so einer sie wellt koufen. Allein ich die Bänk will halten. Darus künnt ein guet und gewiß Wittum beschaffen sin vor die jung Husfrou, und Ihr und ich itweder stürend ze glichen Teilen zuo: Ihr us dem Erbguet und ich us deme Wittum.“
So wuchsen die Hände der beiden zum anderen Mal ineinander, und es blieb nur zu beraten, wann sie die beiden Jungen zusammentun wollten, und wie der Brautlauf sollte bestellt sein, denn die reichsstädtische Polizeiordnung hatte das Fest bis zur Kümmerlichkeit beschnitten: die Bürger zu Werde sollten sparen, daß man desto voller greifen könne, wenn es nottat.
***
„Vor diner Seelen sing, o Mensch, als ein Nachtigall. Do das Ei ist geleget in das Nest, setzet sich der Vater darvor und singet lieblich, hält nit an, bis dem Eie das Jung ist usgeschloffen. Also din Seel, Mensche: die leit im Gfangnis einer Schalen, das ist die Welt. Do solltu singent vor gar lieblichen ohn Unterlaß zuo Gott und den Heiligen. Als schlüpfet din Seel us der Schalen dieser Welt.“
Margretlein lächelt und hebt die hellen Augen. Rings um sie, dicht gedrängt sitzen und stehen die Leute dieser Predigt. Aus ihnen geht ein Lauschen auf wie eine leise, erglühende Bewegung. Denn jeder ist von der Lieblichkeit der Erinnerung ergriffen. Schön ist es, die Nachtigall am Burgweiher in den Büschen oder an der Donaulände unter den Lederern zu hören. Bald sollen die Tage erwärmen und die Nächte lau werden. Dann schlägt die Nachtigall um Werde, die Stadt. Margarete hat nur nicht gewußt, warum sie so voll und zwingend singt, daß einem bang werden kann für das Fiederbrüstlein. Sie weiß nun: das Ei liegt im Nest, und das Nachtigallenhähnchen singt dem Jungen Kraft zu, daß es schlüpfe.
Auf der Kanzel steht der Mann mit dem blassen Gesicht, das für alle da ist und sich doch zu keinem neigt, das groß aus sich heraus spricht und weit hinaussieht, als spräche und blicke es durch alle hindurch und über alle hinweg wie das Gesicht eines Altarheiligen. Auch die Agnes-Mutter hat ihren Kopf gehoben, sie sieht hinauf und lächelt ein wenig.
„Und tu uf dine Seelen, Mensche! Sie ist ein Jungfrou, lieblich in sich geneiget und heiß, die harret des Bröitigams. Du sollt öffnen din Seel als die Brout, so dem Bröitigam uftuet die Rosen ihres Leibes mit Lust und Fröiden. Also tue dich uf, dann siehe, der Bröitigam stehet vor der Tür …“
Es ist der vierte Sonntag in den Fasten. Dann bleiben nur mehr drei bis auf den Weißen Sonntag, und darnach ist der Alheid und dem Matthies die Handreichung gesetzt und die Lautmehrung im Haus, weil das Rathaus schon abgerissen wird und kein Saal sonst zu finden ist. Da kommt die Stunde der Alheid, und sie muß auftun die Rose ihres Leibes. Margarete hört den Klang der dunklen, tragenden Stimme von der Kanzel, aber sie vernimmt die Worte nicht mehr. In ihr hallt es nach, immer wieder dasselbe, und läßt sie nicht los. Es ist wie ein Spruch der alten Ann, der wischt auch alle anderen Worte aus. Sie blickt zur Mutter auf, die neben ihr im Gestühl der Ratsverwandten sitzt. Untergetaucht sind sie beide unter all den Leuten, die dicht gedrängt vor ihnen und neben dem Gestühl stehen.
Das Gesicht der Mutter verrät nichts, es ist gleichmütig in seiner frommen Hingabe an den Prediger. Die Mutter nimmt das seltsame Wort hin, als halle es durch den Alltag Gottes. Und der blasse, schöne Bruder Lambert, dem alle zulaufen, wo er predigt, hat davon gesprochen, daß sich die Rose des Leibes dem Bräutigam auftut in Lust und Freuden.
Es muß an der Agnes-Mutter geschehen sein, auch sie hat die hochzeitliche Lautmehrung gehabt und ist vom Turm angeblasen worden, auch sie hat den Machelring unter der Kirchtür empfangen und hat das Beilager gehalten. Der Vater war jung und ein Bräutigam, die Mutter hat auftan die Rose ihres Leibes. Warum hat die Agnes-Mutter nicht das Gesicht gehoben, wie bei dem Worte von der Nachtigall? Und warum nicht die anderen ringsum? Es ist an ihnen vorbeigegangen, als wäre es nichts.
Margarete möchte nach der Alheid umsehen, die ist zu spät gekommen und sitzt hinter ihnen im Stuhl. Aber sie rührt sich nicht. Wenn er nicht spräche da oben aus seinem großen Antlitz, sie würde die Mutter fragen. Hier in der Kirche könnte sie. Margarete weiß, daß sie es draußen nicht wird tun können.
Da bricht es schwer hernieder auf sie: „Das ist die Höll gsi üres Fleisches, so Ihr habet gebüeßet, dann üer Leib ist die Flammen der Höll und des Tüfels Kalfakter, daran er sine Händ wärmet, so ihn frieren im Angesichte Gottes des Herrn. Das sänt die heiligen vierzig Täg gsi. do wir fasten und wir den Zehent bringen in die Scheun Gottes durch Abbruch unsers höllischen Leibs vor diese Zit unsers Lebens …“
Margarete stutzt in sich hinein und wagt kaum zu atmen, als sei sie auf losen Wegen ereilt worden. Kühl haucht es ihr über den Rücken. Leib und Fleisch – die Flamme der Hölle! Und doch – die Rose, die sich dem Bräutigam auftut. Wo ist der Schlüssel zu der Kammer dieses Geheimnisses? Sie spürt eine mächtige Verborgenheit, die unter diesen Worten pocht wie Herzschlag, und heimlich zieht sie den Handschuh von der Rechten und fühlt an ihre Wange, die frisch ist und sanft. Der Kalfakter, der in des Vaters Rechenstuben eingefahren wird, der glüht, daß man sich kaum nahen kann. – Der Bruder Lambert hat aus einer Ferne gesprochen, die alle anderen rings um sie schon überholt haben müssen, denn niemand ist erstaunt, und kein Blick sucht und fragt; alle wissen um die Höllenglut des Leibes und um sein Rosenblühen. Nur eines ist sicher: daheim die Alheid und der Matthies, die tragen das Geheimnis wie ein brennendes Licht in der Luzerne. Das muß den anderen ausgebrannt sein, auch der Agnes-Mutter, sonst säße sie nicht so gleichmütig neben ihr. Margarete fühlt, fröstelnd, befremdend, daß etwas zwischen ihr und der Mutter liegt, weit und anders. Das Wort aus dem großen Antlitz da oben hat es ihr offenbart. Sie hört nun, als schwinge es um sie, gleich den hangenden dünnen Ästen einer Birke im Winde:
„O starker Gott,
All unser Not
Befehln wir, Herre, in din Gebot,
Laß uns den Tag in Gnaden oberschinen!
Die Namen dri,
Die stöhnt uns bi
In aller Not und wo es si.
Hilf uns, Herre, mit allen Schmerzen dinen!
Also schreiten wir us denen Fasten in die Zit der Heilung, do ist unser Herr gstorben den Marteltod für unser Sünd, daß uns Gott genade! Amen.“
Noch unter dem verhallenden Amen sinkt der Bruder Lambert am Kanzelbord nieder. Er legt seinen Kopf auf die gefalteten Fäuste, so daß die bleiche Glatze zu sehen ist. Kaum ist aber sein Wort entschwunden, scharren die Füße über dem Ziegelpflaster und aus der Kirche. Sie beide müssen verharren, denn es ist zuviel Volks, und das Gedränge staut sich am Tor. Da rutscht die Agnes-Mutter auf die Knie, und neben ihr die Trugenhovin, und sie stützen gleich ihm die Stirn auf die gefalteten Hände. Margret sieht hinauf. Die Glatze ist kreisrund ausgeschnitten, und das hellblonde Haar umgibt sie wie ein scheinender Kranz.
Der Bruder Lambert kennt sie und die Mutter gut, er kommt zuweilen in das Haus. So wirken alle seine Worte doppelt nah und doppelt tief. Der Bruder hat eine weiche Hand, und ob er auch nur leise tut, ihre Berührung dringt ein wie seine Worte. Ihn möchte sie fragen, er müßte das Geheime aufschließen können, ohne daß eine Furcht dabei bliebe. Aber wie soll sie ihre Stimme zu ihm heben, wo die Stimme der Mutter schwebend wird und wie ein Wasser im Schaffe zittert, wenn sie zu ihm spricht! Sie sieht hinauf und denkt, wenn sie ihm leise an die kreisrunde Glatze regen dürfte, so leicht, wie er ihr zum Gruße die Hand aufzulegen pflegt, vielleicht merkte er es dann und spräche von selbst.
Da wird das schlurfende Geschiebe unter der Kanzel und um den Ratsstuhl locker. Die alteTrugenhovin wächst schwerfällig in die Höhe und stößt des Ebners Ehfrau an, aus der Andacht zurückzufinden. Denn auch der Bruder Lambert hat sich erhoben. Er prüft die weichende Gemeinde ruhig schweifenden Augs unter gesenkten Lidern. Die Agnes-Mutter reckt den Kopf, ihr erster Blick gilt der Kanzel, und sie versteht den Wink der Trugenhovin. Der Bruder Lambert scheint die beiden verharrenden Frauen nicht bemerkt zu haben, aber er steigt langsam, fast zögernd die enge Holztreppe hinab. Margarete spürt, daß er eingeholt werden soll, ihr Herz klopft erwartungsvoll. Die alte Trugenhovin ist voran, und die Agnes-Mutter faßt ein wenig heftig und ungewohnt ihre Hand. Sonst wird sie nicht geführt.
Dann stehen sie vor dem Kaisheimer Bruder. Er winkt den beiden Frauen in die Kapellennische der Sankt Afra und spricht dann mit leiser Stimme hernieder. „Soll üch sin gseit, Frouen, der Meister ist us Paris kommen und ist dieser Täg ze Basel gsi. Er goht uf Rom. Do hät er ze Basel geprediget uf dem Wege unde gseit: Gott machet uns also selber für sich, daß wir ihn bekennen.“
Die beiden Frauen sehen auf, und Bruder Lambert läßt seine Augen von einer zur anderen gehen, er nickt ernst und wartet. Die alte Trugenhovin runzelt die Stirn und will schon ansetzen. Sie geht den Dingen sofort auf den Grund und läßt sich durchaus nicht verblüffen. Die Agnes-Mutter aber ist gläubig und bereit, auch unvermögenden Geistes hinzunehmen. Darum wendet sich der Bruder, der Trugenhovin leise wehrend, zu ihr:
„Do will der Meister sagen: All ünser Bekanntnus zuo Gott dem Herrn sige von ihme selbst ingeschaffen in uns. Und folget der Meister us deme: Gott ist in siner Substantie unde Nature unde Wesen sin eigen Bekennen, und do er uns sin Bekennen hat geschaffen in, als bin ich einsglichen sin Wesen, Substantie unde Nature, unde er ist das min.“
Da atmet die Agnes-Mutter tief. Die Trugenhovin aber blickt sie von der Seite an, als meine sie, man sei noch nicht am Ort und wisse längst nicht aus und ein.
„Höret, Frouen, und haltet dies Wort und tragets us. Dann wir können vor dieser Osterzit nicht zesammen sin, und es möchti uf Pfingsten zuogohn mit ünserer Samenunge. Ich mueß uf Friburg. Sagets der Ann, der Münzmeisterin, was der Meister hät gseit ze Basel, und der Frou Kathrin, der Scheppachin ze Hochstätt, der Mechthild, des Scharnstätten Wib, und dem Konz ze Bissingen. Die sullen sich dies Wort bedenken des Meisters: Ich bin sin Wesen, Substantie unde Nature, unde er ist das min.“
Die Trugenhovin murrt es unter gesenkter, widerstrebender Stirne nach. Die Agnes-Mutter aber hat die Augen geschlossen, nur ihre Lippen beben leise. Der Bruder flüstert mit verhaltener Stimme:
„Der Meister hät also gesprochen, und es treibt mich umb! Do mueß ich predigen, und alls Volk willt ein Predigt sim Verstand nach, daß es sie wahrnehme in der kurzen Wil des gesprochen Worts … und des Meisters Red leit mir hart uf und brennet in dem Gmüet, dann es machet den Tüfel und alls ze nichte, was do Sünd ist unde Boshet ist. Dann so ich bin us Gott, und Gotte ist min eigen, do wird der Tüfel in mir und an mir ze nichte. O Frouen, bedenket dies wohl, darvor ich nit kann Schlaufen.“
Das will der Trugenhovin besser eingehen, sie denkt, wenn der Teufel nichts ist, dann ist aller Predigt ein End, und die Gmein fährt auseinander wie eine Schafherd, darein der Donner schlägt. Denn der Teufel ist ein peinlicher Herr und hält die Gmein in der Furcht wie der Hund die Herde. Sie sagt also sehr bestimmt: „So wir dies umbreden sulln, als müessen wir unser Samenunge ehender han dann uf Pfingsten. Ihr sullt ehender her, Bruder Lambert. Dann sie wöllent all gewiesen sin, es ist ein Unduld in ihnen allen, und alles Land ist in Arbeit.“
Der Bruder sieht sie an und bestätigt: „Es ist ein Unmuet und Unduld in Menschen dütscher Zung, Trugenhovin. Und schwärment als die Immen. Aber wisset ihr – etwan hat Gott den Unmuet gsatzt, daß ein nüe Welt Höffens und Glaubens ufgang us dem Grund der Herzen.“
Seine Augen schweifen vor den Blicken der Frauen zur Seite und senken sich gedankenschwer. Da treffen sie die hellen, braunen Lichter des Kindes Margarete. Er lächelt, hebt die Hand und legt sie weich auf den unverhüllten blonden Scheitel. Darauf hat Margarete gewartet. Es durchschauert sie, und ihre Augen schieiern, so offen sie stehen, sie sinken in die beiden dunklen Borne, die ihre Kraft entgegengießen. Des Kindes Gesicht nimmt einen Ausdruck an, als schwebe es über dem Boden und wachse ihm entgegen. Das befängt den Mann, der viel in Frauenaugen blickt und viel um Frauenherzen weiß. Er reißt sich los und streicht, schon abgewendet, über die Wange des Kindes.
„Es ist Üer Margretle, Ilsungin? Ich hab das Maidle so göttlich zuotan ninder gsehn.“
„Sie ist angelobet sider eim Jahr.“
Da ändert sich sein Ausdruck. Er lispelt mit gespitzten Lippen: „Oblata, candidissima, filia …“ und setzt hinzu:
„Haec est fides orthodoxa, non hic error sive noxa …“
Ein vertrautes Lächeln spielt um seinen Mund. Margarete hat die Augen wieder staunend erhoben und errötet unter seinem Blick. Als habe sie unverhofft einen Segen erhalten, der sie über alle ringsumher hinaushebt, löst sie ihre Hand aus der Mutterhand, ergreift die große, weiche Rechte des geistlichen Mannes und küßt sie demütig.
Auch das, und wie sie es tut, gemessen und hauchzart, befängt den Erfahrenen. Er neigt sich, vom eigenen Herzen überrascht und um die leichte Wirrsal zu verbergen, tief zu ihr nieder. Fast berührt er mit den Lippen ihren Scheitel und flüstert wirklich den Segen, den sie durch ihren Dank vorweggenommen hat. Er wiederholt den Schluß der Fastenmesse seines heutigen Morgens: „Benedicamus Domino“, als habe er den heiligen Leib noch einmal auf geopfert, und fügt hinzu: „Cor mundum crea in istam tuam filiam, Deus, ut digne Paraclytum tuum recipere valeat.“
Obwohl sie das Latein nicht versteht, es wird der alten Trugenhovin zuviel. Sie faßt den Bruder etwas derb am Arm und sagt:
„Ihr kummt nachend zem Imbiß ins Hus, Bruder Lambert. Wir hänt vom Harpfern-Fischer ein Zuberlach Forchen, die süllent Üch nach Meß unde Predigt guet ton.“ Sie schüttelt ihn unter einem trockenen männlichen Lachen, das keine Einwendung verträgt. Und auch die anderen wissen damit, daß die Kirche leer steht und es an der Zeit ist.
Margarete sucht selbst nach der Mutterhand. Der Bruder hat, freundlich ernüchtert, nur zu nicken vermocht, er wendet sich in die Sakristei, ohne den Frauen nachzusehen. Noch in der Kirche kommt es der alten Trugenhovin spöttlich über die dünnen Lippen:
„Das sollt mir ergötzlich sin an ihme, und es gstünd ihme dester baß zue, so er rescher war unde nit also glimpflich unde süeß. – Des Meister Eckharten Spruoch treibet ihn umb, und er schlaufet nit darvor! Do wollt ich sehn, was der Meister ohn ein Tüfel vermocht. Wer den Tüfel will fressen, dem tuet ein langer Löffel not.“
Die letzten Worte brummte sie schon in sich hinein, winkt den beiden, läßt sie hinter sich und geht langen, männlichen Schrittes dem Friedhofpförtlein zu. Mutter und Tochter verhalten unwillkürlich eine Weile und lassen die große, derbe Frau voraus.
Sie gehen langsam und tragen an dem, was sie fühlen. Das Weib des Ebner hat zum erstenmal die Ahnung dessen bekommen, was es heißt, ein Kind der Macht geben, die jenseits des Hauses, des Heimes und des Blutes steht. Und Margarete hat wohl ihre Hand gefaßt, aber sie hat ihr nicht die Kindeshand gegeben. Über einen Bach hinüber ist es geschehen, und der führt ein reißendes Wasser. Margretle steht jenseits. Auch das Kind spürt es. Es hat den Hauch der Lateinworte gefühlt und hat ihren Sinn halb und halb vernommen. Sie ist empfangen, wohin nicht Vater, Mutter, Alheid reichen. Etwas von der namenlosen Würde hat sie unter die Sohlen bekommen und geht auf Wolken.
***
In der Osterwoche ist das Haus so sehr von der Weltsorge um die kommende Hochzeit erfüllt, daß Margarete vergeblich auf das verheißene Ostererlebnis wartet. Die Klosterfrau Klara hat ihr von der Wonne des Leidens in Christo dem Herrn gesagt, die fromme Herzen zu Ostern überkommt. Im Hause aber schwirrt es von Schneiderinnen und Nähterinnen, es ist im Hof geschlachtet, in der Küche gewurstet und gepökelt worden, aus Dillingen ist der Meister Wolfert da, der beste Zuckerbäcker bis nach Augsburg hin, und auch dorthin schon gerufen. Marzipan, Latwergen, Konfekt, die süße Apothekerei, versteht er wie keiner, er war in Italien und Burgund, der Matthies kennt ihn von dorther und hat ihn bestellt. Alles Handwerk geht aus und ein, Schuster, Kürsdiner, Beutler, Handschuhmacher sinds nicht allein, nur der Schmiede zu denken, und nicht erst des Goldschmiedes, waren der Pfannenschmied und der Kupfer- und Messingschläger, der Schellenmacher und Gewichtmacher da. Auch im Haus hinter der Ilgen auf die Bäcken zu wird der neue Hausstand gerichtet mit eigenem Rauch und eigenem Stall. Es geht treppauf, treppab, und die Nähterinnen sind schon so in das Haus gewöhnt, daß sie lachen und singen, und die Alheid lacht mit ihnen. Die Alheid hat ein schallendes Regiment aufgetan, davor die Agnes-Mutter fast verschwindet. Sie treibt das Haus um, denn sie weiß anzuschaffen wie der Vater. Und das freut ihn, er muntert die Alheid und läßt sich nicht spotten. Es springen die Gulden über den steinernen Rechentisch. Die Alheid hat ein Funkeln im Blick. Sie muß die feierlichen Worte des Bruders Lambert vergessen haben: sie soll dem Bräutigam auftun die Rose ihres Leibes in Freuden. Hat eine Rose sich je erschlossen, es sei denn in der Stille und im Hauch zarter Düfte, die gele Buttervögelein anlocken, daß sie um das lautlose Wunder spielen?
Und auf den Karsamstag Abend nach Auferstehung der Glocken ist der Matthies zum gebratenen Lamm geladen.
Kein junger Mann in Werde, Hochstätt und Dillingen, der sich so subtil zu tragen wüßte als Matthies, der Vetter von der Ilgen, der Bräutigam. Über Nördlingen bis Würzburg – dorthin fahren die von der Ilgen ihre Salzscheiben – ist er bekannt dafür. Er begleitet hie und da einen Wagenzug und führt überall seine Kleidertruhe mit. Margretlein riecht ihn gerne, sein Haar glänzt von einer Salbe, er trägt es gekräuselt und gescheitelt, es hat einen rötlichen Stich und fällt ihm über die Ohren nieder. Sie weiß auch, daß er seine Wangen mit Bimsstein glättet. Er hat sie einmal zu sich gezogen, die Alheid zu tratzen, denn die hat nicht auf seine Knie sitzen wollen. Da hat sie ihn gefragt, und er hat ihr das Geheimnis seiner glatten Wangen ins Ohr geflüstert. Das hat die Alheid wirklich in Zorn gebracht. Sie ist aus dem Zimmer, hat die Tür zugeschlagen. Gleich hat sie der Matthies nachgeschickt, die Alheid aber hat ihr den Botenlohn fünf Finger breit ins Gesicht gehauen. Es war eine lange Heulerei.
Der Matthies kann Laute spielen und singt. Er spreizt nicht die Beine wie der Vater und hält des Vaters kräftige Brust und breite Schultern für dörpisch. Darüber ist einmal eine Bemerkung gefallen, und er hat dabei mit den abgestreiften Handschuhen verächtlich auf den Schenkel geschlagen und mit einem stolzen Lächeln „vilain“ geflüstert. Gerade so etwas vergißt Margarete nicht. Bloß die Alheid lacht dazu. Sie spottet ihm nach, wie er seine Brust einzieht, den Bauch vorstreckt, den Rücken krümmt und mit langsamen Schritten vorwärts rutscht, so daß die Spitzen seiner Schuhe leise wippen. Aber sie kommt ihm auch anders bei. Wenn ihr der Matthies allzu üppig ins höfische und burgundische Wesen haut, dann kann sie sich vor ihm recken und ihre Zähne zeigen, daß es eine Pracht ist und er blaß wird und seine Nüstern beben.
Margretlein sitzt wie ein Katze in einem Winkel und hat auf das Spiel acht, sie sieht alles, und es wird ihr zuweilen bange. Manches kann sie nicht verwinden, es läßt sie nicht los, und dann – unter dem Einschlafen geschieht es ihr – schreckt sie auf und muß beten, sie weiß keine andere Hilfe, es ist ein Bedürfnis. Beten oder an den Bruder Lambert denken und an seine geheimnisvollen Worte! Sie stellt im Gedächtnis den Mönch neben den Matthies, und im Spiel der Gedanken Widerstreiten die beiden, auch der Matthies kann gewinnen. Sein Lächeln ist es, die Art, wie er seine Locken zurückstreicht und dabei die Augen kneift. Das kann der Bruder Lambert nicht mit seiner runden Glatzen und dem gestutzten Haarkranz darum. Aber es ist nicht gut, wenn die beiden miteinander streiten, es ist besonders schlecht, wenn der Matthies gewinnt. Dann bleibt eine Wirrsal zurück, Margretlein erwacht völlig und sie schläft dann lange nicht ein. Der Kolter drückt sie, es wird ihr heiß, sie möchte nackend über eine tauige Wiese gehen und sich am Mondlicht kühlen.
Weil mit den Glocken die Ostern auferstanden sind und alle Trauer hin ist, hat der Matthies seine Laute mitgebracht. Die lehnt wie ein vergessenes Versprechen in einem Winkel, er selber sitzt bei Tisch neben der Alheid und bedient sie. Mit spitzen Fingern hat er ein Stück Lammskeule heruntergeschnitten und ihr auf den Teller gelegt. Dann nimmt er sich selbst. Margretlein steht hinter der Mutter, sie bekommt von ihr und vom Vater zuweilen ein Stück in den Mund geschoben. Es wird nicht mehr lange dauern, dann kommt sie auch zu ihren Tagen und darf mit den Großen am Tisch sitzen. Man muß das erwarten können, als Klosterfrau gebührt ihr einmal der Ehrensitz neben dem Vater.
Es gibt auch noch frischen Kressesalat und danach Brezeln in öl gekocht und dazu eingemachte Weichsein. Wunderbar, wie der Matthies die Kressekräutlein zu Mund geführt hat und wie er die Weichsein aufs Messer spießt und dann seine Hand vorhält, wenn er den Kern unter den Tisch spuckt! Man lernt, was fein ist, und es wird einem wohl dabei. So machen sie es in Besanfon, und es ist sehr höfisch. Der Vater sieht nicht gerne hin, sieht er aber, dann haut er desto kräftiger ein und achtet es nicht, wenn ihm das Kinn vom gelben Fett tropft. Er wischt sich einfach am Tischtuch und hebt seinen Becher: „Matthies, gsegnet!“ – Der Matthies hat die feiste Art mit einem spöttlichen Blick gestreift. Der Vater lacht herausfordernd, und der Matthies muß tüchtig Bescheid tun. Die Alheid, die auch alles merkt, lacht mit dem Vater und stößt den Matthies an, daß ihn der Wein anschwappt, und dann kommt der Matthies ins Lachen, und selbst die Agnes-Mutter tut mit.
Margretlein weiß nicht recht, weshalb gelacht wird. Sie kennt das Spiel über Art und Form hinweg noch nicht.
Es gibt zur Auferstehung noch eine gefüllte Omelette. Sie wird in einer großen irdenen Schüssel aufgetragen und in die Mitte gestellt. Vater und Mutter fassen mit den Löffeln von der Schüssel gleich in den Mund, denn die Omelette ist flaumig und von Butter und Eingemachtem umflossen. Der Matthies aber – er hat sich über die Schüssel geneigt und den Duft eingezogen, seine Fingerspitzen geküßt und dann mit der Zunge geschnalzt – schneidet für Alheid und sich aus der Brotrinde Löffel, denn er sagt, es dürfe kein Zinn daran, das schmecke übel aus der Salse. Er schöpft und streift mit der Rinde für sich und Alheid ein Stück samt Butterseim und Fruchtsaft auf einen Holzteller. Das kosten die beiden mit den Brotlöffeln aus. Die Alheid hat dem Matthies schon viel abgesehen, denn das burgundische Wesen steckt an.
„Weis her“, meint der Vater.
Der Matthies schneidet auch ihm eine Brotrinde zurecht, reicht ihm den Holzteller. Heinrich, der Ebner, gibt zu, daß Ei, Butter und Fruchtsaft besser vom Brot munden.
Margret will die Laute bringen, aber die beiden Männer haben Wichtigeres vor. Im Keller liegen die Weinfässer für die hochzeitliche Lautmehrung: der Leutewein, der Gästewein und der Brautwein. Margarete darf nicht mit, die Frauen bleiben alle. Die beiden Männer haben bedeutende Mienen, sie nehmen nur noch ein Körbchen mit feinen Brotschnitten in den Keller, die Zunge bereit zu halten. Margarete hat sich auch die Weinnamen gemerkt, fast so köstlich wie die der Stoffe auf dem Söller: der Elsässer, der Bozener, dann der Rummeni, der süß sein soll und weit her kommt aus Napoli di Romana, der Muskateil, der Ratioler und Cyperwein. Eine Sorte hat verheimlicht werden müssen, da sie zu kostbar ist und gegen die neue Polizei, von diesem Wein weiß Margarete nicht einmal den Namen. Auch einen Claret haben sie gemacht. Margarete hat das Gewürz stoßen dürfen. Mit Honig ist das Pulver gemengt und in ein Leinensäcklein getan worden, das war lange in einem Faß von bestem Welschwein gehangen, der muß nun immer wieder geseiht werden, bis er klar wird, dann aber ist er wundertätig stark.
Es dauert eine gute Weile, die Alheid gähnt und auch die Agnes-Mutter. Ob es noch zum Lautenspiel kommen wird? Es ist längst Nackt.
Heute brennen zwei Kerzen statt der einen, das wird des Matthies wegen sein. Die Alheid sitzt bei der einen und stickt.
Mit roten Köpfen kommen sie wieder, der Vater ist schwer, er hat einen unsicheren Schritt, und der Matthies wippt bei jedem Schritt, als wolle er tanzen.
„Gang, Gretle“, winkt ihr der Vater.
Sie soll schlafen gehen und hat auf den Matthies gewartet. Die Laute ist da, und er singt so schön. Schnell holt sie die Laute aus der Ecke und reicht sie ihm. Aber der Vater will nicht, daß sie bleibe. Im Weine hat er den härtesten Willen.
„Gang!“
Sie muß verschwinden. Es ist stockfinster auf dem Söller. Sie könnte ungesehen warten und hören, und dann, dann gleich in die Bettlade.
Der Matthies hat verstanden, daß es auch für ihn Zeit geworden sei, allein er ist vom Weine befeuert und hat ihr die Laute abgenommen. Da sie knicksend ging, hat er sie höfisch gegrüßt, als sei sie schon erwachsen, und dabei sanft über die Saiten gestrichen. Sie darf also noch ein wenig warten und hören, draußen, versteckt, weil er so freundlich gewesen ist. Sie tastet sich unter die Stiege, dort hockt sie nieder. Im Zimmer lachen und reden sie laut. Endlich klingt es weich aushallend unter seinen festen Griffen. Sie war schon auf dem Sprung hinaufzugehen, jetzt kann sie nicht mehr.
„Ach Gott, daß ich sie meiden muoß,
Die ich zu Fröiden hab erkorn!
Das tuet mir wahrlichen weh.
Müget mir noch werden ein fründlicher Grueß,
Des ich han alsolang entbohrn,
Als wär mir wohl und süfzet ich niemeh.“
Es folgt eine Reihe perlender Akkorde. Da kann man hören, wie gut der Matthies seine Laute schlägt. Er beginnt wieder, und sehr beweglich. Die Stimme zittert ihm. Dem Margretlein kommen fast die Tränen.
„Noch ist mir einer Klage not Von der liebesten Frouen min,
Daß ihr zartes Mondelin rot Kunnt mir ungenädig sin.
Sie müg mich ze Grund verderben,
Untrost well sie an mich erben.“
Sie lachten, indes Margret aus Mitleid mit dem armen Matthies ihr Herz mit beiden Händen preßt und leise aufschluchzt, so schwer liegt ihr seine bebende Stimme an. Sie kann das rauhe Lachen nicht fassen. Aber vielleicht singt er noch eine tröstlichere Weise. Sie faltet die Hände, wartet geduldig und drückt sich fester an die Wand, sie muß ganz krumm sitzen, aber es ist in der Finsternis gut, wenn man eine Wand fühlt.
Nach einer Weile, sie haben in der Stube laut durcheinander geredet, geht die Tür. Margret duckt sich, so tief sie kann. Keiner darf sie gewahren. Alheid ist es mit dem Lichte, der Matthies folgt ihr. Die Alheid geht voran und hält das Licht hoch. Inmitten der Stiegen, die schmal an der Wand hängt, umschlingt der Matthies die Alheid vom Rücken her und preßt sie an sich. Er steht eine Stufe höher, seine Hände fassen das dünne Linnenbrüstlein, das sich aus dem Mieder vorbauscht, und es ist erst auf diesen Morgen gestärkt und gefältet worden. Er hat durchaus keine Acht darauf, und die Alheid auch nicht, sie neigt das Gesicht an seine Brust zurück, und sie küssen einander, als müßten sie eins des anderen Hauch austrinken. Ein Wunder, daß ihr das Licht nicht aus dem Leuchter fällt. Sie hält die Hand weit vorgestreckt, und das Licht tropft schändlich auf die Stufen. Die Wachsklecker werden zu finden sein.
Margret hört des Matthies Stimme, und es ist, als sei er gelaufen und er hätte keinen Atem mehr: „Alheid … loß mich in … loß mich in uf diese Nacht …“
„Es währt nit meh dann vierzehen Täg, Matthies …“ flüstert die Alheid.
„Loß mich in … du sollt mirs nit meh Vorbehalten … min Trudle, min süeß … ich will hübschlich inschlaufen, sull niemen ein’ Murks hörn und in kein Weis … Trudle min …“
„Gang, Matthies, Lieber, Matz min … es möcht mir das Herz usse dem Hals brechin umb dinetwillen! Bis getrost … vierzehen Täg sänt bald hin … so ist alls din … min Friedei.“
Es ist ein Leidwesen unter Seufzen, Kosen und Küssen. Margretleins Herz pocht auch in den Hals. Sie wagt kaum zu atmen, und es sprengt ihr fast die Brust. Gott steh ihnen bei, der Alheid und dem Matthies! Es muß ein Wehtag sein; beschwerlich flüstern sie und inbrünstig mit Seufzen.
Die Alheid drängt hinunter.
„Alheid, daß du mirs nit günnst!“
„Ich günns dir wohl, Friedei, min Matz … kumm abe und gang in dieser Nacht! Daß uns nit möcht ein Widerdrieß geschechen.“
Dann versteht sie nichts mehr. Der Matthies geht, es scharrt der Riegel. Sie muß eilends auf und in die Bettlade. Die Alheid kommt noch durch die Kammer, und da muß sie schon fest liegen und schlafend tun.
Und, längst unter dem Kolter verkrochen, in die Kissen vergraben, klopft ihr das Herz noch. Die Alheid braucht zum Glück Zeit an diesem Abend. Sie geht mit dem Licht vorbei und hat ein Lächeln um den Mund, und es ist ihr die Beschwer nicht mehr anzumerken, die ihr und dem Matthies auf der Stiege so hart überkommen ist. Sie sieht aus, als habe sie ein Spiel gewonnen, auf dem viel gestanden war. Die Alheid ist ein Frauensmensch sonderlicher Art, und sie kann sich verhärten. Es ist gut, daß sie nicht unter den Stiegenwinkel geleuchtet hat, sie hätte es ihr entgolten, und es war doch des Lautenspieles und des Gesanges wegen geschehen.
Margret liegt, horcht in die Finsternis, im Innersten aufgerührt. Schweigen muß sie und selber fertig werden. Sie haben einander liebkost und geküßt, das hätte eine Freude sein müssen. Wenn die Agnes-Mutter streichelt und küßt, das bringt eine Müdigkeit und einen sanften Frieden, aber die Alheid und der Matthies haben schwer getan, und es war eine Klag und ein jämmerliches Geflüster in der Nacht. Der Matthies hat ausgesehen, als könnt er das grausame Leidwesen nimmer verwinden. Die Alheid hat ihn getröstet, es soll in vierzehn Tagen ein End haben.
In vierzehn Tagen ist die hochzeitliche Lautmehrung im Haus, und es soll etliche Täg zugehen mit Essen und Trinken. Was kann dem Matthies so herzbrechend darum sein, daß ihn die Alheid auf die vierzehn Täg vertrösten muß? Der hat auch jetzt genug, und mehr, als er kann! Sie sieht das Lächeln der Alheid wieder. Langsam ist sie vorübergegangen, hat das Licht mit der Hand geschirmt, sie ist ruhig hinüber in die Kammer, dort schläft sie jetzt. Sie schläft, das weiß Margret.
Und es war ein Lachen um ihren Mund, das über einem bangen Herzen nicht aufgehen kann. Ohne Demut ist es gewesen, aber ihr selber ist bang, und es ist ihr auch nicht um den Matthies bang, das weiß sie jetzt. Der hat zurückkommen wollen und heimlich. Die Alheid hat ihm helfen sollen. Er muß genug gehabt haben: der Vater war schwer vom Wein, auch er hat ein glühendrotes Gesicht gehabt. Das scheint ihr ärgerlich und gemein, wo er sonst so höfisch tut. Sie versteht den Vater, dem fährt das burgundische Wesen auch wider den Strich, vielleicht weiß der Vater, was dahintersteckt, hinter all dem Putzi. Margarete ist sehr enttäuscht vom Matthies. Aber das hilft ihr wenig. Morgen wird man es sehen auf der Stiege, wo der Matthies die Alheid bedrängt hat. Das Wachs wird die Spur sein, und der Tag wird auf das ungeduldige Wesen scheinen.
Da wird in ihr die Fastenpredigt des Bruders Lambert wach. Tiefe Verborgenheit und Geheimnis: die Höllenglut des Leibes und sein Rosenblühen. Etwan ist es doch nicht der Wein im Keller und das Essen und Trinken bei der Lautmehrung, auf das der Matthies warten soll noch vierzehn Täg. „Tu uf die Seelen als ein Brout, so dem Bröitigam uftuet die Ros ihres Leibs mit Lust und Fröiden …“ Der Bruder Lambert hat alle geheißen, auftun. Und was ist die Rose des Leibes? Die Seel ist die Rose des Leibes. Und die Alheid soll ihre Seelen dem Matthies in Lust und Freuden auftun. Die Agnes-Mutter war still gesessen unter den Worten des Priesters, ohn eine Regung. Die Agnes-Mutter hat auch eine Seel, und warum tuet sie nit auf die Rose ihres Leibs als eine Braut? Sie hat keinen Bräutigam mehr, das ist es. Der Spruch des Bruders Lambert bedeutet: die Seel kann einmal nur auf tan sein in Lust und Freuden, das ist vor dem Bräutigam. Der Vater hat auftan die Seelen der Mutter, und nun ist sie offen. Und die Seel der Alheid ist noch beschlossen in ihrem Leib. Die muß der Matthies auftun.
Margretlein weiß, warum er die Alheid ans Herz gefaßt hat so inbrünstiglich mit den Händen und sie an sich gepreßt hat. Sie versteht die Ungeduld, denn es muß schön sein, eine Seele zu erlösen aus dem feurigen Faß des Leibes, der des Teufels Kalfakter ist, und es muß schwer sein, denn eine Seele ist fest beschlossen in dem Leib. Da haben die beiden wohl geseufzt, und es war keine Freudigkeit und nicht ein Frieden bei dem Liebkosen. Denn sie müssen noch warten. Der heilig Ulrich und die heilig Afra geb ihnen Geduld auf die vierzehn Tag! Da ist die Hochzeit, und die Alheid und der Matthies bekommen den Machelring unter der Kirchtür … Margret sieht die große Hand des Abtes vor sich. Auf dem Zeigefinger trägt er den Ring. Ein Karfunkelstein ist in das Ringkästlein gefaßt, der blitzt aus einer Bruchkante rot den Widerstrahl des Lichts. Sie darf den Ring küssen. Es ist, als küsse sie einen Tropfen steinharten Blutes … der Abt Konrad greift ihr in den Mund … er tut es mit spitzen Fingern, höfisch … er greift ihr die Seele und zieht sie ein Stück aus dem Mund. Es ist vor ihrem Gesicht wie der Hauch im Winter. Und er läßt die Seele los, da schlüpft sie wieder ein, wie die Schnecken ins Haus … denn er ist der Bräutigam nicht … der ist der Matthies mit der spitzen Gugel hinten im Nacken, und eine Schellen hängt ihm daran, und seine Ärmel sind lang, schleifen bald auf dem Boden … er streicht über die Saiten, es schallt auf und hallt auf … er trägt die Laute an einem rotseidenen Band … ein zartes, zartes Mondelin rot …