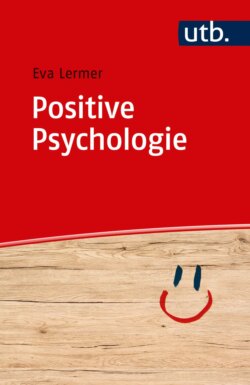Читать книгу Positive Psychologie - Peter Fischer, Eva Lermer - Страница 7
ОглавлениеHauptteil
Positive Psychologie: Geschichte, Kritik und Ziele
1
Geschichte der Positiven Psychologie
„What is a good life?“
Lange Zeit bevor ForscherInnen damit begannen, Glück wissenschaftlich zu studieren, haben verschiedenste Kulturen, Philosophen sowie spirituelle Meister eigene Vorstellungen davon entwickelt, was ein gutes, glückliches Leben ausmacht (Lermer, 2007).
In der westlichen Kultur beschäftigten sich die Menschen seit den Anfängen der klassischen abendländischen Philosophie (seit etwa zweieinhalb Jahrtausenden) mit der Frage nach dem, was Glück ist. Zu den bedeutsamsten philosophischen Meinungen der Antike zählen jene von Aristippos (435–355 v. Chr.), Platon (427–347 v. Chr.), Diogenes (399–323 v. Chr.), Aristoteles (384–322 v. Chr.), Epikur (341–270 v Chr.) und Epiktet (50–138; Lermer, 2007; für einen Überblick siehe Erler & Graeser, 2000).
So etwa vertrat der Begründer der kyrenaischen Schule Aristippos – er gilt auch als Begründer des Hedonismus – die Auffassung, dass das Lebensziel in der Maximierung der Lust bestünde. Der Weg zum Glück läge „im bewussten Genießen“.
Anders hingegen beschreibt Epikur den Weg zum Glück. Zwar ist Lust für ihn ein Prinzip gelingenden Lebens, doch er sieht Glück nicht in der Hingabe an die Lust, sondern in der Freiheit von Schmerzen und Unlust. Nicht dürsten, nicht hungern, nicht frieren. Dafür die Erfüllung von Lust in Form von Lebensfreude verfolgen. Eine hedonistische Haltung: der Epikureismus.
Als Gegenpart zum nach möglichst dauerhafter Lust strebenden Epikur gilt Epiktet, der mit Marc Aurel und Seneca zu den bedeutendsten Stoikern zählt. Die Glücks-Formel der Stoa fokussiert auf der Befreiung von Äußerem, also Geld, Macht, Ansehen etc. In der stoischen Seelenruhe und Gelassenheit sei die höchste Form von Glückseligkeit zu finden. Eine Haltung, die bis heute insbesondere der Buddhismus durch die Befreiung vom Ego empfiehlt.
Der Gedanke, dass vollkommene Bedürfnislosigkeit der Weg zum Glück sei, findet sich bei Diogenes. Darüber hinaus gehört für ihn absolute Unabhängigkeit von der Außenwelt zum Glück (Lermer, 2007; Erler & Graeser, 2000).
Platon, der ebenfalls wie Aristippos ein Schüler Sokrates war, sieht Glück im Gleichgewicht der Seelenteile Vernunft, Mut und Begehren. Dabei sei Glück stets gebunden an das Gute und Gerechte.
Aristoteles beschreibt in der Schrift „Nikomachische Ethik“ Glückseligkeit (eudaimonia) als das höchste Gut, nach dem alle Menschen streben. Für ihn liegt der Weg zum Glück in der wesensgerechten und tugendhaften Entfaltung der Fähigkeiten und Möglichkeiten, die ein jeder in sich trägt (Lermer, 2007; Erler & Graeser, 2000).
Die hier angerissenen, verschiedenen Ansätze machen deutlich, dass das Glück von den antiken Philosophen sowohl äußerst different definiert als auch in vollkommen unterschiedlichen Haltungen vermutet wird. Damit blieben die Wege zum Glück, wie auch die Bedeutung des Wortes selbst, weiter im Ungefähren. Seit einiger Zeit beschäftigt sich nun auch die Psychologie (wieder) mit eben solchen Fragen und versucht, über empirische Zugänge Antworten zu liefern.
Positive Psychologie: Eine junge Wissenschaft?
Die psychologische Forschung hatte sich bereits Anfang des 20. Jahrhunderts mit Themen der Positiven Psychologie auseinandergesetzt. Doch trotz ihrer frühen Wurzeln ist die Positive Psychologie heute einer der jüngsten Forschungsbereiche der wissenschaftlichen Psychologie. Eine Erklärung, wie es dazu kommen konnte, dass die heute so populäre Positive Psychologie über so viele Jahrzehnte in den Hintergrund gerückt war, gab Martin Seligman in seiner Grundsatzrede zur Ausrichtung der Psychologie. Seligman wurde im Jahr 1998 mit der bis dahin größten Mehrheit zum Präsidenten der American Psychological Association (APA) gewählt. In seiner Ansprache mit dem Titel „Building human strength: Psychology’s forgotten mission“ griff er die Positive Psychologie wieder auf und beschrieb, dass die Psychologie noch vor dem Zweiten Weltkrieg drei Aufgaben hatte:
1. Heilung psychisch kranker Menschen
2. Verbesserung der Lebensqualität aller Menschen
3. Identifizierung und Förderung von Talenten und Begabungen (Seligman, 1998).
Nach dem Krieg sollen vor allem zwei Faktoren maßgeblich dafür verantwortlich gewesen sein, dass zwei dieser drei Aufgaben in den Hintergrund rückten: Zum einen wurde im Jahr 1946 in den USA die Veteranenverwaltung gegründet. Dies soll zur Folge gehabt haben, dass viele praktizierende PsychologInnen ihren Lebensunterhalt mit der Behandlung von psychischen Erkrankungen bestreiten konnten. Zum anderen wurde im Jahr 1947 das National Institute of Mental Health gegründet. Als akademische PsychologInnen entdeckten, dass sie nun Zuschüsse für die Forschung vor allem über Anträge zu Themen psychischer Erkrankungen erhalten konnten, begannen sie, eher solche Themen zu besetzen (Seligman, 1998).
Aufgrund seiner Rede und der darauffolgenden Entwicklung wird Martin Seligmann zugeschrieben, die Positive Psychologie in der American Psychological Association (APA) eingeführt zu haben. Tatsächlich aber hatte bereits William James im Jahr 1906 in seiner Ansprache als Präsident der APA zur Untersuchung positiv-psychologischer Inhalte aufgerufen (Froh, 2004).
Insgesamt betrachtet, geht die Entwicklung der Positiven Psychologie letztlich auf weit mehr WissenschaftlerInnen zurück. Einige prominente PionierInnen und psychologische Schulen sollen im Folgenden aufgeführt werden.
Großeltern der Positiven Psychologie
In seiner berühmt gewordenen Vorlesung „Positive Psychology“ an der Harvard University differenziert Tal Ben-Shahar (Goldberg, 2006) die Pioniere der Positiven Psychologie in die Kategorien Großeltern und Eltern der Positiven Psychologie. Zu den Großeltern zählt er Abraham Maslow (1908-1970), Karen Horney (1885-1952) und Aaron Antonovsky (1923-1994). Des Weiteren können hier hinzugenommen werden William James (1842-1910), Carl Rogers (1902-1987) sowie Viktor Frankl (1905-1997). Zu den Eltern zählt Ben-Shahar Martin Seligman (1942*), Ellen Langer (1947*) und Philip Stone (1936-2006).
Mit dieser Perspektive lässt sich festhalten, dass die Positive Psychologie ein Urenkel der Humanistischen Psychologie ist, eine psychologische Schule, die sich ab Ende der 1950er Jahre entwickelte. Im Fokus stehen hier die Entwicklung und Entfaltung einer gesunden, sich selbst verwirklichenden Persönlichkeit. Zu ihren Begründern zählen Carl Rogers und Abraham Maslow.
Definition
Bei der Humanistischen Psychologie handelt es sich um eine psychologische Schule (Perspektive), die sich in den 1950er Jahren als Alternative zur behavioristischen und psychodynamischen Perspektive entwickelt hat. „Gemäß der Humanistischen Perspektive ist die Hauptaufgabe des Menschen, nach positiver Entwicklung zu streben“ (Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 12).
Carl Rogers (1902-1987) ist aus diversen Gründen einer der Großväter der Positiven Psychologie. Hierzu zählt auch, dass Rogers stets der Ansicht war, dass der Mensch im Grunde gut ist und die Fähigkeit zur Selbstverwirklichung hat. Dazu braucht es nach Rogers ein wachstumsförderliches Klima, das definiert ist durch Echtheit, Empathie und Wertschätzung. Das von ihm stammende Konzept der bedingungslosen, positiven Wertschätzung (unconditional positive regard) ist bis heute eine der drei Grundhaltungen der klientenzentrierten Gesprächstherapie (Finke, 2004; Rogers, 1961).
Abraham Maslow (1908-1970) war seiner Zeit voraus. Er prägte bereits 1954 den Begriff Positive Psychologie. In seinem Werk „Motivation and Personality“ beschreibt er den beschränkten Fokus der zu seiner Zeit aktuellen Psychologie, auf die negative Seite:
„The science of psychology has been far more successful on the negative than on the positive side; it has revealed to us much about man’s shortcomings, his illnesses, his sins, but little about his potentialities, his virtues, his achievable aspirations, or his full psychological height. It is as if psychology had voluntarily restricted itself to only half its rightful jurisdiction, and that the darker, meaner half“ (Maslow, 1954, S. 354).
Auch Maslow war – wie Rogers – überzeugt davon, dass der Mensch im Grunde gut ist. Daher brauche es auch Forschung zu Freundlichkeit, Güte und Optimismus.
David Myers (2014, S. 586) fasst Rogers und Maslows Humanistischen Ansatz wie folgt zusammen: „Anstatt die Probleme kranker Menschen zu untersuchen, sei es dienlicher zu beobachten, wie gesunde Menschen nach Selbstverwirklichung streben“.
Zu den Vertretern aus der Generation der Großeltern der Positiven Psychologie kann ferner die Psychoanalytikerin und Vertreterin der Neopsychoanalyse, Karen Horney (1885-1952), gezählt werden. Horney (1950) war der Ansicht, dass die Ursachen für Neurosen vor allem in der Angst liegen. Sie untersuchte unter anderem die Bedingungen, die einer gesunden Psyche entgegenwirken. Ferner sah sie die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung in der Entwicklung der individuellen Potenziale. Durch ihre Ansätze gilt Horney als eine wichtige Wegbereiterin der Humanistischen Psychologie und wird als die erste humanistische Psychoanalytikerin beschrieben (Fadiman & Frager, 1976).
Ein weiterer wichtiger Wegbereiter der Positiven Psychologie ist der Vater der Salutogenese, Aaron Antonovsky (1923-1994). Ende der 1970er Jahre revolutionierte Antonovsky vor allem die Medizinsoziologie durch die Vorstellung seines Modells zur Salutogenese (lateinisch salus: „Gesundheit“, „Wohlbefinden“, und genese: altgriechisch „Entstehung“: „Gesundheitsentstehung“) – als Komplementärbegriff zur Pathogenese (páthos: altgriechisch „Leiden“ und genese: altgriechisch „Entstehung“: „Krankheitsentstehung“).
Definition
Das Konzept der Salutogenese beschreibt die Wissenschaft von der Entstehung und Erhaltung von Gesundheit – als Komplementäransatz zur Pathogenese, welche als die Wissenschaft von der Entstehung und Entwicklung von Krankheit verstanden werden kann. Während bei der Pathogenese der Fokus auf Krankheiten, Fragen nach Ursachen und Einflüssen, die es zu vermeiden gilt, gelegt wird, richtet die Salutogenese den Blick auf Gesundheitszustände und die hierzu notwendigen Ressourcen.
Literatur
Ein guter Einstieg in das Thema Salutogenese findet sich in
Lorenz, R.-F. (2016). Salutogenese: Grundwissen für Psychologen, Mediziner, Gesundheits- und Pflegewissenschaftler. München: Ernst Reinhardt.
Daneben sei natürlich verwiesen auf Antonovskys Hauptwerk
Antonovsky, A. & Franke, A. (1997) Salutogenese: Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Tübingen: dgvt.
Betrachtet man den aktuellen Kenntnis- und Forschungsstand der Positiven Psychologie, wird schnell offensichtlich, dass allein die westlichen Wurzeln des letzten Jahrhunderts weitaus breiter sind, als vielfach angenommen. Es verwundert daher wenig, dass sich die Liste relevanter Vordenker der Positiven Psychologie leicht verlängern ließe. Um in der Terminologie der Großeltern zu bleiben, soll hier ebenfalls der US-amerikanische Psychologe und Philosoph William James (1842-1910) genannt werden. James gilt nicht nur als Begründer der Psychologie in den USA, sondern wird auch als Pionier der Positiven Psychologie gesehen. Von ihm stammen wesentliche Ansätze, von denen die Psychologie heute mit empirischen Belegen um ihren Einfluss auf das Wohlbefinden des Menschen weiß. Diese Ansätze finden sich überdies in zahlreichen, mittlerweile berühmt gewordenen Zitaten von James, wie etwa „wherever you are it is your friends who make your world” oder „if you believe that feeling bad or worrying long enough will change a past or future event, then you are residing on another planet with a different reality system“.
James vertrat die Ansicht, dass man das subjektive Erleben berücksichtigen müsse, um zu verstehen, wie Menschen optimalerweise funktionieren. Unter anderem aufgrund dieser Haltung wird James als einer der ersten US-amerikanischen Vertreter der Positiven Psychologie gesehen (Taylor, 2001). In seiner Arbeit „The Varieties of Religious Experience: A Study of Human Nature“ untersuchte William James schon 1902 die Gründe, warum manche Menschen auch angesichts von Widrigkeiten glücklich zu sein scheinen, während andere traurig und melancholisch sind und keinen Sinn in ihrem Leben sehen. In diesem Zusammenhang prägte James den Begriff „healthy mindedness“, die für ihn die menschliche Fähigkeit, Glück und Selbstvertrauen zu empfinden, ermöglicht (Hart, 2008).
Jeffrey Froh (2004) betont in seinem Artikel „The history of positive psychology: Truth to be told“, dass er in James die Person sieht, die die Positive Psychologie zum Gegenstand der wissenschaftlichen Psychologie gemacht hat, durch seinen Aufruf bei der APA 1906. Bei seiner Ansprache stellte James die Frage, warum es manchen Menschen gelingt, ihre Ressourcen voll auszuschöpfen, und anderen nicht. Um dies in Erfahrung bringen zu können, bedürfe es der Beantwortung zweier weiterer Fragen:
a) Wo liegen die Grenzen der menschlichen Energie?
b) Wie könnte diese Energie stimuliert und freigesetzt werden, damit sie optimal genutzt werden kann? (Rathunde, 2001).
Froh (2004) führt ferner aus, dass prominente, aktuelle Modelle der Positiven Psychologie (wie z.B. die Fünf Säulen des persönlichen Wohlbefindens, Seligman, 2002, 2015) eindeutige Parallelen zur Arbeit von William James und Abraham Maslow haben.
Literatur
Für einen Einstieg in die Auseinandersetzung mit James‘ Arbeit zu „healthy mindedness“ sei auf den Artikel von Curtis Hart (2008) „William James’ the varieties of religious experience revisited“ verwiesen, welcher im Journal of Religion and Health erschienen ist.
Der österreichische Psychiater und Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse Viktor Frankl ist ferner als einer der Großväter der Positiven Psychologie zu nennen. „Je mehr der Mensch nach dem Glück jagt, umso mehr verjagt er es auch schon“ (persönliches Interview mit Dr. Stephan Lermer 1981 (Lermer, 2017)) war einer der Kern-Sätze. Er sah im Sinn des Lebens – das zentrale Thema seines Wirkens – die größte Glücksquelle. Wobei er empfahl, sich vom Suchen nach dem Sinn zu verabschieden und dafür ganzheitlich zu erforschen, wie man selbst seinem Leben einen Sinn geben könne.
Eltern der Positiven Psychologie
Zu den Eltern den Positiven Psychologie lassen sich viele einflussreiche WissenschaftlerInnen zählen. Insbesondere zu nennen sind hier jedoch Martin Seligman, Ellen Langer, Philip Stone und Mihály Csíkszentmihályi.
Aufgrund seiner Tätigkeit in seiner Funktion als damaliger Präsident der American Psychological Association (APA) wird Seligman – wie bereits erwähnt – vielfach die Grundsteinlegung der Positiven Psychologie zugeschreiben. Wie hier aufgezeigt, gehen die Wurzeln allerdings weitaus tiefer. In jedem Fall jedoch hat die Arbeit von Seligman maßgeblich dazu beigetragen, dass die Positive Psychologie ab diesem Zeitpunkt einen enormen Zuwachs erfuhr. Ein relevanter Anstoß mag hierbei die Herausgabe eines Sonderheftes im Journal American Psychologist zum Thema Positive Psychologie im Januar 2000 gewesen sein. Hierbei beklagen die Herausgeber Martin Seligman und Mihály Csíkszentmihályi den zu dieser Zeit aktuellen Wissenstand der Psychologie: „Yet psychologists have scant knowledge of what makes life worth living“ (Seligman & Csíkszentmihályi, 2000, S. 5). Von hier an findet sich zunehmend mehr Forschung zur Positiven Psychologie. Zahlreiche Bücher werden veröffentlicht und immer mehr Konferenzen bringen ForscherInnen zum Thema Positive Psychologie zusammen (Gable & Haidt, 2005). Noch im selben Jahr entsteht das interdisziplinäre Peer-Review Journal of Happiness Studies unter anderem durch Ed Diener. Im Jahr 2006 entsteht die Peer-Review-Zeitschrift The Journal of Positive Psychology, welche bis heute sechs Ausgaben pro Jahr veröffentlicht.
International Positive Psychology Association
Für Netzwerk- und Konferenzinteressierte sei beispielsweise auf die Seite der International Positive Psychology Association (ippa) verwiesen. Diese ist zu finden unter www.ippanetwork.org. Zum Board of Directors zählen neben weiteren Seligman sowie deren frühere Präsidentin Barbara Fredrickson. Auf den Seiten des ippa-Netzwerks werden unter anderem regelmäßig stattfindende Veranstaltungen vorgestellt, darunter auch der World Congress on Positive Psychology (www.ippaworldcongress.org) ausgerichtet von der ippa. Ein Netzwerk für den deutschsprachigen Raum ist die Deutsche Gesellschaft für Positiv-Psychologische Forschung (DGPPF). Diese ist online zu finden unter dgppf.de.
Martin Seligman hat jedoch nicht nur durch seine Aufrufe zur Erforschung der Positiven Psychologie zur Prägung dieser Disziplin beigetragen, sondern auch maßgeblich durch seine inhaltliche Arbeit. Im Jahr 2003 startete das Master of Applied Positive Psychology (MAPP) Programm an der University of Pennsylvania unter der Leitung von Seligman.
Zusammen mit Christopher Peterson entwickelte Seligman im Jahr 2004 ein von ihnen sogenanntes positives Gegenstück zum DSM-Krankheitskatalog (das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ist ein Klassifikationssystem der Psychiatrie für psychische Erkrankungen). In ihrem Buch „Character Strengths and Virtues“ fokussieren Peterson und Seligman (2004) den Blick auf menschliche Stärken, die ein gutes Leben ermöglichen sollen. Am Values-In-Action(VIA)-Institut in Cincinnati, Ohio (www.viacharacter.org) – einer Non-Profit-Organisation zur Erforschung menschlicher Stärken, gegründet von der Manuel D. & Rhoda Mayerson Foundation – entwickelten Peterson und Seligman den Fragebogen VIA-IS („Inventory of Strengths“), um psychologische Stärken und Tugenden messbar zu machen. Laut Angabe des VIA-Instituts haben bis heute über sieben Millionen Menschen an dieser Befragung teilgenommen. Es liegen Übersetzungen in 41 Sprachen vor, und es wurden über 500 wissenschaftliche Studien mit diesem Instrument unternommen.
Auf der Seite www.charakterstaerken.org findet sich eine deutsche Adaption des Charakterstärken-Messinstrumentes als Online-Fragebogen der Fachrichtung Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik des Psychologischen Instituts der Universität Zürich, unter der Leitung von Willibald Ruch (Ruch et al., 2010). Durch die Teilnahme an diesem Forschungsprojekt kann man sein persönliches Charakterstärkenprofil erhalten. Der VIA-IS besteht aus 240 Fragen und bildet 24 Charakterstärken ab, welche in sechs Tugenden eingruppiert werden.
Tab. 1: Tugenden und Charakterstärken (nach www.charakterstaerken.org/VIA_Interpretationshilfe.pdf, 07.05.2019)
| Tugenden | Charakterstärken |
| Weisheit und Wissen (kognitive Stärken) | Kreativität, Neugier, Urteilsvermögen, Liebe zum Lernen, Weisheit |
| Mut (emotionale Stärken) | Authentizität, Tapferkeit, Ausdauer, Enthusiasmus |
| Menschlichkeit (interpersonale Stärken) | Freundlichkeit, Bindungsfähigkeit, soziale Intelligenz |
| Gerechtigkeit (Stärken, die das Gemeinwesen fördern) | Fairness, Führungsvermögen, Teamwork |
| Mäßigung (Stärken, die Exzessen entgegenwirken) | Vergebungsbereitschaft, Bescheidenheit, Vorsicht, Selbstregulation |
| Transzendenz (Stärken, die uns einer höheren Macht näher bringen und Sinn stiften) | Sinn für das Schöne, Dankbarkeit, Hoffnung, Humor, Spiritualität |
Martin Seligman hat die Positive Psychologie ferner durch seine Theorien und das von ihm entwickelte PERMA-Modell geprägt (siehe Kapitel PERMA). Nach Seligman findet sich über die 24 Charakterstärken der Weg zu jedem der fünf Bereiche von well-being (PERMA):
▪ positive emotion
▪ engagement
▪ relationships
▪ meaning
▪ accomplishments
Als eine der Mütter der Positiven Psychologie sei die Sozialpsychologin und Harvard-Professorin Ellen Langer genannt. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen des gelingenden Alterns und insbesondere Achtsamkeit (mindfulness; siehe Kapitel Achtsamkeit). Aufgrund ihrer weltweit viel rezipierten Arbeit zum Thema Achtsamkeit wird Langer von der Presse auch „mother of mindfulness“ genannt. Mehr über Ellen Langers Arbeit findet sich auf der Seite zum The Langer Mindfulness Institute (langermindfulnessinstitute.com/).
Als Pionier der Positiven Psychologie in der akademischen Lehre führte der Psychologie-Professor Philip Stone die Positive Psychologie 1999 in das Curriculum Psychologie an der Harvard-Universität ein. Zu dieser Zeit gab es nur wenige Institute, die Kurse zu diesem Thema anboten. Sieben Jahre später sollen es bereits über 200 in den USA gewesen sein (Lambert, 2007).
Positive Psychologie in der Lehre
Bis heute ist die Positive Psychologie kein fester Bestandteil der universitären Lehre. Im deutschen Sprachraum finden sich akademische Lehrveranstaltungen zur Positiven Psychologie überwiegend an privaten Einrichtungen.
Die Arbeit von Ed Diener hat die Positive Psychologie ebenfalls stark geprägt. Diener, von der Presse auch „Dr. Happiness“ genannt, zählt heute zu den meistzitiertesten WissenschaftlerInnen dieser Disziplin (bis Juli 2019 über 180.000 Zitationen; googlescholar.de). Dieners Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen subjektives Wohlbefinden (siehe Kapitel Begrifflichkeiten), der Messbarmachung von Wohlbefinden und Zufriedenheit und der kulturvergleichenden Glücksforschung. Der von Diener, Emmons, Larsen und Griffin (1985) publizierte Artikel „The satisfaction with life scale“ wurde bis 2019 über 23-Tausend Mal zitiert. In einer aktuellen Studie von Diener, Tay und Oishi (2013) „Rising income and the subjective well-being“ kontrastieren die Autoren die Ergebnisse vorausgehender Untersuchungen zum Zusammenhang von Einkommen und subjektiven Wohlbefinden.
Internet
Die deutsche Version der Satisfaction With Life Scale (SWLS) von Jahnke und Glöckner-Rist (2012) findet sich neben zahlreichen weiteren, frei zugänglichen Messinstrumenten auf der Seite des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften: Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items und Skalen (zis.gesis.org).
Als Väter und Mütter der Positiven Psychologie ließen sich noch zahlreiche weitere renommierte WissenschaftlerInnen aufführen. Hier sei abschließend auf den ungarisch-US-amerikanischen, emeritierten Professor für Psychologie der University of Chicago, Mihály Csíkszentmihályi, verwiesen. Csíkszentmihályi (im Englischen gesprochen: six-cent-mihaly; Kahneman, 2011, S.40) wurde insbesondere bekannt für seine Arbeit zum Thema Flow (siehe Kapitel Flow). Das Flow-Konzept beschreibt einen mentalen Zustand mit äußerst hoher Fokussierung.
Kritik an der Positiven Psychologie
Die Positive Psychologie wird vielfach, speziell innerhalb der Psychologie, als wissenschaftliche Disziplin diskutiert. Zu den zentralen Argumenten zählen insbesondere die Begriffsproblematik, die vielfach zu kurz und damit inkorrekt dargestellte, historische Entwicklung der Positiven Psychologie sowie empirisch nicht begründete Aussagen und nicht evidenzbasierte Do-it-yourself-Empfehlungen.
1. Vielfach wird kritisiert, dass mit dem Begriff Positive Psychologie eine Dichotomisierung der Psychologie in die Bereiche positiv und negativ verstanden werden könnte. Eine Differenzierung dieser Art ist jedoch keineswegs sinnvoll und dazu falsch, da sie viel zu kurz greift.
Der Begriff Positive Psychologie meint nicht, dass der Rest der Psychologie negativ ist. Tatsächlich ist die Mehrheit der akademischen Forschungsleistungen der Psychologie neutral und konzentriert sich weder auf Wohlbefinden noch auf Not.
Die Positive Psychologie wuchs weitgehend aus der Wahrnehmung eines Ungleichgewichts in der klinischen Psychologie, in der sich die meiste Forschung tatsächlich auf psychische Erkrankungen konzentriert (Gable & Haidt, 2005). WissenschaftlerInnen aus anderen Subdisziplinen, wie etwa der Sozial-, der kognitiven, Persönlichkeits-, oder Entwicklungspsychologie, mögen dieses Ungleichgewicht weniger wahrnehmen.
2. Ein weiterer Kritikpunkt, der sehr wahrscheinlich ebenfalls der Begriffswahl geschuldet ist, lautet, dass die Positive Psychologie Gegenstände untersucht, die zwar genuin psychologisch, aber nicht exklusiv positiv psychologisch sind. Konzepte wie Werte, Emotionen oder Liebe gehören nicht ausschließlich dem Themengebiet der Positiven Psychologie an. So etwa argumentieren – unter vielen –Fernández-Ríos und Novo (2012), dass die Forschungsinhalte der Positiven Psychologie vielfach eine Nachbildung von bereits bekanntem Wissen darstellen. Damit stellt sich die Frage nach dem Bedarf und damit der Begründung einer Subdisziplin namens Positiver Psychologie.
3. Dazu kommt, dass die historische Entwicklung der Positiven Psychologie vielfach nur allzu kurz geschildert wird. Dies mag gewollt oder unwissentlich verschuldet sein. Jedoch entsteht dadurch nicht selten der falsche Eindruck, Positive Psychologie behaupte, eine Disziplin zu sein, die sich als solche erstmalig mit Konzepten wie Glück auseinandersetzt. Mit dem Fokus auf die Wissenschaftlichkeit mag dies jedoch eher zutreffen. Wenngleich auch andere Subdisziplinen der Psychologie gleiche Gegenstände theoriegeleitet und empirisch überprüft haben mögen, ist dieser Zugang relativ jung – während die rein intellektuelle Auseinandersetzung mit den Inhalten, derer sich die Positive Psychologie aus wissenschaftlicher Perspektive annimmt, zweifelsohne älter ist.
4. Es kommt hinzu, und dieses Argument ist hoch relevant, dass der Terminus Positive Psychologie zunehmend mehr zu einem Sammelbegriff geworden ist, der viele unwissenschaftliche Vertreter angezogen hat. Zahlreiche Esoteriker, selbsternannte Gurus und andere Erkenntnismonopolisten greifen ohne wissenschaftliche Auseinandersetzung auf den Begriff Positive Psychologie zurück und beanspruchen diesen ebenso für sich. Damit wird der Begriff verwässert. Denn nicht jeder Rezipient ist wissenschaftlich geschult und kann zwischen theoretisch fundierter, empirischer psychologischer Forschung und esoterischen Behauptungen oder Pseudowissenschaft unterscheiden.
5. Die Definitionen der untersuchten Konzepte sind häufig nicht eindeutig (Beispiel „happiness“), und vielfach werden Begriffe synonym verwendet.
Aus Gründen wie den hier genannten und natürlich weiteren wird vielfach diskutiert, ob es einen solchen Terminus und noch weitergehend die Subdisziplin Positive Psychologie überhaupt braucht. Gable und Haidt (2005) halten in ihrer Analyse zu der Frage, warum es diese Wissenschaft gibt, fest, dass sie sehr wahrscheinlich einfach ein Bedürfnis erfüllt hat: als eine Anleitung für WissenschaftlerInnen nämlich, sich bislang zu wenig erforschten Inhalten zu widmen. Sie fügen ihre Sicht auf die Entwicklung der Positiven Psychologie hinzu:
„If the positive psychology movement is successful in rebalancing psychology and expanding its gross academic product, it will become obsolete.“ (Gable & Haidt, 2005, S. 104).
Diese Aussage stammt aus dem Jahr 2005. Bislang lassen die positiv psychologischen Entwicklungen jedoch keinen Abschwung der Forschungsbestrebungen erkennen. Das Gegenteil scheint vielmehr der Fall zu sein, blickt man auf die zunehmende Anzahl an Publikationen, Konferenzen und Instituten.
Literatur
Für einen kompakten Überblick über die Entwicklung und auch zur Kritik an der Positiven Psychologie eignet sich der Artikel „What (and why) is Positive Psychology?“ von Shelly Gable und Jonathan Haidt (2005), erschienen in Review of General Psychology. Für eine kritische Auseinandersetzung sei auf die Artikel „The negative side of Positive Psychology“ von Barbara Held (2004), erschienen im Journal of Humanistic Psychology, sowie „Myths of Positive Psychology“ von Fernández-Ríos und Vilarino (2016), erschienen in den Psychologist Papers verwiesen.
Ziele und Begriffe
Ziele
Das Ziel der Positiven Psychologie besteht nicht in der Verleugnung aversiver Zustände oder der Betrachtung von Negativem mit einer die Dinge verschönernden Brille. Es geht vielmehr um die Beleuchtung der bis heute zu wenig erforschten positiven Inhalte, wie etwa Freude, Altruismus oder gesunde Familienstrukturen, um damit das gesamte Spektrum menschlicher Erfahrungen zu betrachten (Gable & Haidt, 2005). Dabei wird den Forschungsgegenständen eine eigenständige, objektive Relevanz zugeschrieben, wodurch diese nicht nur als Puffer gegen negative Einflüsse oder Probleme erachtet werden. Unabhängig davon sprechen natürlich zahlreiche Forschungsergebnisse dafür, dass positive Prozesse einen protektiven und positiven Effekt haben. Auf die Frage, was Positive Psychologie ist, antworten Sheldon und King (2001, S. 216):
„It is nothing more than the scientific study of ordinary human strengths and virtues. Positive Psychology revisits ‘the average person’, with an interest in finding out what works, what is right, and what is improving. It asks, ‘What is the nature of the effectively functioning human being, who successfully applies evolved adaptations and learned skills? And how can psychologists explain the fact that, despite all the difficulties, the majority of people manage to live lives of dignity and purpose?"
Shelden und King (2001) führen hierzu weiter aus – und diese Perspektive mag unter anderem den Diskurs befeuern, den die boomende Entwicklung der Positiven Psychologie seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts entstehen ließ:
„As such, we argue that positive psychology is simply psychology. That is, just as other natural and social sciences try to describe the typical structure and natural functioning of their topics of interest, so should psychology“ (S. 216).
Dieser Ansatz führt vor Augen, dass die Psychologie zumindest bis heute, relativ betrachtet, zu wenig Gewicht auf das gelegt hat, was als typisch oder normal erachtet wird. Ferner wird hierdurch das Diskussionspotenzial offensichtlich, das die Positive Psychologie, die sich als eigene (Sub-)Disziplin versteht, mit sich bringt. So lange dieses Ungleichgewicht jedoch besteht, findet sich ein begründetes Argument für diese Ausrichtung als eigenständige Entität. Damit ist nicht ausgeschlossen und vielmehr angestrebt, dass die Gegenstände der Positiven Psychologie in Zukunft zunehmend auch von anderen Ausrichtungen aufgenommen werden und es hier zu größeren Schnittmengen kommt.
Ruch und Proyer (2011) halten diesbezüglich fest, dass von verschiedenen Orten argumentiert wird,
„dass das endgültige Ziel der Positiven Psychologie ist, sich selbst wieder überflüssig zu machen. Das wäre dann erreicht, wenn es in der Psychologie selbstverständlich wird, dass Forschung zu positiven und negativen Bereichen des Lebens gleich wichtig nebeneinanderstehen“ (S. 69).
Literatur
Einen gut zu lesenden und kurzen Einstieg in die Grundlagen der Positiven Psychologie bietet der Artikel von Ruch und Proyer (2011) „Positive Psychologie: Grundlagen, Forschungsthemen und Anwendungen.“ Report Psychologie, 36, 60–70.
Begriffe
Definitionen der Positiven Psychologie finden sich einige in der wissenschaftlichen Literatur. Gemeinhin kommen diese in folgendem Inhalt überein:
Positive Psychologie ist die Wissenschaft der Bedingungen und Prozesse, die zur optimalen Entwicklung und Funktionieren von Menschen, Gruppen und Institutionen beitragen (Gable & Haidt, 2005, S. 103).
Definition
Die Positive Psychologie ist die wissenschaftliche Untersuchung des Erlebens und Verhaltens in Bezug auf positive Aspekte des menschlichen Lebens. In diesem Ansatz werden Faktoren untersucht, die zu einem gelingenden und erfüllten Leben beitragen, die die Persönlichkeitsentwicklung und das subjektive Wohlbefinden positiv beeinflussen.
In der Literatur finden sich zahlreiche Definitionen von „happiness“ (siehe für eine Übersicht Cropanzano & Wright, 2001). Cropanzano und Wright (2001) halten fest (wie auch bereits Diener, 1984), dass das konzeptuelle Verständnis von „happiness“ überwiegend kongruent ist. Das Problem, so die Autoren, liege in der Verwendung unterschiedlicher operativer Definitionen und damit der variierenden Operationalisierung von „happiness“.
Definition
Operationalisierung steht für die Messbarmachung eines Konstruktes (z.B. Intelligenz). Hierdurch wird festgelegt, mit welchem Messinstrument die empirischen Merkmalsausprägungen erhoben werden.
In den meisten wissenschaftlichen Arbeiten zu „happiness“ finden sich drei Komponenten (Cropanzano & Wright, 2001; Diener, 1984):
1. „Happiness“ wird subjektiv erlebt (Diener, 1994; Diener, Sandvik, Seidlitz & Diener, 1993; Parducci, 1995). „People are happy to the extent that they believe themselves to be happy“ (Cropanzano & Wright, 2001, S. 183).
2. „Happiness“ beinhaltet die relative Präsenz positiver Emotionen und die relative Abwesenheit negativer Emotionen (z.B. Angst) (Argyle, 1987; Diener & Larsen, 1993; Warr, 1990).
3. „Happiness“ ist ein allgemeines Urteil: Es bezieht sich auf das Leben im Ganzen (z.B. Diener, 1984).
Die Zufriedenheit eines Menschen ist vor allem durch kognitive Aspekte beeinflusst während das Glück durch affektive Einflüsse festgelegt ist (Diener, 1993; Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999).
Ein weiterer Grund für die Begriffsproblematik liegt darin, dass es sich bei der Positiven Psychologie um eine internationale Disziplin mit der Wissenschaftssprache Englisch handelt. Dies hat zur Folge, dass es nicht selten zu begrifflichen Problemen kommt, wenn ein deutsches Äquivalent nicht existiert – oder aufgrund kultureller Unterschiede eine andere Konnotation als der englischsprachige Begriff besitzt. Oft führt dies dazu, dass Begriffe synonym verwendet oder erst gar nicht übersetzt werden (Dette, 2005). Darüber hinaus sind Begriffe wie Wohlbefinden oder Lebenszufriedenheit sehr breit zu verstehen. Daher ist die Erforschung, etwa die der allgemeinen subjektiven Lebenszufriedenheit, beeinflusst von der Frage, wie das Konstrukt definiert und im Zuge der jeweiligen Untersuchung operationalisiert (also messbar gemacht) wurde.
„ForscherInnen, die sich wissenschaftlich mit dem Glück beschäftigen, sehen sich immer wieder der Kritik ausgesetzt, dass sie mit einem nicht klar definierten Begriff hantieren“ (Grimm, 2006, S. 2).
Subjektives Wohlbefinden
Ein zentraler Bereich der Positiven Psychologie ist die Analyse des subjektiven Wohlbefindens (subjective well-being, oft abgekürzt SWB). Das Konzept des SWB stammt vom US-amerikanischen Psychologen Edward Diener und beschreibt die kognitive und affektive Bewertung der eigenen Lebensqualität (Diener, 2000). Mit seiner Definition von SWB hält Diener fest, dass die Bewertung von Lebensqualität subjektiv ist. Damit wird einem jeden die Möglichkeit eingeräumt, selbst zu beurteilen, inwieweit das eigene Leben als lebenswert erachtet wird.
Diener (2000) bestätigt, dass der Begriff SWB umgangssprachlich gelegentlich als „happiness“ (Glück) bezeichnet wird, und beschreibt SWB wie folgt:
„Menschen haben ein hohes SWB, wenn sie viele angenehme und wenig unangenehme Emotionen erleben, wenn sie interessante Tätigkeiten ausüben, wenn sie viel Erfreuliches und wenig Schmerzliches erleben und wenn sie zufrieden mit ihrem Leben sind“ (S. 34; Übersetzung E.L.).
Abb. 1: Komponentenmodell des subjektiven Wohlbefindens nach Diener et al. (1999; adaptiert von Dette, 2005, S. 42).
Für die Einordung der verschiedenen Facetten des SWB schlagen Diener et al. (1999) das Komponentenmodell vor (Dette, 2005, s. Abb. 1). Dieses dient dabei als Rahmen, wobei die Zusammenhänge zwischen den Komponenten des Modells nicht als spezifisch zu erachten sind.
Diener et al. (1999) folgen dem Vorschlag von Bradburn und Caplovitz (1965), wonach positiver und negativer Affekt als unabhängige Faktoren erachtet und dementsprechend separat berücksichtigt werden sollen. Die Unabhängigkeit der beiden Dimensionen wird jedoch vielfach diskutiert. Diener, Smith und Fujita (1995) kamen in ihrer Studie zur Struktur des Affektes zu dem Ergebnis, dass positiver und negativer Affekt zwar moderat stark, negativ miteinander korrelieren, jedoch eindeutig voneinander getrennt sind.
Zu der Komponente positiver Affekt zählen Diener et al. (1999): Happiness (Glück), joy (Freude), elation (Euphorie), contentment (Zufriedenheit), pride (Stolz), affection (Zuneigung), ecstasy (Ekstase).
Zur Komponente des negativen Affekts führen die Autoren folgende Facetten auf: guilt and shame (Schuld und Scham), sadness (Traurigkeit), stress (Stress), anxiety and worry (Angst und Sorgen), anger (Wut), depression (Depression), envy (Neid).
Zur Komponente der Lebenszufriedenheit zählen sie: desire to change life (Wunsch, das Leben zu verändern), satisfaction with current life (Zufriedenheit mit dem gegenwärtigen Leben), satisfaction with past (Zufriedenheit mit der Vergangenheit), satisfaction with future (Zufriedenheit mit der Zukunft), significant others’ view of one’s life (Sichtweise relevanter anderer auf das eigene Leben).
Bei der domänenspezifischen Zufriedenheit nennen Diener et al. (1999): Work (Arbeit), family (Familie), leisure (Freizeit), health (Gesundheit), finances (Finanzen), self (Selbst), one’s group (die eigene Gruppe).