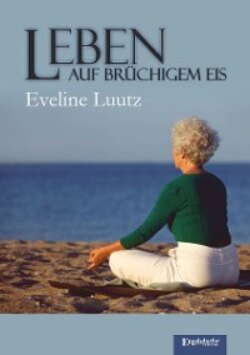Читать книгу Leben auf brüchigem Eis - Eveline Luutz - Страница 8
3
ОглавлениеIch beschloss, mir Großmutters Lebensgeheimnis abzuholen, es wegzutragen, ehe Großmutter es sich anders überlegte. Wie töricht ich doch war.
Das Geheimnis, das sich mir offenbaren sollte, das begriff ich bald, war nicht mit wenigen Worten umrissen. Es bedurfte einer Portion Zeit und Geduld, es zu entschlüsseln. Großmutter führte mich in viele verborgene Winkel und in Sackgassen ihres Lebens. Anfangs meinte ich, mich in dem Gewirr der Lebensepisoden zu verirren, doch allmählich schälte sich eine Struktur heraus, trat das Geheimnis Stück für Stück zutage. Irgendwann, nur wenige Wochen bevor Großmutter starb, sah ich es klar und deutlich vor mir liegen.
Am jenem Ostersonntag bekam ich lediglich das erste Mosaiksteinchen einer Geschichte zu Gehör, die nahezu Großmutters ganzes Leben umspannte. Sie nahm ihren Anfang mit Ewald Klötzes Hochzeit, einer Hochzeit, auf der sie, so beteuerte Großmutter hartnäckig, eigentlich nichts zu suchen hatte. Weder mit der Braut, noch mit dem Bräutigam war sie verwandt oder befreundet. Sie kannte die Familie aus dem Krieg. Auf dem Hof von Familie Klötze, nahe ihrer Heimatstadt, absolvierte meine Großmutter ihr Pflichtjahr. Eigentlich sollte sie Arbeiten im Stall und auf den Feldern verrichten, um die ins Heer eingezogenen Knechte mehr schlecht als recht zu ersetzen. Hulda Klötze indes, die Bäuerin, ließ das nicht zu. Aus einer tiefen und demütigen Dankbarkeit heraus holte sie das schmächtige Mädchen zu sich ins Haus, lehrte sie Gertrud das Wirtschaften von der Pike auf. Doktor Alfred Behringer, Großmutters Vater, Chirurg am Hospital der nahen Stadt, davon war Hulda Klötze fest überzeugt, hatte vor Jahren ihrem Mann das Leben gerettet.
Bei einem Unfall auf dem Acker war der Bauer vom Mähbinder, den er reparieren wollte, übel zerschnitten worden, weil die vorgespannten Pferde plötzlich anzogen. Wochen verbrachte er im Krankenhaus. Doktor Behringer hatte am Körper des Bauern kunstvoll Nähte über Nähte gezogen, den Bauern regelrecht wieder zusammengeflickt. Dafür liebte und verehrte Hulda Klötze Doktor Behringer solange sie lebte.
Ein Zufall hatte es eingerichtet, dass ausgerechnet Gertrud, die Tochter von Doktor Behringer, im Pflichtjahr den Klötzes zugeteilt worden war. Hulda Klötze indes glaubte nicht an Zufälle, sondern betrachtete Gertruds Erscheinen als eine Fügung des Schicksals, als Aufforderung, den Dank für eine große Wohltat zu entrichten.
Doktor Behringers Tochter, das schwor sie sich, sollte es gut bei ihr haben. Alles, was die begabte Hausfrau und Köchin wusste und konnte, wollte sie dem Mädchen aus Dankbarkeit mit auf den Weg geben. Auf dem Klötzeschen Hof lernte Großmutter neben der Hauswirtschaft Hühner, Gänse, Fische und Kaninchen schlachten, ausnehmen, rupfen und enthäuten, Obst und Gemüse anzubauen, ja sogar Leinen zu weben. Wenn meine Großmutter jemals so etwas wie ein Hobby besaß, dann bestand das in all dem, was sie bei Hulda Klötze erlernt hatte. Sie kochte zeitlebens sehr gern altdeutsche Gerichte, die mir stets sehr gut schmeckten. Es gab kein Sonntagsessen, das nicht aus mindestens drei Gängen bestand: der legierten Vorsuppe, dem Hauptgang und dem Dessert. Ich erinnere mich an die „Errötende Jungfrau“, eine schaumige Cremespeise aus dem Saft schwarzer Johannisbeeren, an Weinschaumcremes und „Äpfel im Schlafrock“, allesamt Nachspeisen, bei denen allein der Name meine Geschmacksnerven wach kitzelte. Im Kochen und Backen ging meine Großmutter förmlich auf.
Jedenfalls bat man meine Großmutter, damals noch eine junge Frau, als Ewald Klötze, der älteste Sohn, heiratete, zur Hochzeitsfeier; es fehlte eine Tischdame für Ewalds besten Freund von der Gewerbeschule für Forst- und Holzwirtschaft. Großmutter zierte sich nicht lange. Gerne kam sie der Bitte nach. Eine Hochzeit, zumal bei einem wohlhabenden Bauern, versprach Leckerbissen, die in jenen Jahren nicht gerade alltäglich auf den Tisch kamen. Zu dem guten Essen gäbe es Geselligkeit und Zerstreuung und vielleicht sogar würde Musik aufspielen und es konnte getanzt werden.
Das Tanzen stellte Großmutters zweite, heimliche Leidenschaft dar, der sie zeitlebens nur auf Familienfeiern frönte. Selbst als junges Mädchen ging sie selten aus. Sie mied öffentliche Feste, tat sich schwer im Umgang mit ihren Mitmenschen und besaß zeitlebens keine einzige enge Freundin, der sie sich hätte anschließen können. So blieb denn das Tanzen eine stille Leidenschaft, der sie zuweilen verschämt im elterlichen Wohnzimmer nach Musik vom Grammophon gemeinsam mit ihrer Schwester Liane nachging. Ihre Mutter, eine früh verbitterte Frau, durfte von diesem Vergnügen nichts mitbekommen. Sie hätte sich kategorisch dagegen verwahrt, dass in ihrem Hause getanzt und gelacht wurde.
Auch das Tanzen hatte Gertrud bei Familie Klötze erlernt. Hulda Klötzes Schwester, Elfriede, lebte, seit ihre Wohnung in Berlin bei einem Bombenangriff zerstört worden war, mit ihrem Sohn Adolph, auf dem Hof. Elfriede war eine echte Großstadtpflanze und kein Kind von Traurigkeit. Abends, wenn alle Arbeit ruhte, zog sie das Grammophon auf und tanzte bald mit ihrer Schwester, bald mit ihrem Schwager oder Gertrud gut gelaunt durch das Wohnzimmer. Sie kannte alle Schlager, sie sang vergnügt mit und beglückte alle mit ihrer guten Laune. Elfriede war es, die Gertrud das Tanzen lehrte, die ihr die Schrittfolgen geduldig zeigte und sich schwungvoll im Walzertakt mit ihr drehte, wann immer sich Gelegenheit dazu bot. Gertrud hatte bis dahin nicht geahnt, dass ihr das Tanzen ein solches Vergnügen bereiten könnte.
Als das Pflichtjahr endete, bedauerte Gertrud das zuerst um des Tanzens willen. Sie hatte Liane unter dem Siegel der Verschwiegenheit davon erzählt und eines Tages, als die Mutter beim Frisör saß, das Grammophon in Gang gesetzt, um Liane erste Schritte beizubringen. Immer, wenn die Schwestern sich allein zu Hause wussten, setzten sie die Tanzstunden heimlich fort.
Gewiss hätte Gertruds Vater nichts dagegen einzuwenden gehabt, dass seine Töchter im Wohnzimmer tanzten. Alfred Behringer war ein Lebemann, den schönen Dingen des Lebens allzeit zugetan. Er hätte, wäre er jemals zu solch einer Tanzstunde hinzugekommen, eine der Frauen umfasst und wäre mit ihr im Takt der Musik selig über das Parkett geflogen. Er hätte gelacht und einen guten Wein oder gar Champagner spendiert. Viel zu selten wurde seiner Meinung nach bei Behringers gescherzt und gelacht, seit vor vielen Jahren Großmutters Bruder Hans bei einem Badeunfall ertrunken war. Hilde Behringer, Großmutters Mutter, gab die Schuld für diesen Unfall allein ihrem Mann, der dem Jungen stets erlaubt hatte, mit seinen Schulfreunden baden zu gehen. Hans war vierzehn Jahre alt gewesen, als das Unglück geschah. Seither trug Hilde Behringer die Trauer wie ein Banner vor sich her. Sie ging zu keinem Vergnügen mehr, sei es eine Theateraufführung, ein Ball oder ein Festessen. Sie beabsichtigte ihren Mann durch ihre Verweigerung lebenslang zu strafen. Alfred Behringer liebte rauschende Feste und ausschweifende Vergnügungen. Eine Zeit lang entsagte er ihnen, blieb er mit seiner Frau und ihren anklagenden Blicken zu Hause. Er trauerte anders als sie um seinen Sohn. Er vermisste ihn jeden Tag, denn Vater und Sohn hatten einander sehr nahe gestanden. Alfred Behringer indes zelebrierte seine Trauer vor niemanden und er glaubte nicht, dass eine Entsagung von den Lebensgenüssen im Sinne von Hans gewesen wäre. Hans war ein fröhliches, lebenshungriges Kind gewesen. Irgendwann siegte die Lust auf Leben über die von seiner Frau verordnete Traurigkeit. Da Hilde sich weigerte, ihn zu begleiten, da sie sich in der Rolle der Anklägerin eingerichtet hatte, ging er fortan alleine aus. Anfangs trug er seiner Frau noch an, ihn zu begleiten, bald jedoch unterließ er selbst die Frage. Hilde verbrachte all ihre Tage in den Räumen der Villa. Sie versank in den Romanen Hedwig Courths-Mahlers. Hin und wieder sprang das Glück der Romanzen auf Hilde Behringer über, dann sehnte sie sich danach, im Walzertakt durch einen Festsaal zu schweben, doch selbst diese sentimentalen Regungen verbot sie sich.
Dadurch, dass das Tanzvergnügen vor Vater und Mutter strikt verborgen wurde, besaß es in den Augen meiner Großmutter stets den Nimbus des Anrüchigen und Verbotenen. Nichtsdestotrotz tanzte sie leidenschaftlich gern, was sie sich leider selbst nie wirklich einzugestehen wagte. Sie dürstete förmlich nach Gelegenheiten, ohne Aufsehen zu erregen, tanzen zu dürfen. Die Hochzeit kam ihr dabei zupass.
Ihr Tischherr auf der Hochzeitsfeier, Max Ludewig, ein junger Mann mit sehr guten Umgangsformen, dessen Kopfhaar sich ungeachtet seiner noch jungen Jahre bereits zu lichten begann, gefiel Großmutter. Er trug einen graumelierten Anzug aus ungewöhnlich gutem Stoff, der seinen hohen Wuchs nachhaltig unterstrich. Dem Gesicht verliehen besonders die sehr klaren, freundlichen blauen Augen sowie die sehr schlank und edel wirkende Nase einen Hauch von Eleganz. Er verstand charmant zu plaudern, Großmutter zu erheitern. Zudem erwies er sich als recht passabler Tänzer. Gerade diese Fähigkeit schätzte sie auf jenem Hochzeitsfest am meisten an ihrem Tischherrn. Beinahe jeden Tanz tanzte sie mit ihm. Er zog sie eng an sich heran, für ihren Geschmack ein wenig zu eng. Er sang vergnügt und heiter die Schlagertexte mit. Er bewegte sich leichtfüßig im Rhythmus der Musik. Die Zeit verrann wie im Fluge.
An diesem Tage, davon war Großmutter lange überzeugt, meinte sie einen Glückshauch verspürt zu haben. An diesem Tage besaß sie alles, was sie sich wünschte. Sie empfand eine ungewohnte Seligkeit, fühlte sich trunken vor lauter heiterer Freude. Wahrscheinlich sprang sie an diesem Tage ein Mal über ihren eigenen Schatten: Sie ging aus sich heraus, während sie sich sonst ihr Leben lang in sich zurückzog. Sie kannte sich selbst nicht wieder.
Sonst schweigsam, kontaktscheu und beinahe asketisch, wie ihre Mutter, lebte sie auf. Sie lachte ungezwungen und klönte mit dem ihr fremden Mann. Max Ludewigs Fröhlichkeit und die Leichtigkeit, mit der er das Leben betrachtete, waren unversehens auf Gertrud übergesprungen. Sie schaffte es, die Sinnesfreuden dieses Tages – Essen, Trinken und Geselligkeit – ohne Wenn und Aber zu genießen. Mehr noch, sie verliebte sich in den Mann, der all jene Eigenschaften besaß, die ihr fehlten, der sie aus ihrer traurigen Lethargie riss. Sie bewunderte seine Leichtlebigkeit, dieselbe Leichtlebigkeit, die sie später ihrem Mann als das fürchterlichste aller Laster ankreidete.
An diesem Tag jedoch fühlte sich Großmutter von seiner Aufmerksamkeit geschmeichelt und suchte ihm zu gefallen. Unerfahren im Umgang mit Männern, sie hatte bislang nicht die kleinste Liebelei gehabt, erlag sie seinen Komplimenten. Erstmals in ihrem Leben hielt sie sich als Frau für schön und begehrenswert. Beschwipst von der Bowle, ließ sie sich von ihm küssen, dass ihr der Atem zu versagen drohte. Max Ludewig, das hätte sie an diesem Tage geschworen, war der Mann all ihrer Träume.
Dennoch beantwortete sie Max’ Frage nach einem Wiedersehen sehr vage. Genau genommen schien ein Wiedersehen unwahrscheinlich. Gertrud Behringer, die älteste Tochter des hiesigen Doktors, studierte, auf Wunsch ihres Vaters, in Rostock Medizin. Doktor Behringer wollte sie gern in seinen Fußstapfen stehen sehen, die Familientradition fortgesetzt wissen. Sie hatte sich dem väterlichen Wunsch widerspruchslos gefügt und gar nicht versucht, eigene Interessen zu artikulieren. Wäre ihr Bruder nicht beim Baden ertrunken, dann wäre ihr das Studium erspart geblieben und sie hätte, wie es ihren eigentlichen Plänen entsprach, in einem Büro als Sekretärin arbeiten können, bis sich ein Mann zum Heiraten gefunden haben würde. Es hatte jedoch nicht sein sollen.
Gertrud wohnte also gar nicht mehr in Goldberg. Ihre und Max Ludewigs Wege, die sich eben erst berührt hatten, drifteten bereits wieder auseinander. Wo sollten sie sich denn wiederbegegnen? Alles würde einmalig bleiben. Diese Aussicht verlieh dem Abend und dem jungen Mann alsbald eine märchenhafte Aura. Gertruds Träume von dem jungen Mann, den ein Zufall ihr für einen Tag beschert hatte, würden bald verblassen. Irgendwann würde sie einen anderen kennen lernen, der vielleicht zum Ehemann taugte.
Großmutters allzeit nüchterner Realismus gewann rasch die Oberhand: Max Ludewig, das war einmal!
Angesichts dieser Erkenntnis verspürte sie keine übermäßig große Trauer. Ewald Klötzes Hochzeit hatte ihr einen unerwartet schönen Tag beschert, an welchem so etwas wie ein Wunder geschah. Ein schöner Mann hatte sie umworben. Das erlebt zu haben, tat ihr wohl, sie würde es nie vergessen. Allein, um eine Fortsetzung des Wunders zu kämpfen, lag nicht in Gertruds Naturell, dazu war sie zu wenig emanzipiert und zu wenig eine Frau der Tat. Freilich, wenn sich von selbst eine Fortsetzung ergäbe, dann wäre sie nicht abgeneigt. Doch an welchem Ort sollte das geschehen? Es war besser, sich Max Ludewig gleich aus dem Kopf zu schlagen.
Eines Tages, Gertrud befand sich mit einer Kommilitonin in Rostock auf dem Weg zur Vorlesung, da begegnete ihr Max Ludewig. Er sah blass aus, um die rechte Hand trug er einen schneeweißen Verband. Er schlenderte in Gedanken versunken über die Straße. Hätte Gertrud ihn nicht angesprochen, er wäre achtlos vorübergegangen und ihrer beider Leben hätte einen anderen Verlauf genommen.
Warum sie Max anredete, das vermochte sie nie genau zu sagen. Vermutlich wollte sie Rita imponieren, vor ihr nicht länger als Mauerblümchen dastehen. Rita war eine sehr attraktive Brünette, die über mangelndes Interesse von Seiten ihrer männlichen Kommilitonen nicht klagen konnte. Sie wurde umschwärmt. Gertrud wollte dieser allseits bewunderten Frau beweisen, dass auch sie durchaus Chancen bei attraktiven Männern besaß.
Max’ Gesicht hellte sich sofort auf, als Gertrud ihn ansprach. Aus seinen Augen blitzte ein Lachen. Er lud die beiden Frauen sogleich auf einen Kaffee und Kuchen in eine nahe Konditorei ein. Er unterhielt sie gutgelaunt, nichts erinnerte mehr an den nachdenklichen Mann von vorhin. Auf Ritas Nachfrage erklärte er die Funktion des Verbandes: er habe sich am Vortag mit der Kreissäge den Ringfinger abgesägt.
„Ein Arbeitsunfall“, fasste er lapidar zusammen. „An einer elektrischen Säge darf man nicht träumen.“
„Wie interessant, ein Mann, der träumt“, buhlte Rita um Max’ Aufmerksamkeit und weckte Großmutters Ehrgeiz, Rita diesen Mann keinesfalls zu überlassen.
Erstmals in ihrem Leben verspürte Gertrud einen Anflug von Eifersucht. Sie drängte darauf, die Vorlesung nicht zu versäumen, erhob diese zu ungeheurer Wichtigkeit. Alles in ihr riet ihr, Rita sofort von Max zu entfernen, wollte sie ihre eigenen Chance auf jenen Mann, der in ihrer Fantasie bereits zu einem Prinzen verklärt war, nicht verspielen.
Instinktiv hatte Gertrud Max’ Hingezogensein zu der lebenshungrigen Rita bemerkt. Sie verstand Max’ Interesse durchaus. Rita war eine schöne Frau, mit einem sehr weiblichen Körper und einem fröhlichen Naturell. Sie nahm das Leben nicht allzu schwer und passte insofern gut zu Max Ludewig. Dennoch glaubte Großmutter, ein Vorrecht auf Max zu besitzen, denn schließlich hatte sie ihn gefunden.
Sie bat Rita, schon mal vorzugehen und verabredete sich beim Abschied für den Sonnabend mit Max zum Tanz. Sie versprach, ihre Freundin mitzubringen. In Wirklichkeit dachte Gertrud allerdings keinen Moment daran, ihr Versprechen zu halten. Aufmerksam hatte sie registriert, dass Max an Rita Gefallen gefunden hatte und mit dem Versprechen lediglich einen Köder ausgeworfen, den Max gutgläubig schluckte.
Am Sonnabend, beim Tanz, verleugnete sie die Freundin schamlos. Sie erzählte, Ritas Verlobter sei auf Besuch gekommen, denn Rita erwarte ein Kind und müsse möglichst rasch heiraten. Was sie zu dieser Lüge trieb, das wusste sie nicht, denn ehrlich gesagt, glaubte Gertrud nicht ernsthaft, Max auf Dauer an sich fesseln zu können. Dennoch trafen sie sich fortan öfter zum Tanzen und tasteten sich in den Gesprächen langsam ab. Gertrud freilich hatte nicht viel zu erzählen. Sie studierte Medizin. Sie war dem Elternhaus entkommen, in welchem die Mutter nach mehr als fünfzehn Jahren noch immer verbissen um den toten Bruder barmte und allen Frohsinn verdammte. Irgendwann, die Frist war absehbar, würde Gertrud das Studium beenden. Das Einzige was sie sicher wusste, war: Zurück nach Goldberg wollte sie auf keinen Fall.
Max arbeitete in einer Möbelfirma in Rostock. Er wohnte mit anderen Männern zusammen in einem Arbeiterwohnheim, in welchem er sich nicht wohl fühlte. Max Ludewig liebte den Luxus und ein gutes Leben. Das Wohnheim war ihm zu spartanisch, das Eingepferchtsein und die Provisorien behagten ihm nicht und doch gedachte er noch ein paar Jahre zu bleiben, billig zu hausen und gutes Geld zu verdienen. Mit dem Geld plante er, sich irgendwo am Wasser ein modernes und geräumiges Haus zu bauen. Er entwarf vor Gertrud ein Bild dieses Hauses, ließ sie in Gedanken mit ihm durch die Zimmer wandeln und durch die großen, blanken Fenster hinaus auf die weite Wasserfläche schauen. Er ahnte nicht, dass sich Gertrud in seinen Träumen verfing, dass sie sich wie Netze um Gertrud schlangen: Ein großes Haus bewohnen, morgens schon das Wasser zu sehen – das erschien ihr beinahe noch anziehender als der überaus attraktive Mann, der vom Hausbau träumte. Sie wollte das Haus und den Mann, der ihr genau dieses Haus bauen würde!
Es war das erste Mal, dass Gertrud Behringer etwas unbedingt wollte. Sie entwickelte fortan einen ungeahnten Ehrgeiz, Max zu treffen, sich ihm anzuempfehlen und sich ihm unentbehrlich zu machen. Wie sie es auch bedachte, das sicherste Mittel einen Mann an sich zu binden war ein Kind. Sie musste unbedingt schwanger werden, dann würde Max Ludewig sie heiraten, ihr das Haus bauen müssen.
Bei den Tanzvergnügungen gab sie nunmehr einen Gutteil ihrer bisherigen Zurückhaltung auf. Sie kokettierte und flirtete so gut sie es vermochte mit Max und sie nahm ihn heimlich nach den Tanzvergnügen mit in das möblierte Zimmer, welches sie in der Südstadt bewohnte. Zwar waren Herrenbesuche strikt verboten, aber um diese Zeit schlief die alte Witwe Loeser tief und fest. Morgens, ehe die alte Frau aufstand, war Max, ein leidenschaftlicher Frühaufsteher, längst gegangen.
Mit Männern völlig unerfahren, war Max Ludewig der erste Mann in Großmutters Leben und er sollte auch der einzige darin bleiben.
Mag sein, dass Gertrud unter anderen Umständen Sexualität irgendwann als etwas überaus Schönes und Lustvolles hätte erfahren können. Für sie blieb Sex zeitlebens ein Muss und sie verstand nicht, was die Menschen am Sex in solch einen Rausch versetzte, dass erwachsene Männer und Frauen die absurdesten Tollheiten begingen. Vielleicht spielte ihr Beruf, die Nüchternheit bei der Begutachtung von menschlichen Körpern, vielleicht ihre puritanische Erziehung durch die eigene Mutter eine Rolle bei ihrer lebenslangen Voreingenommenheit gegenüber allen sexuellen Regungen. Auch waren ihre ersten sexuellen Erfahrungen nicht eben dazu angetan, Neugier und Lust aufeinander zu wecken. Sex verkörperte für sie zuerst Anstrengung und Mühsal: Der kraftvolle und drängende Mann musste gebändigt, ihre Angst, von der Witwe Loeser durch die dünnen Wände gehört zu werden, beherrscht werden, was sie immerfort dazu verleitete, zu lauschen, ob das Schnarchen der alten Frau noch anhielt. Jeder lustvolle Laut, jedes Lachen oder Stöhnen musste unterdrückt werden. Hinzu kam der verzweifelte Versuch, schnell schwanger zu werden, der sie völlig verkrampfen und ständig auf ihren eigenen Körper achten ließ. Unter diesen Voraussetzungen konnte sich einfach keine Lust einstellen.
Trotz Gertruds intensiver Bemühungen, obwohl sie allen sexuellen Wünschen von Max Ludewig nachgab, selbst jenen, die ihr Schamgefühl verletzten, wurde und wurde sie einfach nicht schwanger. Längst hatte sich ihr Vorrat an Geduld erschöpft. Sie befasste sich ernsthaft mit dem Gedanken, aufzugeben. Ihr waren die Nächte mit Max über. Sie verstand nicht, woher dieser Mann seine sexuellen Energien nahm, warum sie sich nicht abnutzten oder erschöpften. Sie wollte endlich ihre Ruhe haben, sollte er sein Haus getrost für eine andere bauen. Innerlich begann sie, sich damit abzufinden, Max über Kurz oder Lang zu verlieren. Alle Hoffnungen auf eine Schwangerschaft gab sie verloren, da war sie eines Tages doch schwanger geworden.
Nun wurde ihr die Zeit knapp. Sie musste das Studium abschließen, die Prüfungen bestehen noch ehe das Kind geboren wurde. Das schaffte sie gerade noch rechtzeitig.
Ende November des Jahres 1951 heirateten Gertrud und Max in aller Stille. Das große rauschende Fest, das Gertrud sich in ihren Jungmädchenträumen einst ausmalte, sie ganz in Weiß und im Mittelpunkt, bewundert und beneidet von ihren Altersgefährtinnen, fiel aus. Zum einen war es eine Illusion gewesen, dass sie mit ihrem dicken Babybauch eine bewunderte Braut abgegeben hätte, zum anderen schickte sich kein rauschendes Fest während der Trauerzeit.
Im Sommer des Jahres hatte sich Max’ Vater im Wald erhängt. Er hatte das drückende Schweigen über die Geschehnisse jener Nacht, da seine Frau und seine Tochter vergewaltigt wurden, nicht mehr ertragen. Niemals hatte er Anzeige erstattet, zu keinem Außenstehenden ein Wort verloren, um – wie er meinte – den Frauen die Schande zu ersparen. Er fühlte sich zutiefst schuldig. Hätte wenigstens seine Frau ihn zeternd angeklagt, vielleicht hätte er dann leben können. In der schreienden Stille ihres Schweigens hingegen vermochte er nicht mehr zu atmen.
Auf dem Standesamt von Goldberg wurden Gertrud und Max im Beisein von Gertruds Eltern und ihrer Schwester getraut. Auf den kirchlichen Segen verzichtete das junge Paar, sehr zur Freude von Gertruds Vater, einem überzeugten Freidenker.
Von Max’ großer Verwandtschaft war lediglich seine Mutter bei der Trauung anwesend.
Gertruds Eltern mochten Max. Vor allem ihr Vater war von seinem Schwiegersohn sehr angetan. Alfred Behringer erkannte in ihm sogleich eine verwandte Seele. Er war zutiefst davon überzeugt, dass sein Schwiegersohn die hochfliegenden Pläne, welche er hegte, mit Elan verfolgen würde. Der Junge besaß einen äußerst scharfsinnigen Verstand und zumindest finanziell würde es Gertrud, seiner Tochter, künftig an nichts fehlen. Allein ob sie tatsächlich zu Max passte, das bezweifelte selbst der Vater innerlich. Er fand seine Tochter stets eine Spur zu asketisch und kühl, zu wenig weiblich und aufreizend, als dass er sie für eine gute Partie hielt. Leider ähnelte sie ihrer Mutter allzusehr, nicht nur äußerlich. Sie gab sich wie diese: herb, streng, unnachsichtig, ja geradezu pedantisch und kalt. Dieser lebensfrohe Schwiegersohn würde es vielleicht schaffen, seiner Tochter Leben einzuhauchen, etwas, was er bei der eigenen Frau vergebens versucht hatte. Und sollte sich Gertruds puritanische Erziehung als stärker als die Lebensfreude des Schwiegersohns erweisen, nun dann würde dieser, wie er selbst es getan hatte, andere Gespielinnen zu finden wissen.
Es mochte irgendwo eine lichte Zukunft auf Max Ludewig warten, allein zum Zeitpunkt seiner Hochzeit besaß er schlichtweg nichts außer einem modischen Anzug, einem Motorrad mit Seitenwagen, eine hochschwangere Frau und einen Himmel voller Träume. Vor allem besaßen Max und Gertrud als Paar keine Bleibe, das bedrückte Gertrud am meisten. Anfang Februar sollte sie niederkommen, aber wo? Natürlich bliebe ihr die elterliche Villa als Zufluchtsort, aber sie verbot sich, diese Variante auch nur zu denken. Das Studentenzimmer in Rostock überließ ihr die Witwe Loeser auch für die Zeit des Facharztpraktikums, doch für ein Kind war darin wahrlich kein Platz.
Versuchte sie mit Max über das Thema zu reden, wiegelte er ab. Er sah nirgends ein Problem. Einstweilen würden sie bei seiner Mutter unterkommen, die gerade im Begriff stand, aus dem Forsthaus in Kogenhagen nach Geestade, in den windschiefen Katen ihrer Eltern, einzuziehen. In dem Haus am Wald, in welchem Max’ Mutter mehr als ein halbes Menschenleben verbracht hatte, konnte sie nach dem Tod ihres Mannes plötzlich nicht mehr leben. Sie fürchtete sich weniger vor nächtlichen Eindringlingen als vielmehr vor dem Geist des Verstorbenen. Als Zufluchtsort wählte sie Geestade, das Dorf ihrer Kindertage. Sie ahnte, dass ihr Aufenthalt dort nicht von langer Dauer sein würde. Der Zahn der Zeit hatte an dem Haus, das seit dem Tod ihrer Mutter leer stand, genagt. Vor allem das Dach und die Fenster waren lädiert, aber so lange sie lebte, würde das Haus standhalten und hernach mochte es getrost der Wind forttragen.
Max, der nicht nur gut aussah, sondern auch über handwerkliches Geschick verfügte, hatte den Katen im Sommer für seine Mutter instand gesetzt, nicht ganz selbstlos, wie er offen einräumte. Er spekulierte insgeheim auf das großelterliche Anwesen. Hier, auf diesem Stück Land sollte sein Traum vom Haus am Wasser dereinst wahr werden. Er liebte diesen Flecken Erde innig. Als kleiner Junge hatte er die Schulferien hier verbracht. Aus diesen Tagen besaß er bis heute treue Freunde und einen riesigen Vorrat an guten Erinnerungen. Geestade erschien ihm wie ein Versprechen auf das einstige Kindheitsglück.
Gründlich wie er war, verständigte er sich mit seinen Schwestern darauf, dass er die Mutter und das großelterliche Anwesen übernehmen werde. Keine von seinen drei Schwestern brannte darauf, den alten, windschiefen Katen zu besitzen. Ihre Mutter gut versorgt zu wissen, kam derweil ihren eigenen Interessen entgegen. Max regelte alles juristisch korrekt, die Zukunft allzeit fest im Blick.
Im Februar des Jahres 1952, in einer klaren, frostigen Winternacht, wurde Griseldis, Großmutters älteste Tochter, meine Tante, in ebendiesem Katen geboren. Als die Hebamme aus der Stadt eintraf, lag das kleine Mädchen bereits gewickelt in der Wiege und Gertrud erschöpft in den dicken Federkissen ihrer Schwiegermutter. Zu Großmutters Erschöpfung gesellte sich Scham. Während der letzten Stunden des Geburtsvorgangs hatte sich Großmutter nicht souverän wie eine angehende Ärztin aufgeführt. Der Schmerz und die endlose Dauer der Wehen hatten sie zermürbt und zu hysterischen Weinkrämpfen getrieben, welche der stummen Schwiegermutter die Sprache wiedergaben.
„Is doch gaud, min Deern“, hatte die Schwiegermutter immer wieder beschwichtigend auf ihre Schwiegertochter eingeredet.
Sie hatte sich als überaus lebensklug und praktisch erwiesen und das Kommando übernommen. Mit ihren von der Arbeit harten Händen hatte sie Trost und Zuversicht gespendet, mit ihrer Stimme zum Durchhalten motiviert. Schließlich hatte sie fachgerecht die Nabelschnur durchtrennt und das kleine Mädchen mit einem ganzen Schwall von Koseworten willkommen geheißen.
So viele Worte wie in dieser Nacht hatte die Schwiegermutter in all den Monaten, die Gertrud sie nun kannte, noch niemals gesprochen. Es schien, als habe sich mit der Geburt ihrer Enkelin die Zunge aus ihrer Erstarrung befreit.
Zweifellos, das erkannte Großmutter augenblicklich, war die kleine Griseldis bei ihrer Schwiegermutter in guten Händen. In aller Ruhe konnte sie selbst nach ein paar Wochen der Erholung zurück nach Rostock fahren und das Facharztpraktikum beginnen.
Der gutmütigen alten Frau, der keine Arbeit jemals zuviel wurde, bedeutete die Kleine eine unendliche Freude. Sie hielt den alten Katen blitzsauber, sie setzte den verwilderten Garten instand, sie pflanzte und säte, sie kochte und wusch und sprach dabei immerfort mit der Kleinen oder sang ihr mit brüchiger Greisinnenstimme alte Kinderweisen vor.
Max arbeitete inzwischen im Sägewerk in der nahen Kreisstadt und wohnte, zusammen mit seiner Mutter und seiner Tochter, im Katen.
Gertrud, meine Großmutter, kam lediglich an den Wochenenden, an denen sie keinen Dienst hatte, mit der Bahn nach Geestade gefahren. Dann überschüttete sie das Kind, das fremdelte, mit Zärtlichkeiten, die ihrem schlechten Gewissen entsprangen. Sie spielte gedankenlos mit ihm und war zugleich froh, wenn das Wochenende vorüber war, wenn sie dem engen Katen entfliehen und sich in das Zimmer, das nur ihr gehörte, zurückziehen konnte. Dieses Zimmer in Rostock, wo sie nach Feierabend keinerlei Verpflichtungen unterlag, erschien ihr wie das Paradies auf Erden. Wenn sie sagen sollte, was sie in diesem Zimmer trieb, es fiele ihr schwer. Sie schlief lange, sie verlor sich in Tagträumen.
Bereits in den ersten Monaten ihres Ehelebens befiel Großmutter der Verdacht, dass sie den Mann, dessen Namen sie nun trug, wenig kannte. Der Verdacht verhärtete sich immer dann, wenn sie für den kurzen Zeitraum von ein oder zwei Tagen in Geestade weilte. Max schien ihr dann seltsam fremd.
Sein Äußeres blieb unverändert, auch die Charakterzüge erwiesen sich als konstant. Wenige Monate hatten ihm genügt, sich in Geestade zu etablieren. Jedermann im Ort kannte und grüßte ihn und umgekehrt kannte er alle Einwohner. Er hatte in der kurzen Zeit seit seiner Rückkehr Ideen und Visionen für den Ort und seine Einwohner entwickelt, Mitstreiter um sich geschart. Nicht allein, dass er die freiwillige Feuerwehr neu organisierte, er kämpfte um ein Gemeindehaus mit Kindergarten und Arztpraxis. Er setzte sich für die Belange der Leute vor Ort ein und verlor dabei seine eigenen Interessen zu keinem Zeitpunkt aus dem Blick. In der hiesigen Arztpraxis, die bislang nur in seinen Vorstellungen existierte, sah er seine Frau wirken. Es behagte ihm keineswegs, eine Wochenendbeziehung zu führen. Max Ludewig war ungeachtet seiner Machoallüren ein sehr liebebedürftiger Mann. Er wünschte sich, nachts die Wärme seiner Frau zu spüren, er sehnte sich nach Streicheleinheiten, kurzum: nach dem Ende von Gertruds Facharztpraktikum.
Großmutter würdigte diese Seite von Max’ Engagement nicht. Sie sah nur, dass er immerfort unterwegs war. Sie sah es mit Eifersucht. Nicht, dass sie ihm eine Liebschaft unterstellte, aber sie registrierte, dass ihr Mann bei Alt und Jung beliebt war, während man ihr kühl und abwartend begegnete. Die fragenden Blicke der Dorfbewohner behagten ihr nicht. Sie fühlte sich taxiert und an ihrem Mann gemessen, so wie sie in Goldberg an ihrem Vater gemessen worden war. Die Neugier der Einwohner verursachte ihr Bauchschmerzen. Sie war stets froh, Geestade nach dem Wochenende zu entkommen, in die Anonymität der Stadt abzutauchen.
Ihr Unbehagen in Geestade wurde noch aus einer anderen Quelle gespeist. Sie fürchtete sich vor ihrem Mann, vor seinem Verlangen. Er drängte und forderte zu jeder Tageszeit Sex. Er zog und drängte sie in Ecken, in denen er sich unbeobachtet wähnte, er übergoss sie mit Küssen und schob seine Hände verlangend unter ihre Kleider. Sie jedoch kam seinem Verlangen noch gehemmter als in den Rostocker Jahren nach. Nicht allein, dass sie eine zweite Schwangerschaft fürchtete, stets mutmaßte sie, ihre Schwiegermutter überwache jede ihrer Aktivitäten mit Argusaugen. Sie ließ sich ungern auf ein Liebesspiel ein, tagsüber im Freien nicht und nachts im Ehebett auch nicht. Hinter einer dünnen Bretterwand, in der zweiten Dachkammer, schliefen Max’ Mutter und Griseldis. Das Wissen um die Nähe der Schwiegermutter stellte für Großmutter eine unüberwindliche Hemmschwelle dar. Sie versteifte sich unter Max’ Zärtlichkeiten, sobald sie an ihre Schwiegermutter dachte, und ließ ihn lediglich lustlos gewähren. Max bemerkte ihre kühle Abweisung durchaus und befragte sie nach den Gründen.
„Deine Mutter kann uns hören“, lautete die leise geflüsterte Erklärung.
„Das war früher nicht anders, auch da haben die Eltern und Kinder einander gehört. Das hat ihrer Lust aber keinen Abbruch getan. Denk nicht an sie, lass dich einfach fallen.“
Sicher hatte Max Recht, aber Gertrud konnte nicht aus ihrer Haut heraus. Sie war nicht fähig und nicht gewillt, jene gedankliche Barriere zu überschreiten. In den Nächten blieb Gertrud steif und unbeteiligt und am Tage, wenn Max versuchte sie ins Bett zu ziehen, lehnte sie sein Ansinnen als unschicklich ab. Noch bot ihr das Praktikum einen Schutzraum, eine Fluchtburg. Jedoch die Facharztausbildung endete viel zu früh. Großmutter zog endgültig nach Geestade, in den Katen. Sie kam in einen fremden Ort, zu einem fremden Mann. Sogar ihr Kind verkroch sich schüchtern in den Röcken seiner Oma. Was sollte sie hier?
Am liebsten wäre sie gleich am ersten Tage für immer entflohen. Doch wohin sollte sie gehen? Sie fürchtete die Verachtung, die man einer Frau, welche Mann und Kind verließ, offen entgegenbringen würde. Das Pflichtbewusstsein und die Angst hielten sie mit unsichtbaren Fäden gefangen.
Gertrud Ludewig bekam in der Poliklinik der Stadt eine Arbeitsstelle zugewiesen, die ihr einen neuerlichen Fluchtweg eröffnete. In der Stadt praktizierte Gertrud in einem eigenen Praxisraum. Die Arbeit gefiel ihr, auch der räumliche Abstand zu Geestade und seinen Einwohnern. Der tägliche Arbeitsweg mit dem Bus belastete sie nicht. Griseldis wusste sie gut von der Oma betreut. Die Oma, Frida Ludewig, kümmerte sich auch um die Einkäufe und den Haushalt. Gertrud konnte sich als junge Ärztin ganz und gar auf ihre Arbeit konzentrieren. Oder sollte ich sagen, sie konnte sich in ihre Arbeit verkriechen?
Das Leben von Max hatte sich durch Gertruds tagtägliche Anwesenheit wenig verändert. Er fuhr morgens zur Arbeit in die Kreisstadt und abends, nach Feierabend ging er ins Dorf zu seinen Gefährten. Erst gegen Mitternacht kehrte er heim, kroch er lautlos zu seiner Frau ins Bett und bedrängte sie mit seinem leidenschaftlichen Verlangen.
Als ob sie dem Eheglück ihres Sohnes nicht weiter im Wege stehen wollte, schlief eines Nachts Frida Ludewig ein, um nie mehr zu erwachen.
Durch Fridas Tod lernte Gertrud nun endlich die gesamte Familie ihres Mannes kennen. Bis dahin war lediglich seine jüngste Schwester, Annelies, hin und wieder aus dem nahen Zingst gekommen, um ihre Mutter zu besuchen. Allerdings hatte Gertrud Annelies nur ein einziges Mal gesehen. Die Begegnung lag lange zurück. Damals war Griseldis gerade erst geboren und Annelies kam, um ihrer Schwägerin einen Wochenbesuch abzustatten und das kleine Mädchen in der Familie willkommen zu heißen. Gertrud fand Annelies und die Geste gleichermaßen nett. Diese unkomplizierte, freundliche Frau ihres Alters konnte sich Großmutter durchaus als eine unaufdringliche Freundin vorstellen. Die anderen beiden Schwestern ihres Mannes kannte Großmutter lediglich dem Namen nach und aus Erzählungen.
Auf dem Friedhof traf Gertrud sie nun alle: Ingelore und Horst, Max’ älteste Schwester und deren Mann, Else und Gerhard, die im amerikanischen Sektor von Berlin wohnten und Annelies und Friedhelm. Alle drei Töchter von Frida Ludewig sahen ihrer Mutter sehr ähnlich. Schon jetzt, in jungen Jahren, neigten sie dazu, in die Breite zu gehen. Alles an ihnen war rund, weich und sehr weiblich. Die munteren graublauen Augen waren dieselben wie bei Frida und selbst die Zahnlücke zwischen den oberen Schneidezähnen wies sie unverkennbar als Fridas Töchter aus. Genau wie ihre Mutter besaßen alle drei ein unkompliziertes, freundliches Wesen und einen feinen, hintersinnigen Humor. Sie lachten gern und strahlten Wärme und Güte aus. Die Gesamtheit all dieser Eigenschaften verlieh jeder der drei Töchter eine eigenwillige Schönheit und Attraktivität, der auch Gertrud sich nicht zu verschließen vermochte. Keine der Schwestern wirkte hässlich oder gar abstoßend. Sie besaßen alle drei das gewisse Etwas; sie verkörperten selbstbewusste junge Frauen, die sogar ihrer allzeit nüchternen Schwägerin, Gertrud, irgendwie imponierten. Neidlos musste sie sich eingestehen, dass Max’ Schwestern in ihrer üppigen Weiblichkeit um ein Vielfaches schöner und anziehender wirkten als sie selbst.
Bei den anwesenden Paaren zogen die Frauen die Aufmerksamkeit auf sich, lediglich bei ihr und Max war es umgekehrt. Max, der große und schlanke Mann mit den feinen Gesichtszügen und der angenehmen dunklen Stimme, zog alle Blicke an. Neben ihm wirkte Gertrud klein, grau und unscheinbar wie eine Maus. Niemand schien sie zu beachten und da sie sich selten in Gespräche einbrachte, verfestigte sich dieser Eindruck. Gewiss mutmaßten viele Geestader, was Max an dieser unscheinbaren, blassen Frau finde. Reizlos indes wirkte keine ihrer drei Schwägerinnen, im Gegenteil. Bei ihnen drohten die Männer an ihrer Seite ein wenig unterzugehen.
Horst, Ingelores Mann, war ein hagerer Pantalon. Er hinterließ bei Gertrud einen intellektuellen, doch verschlossenen Eindruck. Selbst in Gesellschaft sprach er kaum. Wer ihn nicht kannte, konnte meinen, Horst sei stumm. Er saß schweigend in den Gesprächsrunden. Selbst wenn es hitzig zuging, beschied er sich zumeist mit der Zuhörerrolle. Kein Außenstehender vermutete in Horst einen klugen und scharfsinnigen Denker. Horst arbeitete in irgendeiner Behörde und behauptete hartnäckig von sich, zwei linke Hände zu haben. Er vermochte keinen Nagel in die Wand zu schlagen, verstand jedoch zur Freude der Verwandten recht passabel Akkordeon zu spielen. Zu ihm gelang es Großmutter nie, eine wirkliche Beziehung aufzubauen. Horst blieb ihr fremd. Er starb jung, mit gerade einmal vierzig Jahren.
Ähnlich verhielt es sich mit ihrem Schwager Gerhard, Elses Mann. Gerhard war ein molliger, lebenslustiger und geselliger Mensch, allerdings standen die Berliner Mauer und die wenigen Möglichkeiten, einander zu treffen, einer engen Beziehung im Wege.
Nur zu Annelies’ Mann, Friedhelm, entstand bereits bei der ersten flüchtigen Begegnung etwas, das Gertrud gleichermaßen beunruhigte und erfreute.
Beim Leichenschmaus für die tote Schwiegermutter, Gertrud als Hausfrau hatte in der guten Stube des Katens den Tisch gedeckt und goss gerade Kaffee ein, da berührten sich ihre und Friedhelms Blicke einen Moment lang und versetzten Gertrud in einen Zustand, den sie selbst im Nachhinein kaum in Worte zu kleiden vermochte. Ihr war, als habe jemand eine unsichtbare Brücke von diesem Mann zu ihr geschlagen, die zu betreten sie sich insgeheim fürchtete und zugleich ersehnte. Ihr Herz begann aufgeregt zu klopfen. Alles in ihr schwang in der wunderbaren Spannung, die von diesem Mann ausging. Vor Aufregung röteten sich ihre Wangen und eine Woge ungeahnter Zärtlichkeit für den Fremden brandete in ihr auf, als dieser sie vertraut anredete: „Danke Trudi. Ich hoffe doch, dass wir uns demnächst bei einem freudigeren Anlass sehen.“
Vor allem die Anrede „Trudi“ wirkte wie ein sanftes Streicheln ihres strengen Gesichts.
Trudi, so hatte sie niemand jemals genannt. Gertrud, Trude, Gerte, das waren Rufnamen, die man ihr im Laufe des Lebens gegeben hatte, Namen, die ihrem herben Wesen entsprachen.
Trudi, das klang verspielt, neckend. Es klang zärtlich und verheißungsvoll in Gertruds Ohren. Wie ein Versprechen erschien der Kosename meiner Großmutter. Der Name allein berührte etwas in Gertrud, das sie angenehm durchflutete, er erweckte etwas in ihr, das bislang verborgen lag, etwas, das ihr gefiel. Sie fühlte sich augenblicklich zu dem Unbekannten hingezogen, fühlte sich ihm nahe, von ihm in ihrem innersten Sehnen verstanden. Es war, als habe der Prinz, auf den sie seit Ewigkeiten sehnsüchtig wartete, endlich, nach tausend Irrwegen im Labyrinth, doch noch zu ihr gefunden.
Gertrud Ludewig, eine allzeit nüchtern denkende Frau, die ihre Gefühle jederzeit unter Kontrolle hatte, verliebte sich an diesem traurigen Tag in diesen, ihr ganz und gar fremden, Mann, ihren Schwager Friedhelm Mertens.