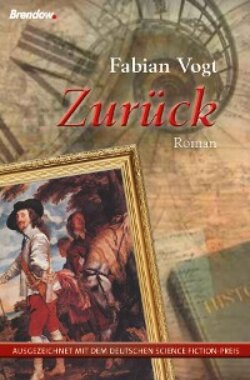Читать книгу Zurück - Fabian Vogt - Страница 7
Оглавление1635 Ich reise. Ich reise durch die Zeit, genauer gesagt: in die Vergangenheit. Ich tauche ein in die Geschichte und versuche verzweifelt, nicht darin unterzugehen. Denn so sehr ich mich auch dagegen wehre: Meine Uhr springt zurück, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Unaufhaltsam falle ich durch die Jahre. Dafür muss es einen Grund geben, ich weiß nur noch nicht, welchen. Aber ich werde es herausfinden.
Der Künstler Antoon Van Dyck, den ich vor fünf Tagen an Bord des Fährschiffs „Marian“ kennen gelernt habe, hat Recht behalten. Er behauptete, er habe mir einige Jahre zuvor geholfen, meine Erfahrungen aufzuschreiben. Und tatsächlich: Ich sitze in einem kleinen, verwinkelten Raum neben seinem Atelier und schreibe auf seinem Zeichenpapier mit einer Feder, die er mir geschenkt hat. Das ist ein gutes Gefühl. Zum ersten Mal seit dem Beginn meiner widersinnigen Wanderung habe ich ein Ziel: Ich werde alles aufschreiben, was mir auf den Stationen meiner Wanderung widerfahren ist, denn vielleicht stoße ich dabei auf eine Spur, einen Hinweis, irgendetwas, das mir hilft, das Unglaubliche zu verstehen.
Wie warm es hier ist. Von allen Seiten starren mich Theatermasken an und lächeln über den einsamen Schreiberling, der sich an seiner Feder festhält wie an einem Rettungsring. Draußen schlägt eine Glocke, eins, zwei, drei, vier … zehnmal, und die Schläge hallen in dem dunklen Gewölbe nach.
Gerade ist mir bewusst geworden, welches Jahr wir heute haben: 1635. Ich wage kaum, diese Zahl noch einmal hinzuschreiben. Denn sie ist etwas Besonderes, ein kleiner Haltepunkt in meinem dahintreibenden Dasein. Heute bin ich genau 365 Tage in die Vergangenheit vorgedrungen, ein Jahr meines aus der Zeit gerissenen Lebens. Aber 365 Jahre der Geschichte, denn jeden Morgen, wenn ich aufwache, ist der Kalender genau um ein Jahr zurückgesprungen. Dann reibe ich mir jedes Mal die Zukunft aus den Augen und versuche, mich so gut wie möglich in der neuen Situation zurechtzufinden.
Zum Glück hat sich in meiner Umgebung meist wenig geändert. Manchmal tauschen die Möbel ihre Position, Pflanzen schrumpfen zusammen und Farben leuchten kräftiger. Geografisch wache ich aber immer an dem Platz auf, an dem ich am Abend zuvor eingeschlafen bin. Darum habe ich so große Angst, die Zeit um Mitternacht auf einem Schiff zu verbringen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Jahr vor meiner Abfahrt an der Stelle meines „Zurück“, wie ich diesen unerklärlichen Sprung für mich nenne, gerade wieder ein Fahrzeug befindet, ist doch eher gering, und ich konnte noch nie besonders gut schwimmen. Mein Sportlehrer hat mir damals sogar abgeraten, irgendein Abzeichen, ich glaube, es hieß „Seepferdchen“, zu machen, weil ich im Wasser immer wie ein Walross schnaubte. Das ist ewig her.
Nein! Das stimmt nicht … ich werde mich wohl nie daran gewöhnen, es richtig auszudrücken: Das ist nicht ewig her, das wird erst in einer Ewigkeit passieren. Da ich in der Zeit zurück reise, ist meine Vergangenheit die Zukunft der Welt und umgekehrt: Die Vergangenheit der Welt ist meine Zukunft. Ich weiß im Jahr 1635 ganz genau, was im Jahr 1640 passieren wird, denn von dort komme ich; die Menschen aber, die ich dann treffe, wissen sehr genau, was mich im Jahr 1630 erwartet, denn diese Zeit haben sie schon hinter sich. Wir nähern uns einander aus entgegengesetzten Richtungen – und ich bin der, der die Zusammenstöße vermeiden muss. Wenn ich erst einmal weiß, wer (oder was) hinter dieser Reise steckt, dann wird es mir auch leichter fallen, sie zu ertragen.
Ich werde mehr Tinte brauchen.
Ich kam nach London, weil ich dem Dreißigjährigen Krieg ausweichen wollte. Ich hatte keine Lust, mich mit diesem ganzen politischen Unsinn zu beschäftigen. In Europa wütet das Böse und trägt dabei wechselweise katholische oder protestantische Kleider, während sich England geschickt aus den Wirrungen heraushält.
Wenn man wie ich die Geschichte im Zeitraffer und zugleich im Rückwärtsgang erlebt, verliert vieles an Bedeutung. Ich verbringe in jedem Jahr nur einen Tag und werde dann schon wieder herausgerissen. So rast die Historie an mir vorbei und beraubt sich damit selbst ihrer Bedeutung. Warum sollte ich etwas ernst nehmen? Ein Menschenleben währet 70 Tage, und wenn‘s hoch kommt, so sind es 80 Tage, und am Ende bleibt nichts als Angst, Elend und Hoffnungslosigkeit. Es ist doch alles sinnlos. Jeder Lichtblick, den ich erhasche, verweist nur auf den nächsten Schatten.
Mitte diesen Jahres wird es beispielsweise so aussehen, als könnte der Friede von Prag zwischen dem Kaiser und den Sachsen den unseligen Konflikt der Konfessionen endlich zu einem guten Ende führen. Die Menschen schöpfen Hoffnung, Feste werden gefeiert und Freudentränen vergossen – aber ich weiß ja, dass das verheerende Chaos des Krieges noch 13 weitere Jahre durch die Länder ziehen und eine Spur des Elends hinterlassen wird. Der Friede ist nur von kurzer Dauer: Frankreich schlägt sich plötzlich auf die Seite der Schweden und erklärt Spanien den Krieg. Man kann nichts tun, als davonzulaufen.
Außerdem geht es all diesen heiligen Herrschern schon lange nicht mehr um den rechten Glauben. Sie benutzen die Religion, um ihren Einfluss zu vergrößern. Europa wird zu einem riesigen Sandkasten, in dem die verschiedenen Mächte gegen das Haus Habsburg im Burgenzerstören antreten und dabei beliebig viele „Ameisen“ zerstampfen.
Ich kam zum Glück rechtzeitig hier an. So früh, dass ich die vielen Schlachtfelder dieses barbarischen Krieges nicht mehr kreuzen musste, und so spät, dass ich mit der verheerenden Londoner Pestepidemie von 1665 nicht in Berührung kam. Das ist einer der Vorteile, wenn man in die Vergangenheit reist. Man weiß rechtzeitig, ob etwas Übles auf einen zukommt.
Heute Morgen bin ich früh in der zugigen Bauhütte aufgewacht, in der ich zur Zeit arbeite. Ein Bretterverschlag voller schnarchender Einzelgänger, in dem das Röcheln und Schnauben langer Arbeitstage weitergeht und mit dem knisternden Geräusch des Ofens konkurriert. Der Geruch alter, verschwitzter Kleider lehnt an der Wand und grinst einen an.
Natürlich gab es wieder verwirrte Blicke, wie jeden Morgen, wenn ich für alle überraschend in einer Gruppe auftauche: „Wo kommt denn der her? Was will der hier?“ Aber Handwerker sind zum Glück Zeitgenossen, die viel arbeiten und wenig fragen, wenn man sie in Ruhe lässt. Und ich sage ohnehin immer das Gleiche: „Ich bin heute Nacht eingetroffen, ich soll bei eurem Schaffner als Schreiber anfangen.“
Da ich in der Regel den Namen des Schaffners, der sich als Leiter der Bauhütte um die Abrechnungen kümmert, und einige seiner Bekannten schon aus der Zukunft kenne, fällt es mir nicht schwer, die verjüngten Arbeiter jeden Morgen neu von der Richtigkeit meines Daseins zu überzeugen. Manchmal erinnert sich dann jemand daran, dass ich schon vor einem Jahr für einen Tag mitgearbeitet habe, und runzelt die Stirn. Das verblüfft und verunsichert mich immer wieder. Die Tatsache, dass ich in die Vergangenheit reise, bedeutet natürlich auch, dass ich Menschen begegnen kann, die mit mir in vorhergehenden Jahren Erfahrungen gemacht haben, aber ich gewöhne mich nicht daran, mit den fragenden und wiedererkennenden Blicken richtig umzugehen. Es ist mir peinlich, nicht reagieren zu können. Bisweilen schließt mich sogar ein strahlender Fremder in die Arme, weil er sich freut, mich wieder zu sehen, und ich versuche dann, aus seinen Worten herauszuhören, was wir gemeinsam in seiner Vergangenheit erlebt haben. Gleichzeitig sehne ich mich nach diesen bescheidenen Augenblicken, weil sie mir vermitteln, dass ich nicht ganz ohne Beziehungen lebe.
Dass Van Dyck mir das Leben gerettet hat, war sicher die schönste Botschaft aus der Vergangenheit, die ich bisher erhalten habe. Meist vergessen die knurrigen und vor Dreck starrenden Bauarbeiter aber schnell, dass ich schon einmal einen Tag lang mit ihnen Arbeit und Nachtlager geteilt habe. Weggeschickt hat mich in all den Jahren jedenfalls noch keiner. Und wenn, dann wäre es auch nicht tragisch. Ein Kuriosum wie mich kann nichts mehr umwerfen. Schon gar nicht in London.
Hier fühle ich mich wohl. Erstens tut es mir gut, endlich wieder einmal in einer Großstadt zu sein – 420 000 Einwohner findet man zu dieser Zeit nur selten –, und außerdem wird hier gebaut wie nie zuvor. Überall ragen die Gerippe halbfertiger Architektenträume aus dem Boden und schauen den Betrachter mit ihren hohlen Augen an. Nur die vielen herumwerkelnden Männer lassen hoffen, dass aus den Knochengerüsten bald mit Leben gefüllte Wesen werden. London erschafft sich neu. Da findet ein Tagelöhner leicht etwas zu essen und einen warmen Schlafplatz für die Nacht. Ganz gleich, wo man durch die Randgebiete dieser atmenden Stadt geht, man muss aufpassen, dass man nicht aus Versehen in eine Baugrube fällt. Erst nach dem September 1666, in dem 13 000 Holzhäuser und 73 Kirchen von einer Feuersbrunst vernichtet werden, wird London wieder einer solchen Baustelle gleichen.
Mir bereitet es eine kleine Befriedigung, wenigstens für einen Tag im Jahr an etwas Bleibendem mitarbeiten zu können. Wenn mein Leben auf den Kopf gestellt ist, dann möchte ich zumindest in dem, was ich tue, Spuren hinterlassen. Darum höre ich sehr genau hin, was die Menschen erzählen, lausche, was sie beschäftigt und beeindruckt.
So wie ich es bei meiner Ankunft im Hafen getan habe. Und eines flüstert man dort in jeder Spelunke: Der Earl von Bedford baut den ehemaligen Garten der Westminster Abbey, Covent Garden, zu einer exklusiven Wohngegend um. Ein ehemaliger Klostergarten verwandelt sich in ein Nobelviertel. Davon hatte ich bereits in Antwerpen einige Fachleute schwärmen hören und mich deswegen nach der Bestätigung vor Ort direkt dorthin gewandt. Jetzt helfe ich mit, Covent Garden zu bauen, den Stadtteil, den ich früher bei keinem Londonbesuch ausgelassen habe. Das Einzige, was mich deprimiert, wenn ich längere Zeit auf einer Baustelle arbeite, ist die Tatsache, dass ich jeden Tag mit ansehen muss, wie die fast fertigen Gebäude sich wieder in ihre Einzelteile verwandeln. Auch wenn ich im Jahr 2000 zeigen könnte, welchen Stein ich zu einem Palast beigetragen habe, bin ich zur Zeit nur Zeuge des Abbaus. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, ist die Arbeit eines ganzen Jahres ungeschehen gemacht worden, und ich blicke traurig auf die bedauernswerten Gebilde, die ich ja schon fast vollendet betrachten durfte. Und dann frage ich mich natürlich um so mehr, warum etwas mit mir passiert, das scheinbar keinen Sinn ergibt.
Aber ich muss mehr über mich erzählen, sonst komme ich dem Geheimnis meiner Reise nicht auf die Spur. Leider weiß ich noch nicht, wie ich es anfangen soll. Am besten schreibe ich auf, was heute passiert ist, denn das ist ganz gewiss der erste Schritt gewesen.
Ich war heute Morgen sehr neugierig, wie und wann ich Van Dyck treffen würde, und zum ersten Mal seit langer Zeit lief ich wieder aufgeregt umher. Schon beim Frühstück, bei dem wir alle in der muffigen Bauhütte einen körnigen Brei hinunterschlangen, lehnte sich der Werkmeister, ein ungepflegter Kerl mit glasigen Augen, plötzlich mit einem triumphierenden Lächeln zurück und schlug mit einem Löffel gegen seine tönerne Schale: „Es wäre schön, wenn ihr faulen Säcke heute ausnahmsweise mal fleißig ausseht. Mister Jones kommt zu Besuch!“
Lautes Stöhnen ertönte. Ein Steinmetz, den ich aus den folgenden Jahren kannte, lachte künstlich und knurrte: „Es wird genauso ablaufen wie immer: Unserem Bau-Meister ist doch ohnehin alles zu verspielt, was wir machen. Es kotzt mich an. Erinnert ihr euch an das letzte Mal, als er die Ehre hatte, uns zu visitieren:, Ich wünsche schlichtere Formen, klar, streng und nobel. Nicht diese katholische Überfrachtung.‘ Und dann erzählt er wieder stundenlang von Palladio., Lasst es uns machen wie Palladio!‘ Palladio holladio! Ich kann es nicht mehr hören. Palladio, der große Wiederentdecker der alten Formen. Palladio hier, Palladio da. Warum ist Mister Jones nicht in Venedig oder Rom geblieben, wenn ihm der antike Kram der Vorgeschichte besser gefällt als die künstlerischen Formen unserer Zeit!“
Der Werkmeister rülpste genüsslich, und man sah ihm an, dass er die Meinung des aufgebrachten Handwerkers zwar teilte, aber schon kannte. In diesem Moment öffnete sich der mit groben Latten versperrte Eingang ein Stück und Van Dyck blickte in den Raum. Er rümpfte die Nase und blieb in der halboffenen Tür stehen, sodass der Wind ungehindert durch den Raum ziehen konnte. Herrisch fragte er: „Ist Inigo Jones schon hier gewesen?“
Der Werkmeister sprang auf, wischte sich die Hände an der Hose ab und machte einen Schritt auf den Maler zu, was diesen unwillkürlich zurückweichen ließ.
„Er wird jeden Augenblick hier sein, Sir!“
„Wenn er kommt, sag ihm, dass ich vor dem Kirchenportal auf ihn warte!“
„Gerne, Sir, äh, Sir …“ Der diensteifrige Vorarbeiter öffnete überraschend den Mund zu einem breiten Grinsen, bei dem eine Reihe abgebrochener Zähne sichtbar wurde. „Man sagt, Ihr macht nicht nur religiöse Bilder, sondern seid auch ein Meister der erotischen Malerei. Könntet Ihr nicht einmal eine unverhüllte Schönheit auf die Wand unserer kleinen Hütte hier malen? Eine mit großen … na, Ihr wisst schon. Warum guckt Ihr denn so? Eine keusche Jungfrau natürlich!“
Die Männer krümmten sich vor Lachen, während Van Dyck rot anlief und wortlos die Tür hinter sich zuschlug. Der Werkmeister prustete: „Na, das geschieht ihm recht, dem eingebildeten Laffen. Dem Ritter im feinen Zwirn. Habt ihr sein Gesicht gesehen? Wie ein Pferd mit Durchfall.“
Wieder grölten die Männer, und es gelang mir, mich durch die derbe Heiterkeit nach draußen zu schleichen. Van Dyck stand neben dem kleinen Verschlag mit den Werkzeugen, puderte sich erregt die Nase und blickte mit verspanntem Hals in die Ferne.
Da er mir an Bord der „Marian“ erzählt hatte, wie das Bild aussah, das er von mir malen würde, sprach ich ihn vorsichtig an: „Entschuldigt meine Unverfrorenheit, Sir, aber ich würde mich gerne als Modell zur Verfügung stellen.“
Er musterte mich von oben bis unten und verzog dann den Mund zu einem verächtlichen Grinsen: „Wofür? Für den Esel in einem Krippenbild?“
Idiot, dachte ich. „Nein, Sir, für irgendein Bild eben!“
Er hustete in ein spitzenbesetztes weißes Taschentuch und sagte dann mit drohendem Unterton: „Hör zu. Die eine Hälfte Londons möchte von mir gemalt werden und wartet darauf, dass ich für sie Zeit habe. Die andere Hälfte möchte das auch, kann es aber nicht bezahlen. Ich werde also für einen Habenichts wie dich keine Leinwand verschwenden. Und jetzt lass mich in Ruhe.“
Er drehte sich demonstrativ um und sah nach einer halben Minute erstaunt in meine Richtung, weil ich immer noch am gleichen Fleck stand.
„Ich habe gesagt, du sollst verschwinden!“
„Ich kann in die Zukunft sehen!“
„Ach! Und die Erde ist eine Kugel, die um die Sonne fliegt! Gibt es eigentlich überall nur noch Verrückte?“
Er blickte mich verächtlich an und ging Richtung Baustelle davon. Mir wurde mulmig. Eigentlich war ich immer bemüht gewesen, mich aus der Geschichte herauszuhalten. Was sollte ich jetzt machen? Ich hatte von Anfang an große Angst, dass ich Einfluss auf Dinge nehmen könnte, die den Lauf der Welt verändern. Ein scheinbar belangloses Wort zur falschen Zeit ist in der Lage, alles durcheinander zu bringen. Jemand ändert seine Meinung, geht einen neuen Weg oder bekommt Angst – und plötzlich schlägt die Geschichte einen neuen Kurs ein.
Wobei ich ehrlicherweise sagen sollte, dass ich nicht immer so vorsichtig gewesen bin. Zu Beginn meiner Reise in die Vergangenheit habe ich zum Beispiel eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, Adolf Hitler zu töten. Es wäre ein Leichtes gewesen, dem Säugling oder dem Schulkind Adolf aufzulauern und das Jahrhundert etwas menschlicher zu machen. Aber dann wurde ich unsicher, denn ich wusste nicht, ob das überhaupt funktionieren würde. Ich hatte meine Reise ja zu einer Zeit begonnen, in der bereits bekannt war, wie das Dritte Reich verlaufen würde. Außerdem: Wer gab mir das Recht, mich zum Richter aufzuspielen? Ich hätte vielleicht nicht so viel grübeln sollen. Tatsache ist: Ich brachte es nicht fertig. Zumindest habe ich mir das damals eingebildet.
Wahrscheinlich ist der eigentliche Grund aber viel schlichter: Ich war zu feige. Ich wollte die Verantwortung nicht übernehmen. Das war noch nie meine Stärke gewesen. Ich konnte ja noch nicht einmal Entscheidungen für mich selbst fällen, wie sollte ich es dann für die Weltgeschichte tun? Im jetzigen Fall allerdings wusste ich auf Grund unseres Zusammentreffens auf der „Marian“, dass ich Van Dyck näher kennen lernen würde, also lief ich ihm nach.
„Sir, schaut mich doch einmal in Ruhe an. Vielleicht fällt Euch ja doch eine Möglichkeit ein, mich zu verwenden.“
Er drehte den Kopf angewidert über die Schulter, spielte mit der Kette, die über seinem Wams hing, und winkte zwei Maurer heran. „Haltet mir diesen Irren vom Leib.“
Ehe ich mich versah, packten mich die Männer und zogen mich zur Seite. Ich rief, so laut ich konnte: „Ihr werdet ein Bild malen, Sir. Darauf sieht man den König mit Reitknecht und Page. Ich kann es Euch beschreiben.“
Die Maurer waren einen Augenblick unachtsam, sodass ich mich losreißen und auf Van Dyck zulaufen konnte. Als ich ihn fast erreicht hatte, traf mich ein schwerer Schlag von hinten, und ich verlor das Bewusstsein.
Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf einem Strohsack in einem großen Saal. An den Wänden standen und lagen unzählige halbfertige Bilder, die das gezackte Tapetenmuster verdeckten. In der Mitte des Raumes stand eine Staffelei, die von der anderen Seite durch unzählige Kerzen erhellt war.
Van Dyck musste eine meiner Bewegungen gehört haben, denn er kam hinter der Leinwand hervor und blendete mich mit einer Kerze, die unter einem Glassturz stand, sodass ich die Augen zusammenkneifen musste. Er betrachtete mich eine Zeit lang kritisch, dann murmelte er: „Beschreibe dieses Bild, von dem du gesprochen hast!“
Ich schluckte und versuchte, mich daran zu erinnern, was der Künstler mir über das Bild erzählt hatte. Ich richtete mich auf, sackte aber wieder zusammen, als ein stechender Schmerz durch meinen Kopf fuhr.
Leise sagte ich: „Das Bild zeigt auf der linken Seite den König mit seinem Degen und einem Spazierstock. Auf der rechten Seite steht ein Pferd, das so aussieht, als ob es lacht. Ein Reitknecht hat seinen Arm auf den Rücken des Tieres gelegt, während ein junger Mann hinter ihm gedankenverloren, nein, eher fragend, in die Ferne schaut.“
Die Augen des Malers verengten sich: „Welche Farbe hat das Pferd?“
„Es ist weiß!“
„Welche Farbe hat die Hose des Königs?
„Sie ist rot!“
Van Dyck packte mich brutal am Ärmel und zog mich hoch. Er stieß mich so schnell vorwärts, dass ich fast gestolpert wäre. Plötzlich griff seine Hand in meine Haare und drehte meinen Kopf zu dem Bild, an dem er eben gearbeitet hatte.
„Wie bist du hier hereingekommen?“
Ich schwieg. Auf der Staffelei stand das Gemälde von König Charles. Es sah eigentlich genau so aus, wie ich es beschrieben hatte, obwohl das Licht aus einem anderen Winkel zu kommen schien. Erst auf den zweiten Blick entdeckte ich den entscheidenden Unterschied: Auf der Leinwand waren nur der König und der Reitknecht zu sehen. Ich in Gestalt des jungen Mannes fehlte darauf.
Van Dyck schüttelte mich: „Niemand darf meine Bilder betrachten, bevor sie fertig sind. Ich hasse das, hörst du, ich ertrage es nicht. Das wissen sogar meine geringsten Diener. Also: Wie bist du hier hereingekommen?“
Ich packte seinen Arm und befreite mich aus dem schmerzhaften Griff.
„Sir, ich habe offensichtlich das falsche Bild beschrieben. Also kann ich nicht hier gewesen sein. Auf diesem Gemälde sind nur zwei Männer, ich habe aber von dreien gesprochen. Auf meinem Bild sieht man drei Männer. Hier fehlt der Dritte – Ihr seid also, mit Verlaub, im Irrtum. Ich weiß auch gar nicht, warum Ihr Euch so aufregt …“
Van Dyck starrte ins Leere. Er hatte meine Worte ignoriert, darum hörte ich auf zu reden und blickte in sein konzentriertes Gesicht. Unbewusst massierte er sich mit der linken Hand das Ohrläppchen. Er nahm ein Stück Kohle vom Tisch und begann, mit schnellen Strichen etwas zu skizzieren.
Nach einigen Minuten murmelte er leise vor sich hin: „Nicht zwei Figuren, nein, drei, das ist gut, das ist richtig gut. Drei Personen, drei Elemente und Ideen, die irgendwie zusammengehören: Geist, Seele und Körper. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Denken, Träumen und Handeln. Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. Drei in einem. Drei Männer können zusammen die ganze Welt sehen, jeder 120 Grad. Jeder braucht die anderen und doch herrscht einer über sie. Er verkörpert die Macht des Augenblicks, die Herrschaft des Hier und Heute. Denn die Gegenwart ist die Königin des Seins. Darum muss einer dem Betrachter ins Gesicht sehen. Er, der König, der oberste Regent der Gegenwart, ragt heraus – er ist präsent, er bestimmt, er hat das Jetzt im Griff, während die anderen nach vorne und zurück schauen und darin versinken. Das gegenwärtige Sein steht im Vordergrund, der Blick zum Morgen ist der Blick des aktiven Arbeiters, während der gut gekleidete Page ins Gestern schaut. Die Vergangenheit steht im Hintergrund, die Zukunft bleibt der Gegenwart ebenbürtig, doch von ihr abhängig. Das Licht kommt von schräg hinten, es strahlt auf den Herrscher, der aber seinerseits den wärmenden Mantel des Pagen braucht, wenn er nicht erfrieren will. Es ist kalt ohne Vergangenheit. Und man kommt nicht vorwärts, wenn einem nicht die Träume mit schnellen Hufen voraneilen. Darum hat die Zukunft mit ihrem schattigen Gesicht ein schnelles Reittier an der Hand. Das ist der Lauf der Zeit. Stell dich da hin!“
Er deutete bestimmt auf einen Punkt hinter der Staffelei und wandte sich zu seiner Palette, die auf einem kleinen Schemel lag und im Licht der Kerzen glitzerte.
Ich verstand ihn nicht sofort: „Was ist los?“
Der Maler wiederholte seine Bewegung: „Du hast Recht. Ich weiß nicht warum, aber du hast Recht. Das Bild stimmt so, wie es jetzt ist, nicht. Seit Tagen überlege ich, was mir nicht gelungen ist, warum es mir nicht gefällt. Jetzt weiß ich es: Das Entscheidende fehlte. Zwei Figuren zeigen immer ein Gegeneinander, wenn es drei sind, beginnt das Ganze zu leben. Ich mache aus einem Königsporträt ein Meisterwerk über die Zeit. Zwischen Hell und Dunkel, zwischen die leuchtende Gegenwart und die fordernde Zukunft, zwischen König und Reitknecht drängt sich der fahle Schein dessen, der weiß, wo alles herkommt. Denn was ist die Gegenwart ohne die Vergangenheit? Ich werde dich in das Bild einbauen. Du bist die Vergangenheit. Ich muss dich allerdings kleiner malen als in der Realität, denn du bist ja fast einen ganzen Kopf größer als der König, aber das bekomme ich schon hin. Also, stell dich da hin!“
„Nein!“
Van Dyck blickte auf, als habe er ein Wort vernommen, das noch nie an sein Ohr gedrungen war.
„Bist du wahnsinnig geworden? Vorhin wolltest du unbedingt …“
„Ich bin gern bereit, Modell zu stehen, ich stelle nur eine Bedingung: Ich will euch dabei eine Geschichte erzählen dürfen.“
Der Maler hob die Augenbrauen: „Normalerweise bevorzuge ich zwar Musik beim Arbeiten, aber wenn du beim Erzählen einigermaßen ruhig stehen bleiben kannst, soll es mir recht sein.“
So verharrte ich, Stunde um Stunde, und blickte zurück in die Zeit, in meine Zeit, in die Jahrhunderte, die der Welt noch bevorstanden. Und ich ließ all das hervorströmen, was mir seit nunmehr 365 erlebten Jahren den Verstand rauben wollte, meine ganze Angst, meine Ruhelosigkeit und meine Verzweiflung.
Irgendwann hörte Van Dyck auf zu arbeiten und ließ uns etwas zu essen bringen. Er, der große Hofkünstler, das Wunderkind, das schon als junger Mann oberster Assistent von Peter Paul Rubens war, lauschte einem ratlosen Bauarbeiter, der durch widrige Umstände in sein Atelier gekommen war. Ich hatte ihm geholfen, er half mir. Und es tat unendlich gut, zu schimpfen, zu wüten, zu schreien, zu weinen und diesen Sack voller Fragen, der sich während meines selbst verordneten Schweigens in meiner Seele angefüllt hatte, zu öffnen.
Anfangs war der Drang, Worte zu finden, so groß, dass meine Erlebnisse wohl sehr wirr geklungen haben müssen. Ich holte Erinnerungen und Gefühle aus 365 Jahren hervor und warf sie meinem ersten Zuhörer hin.
Van Dyck ließ mich gewähren, zwei, vielleicht drei Stunden lang. Dann unterbrach mich der Künstler das erste Mal, sehr vorsichtig, ja fast zärtlich: „Wie fing alles an?“
1999 Ich kann mich noch an die Farbe des Kleides von Anna erinnern. Ein dunkles Blau mit eingesponnenen Silberfäden. Sie hatte es schon im vergangenen Jahr an Silvester getragen, weil ich es liebte, ihren nackten Rücken zu betrachten. Ich traf sie vor dem Haus, als sie gerade aus ihrem Polo stieg. (Van Dyck stutzte, also sagte ich: „Eine Kutsche ohne Pferde“.) Ich hatte nicht gewusst, dass sie auch zu dieser Party („Hofball“) kommen würde, und fühlte mich unbehaglich. Aber wenn man sich nach fünf Jahren trennt, hat man nun einmal noch einige Zeit den gleichen Freundeskreis.
Anna war unsere Beziehung nach einiger Zeit zu eng geworden, meine Lust am Heiraten, meine enge Welt der Altphilologie („Magister der alten Sprachen“), mein Eingebundensein in die „existenzverneinende“ Welt der Universität, wie sie es immer nannte, das Dahinvegetieren mit einer halben Assistentenstelle („Dasein als Adlatus“), mein zusätzliches Jobben auf dem Bau („Arbeit im Baugewerbe“), meine fruchtlose Forschungsarbeit über den „Humor als Mittel der Zeitkritik. Sprachmuster in den Satiren Lukians“, in der ich nachweisen wollte, dass der feixende Dichter des zweiten Jahrhunderts bewusst die erzählerischen Traditionen seiner Epoche aufgenommen hatte, um durch diese Verfremdungen die damaligen Stil- und Kunstformen als Farce zu entlarven.
Anna fand, dieses Thema sei reine Zeitverschwendung, Lebensverschwendung. Immer wieder fragte sie gehässig: „Was wird sich in der Welt ändern, wenn dein Buch erscheint? Gibt es nur einen Menschen, der dadurch ein bisschen glücklicher wird?“
„Ich!“, sagte ich dann beleidigt, aber das war zu einer Zeit, als wir schon anfingen, unsere Argumente zu wiederholen. Ich wusste, was ihr an mir missfiel, sie wusste, was mir an ihr missfiel, und keiner von uns dachte daran, etwas Grundlegendes zu ändern.
Nein, das stimmt nicht. Wir litten beide unter den andauernden Streitereien, die sich immer an Kleinigkeiten aufhingen und dann mit Tränen endeten, aber trotzdem machte keiner den ersten Schritt zu einer Verbesserung der Situation. Denn es gab immer wieder wundervolle Momente, in denen wir das Gleiche dachten und fühlten. Aber sie wurden seltener. Wäre es nach mir gegangen, hätte sich wahrscheinlich nie etwas geändert, doch dann fand Anna, es sei einfach Zeit, die Beziehung zu beenden, bevor ich sie mit in mein „selbstgeschaufeltes Akademikergrab“ zöge. Wäre unsere Trennung zu dieser Zeit nicht erst drei Monate her gewesen, drei Monate voller Selbstmitleid und Zerknirschung, dann hätte ich sicherlich anders reagiert.
„Was machst du denn hier?“, fuhr ich sie unfreundlicher an, als ich wollte. Anna wühlte noch einen Augenblick im Handschuhfach und schlug dann die Tür fester zu, als nötig gewesen wäre.
„Karsten gehört zu meinen Freunden, falls du das vergessen hast“, blaffte sie zurück. Damit hatte sie zweifelsohne Recht. „Außerdem kann ich den Jahrtausendwechsel feiern, mit wem ich will. Schließlich habe ich die letzten vier Jahre auch in diesem Kreis gefeiert.“
„Schon gut, entschuldige. War nicht so gemeint. Ich … äh … wusstest du, dass ich auch eingeladen bin?“
Sie hatte sich wieder gefangen und sah mich herausfordernd an: „Ja, ich dachte, wir wollten Freunde bleiben, da werden wir doch ohne Streit auf diese Party gehen können. Letztes Jahr ging es ja auch.“
Sehr lustig, dachte ich, da waren wir ja auch noch zusammen!
Mir fiel nichts mehr ein, obwohl ich seit unserer Trennung in meiner Fantasie sicherlich hundert Gespräche mit ihr geführt hatte, in denen ich ihr endlich all das sagen konnte, wofür mir in ihrer Gegenwart die Worte fehlten. Sie blickte ein bisschen mitleidig auf meinen alten Anzug, rückte den Träger ihres Kleides zurecht und ging vor mir ins Haus.
Ich war sehr melancholisch an diesem Abend. Vor allem, weil mein Blick immer Anna suchte. Für mich schien sie unübersehbar. Anna lachend mit einem Glas Sekt in der Hand. Anna mit einer Rose im Haar, die ihr ein angetrunkener Kollege dorthin gesteckt hatte. Dabei wusste ich genau, dass sie sich nichts aus Blumen machte. Sie war eines Tages damit herausgerückt, nachdem ich sie wochenlang mit Rosen überschüttet hatte, die immer wortlos in eine Ecke gestellt wurden. Anna mit attraktiven Männern, in ein angeregtes Gespräch vertieft. Anna mit diesem glücklichen Lachen, das wie eine sanfte Welle über ihr Gesicht floss und alle Ängste und Trübungen mit sich nahm, dieses Lachen, von dem ich immer geglaubt hatte, es sei nur für mich bestimmt. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass sie und ihr jeweiliges Gegenüber die Einzigen waren, die diesen Abend genossen.
Karsten zog mich nach dem Essen in die Küche, hielt mir einen Teller mit Käse hin und setzte eine aufmunternde Miene auf: „Sie macht das, weil sie traurig ist.“
„Na, so sieht sie aber nicht aus! Sie scheint sich prächtig zu amüsieren.“
Er musterte mich, als müsse er überlegen, was er jetzt am besten sagen könnte. Schließlich meinte er optimistisch: „Ich bin sicher, dass sie ihren Entschluss bereut.“
„Da habe ich aber was ganz anderes gehört!“
„Du meinst die Geschichte mit Frank? Das ist doch schon längst wieder vorbei. Sie war traurig, und er hat sie getröstet. Was glaubst du, wie viele Beziehungen auf diesem Wege entstehen? Aber so blöd ist Anna nicht. Die hat schnell genug gemerkt, dass man nicht so einfach eine neue Beziehung anfangen kann. Weißt du übrigens, was das Verrückte an neuen Beziehungen ist?“
Ich wollte in diesem Augenblick weder weise Ratschläge noch Unterhaltung, fand es aber unhöflich, nicht zu antworten. Also sagte ich mürrisch: „Nein!“
Karsten lachte: „50 Prozent davon sind auf jeden Fall alt, denn du bist wieder dabei! Klever, gell? Habe ich neulich irgendwo gehört. Aber mal ganz im Ernst. Wenn du Anna noch liebst, dann solltest du dir ein bisschen mehr Mühe geben!“
„Und was heißt das konkret, Dr. Sommer?“
Er senkte verschwörerisch die Stimme, konnte aber ein Lächeln nicht unterdrücken: „Was meinst du, warum sie dein Lieblingskleid anhat? Geh ran, sie wartet doch nur darauf.“
„Na, ich weiß nicht!“
Ich war an diesem Abend nicht zum Flirten aufgelegt. Alles wirkte trübe und undurchsichtig. Die Party, die Menschen, die Gespräche und das Gelächter, das wieselflink durch den Raum stob, um sich dann hinter einem der Bücherregale zu verstecken. Ich trieb in diesem zerfaserten Dasein wie eine Qualle, die vergeblich gegen die Meeresströmungen ankämpft. Irgendwie zerrann die Zeit in meinen Händen. An der Ursache gab es keinen Zweifel: Es war der Silvesterabend 1999.
Natürlich wusste ich, dass der Jahrtausendwechsel ein willkürliches Datum ist, bei dem sich die Historiker wahrscheinlich so oft verrechnet haben, dass wir eigentlich 2000 Jahre nach der Einschulung Jesu feiern. (Van Dyck hob die Augenbrauen.) Und trotzdem bekam ich plötzlich Angst, dass Anna Recht haben könnte.
Wozu brauchte die Welt eine Arbeit über den Humor Lukians? Und hatte nicht auch meine Mutter Recht, die bei allen Familientreffen spitz fragte, wann denn ihr 35jähriger Sohn gedenke, gediegen und anständig zu werden. Für sie hieß das vor allem eines: Enkelkinder zeugen. Plötzlich schien alles, wofür ich bisher gearbeitet hatte, so unwichtig zu sein. Als würde eine ausgehungerte Zecke mit einem Mal ahnen, dass die Welt doch aus mehr als aus Wärme und Buttersäure besteht. Ich fühlte mich verloren.
Karsten versuchte mehrfach, mich zu Anna zu schicken, aber ich saß den ganzen Abend lang stumm in einer Ecke und tat so, als würde mich seine CD-Sammlung („Verewigte Musik“) ungemein interessieren.
Um fünf vor zwölf knallten im ganzen Haus die Korken der Sektflaschen („Champagner“), und wir liefen mit unseren Gläsern in den kleinen Garten, um zu sehen, wie sich die Nacht über uns in ein Lichtermeer verwandelte. Frankfurt im Glanz der Verschwendung. Die Stadt hieß das neue Jahrtausend willkommen. Mir war schlecht. Eine Minute vor zwölf nahmen wir uns an den Händen, nein, man nahm sich an den Händen, denn auf einmal stand Anna neben mir, und wir zählten miteinander die Sekunden von 60 bis 0.
Es war ein langer Abschied. Ich sehnte mich ganz weit weg, hätte aber niemals sagen können, wohin. 35 Jahre zerrten wie eine einzige Frage an mir, und ich war nicht in der Lage, sie zu beantworten. Ich erinnere mich noch, dass mir in diesem Moment der Gedanke durch den Kopf schoss, ob ich wohl jemals trauriger gewesen war.
Vor allem, als mir auffiel, dass Anna und ich diesmal um null Uhr zusammen sein würden. Trotz unserer gescheiterten Beziehung. Im vergangenen Jahr, als wir noch ein Paar gewesen waren, hatten wir uns nämlich beide so intensiv mit verschiedenen Bekannten unterhalten, dass wir den eigentlichen Jahreswechsel getrennt verbrachten. Sie hatte im Garten gestanden, ich vor dem Haus, und jeder hatte dickköpfig darauf gewartet, dass der andere sich auf den Weg machte. Vor Wut war ich daraufhin erst einmal für zehn Minuten auf der Toilette verschwunden, um meiner Freundin aus dem Weg zu gehen. Und sie hatte später so getan, als sei nichts gewesen.
Aber das ist eben Anna, so war Anna, nein, so wird Anna sein: Sie ignoriert alles, was ihr nicht passt. Und irgendwann, schon drei Monate lang, genauer gesagt, gehörte eben auch ich zu den Dingen, die sie übersah.
Die Stimmen wurden lauter, denn jetzt blieben nur noch zehn Sekunden bis zum neuen Jahrtausend. Zehn, neun, acht … Es war, als würde mein Leben ausgezählt, der geschlagene Kämpfer liegt am Boden, ohne zu wissen, gegen wen er verloren hat, und der Schiedsrichter lässt die Zahlen über diese Niederlage triumphieren. Sieben, sechs, fünf … Die anderen Gäste strahlten sich an und mir wurde schwarz vor Augen. Vier, drei … Ich musste mich an Anna festhalten, deren vor Freude geöffneter Mund bei einem kurzen klaren Blick so aussah, als wollte er mich verschlingen. Ich war wie in einem Vollrausch, dabei hatte ich den ganzen Abend nur ein Glas Wein getrunken. Zwei, eins, null …
Ich spürte, wie etwas zerbrach. Irgendwo in mir. Ein störendes Knacken, lautlos und doch so, als ginge nun ein Riss durch mich hindurch oder als hätte ich einen Sprung bekommen. Einen Augenblick lang hatte ich das Gefühl, ich fiele ins Nichts, stürzte haltlos in den Abgrund. Ich habe keine Ahnung, wie lange dieser Zustand dauerte. Es passierte einfach – und es zog vorüber. Denn plötzlich war das, was den ganzen Abend von mir Besitz ergriffen hatte, wieder verschwunden. Als hätte jemand den auf das Opfer zurollenden Bagger einfrieren lassen oder einen Film angehalten.
Die Eindrücke, die eben noch wie eine Lawine über mich hereinzustürzen drohten, waren wie weggewischt. Ein angehaltenes Uhrenpendel, ein ausgeschalteter Presslufthammer, ein gefallener Bühnenvorhang. Ich war wieder ich. Ich atmete erleichtert die kalte Nachtluft ein und blickte in die Runde.
Anna fiel mir um den Hals und küsste mich auf den Mund, weich und einladend. Ich runzelte die Stirn.
„Hey, was ist?“, fragte sie und beugte sich ein wenig zurück. „Sei doch nicht immer so ernst. Ein frohes neues Jahr!“
„Ein frohes neues Jahr“, murmelte ich und wollte mich von ihr lösen, aber sie umschlang mich schon wieder, drückte ihre Brüste sinnlich gegen meinen Oberkörper und knabberte an meiner Unterlippe. Ich war so verblüfft, dass ich sie einfach gewähren ließ. Irgendetwas lief hier falsch. Sie streichelte meinen Rücken, schmiegte sich an mich und blitzte mich mit ihren grünen Augen verheißungsvoll an.
„Freust du dich auf das neue Jahr?“
„Na, ich weiß nicht so recht.“
Ein Hauch von Ärger zog über ihr Gesicht, aber ehe sie sich aufregen konnte, kamen Freunde und Bekannte von allen Seiten herbeigeströmt, um mit uns anzustoßen. Alle waren so gut gelaunt, dass ich mich anstecken ließ. Einige Freunde hatte ich den ganzen Abend über noch gar nicht wahrgenommen und ich fand es lustig, die ewig gleichen Sprüche zu hören. Alles schien wieder in Ordnung zu sein.
„Hallo, Max, ein gutes neues!“
Jemand klopfte mir auf die Schulter und hielt sich dann daran fest. Ich drehte mich um – und da stand Thomas. Jetzt wurde mir endgültig flau. Meine Gedanken zuckten wie Fische in einem Netz.
Thomas war ein Freund, mit dem ich schon als Schüler die örtliche Pfadfindergruppe unsicher gemacht hatte; der hoch aufgeschossene Verfahrenstechniker mit dem kleinen, unverkennbaren Muttermal am Kinn. Er stand da und grinste. Ich stand da und gefror innerlich. Wie eine Dunstglocke umhüllten mich die aufgeregten Stimmen der Freunde, wurden immer dumpfer und sperrten mich in mir ein.
Vor mir stand Thomas. Ich war im Juni bei seiner Beerdigung gewesen. Mit all den Leuten, die hier um uns feierten. Aber das schien niemandem außer mir aufzufallen. Ein widerlicher Unfall. Thomas war bei einer Nachtfahrt auf gerader Strecke mit dem Motorrad von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren. Keiner konnte sich erklären, wie es dazu gekommen war, denn er hatte jahrelang während des Studiums als Testfahrer für BMW gearbeitet und wusste, wie man mit schweren Maschinen umging.
Ich war bei der Trauerfeier nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder in Tränen ausgebrochen, als ein ehemaliger Mitschüler einen melancholischen Gospel angestimmt hatte. Die Familie hatte später entschieden, dass ich einige altsprachliche Bücher und zwei Lexika von Thomas bekommen sollte. Sie standen seither direkt neben meinem Schreibtisch und erinnerten mich jeden Tag an ihn. Ich musste schlucken und brachte kein Wort heraus. Thomas dagegen war völlig entspannt.
„Na, ihr zwei Hübschen. Was machen denn die Heiratspläne? Ist es dieses Jahr endlich soweit? So etwas nimmt man sich doch an Silvester vor, oder nicht?“
Er zwickte Anna in die Seite, die sich kichernd nach vorne beugte. Sie druckste herum: „Na, alles zu seiner Zeit.“
„Max, was ist denn los? Du siehst aus, als ginge es dir nicht gut.“
Ich ertrug die Situation nicht mehr und rannte davon: „Entschuldigt mich einen Augenblick!“
Ich lief ins Haus, um mich zum Nachdenken auf die Toilette zu verziehen, wie ich es in solchen Momenten immer tue, gerade dann, wenn mich Panik überkommt. Es gibt Zeiten, in denen ich für mich sein muss. Und dieser Alptraum war Grund genug.
Aber ich kam nicht dazu. Denn als ich mich an den Resten des Büfetts vorbeigezwängt, einem halben Dutzend Freunden gequält ein gutes neues Jahr gewünscht und mich zum Flur durchgekämpft hatte, verlor ich völlig die Kontrolle über meinen Verstand. Normalerweise bin ich nicht leicht zu erschüttern, aber diesmal durchzog mich ein kalter Schauder, der nicht aufhören wollte. Mein Herz raste.
Es hatte auch allen Grund dazu: Im Gang stand ich! Ich selbst! Der, den ich sonst nur im Spiegel erblickte. Ich sah mich in angeregtem Gespräch vor der Tür zum Badezimmer stehen, etwa dreieinhalb Meter von mir entfernt. Da lehnte ich an der Wand und plauderte mit einer hübschen Brünetten, die schon im Jahr zuvor auf der Party gewesen war. Ich glaube, sie hieß Julia, aber das war mir in diesem Augenblick völlig gleichgültig.
Ich weiß nicht, ob irgendjemand verstehen kann, was da geschah: Ich sah mich als mein Gegenüber. Zum ersten Mal in meinem Leben begegnete ich mir selbst. Und als ich in den großen Spiegel neben der Eingangstür blickte, stand ich tatsächlich zweimal da. Ich wollte schreien – und konnte nicht. Ab da weiß ich kaum noch, was geschah.
Da sich mein anderes Ich in diesem Moment suchend umdrehte, ließ ich mich zwischen die Jacken und Mäntel an der Garderobe fallen und versuchte verzweifelt, meinen Herzschlag wieder unter Kontrolle zu bekommen. Was ist los? Was ist los? Was passiert hier? hämmerte es in mir, während ich flach und schnell atmete. Bevor ich auch nur eine irgendwie geartete Antwort zuließ, nahm ich völlig verstört meinen Mantel und rannte hinaus. Nach einigem Suchen fand ich an einem Taxistand einen einsam vom Widerschein der Raketen glitzernden Wagen und ließ mich völlig fassungslos auf die Rückbank gleiten.
„Ein gesegnetes Jahr 1999“, sagte der Taxifahrer.
Auf der Fahrt fiel mir ein, dass letztes Jahr, als Anna und ich die Feier verlassen wollten, meine Jacke verschwunden war und wir mit einigen Freunden eine Stunde lang danach gesucht hatten. Ich fand sie später zu Hause mit allen Papieren wieder, wurde stinksauer, und Anna beteuerte vergeblich, dass es sich dabei nicht um einen ihrer üblichen Scherze gehandelt habe.
„Können Sie bitte das Radio anschalten?“, bat ich den Taxifahrer, als ich sah, dass es gerade ein Uhr war. Der Jingle lief schon: „Nachrichten. Es ist ein Uhr morgens. Wir wünschen allen Hörern ein frohes neues Jahr 1999.“
„Danke, das reicht. Schalten Sie bitte wieder aus!“
Der Taxifahrer brummte und drückte auf einen Knopf.
„Was denken Sie über Oskar Lafontaine?“, fragte ich. Schließlich war der Politiker als Finanzminister im März 1999 zurückgetreten.
Mein Fahrer schob seine dicke Mütze nach hinten, drehte sich kurz zu mir um, als wolle er an meinem Gesichtsausdruck erkennen, was er antworten könne, und murmelte dann: „Ich finde, die ersten hundert Tage sollte man einer neuen Regierung schon gönnen, dann kann man immer noch anfangen zu schimpfen.“
Ich schwieg. Ich war noch nie einem Phänomen begegnet, das ich nicht erklären konnte. Zumindest keinem, das so nach einer Erklärung schrie. Ich war es gewohnt, in Büchern nach Antworten auf strukturierte Fragen zu suchen und aus kleinen Indizien historische Schlüsse zu ziehen. Aber ich war es nicht gewohnt, aus dem Jahr 2000 zurück in das Jahr 1999 versetzt zu werden.
Ich weiß nicht, ob es die Müdigkeit, die Verzweiflung oder einfach völlige Ratlosigkeit war, jedenfalls wurde ich mit einem Mal ganz ruhig.
Ich schloss die Augen, lehnte mich zurück und verwandelte mich in den korrekten Wissenschaftler, den Anna so hasste und der alle Probleme als logische Herausforderung betrachtet. Ich schalte dann meine Gefühle aus, atme tief durch und analysiere mich und die Umgebung so lange, bis ich eine rationale Erklärung finde. Ich weiß, dass das erbärmlich ist, aber es hat mir immer geholfen, wenn ich kurz vor der Verzweiflung stand.
Zu Hause angekommen, holte ich einen alten Koffer vom Speicher, den ich nicht vermissen würde, und packte einige Kleider zusammen, die Anna ohnehin nicht gefielen und die ich deswegen normalerweise nie trug. Ich ließ mir noch einmal von unserem Fernseher und vom Computer das Datum bestätigen, stellte schon gar nicht mehr überrascht fest, dass die von Thomas geerbten Bücher nicht mehr, beziehungsweise noch nicht in meinem Regal ruhten, fand im Küchenregal auch tatsächlich den kaputten Toaster wieder, den ich im Sommer 1999 eigenhändig zerlegt und entsorgt hatte, nahm den Schlüssel zur Gartenhütte meiner Eltern und einen Ersatz-Hausschlüssel aus dem Schlüsselkasten und ließ die Tür hinter mir ins Schloss fallen.
So fing es an.
1635 Van Dyck schob mir einen Becher Wein zu, den er auf eine Holzkiste gestellt hatte, die zwischen uns stand, und forderte mich wortlos auf, daraus zu trinken.
„Du behauptest also, du wärst im Jahr 2000 zurück ins Jahr 1999 gesprungen?“
„Nicht nur das. Seitdem wache ich jeden Morgen ein Jahr früher auf. Ich wollte es anfangs selbst nicht glauben. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Ehe ich wirklich realisiert hatte, was passiert war, verging eine ganze Woche, in der ich jeden Tag hoffte, dass jemand von der, Versteckten Kamera‘, ein überdrehter Wissenschaftler oder ein Psychologe zu mir in die Gartenhütte käme, um mir zu sagen, dass das alles nur ein Spiel, ein Experiment oder eine Täuschung gewesen sei. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben.
Als das Unbegreifliche zur Gewissheit wurde, stand auf den Zeitungen am nahe gelegenen Kiosk in der Datumsspalte bereits 1993. Donnerstag, der 7. Januar 1993. Die Tage liefen weiter, aber die Jahreszahlen sprangen zurück.“
Es fällt mir schwer, dieses Gespräch aufzuschreiben, denn ich werde schon wieder von diesem bedrückenden Gefühl überwältigt, das meine Stunden im Atelier bestimmt hat; eine seltsame Mischung aus Hilflosigkeit, Stolz und Wut. Ich soll etwas erklären, was unerklärlich scheint. Welch eine Aufgabe. Niemand hat jemals mein Schicksal geteilt, und darum ringe ich voller Ehrgeiz mit den Worten und erkenne schnell, dass sie mich wahrscheinlich zu Boden werfen werden. Ich bin nicht einmal sicher, ob mich Van Dyck verstanden hat; immerhin lassen seine Rückfragen darauf schließen; wenn ich denn sein von einem starken niederdeutschen Akzent geprägtes Altenglisch richtig interpretiere. Ich könnte seine Erwiderungen natürlich im Original wiedergeben, aber wer weiß, ob ich sie dann in einigen Jahren noch begreifen werde. Schließlich ist es ungewiss, wie lange meine Reise dauern wird.
Was soll ich also machen? Ich kann nur von dem schreiben, was ich selbst begreife. Ich denke, ich werde alle Eindrücke so wiedergeben, wie mein Verstand sie empfangen hat, der ja auch jede Botschaft übersetzt, damit ich sie einordnen kann.
Mein Van Dyck spricht meine Sprache, und ich kann hier ohnehin nur das festhalten, was ich gehört und begriffen habe. Außerdem bin ich es, der das Rätsel lösen will, nein, lösen muss. Das Rätsel Maximilian Temper. Wer könnte mir verbieten, meine Sicht der Dinge zu berichten? Sollte ein anderer irgendwann einmal diese Zeilen lesen, dann wird er die Welt aus meinen Augen sehen und mit meinen Ohren hören. Er wird dann nicht nur meine Reise, sondern auch mich kennen lernen.
Eines jedenfalls konnte ich die ganze Zeit spüren: Van Dyck brannte darauf, zu hören, wie meine Geschichte weiterging.
1993 Jeden Morgen war ich erwartungsvoll aus der winterlich leeren Kleingartensiedlung in das nächste Einkaufszentrum gerannt. Und jedes Mal war ich fest davon überzeugt gewesen, dass es sich bei all dem nur um ein Missverständnis handeln konnte, einen irren Traum, vielleicht durch eine Droge in einem der Drinks auf der Party verursacht. Jeden Morgen vertraute ich darauf, dass sich nun alles aufklären würde. Doch schon, wenn ich mich dem Supermarkt genähert hatte, hatten mich zu viele Kleinigkeiten darauf hingewiesen, dass ich noch weiter in die Vergangenheit vorgedrungen war: Die dichten Büsche waren kleiner geworden, die Markisen hatten heller geleuchtet und die Verkäuferinnen frischer gewirkt. Jeden Tag waren weniger Menschen mit Handys unterwegs und die Autos wurden immer eckiger.
Dann hatte sich jedes Mal mein Schritt verlangsamt, ich war die letzten Meter bis zum Zeitungsständer gewankt und hatte schon gewusst, was ich auf den Titelseiten lesen würde. Und irgendwann hatte sich der letzte Rest Hoffnung in nichts aufgelöst. Als es keinen Zweifel mehr daran gab, dass ich zu einem Gefangenen der Zeit geworden war, stieg in mir Wut hoch. Warum gerade ich?
An einem dieser Tage rannte ich zurück zu meinem Schlafplatz, verbittert und voller Hass. Es war, als müsste sich die ganze Anspannung lösen. Ich musste etwas zerstören, um nicht selbst zerstört zu werden. Also ließ ich all meine Wut raus.
Innerhalb einer halben Stunde zerlegte ich die gesamte Einrichtung der Gartenhütte. Ich war wie von Sinnen, prügelte unkontrolliert mit einem Besen auf die Möbel ein, zerkratzte vor Wut die Tischplatte, riss die Schubladen aus den Schränken und trat gegen alles, was mir in den Weg kam. Ich riss die Tapete von den Wänden, hebelte die Steckdosen aus den Leisten und bohrte mit einem Messer Löcher in den Boden. Und erst als ich ausgebrannt und weinend auf den kalten Dielen lag, wurde mir wieder bewusst, wie erschüttert meine Eltern 1993 gewesen waren, als „irgendwelche“ Vandalen in ihrer Hütte randaliert hatten.
Die nächsten Tage brachte ich damit zu, mit dem Schicksal zu verhandeln. Ich war fest davon überzeugt, dass es möglich sein müsse, diesem Zeitenschwund ein Ende zu bereiten. Es musste etwas geben, das mir helfen konnte: Dämonenaustreiber, Physiker, Historiker, Wunderheiler oder eine Wallfahrt nach Lourdes. Ich spannte endlose Theorien, um den an diesem Leben Schuldigen die Sinnlosigkeit meiner neuartigen Existenz zu beweisen, aber da war niemand, dem ich mein Plädoyer hätte vorlegen können.
Tagelang versank ich in mir und wälzte immer wieder die gleichen Argumente hin und her. Ich verdächtigte alles und jeden, entwickelte ominöse Verschwörungstheorien und überlegte, ob nicht vielleicht am 1. Januar 2000 die Welt untergegangen war. Aber dann fiel mir kein Grund ein, warum jemand gerade mich auf eine derart seltsame Weise davor gerettet haben sollte. Der Irrsinn der Verzweiflung.
Ich lief sogar einige Tage durch die Straßen und versuchte herauszufinden, ob es unter den Passanten vielleicht noch andere Zeitspringer gab. Gemeinsam hätten wir ja möglicherweise eine Chance gehabt, dem Phänomen auf den Grund zu gehen. Aber woran sollte ich sie erkennen? Einige Personen, die auf mich einen ziellosen Eindruck machten, sprach ich sogar an. Ich betrachtete sie lange, und wenn sie sehr unkoordiniert, unsicher und verloren wirkten, verfolgte ich sie vom Supermarkt bis auf die Straße.
Leider gab es überall Fußgänger, auf die diese Beschreibung zutraf, sodass ich immer erst dann mit ihnen in Kontakt trat, wenn sie mehrfach auf das Datum der Zeitung geblickt hatten, ohne sie zu kaufen. Aber selbst zu dieser Sorte Mensch zählten noch so viele, dass ich nicht jeden befragen konnte. Außerdem hatte ich Angst, mich lächerlich zu machen. „Was halten Sie von Zeitreisen?“, hielt ich für die unverfänglichste Frage. Doch ich erntete nur misstrauische, nichts sagende oder befremdliche Blicke. Einmal gaben mir zwei Schüler erstaunlich passende Antworten, die mich aufhorchen ließen, bis ich merkte, dass mich die beiden zum Besten hielten.
Daraufhin zog ich mich wieder zurück und versank im Kerker meiner Gedanken. Ich verabschiedete mich aus der Welt, um mich ihr nicht stellen zu müssen. Tag für Tag zog ein Jahr an mir vorüber. Die deutsche Einheit verpasste ich dabei genauso wie beim ersten Mal. Ein historisches Ereignis, das lautstark an mir vorüberschritt und mich doch nicht erreichte. Die Fragen der Welt verblassten hinter meinen Fragen. Meine Angst und meine Niedergeschlagenheit drängten sich so in den Vordergrund, dass für alles andere kein Platz mehr war. Ich war nur noch ich. Zerrissen, verwundet, hasserfüllt und trotzig. Ein Bär im Winterschlaf, der nicht mehr an den Frühling glaubt. Am 11. Januar 1989 begriff ich endlich, dass das alles keinen Zweck hatte.
1635 Durch das dunkel gewordene Atelier ging ein Luftzug. Heftig und erfüllt mit dem Geruch von Mehlschwitze und Fett.
Van Dyck fluchte: „Es ist grauenhaft. Jeden Abend öffnen diese verblödeten Mägde die Küchentüren und hier fliegen die Leinwände durch den Raum.“
Er stand auf, holte aus einer Truhe zwei Decken und warf mir eine davon zu: „Hier! Wir wollen ja nicht, dass du bis zu den Zeiten Karls des Großen Schnupfen hast.“ Er kicherte leise, wurde aber gleich wieder ernst. „Was meinst du jetzt? Warum passiert so etwas? Warum reist jemand wie du durch die Zeit?“
Ich wickelte mich in den groben Stoff und blickte nicht auf: „Wenn ich das wüsste, dann wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Und weil ich es nicht weiß, bin ich der unglücklichste.“
Van Dyck ging zurück zu seinem Sitzplatz und zog die Nase hoch: „Dann musst du es herausfinden!“
„Eine großartige Idee! Was meint Ihr, warum ich Euch das alles erzähle? Ich hoffe, dass Ihr in meinen Geschichten etwas entdeckt, das Euch und mich dem Geheimnis etwas näher bringt.“
Der Künstler beugte sich nach vorne, um eine weitere Kerze anzuzünden. „Gut, dann lass uns weitermachen. Was geschah nach, entschuldige, vor dem 11. Januar 1989?“
1988 Ich war durch und durch müde. Nicht unausgeschlafen, sondern von einer lähmenden Schwere erfüllt, die jede Bewegung zu einer Qual und jeden Gedanken zu einer unliebsamen Anstrengung macht. Seit ich mein Los akzeptiert hatte, ergab ich mich ihm. Ich wusste nicht, wohin, und darum gab es auch keinen Grund, einen ersten Schritt zu tun. Tagsüber wanderte ich unstet durch das ehemalige Bundesgartenschaugelände an der Nidda, diesem stinkenden Kanal, der sich übermütig Fluss nennt, schaute kleinen Kindern beim Spielen zu und kehrte früh in die Hütte zurück. Ich existierte, aber ich lebte nicht.
Am 12. Januar 1988 wachte ich gegen ein Uhr morgens auf, weil ich fror. Die Kälte kroch in den alten Armeeschlafsack meines Vaters und legte sich heimtückisch um meinen nackten Körper. Zwischen den Wolken lugte bisweilen der Mond hervor, um sich gleich darauf wieder schamvoll zu verstecken.
Ich stand auf und sprang schlotternd umher, bis die Kälte aus meinen Gliedern gewichen war. Und erst dabei wurde mir bewusst, was passiert war: Durch meinen mitternächtlichen Zeitsprung war ich in einem Jahr gelandet, in dem es das kleine Blockhaus noch gar nicht gegeben hatte. 1988 hatten meine Eltern ein neues „Gartendomizil“, wie sie ihre Hütte immer nannten, gebaut und es bewusst in den hinteren Teil des Gartens gesetzt, um nicht wie vorher ab dem späten Nachmittag den Schatten des kleinen Unterschlupfes auf dem Rasen zu haben. Aber das war nur ein Grund gewesen. Mein Vater hatte sich auch deshalb wütend zum Kauf einer festeren Hütte entschlossen, weil die alte Baracke jedes Jahr im Winter aufgebrochen wurde, „von einem dieser Penner, die dann darin übernachten“, wie der stets korrekte Ingenieur in unregelmäßigen Abständen bemerkte.
Mir fiel auf, wie oft meine Reise in die Vergangenheit in meinem ersten Leben Spuren hinterlassen hatte, ohne dass es mir aufgefallen war. Denn es gab keinen Zweifel: Der Penner war ich; ich würde gleich die alte Hütte aufbrechen, zu der ich natürlich keinen Schlüssel hatte. Aber was blieb mir anderes übrig? Ich musste Gewalt anwenden, wenn ich nicht erfrieren wollte. Und genau das tat ich. Glücklicherweise war der alte Heizlüfter noch oder schon da, sodass ich bald wieder im Warmen saß.
Als mein Blick am nächsten Morgen in den ovalen Spiegel fiel, der über dem durchgesessenen Sofa in der alten Hütte hing, wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass ich inzwischen wirklich wie ein Penner aussah. Ich hatte mich zwar einige Male gewaschen, eine Dusche aber gab es in dem Kleingarten natürlich nicht. Unrasiert, mit fettigen, verzottelten Haaren, langen, dreckigen Fingernägeln und ungepflegten Zähnen grinste ich mich verstohlen an – und schämte mich.
Da beschloss ich, endlich wieder zu leben. Ich fand es plötzlich unendlich dumm, mit dem Schicksal zu hadern. Und als ich an diesem Morgen an der Bahntrasse entlang in die Stadt lief, war ich sehr zuversichtlich. Ich hatte mir fest vorgenommen, mich wieder um mich zu kümmern. Und zwar um uns beide: nicht nur um den verwirrten Reisenden, der jeden Morgen froh war, dass ihn zumindest die Dinge, die er am Körper trug, in die Vergangenheit begleiteten, sondern auch um mein altes Ich.
Dieser Gedanke beflügelte mich. Da war dieser ahnungslose Max, der in den achtziger Jahren vor sich hinlebte, ohne zu wissen, was ihm bei der Jahrtausendwende passieren sollte – und keiner kannte ihn so gut wie ich. Ich wollte mir helfen, mich begleiten und mir wichtige Ratschläge geben. Was hätte ich auch sonst tun sollen? Das war das einzige Ziel, das mir blieb. Ich konnte versuchen, aus mir das Beste zu machen.
1986 Am Dienstag, den 14. Januar, besuchte ich mich zum ersten Mal in der Universität. Mein altes Ich war gerade 21 geworden, und ich war immer noch 35 und hatte mir in den vergangenen zwei Wochen so viel Bart wachsen lassen, dass ich mich auf keinen Fall erkennen würde. Ich war lange unsicher gewesen, ob ich diese Begegnung riskieren sollte, aber dann hatte ich mich daran erinnert, dass mir 1986 eine merkwürdige Kneipen-Tour mit einem ausgeflippten Unbekannten, der sich „Christoph“ nannte, den ersten Anstoß gegeben hatte, von Sonderpädagogik zur Altphilologie zu wechseln.
Ich hatte damals die Nase gestrichen voll von all den Schulpraktika, in denen es nicht um die Qualität des Unterrichtsstoffes, sondern um reine Machtfragen ging. Wer zeigt hier wem, was eine Harke ist? Der Lehrer den Schülern oder umgekehrt? (Van Dyck blickte mich verständnislos an.) Und wenn mir meine Schutzbefohlenen einmal nicht den Krieg erklärten, dann hingen sie wie gelähmt in den Stühlen, ließen meine anfangs noch sehr motivierten Unterrichtsentwürfe gähnend über sich ergehen oder starrten Löcher in die Decke.
Ich war 21 und sehr frustriert. In meiner Fantasie existierte Schule so unterhaltsam und freundlich wie im „Fliegenden Klassenzimmer“ von Erich Kästner, in der Realität aber war von diesem Vertrauen zum Lehrer, von der Freundschaft, der Wissbegierde und der Sehnsucht nach Gemeinschaft bei den Schülern nur wenig zu spüren. Und trotzdem wäre ich ohne einen äußeren Anstoß sicher Lehrer geworden, denn einen Wechsel des Studiengangs hätte ich aus eigener Kraft kaum vorangetrieben.
Ich stieg an der Bockenheimer Warte aus der Straßenbahn und schlenderte an den ewig gleichen Ständen mit gebrauchten Büchern vorbei, die sich dort vor dem Campus in Reih und Glied auf wackeligen Tapeziertischen nach neuen Lesern sehnten. Zeigefinger wanderten die Buchrücken entlang, verharrten bei einzelnen Titeln, um sich dann ab und an doch zwischen den Seiten zu verlieren. Eine junge Frau, die erschreckend hohe Absätze trug, holte gerade ihr Portemonnaie heraus, stellte aber offensichtlich fest, dass ihr Geld nicht für die gewählten antiquarischen Angebote reichte. Missmutig steckte sie die Börse zurück und lief eilig davon. ‚Es hat sich nichts geändert‘, dachte ich und wusste doch, dass alles anders war. Und dann sah ich es auch: Das „Depot“ hatte sich aus einer modernen Kultur- und Begegnungsstätte wieder in eine alte Eisenbahnhalle verwandelt und der McDonald‘s im Eckhaus war noch nicht da.
Mehrfach traf ich Bekannte aus der Studienzeit, traute mich aber nicht, sie zu grüßen. Sie hätten mich ohnehin nicht erkannt. Außerdem ging es mir ja um mich. Ich hatte mich daran erinnert, dass zu jener Zeit jeden Dienstag eine gut besuchte Vorlesung über „Die Pädagogik des 20. Jahrhunderts“ angeboten wurde, und mir vorgenommen, mich dort zu treffen, sah mich dann aber schon vorher vor dem Schaufenster des studentischen Reisebüros stehen und nach billigen Reisen Ausschau halten. Das Wissen, dass ich mit einem Flugzeug in wenigen Stunden in einer anderen Welt sein konnte, hatte mich schon immer fasziniert.
1635 Van Dyck wirkte angestrengt. Erst jetzt wurde mir bewusst, dass es für ihn fast unmöglich sein musste, sich diese Zukunft vorzustellen. Immer wieder verzog er sein Gesicht, wenn meine Erzählung seinen Erfahrungshorizont überstieg, hörte mir aber tapfer weiter zu und nippte gedankenverloren an seinem Wein. Meine Geschichte war für ihn nicht nur durch die Reise in die Vergangenheit eine Zumutung, sie erforderte darüber hinaus seine ganze Vorstellungskraft. Kaum etwas von dem, was ich beschrieb, existierte in seiner Welt. Die 365 Jahre, die uns trennten, waren wie ein unüberbrückbarer Graben. Trotzdem nahm er erst die Flugzeuge, die ich ihm gegenüber salopp als Reisevögel bezeichnet hatte, zum Anlass nachzufragen.
Er blickte mich durchdringend an: „Wie lange braucht so ein Reisevogel von London nach Florenz oder Palermo?“
Ich stutzte, weil er mich unterbrochen hatte: „Na ja, ungefähr zweieinhalb Stunden! Und in vier Stunden ist er in Jerusalem.“
„Das ist unmöglich! In dieser Zeit kommt man ja nicht einmal bis Brighton. Ein Reisevogel? Was soll das eigentlich sein? Ein gigantischer Geier oder was?“
„Nein, Sir, eine Maschine aus Metall. Sie hat Flügel, aber auch Räder, auf denen sie immer schneller rollt, bis sie abhebt. Aber ich kann Eure Zweifel verstehen: Fast alles, was Menschen erfunden haben, galt einmal als unmöglich.“
Der Künstler schenkte sich noch etwas Wein ein. Dann atmete er hörbar aus und lehnte sich zurück: „Vergiss meine Fragen und erzähl weiter!“
1986 Ich stand neben mir, also neben dem Maximilian des Jahres 1986, und sprach mich an: „Na, schon in Urlaubslaune? Sag mal, kennst du dich hier aus?“
Mein jüngeres Ich blickte mich fragend an. Ich sprach weiter: „Ja, ich habe gerade die Uni gewechselt und noch überhaupt keine Ahnung, wo‘s langgeht.“
„Was studierst du denn?“, fragte mein jüngeres Ego.
„Sonderpädagogik“, sagte ich, „übrigens: Ich heiße Christoph!“ „Ich bin Max. Na, da hast du ja wirklich Glück gehabt, ich studiere nämlich den gleichen Quatsch.“
Ich fing an, mir die Vor- und Nachteile des Frankfurter Fachbereichs zu erklären, und ich hatte Zeit, mich in Ruhe anzuschauen. Max als Studienanfänger. Zum ersten Mal wurde mir bewusst, wie sehr sich Menschen verändern. Der hochaufgeschossene Jüngling, der da mit kieksiger Stimme auf mich einredete, war ich und war doch nicht ich. Dem da fehlte so viel an Erfahrung, an Reife und an Gelassenheit. Ein typischer Student. Ich war enttäuscht.
Mein 21-jähriges Ich entpuppte sich als unangenehmer Kerl, mit dem ich bestimmt keine Freundschaft geschlossen hätte: zutiefst von sich überzeugt, schnoddrig, unreflektiert, aber vollgestopft mit altklugen Sprüchen. Die dünnen Härchen am Kinn und die schulterlangen Haare wirkten vernachlässigt, und die Hände zuckten die ganze Zeit nervös zur Seite, als wollten sie etwas greifen. Kein Wunder, dass ich damals so oft Krach mit meinem Vater hatte, durchfuhr es mich. Ich war zwar während meines Zivildienstes in Kassel von zu Hause ausgezogen, dann aber wieder zurückgekehrt.
Nach dem Seminar gingen wir zusammen ins „Piccolo Giardino“, ein kleines italienisches Restaurant im Nordend, und ich fragte mich nach meinen Zukunftsplänen: „Willst du später ernsthaft als Sonderschullehrer arbeiten?“
Max, der jüngere, zögerte einen Moment, dann sagte er: „Keine Ahnung. Ich mache erst mein Studium fertig, dann gucke ich weiter.“
„Das klingt ja sehr begeistert“, sagte ich.
Er spielte mit dem Salzstreuer, in dem kleine Reiskörner wie Fische im Aquarium schwammen, und zuckte mit den Schultern: „Na, findest du diese Jugendlichen in den Schulbänken etwa toll?“
„Nein, deswegen werde ich auch zum nächsten Semester das Fach wechseln. Ich werde mit Altphilologie weitermachen!“
„Aha!“ Er grinste mich spöttisch an: „Meinst du nicht, dass du in deinem Alter mal langsam einen Abschluss machen solltest?“
Ich knurrte nur, weil mir in diesem Augenblick klar wurde, dass es mir niemals gelingen würde, mich in der Gestalt eines 35-Jährigen von einem Studienfachwechsel zu überzeugen. Ich erinnerte mich daran, wie kritisch ich damals gegenüber Bummelstudenten gewesen war, die fünfmal mit einem neuen Fach anfangen und dann nach dem Examen direkt die Rente beantragen.
Also versuchte ich einen anderen Weg: „Kennst du Lukian?“
„Nee, nie gehört! Wer soll das denn sein?“
Ich schlug die Beine übereinander: „Das ist ein Kabarettist und Schriftsteller aus dem zweiten Jahrhundert, dessen Karriere mit einem Traum anfing, den er als junger Mann hatte. Er wollte unbedingt Anwalt und Redner werden. Und es gab nur einen ernsthaften Hinderungsgrund: Lukian lebte in Samosata am Euphrat, also in Syrien, die Weltsprache der damaligen Zeit war aber Griechisch. Doch er wusste, dass man, wenn man eine Vision für sein Leben hat, groß denken muss. Also setzte er sich hin und studierte monatelang bei verschiedenen Lehrern Griechisch, bis er die fremde Sprache fließend sprechen und schreiben konnte. Und dann zog er los und fing an, seinen Traum zu leben.“
Max wirkte genervt: „Ja und?“
„Du meinst, warum ich dir das erzähle? Weil mich der Typ fasziniert. Weil er einer war, der wusste, was er wollte. Und dafür war ihm kein Weg zu mühsam und kein Hindernis zu groß. Ich glaube, dass ich jetzt in meinem Studium auch endlich an dem Punkt bin, an dem ich weiß, welchen Traum ich habe. Und ich bin jetzt auch bereit, was dafür zu investieren. Ich habe zu lange alles mit halbem Herzen gemacht, jetzt fang ich an.“ Ich machte eine Pause, dann blickte ich ihm direkt in die Augen: „Weißt du, was du willst?“
Er wich meinem Blick aus. „Keine Ahnung! Meinst du, ich soll Griechisch lernen, oder was? Das hat mir schon an der Schule gereicht.“
„Na ja, es gibt sicher Schlimmeres. Eines ist jedenfalls sicher: Wenn dich das Unterrichten jetzt schon ankotzt, dann wäre es ja wohl das Sinnloseste, die nächsten 30 Jahre damit zu verbringen.“
Mein jüngeres Ich schaute mich genervt an. „Und was hat dieser Lukian davon gehabt? Heute kennt ihn keiner mehr!“
„Na, immer langsam! Ich bin ziemlich sicher, dass er ein sehr zufriedener Mensch war. Und es ist ja nicht übel, nach 1800 Jahren immer noch gedruckt zu werden. Das können nur wenige von sich sagen. Außerdem hat Lukian eine Menge anderer Dichter und Denker inspiriert. Goethe hat sogar die Geschichte vom Zauberlehrling von ihm geklaut. Ich jedenfalls gehe fest davon aus, dass ich als Altphilologe mehr über das Leben lerne als in der Sonderpädagogik.“
Irgendwie wusste ich nicht weiter. Ich kam mir dumm vor. Ich saß da und versuchte, mich selbst von etwas zu überzeugen, von dem ich als 35-Jähriger gar nicht mehr überzeugt war. Und doch musste ich mich vor einem Beruf retten, der mich ruiniert hätte.
Ich starrte auf meinen Teller, stocherte lustlos in meinen „Fettucine a la panna“, grübelte vor mich hin und suchte nach Argumenten. Max sah mich nachdenklich an. Als ich mit dem Blick dem Weinglas folgte, das er zum Mund führte, bemerkte ich, wie sich der geblümte Vorhang vor dem Windfang bewegte und eine Gruppe gut gelaunter Studentinnen aus der Kälte hereinkam. Die ersten beiden setzten sofort ihre Brillen ab, die in dem stickigen Raum beschlugen, und blickten mit großen Augen in den Raum. Die dritte strich sich genüsslich die Haare aus dem Gesicht und gab ihrer Freundin eine flapsige Antwort auf etwas, das diese gesagt hatte. Es war Verena.
Verena, die Wilde, die Verrückte, die einzige Liebe meiner Studentenzeit. Verena, die Frau, die immer in der Angst lebte, etwas zu versäumen. Sie war es, die mir beigebracht hatte, Dinge um ihrer selbst willen zu tun: Tanzen, Singen und Spazierengehen, Weinen oder Streiten. Wir hatten drei wundervolle Jahre miteinander verbracht, in denen ich angefangen hatte, das Leben zu lieben. Als sie dann nach Hamburg gezogen war, um ihr Studium zu beenden, führten wir noch eine Zeit lang eine Wochenendbeziehung.
Doch es ging uns wie so vielen. Da wir uns nur selten sahen, hatten wir keine gemeinsame Geschichte mehr. Wenn wir jetzt Zeit miteinander verbrachten, drehten wir uns nur noch umeinander und verloren dabei den Alltag völlig aus dem Blick. Nach den Wochenenden kehrte jeder in eine dem anderen unbekannte Welt zurück. Trotzdem hätte unsere Beziehung vielleicht überlebt, wenn ich sie nicht mit meiner Eifersucht kaputt gemacht hätte. Verena hasste es nämlich, kontrolliert zu werden, und ich hasste es, wenn sie immer wieder von Kommilitonen erzählte, mit denen sie ausgegangen war. Einmal hatte ich in meiner Wut und Ohnmacht, als sie mir am Telefon von einer „tollen“ Party mit „echt netten Männern“ erzählte, ein Stück aus dem Glas gebissen, das ich gerade in der Hand hielt.
Ich glaube nicht, dass sie mich jemals betrogen hat, aber es reizte sie so sehr, mein Vertrauen auf die Probe zu stellen, dass sie in ihrem Übermut immer verfänglichere Situationen herbeiführte. Je eifersüchtiger ich wurde, desto herausfordernder lebte sie: Sie ging ständig mit Studienkollegen in die Sauna, ließ nach langen Lernabenden Freunde bei sich übernachten, berichtete stolz, welche Männer an ihr interessiert seien und betonte bei all dem, dass sie doch wohl nicht mein Eigentum sei.
Für sie war das alles ein amüsantes, reizvolles Spiel, aber sie beendete es nicht, solange sie die Spielregeln noch kontrollieren konnte. Und ich Idiot war so eifersüchtig, dass ich anfing, ihr Verbote zu erteilen; was sie natürlich nur noch mehr reizte und anstachelte. In meiner Hilflosigkeit und Verzweiflung verlor ich wohl all die Eigenschaften, die Verena jemals an mir geliebt hatte. Und als wir uns trennten – das dachte ich damals jedenfalls –, wollte keiner von uns beiden, dass es passierte. Aber wir hatten uns zu sehr herausgefordert.
Später heiratete sie einen Mediziner, der vor ihrer Scheidung mehrfach fremd ging. Ich schäme mich noch heute dafür, dass mir diese Entwicklung eine innere Genugtuung bereitete. Aber das sollte ja alles erst sehr viel später kommen.
Jetzt war die 20-jährige Verena im Raum, und mir fiel wieder ein, dass ich ihr an diesem Abend das erste Mal begegnet war, am 14. Januar 1986. Ich konnte mir das Datum damals gut merken, weil es einen Monat vor dem Valentinstag lag.
Spontan rief ich: „Hallo, Verena!“
Sie sah mich irritiert an, und erst da wurde mir bewusst, dass ich für sie ein völlig Unbekannter war. Einer, der plötzlich die Anonymität aufbrach. Sie winkte unsicher zurück, und man konnte ihr ansehen, dass sie verzweifelt versuchte, mich einzuordnen, diesen 35-jährigen Kerl, der so vertraut tat. Es war für sie offensichtlich einer dieser grauenhaften Momente, in denen man sich nicht blamieren will, obwohl man mit dem fröhlich grüßenden Gegenüber nichts, aber auch überhaupt nichts anfangen kann. Sie zögerte.
Ich aber wusste plötzlich, dass ich jetzt etwas tun musste, weil sonst mein 21-jähriges Ich niemals die Bekanntschaft dieser Prachtfrau machen würde. Jetzt hatte ich die Gelegenheit, mir etwas Gutes zu tun. Nein, ich musste sogar die Initiative ergreifen, wenn mein Leben nicht völlig anders verlaufen sollte, als ich es kannte.
Weil Verena immer noch unschlüssig zwischen unserem Tisch und ihrer Clique hin- und herblickte, winkte ich sie herüber. Sie flüsterte ihren Freundinnen etwas zu und kam dann an unseren Tisch.
„Sei nicht böse, aber ich kann mich im Augenblick gar nicht erinnern, woher ich dich kenne!“
Ich lachte: „Du kennst mich auch nicht, aber jedes Mal, wenn eine schöne Frau den Raum betritt, rufe ich ‚Hallo, Verena‘, und nach 144 Versuchen hat es endlich geklappt. Du ahnst gar nicht, wie selten der Name Verena ist.“
Sie strich irritiert ihre Haare aus der Stirn: „Erzähl keinen Mist. Also, woher kennen wir uns?“
„Ich sage es dir, wenn du dich zu uns setzt.“
Die Neugier siegte. „Aber nur einen kurzen Moment, ich bin ja nicht allein hier.“
Sie nickte in Richtung ihrer Freundinnen, hängte ihre Handtasche über die Stuhllehne, und dann saß sie bei uns, Verena, die Kantige, die Frau mit den lachenden Augen und dem wissbegierigen Blick. Die Schöne mit den geschwungenen Augenbrauen, in deren Zügen sich noch Spuren ihrer tschechischen Vorfahren fanden. Ich war verzaubert. Meine Nase erkannte ihr Parfum wieder und verliebte sich sofort.
„Ich bin Christoph, das ist Maximilian.“
Sie stutzte: „Seid ihr Brüder?“
„Nein, wieso?“
„Ihr seht euch irgendwie ähnlich.“
Maximilian lachte, und ich verzog den Mund zu einem bübischen Lächeln: „Um es mit einem alten Indianersprichwort auszudrücken: ‚In unsern Adern fließt das gleiche Blut.‘“
„Ach“, sagte Max, „das wusste ich ja noch gar nicht!“
Verena blickte sich um. „Also, Christoph, auch jetzt, wo ich deinen Namen weiß, fällt mir nicht ein, wann und wo wir uns schon einmal gesehen haben.“
Ich strahlte: „Du hast mich noch nicht gesehen. Ich dich schon!“
Sie feixte und ließ zwei kleine Grübchen auf ihren Wangen blitzen. „Ach, bist du ein Spanner?“
„Nein, ich bin … na, sagen wir mal, ein Prophet, ein Hellseher, ein Wahrsager oder so etwas Ähnliches.“
„Komisch!“, sagte Maximilian, „ich dachte, du studierst Altphilologie!“
„Noch nicht, das war doch auch eine Prophezeihung. Ich kann übrigens genauso gut in die Gegenwart sehen. So wie ich Verena auf die Nase zusagen kann, dass ihre Schwester Anja heißt, sie am Palmengarten wohnt und ihr Vater Projektleiter bei der GTZ, der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, ist.“
Verena zog die Stirn in Falten. „Machst du hier einen auf Privatdetektiv?“
Ich öffnete vielsagend die Hände. „Na, Philipp Marlowe würde wahrscheinlich nur schwer herausbekommen, dass du am liebsten Käsespätzle isst, dass du dieses Jahr nach Korsika fahren willst, und schon gar nicht, dass du es hasst, wenn man dich am Hals küsst.“
Jetzt wurde sie blass. Sie warf einen unsicheren Blick zu ihren Freundinnen, die aber untereinander ins Gespräch vertieft waren. Alles an ihr strahlte Verwirrung aus, als wüssten ihre Gedanken nicht, in welche Richtung sie gehen dürften.
Ich genoss es, mit ihr spielen zu können.
Langsam fasste sie sich. „Augenblick mal, welche Schuhgröße habe ich, und wie heißt unser Hund?“ Sie zog instinktiv ihre Beine zurück, um ihre Füße zu verbergen.
Ich spielte lässig mit der Serviette. „Du hast Größe 36, und euer Hund heißt Saphir, aber alle nennen ihn Schnuff. Dass er Saphir heißt, weil dein Vater deiner Mutter zum Hochzeitstag die Wahl zwischen einem Hund und einem Saphirring ließ, soll niemand erfahren, weil deine Mutter Angst hat, dass jemand sie auslacht.“
Max kniff die Augen zusammen. „Sagt mal, was geht hier eigentlich vor? Habt ihr beiden euch vorgenommen, mich zu verarschen, oder was?“
Verena schüttelte den Kopf. „Das Gleiche wollte ich auch gerade sagen. Da ist doch irgendein Trick dabei.“
Max hob theatralisch die Hand. „Also, ich habe damit nichts zu tun, ich kenne Christoph selbst erst seit heute Mittag. Nebenbei: Könntest du über mich auch so viel erzählen?“
Ich lachte. „Oh, noch viel mehr.“
Ich hatte das Gefühl, dass ich meinem Ziel näher kam. Wenn Verena und Max mich als gemeinsamen Gegner empfanden, war das eine gute Ausgangsposition. Eben noch waren sie sich fremd gewesen, jetzt überlegten sie schon zusammen, worin mein Geheimnis bestand. Sich selbst zu verkuppeln, ist eine schöne Aufgabe.
Ich musste schlucken, weil mir einige der vielen wundervollen Momente einfielen, die die beiden zusammen erleben würden: der erste Kuss auf dem Eisernen Steg, der gemeinsame Korsika-Urlaub auf dem kleinen Campingplatz in dem hoch gelegenen Edelkastanienhain, die Bouillabaisse am Hafen von Ajaccio, die Spaziergänge durch den Grüneburgpark, der Moment, als im Stadtbad Mitte Verenas Glitzerbikini-Oberteil beim Sprung vom Dreimeterbrett riss, sie es nicht bemerkte und, als sie aus dem Becken stieg, nur fragte: „Warum guckt ihr alle so komisch?“, der gemeinsam aufgezogene Igel, der schon ganz steif auf der Terrasse gelegen hatte, oder die zärtlichen Treffen im Gartenhäuschen. Für einen kurzen Moment wurde ich auf mich selbst eifersüchtig.
Während meiner romantischen Gedanken hatte ich an Verena vorbei gesehen. Das war ein Fehler gewesen. Offensichtlich interpretierte sie mein Schweigen falsch. Sie blitzte mich an und sprang wütend auf: „Ich weiß nicht, woher ihr das alles wisst und mit welcher neuen Masche ihr zwei komischen Typen jetzt die Frauen anmacht, aber es ist eine wirklich miese Tour. Habt ihr schon mal etwas von Datenschutz gehört? Hör auf zu grinsen, Christoph, oder wie du wirklich heißt.
Was meinst du: Wie würdest du dich fühlen, wenn plötzlich jemand vor dir stünde, der dir dein ganzes Leben erzählt? Der so tut, als gäbe es keine Geheimnisse mehr. Als wüsste jeder, was du tust und treibst. Kann sein, dass ihr so etwas toll findet, mich widert ihr nur an! Kann auch sein, dass ihr andere Frauen damit ins Bett bekommt, mich garantiert nicht. Egal, wie ihr an die Informationen gekommen seid, ihr habt kein Recht, mich so auszuspionieren.“
Ich konnte mich einfach nicht mehr erinnern, ob diese Situation, als ich sie das erste Mal erlebt hatte, auch so abgelaufen war. Verenas Zorn, der alles kaputt zu machen drohte, wäre mir sicher in Erinnerung geblieben.
Andererseits: 14 Jahre sind eine lange Zeit. Vielleicht hatten die gemeinsamen Glücksmomente den schlechten Start verdrängt, vielleicht werden manche Erlebnisse auch irgendwann aus dem Gedächtnis gelöscht.
Ich wusste es nicht. Ich spürte nur, dass mir die Situation aus der Hand zu gleiten drohte. Verena hatte ihre Handtasche gegriffen und zwängte sich bereits erregt am Nachbartisch vorbei. Trotzdem drehte sie sich noch einmal um, wohl in der Hoffnung, eine Erklärung zu bekommen. Sie war eben schon immer neugierig.
Da beschloss ich, alles auf eine Karte zu setzen: „Hast du den Brief noch, den ich dir vor einem Jahr geschickt habe und den du erst morgen öffnen sollst?“
Verena blieb mitten im Lauf stehen. Natürlich hatte ich die Bemerkung mit dem Brief improvisiert, aber ich hatte ja tatsächlich die Möglichkeit, ihr im Jahr 1985 etwas zu schicken. Langsam drehte sie ihren Oberkörper wieder in unsere Richtung. Ihr Gesicht war eine einzige Frage: „Wie sieht dieser Brief aus?“
Volltreffer. Jetzt hatte ich sie. Ich war bisher nicht auf die Idee gekommen, meine Zeitreise praktisch zu nutzen, jetzt ahnte ich etwas von den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung standen.
Versöhnend sagte ich: „Es ist ein grüner Briefumschlag. Und in diesem grünen Briefumschlag steckt ein zweiter Briefumschlag, ein roter. Darauf steht: ‚Diesen Brief auf keinen Fall vor dem 15. Januar 1986 öffnen. Ein guter Freund.‘“
Verena zog ihre Handtasche vor den Bauch, öffnete sie und holte einen kleinen roten Briefumschlag hervor.
„Dieser hier?“
Ich nickte. Sie aber atmete laut: „Du hast diesen Brief geschrieben? Aber warum? Wir kennen uns gar nicht. Langsam verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich wollte diese mysteriöse Botschaft heute Nacht mit meinen Freundinnen zusammen öffnen, weil wir alle unbedingt wissen wollen, wer und was dahinter steckt. Wir dachten, es sei irgendein Spaßvogel. Oder ein heimlicher Verehrer.“
„Vielleicht trifft ja beides zu!“
Ich prägte mir Form und Farbe des Umschlags ein, denn ich würde morgen, also im Jahr 1985, genau so einen finden und abschicken müssen. Verena sah jetzt entspannter aus. „Warum erzählst du mir nicht einfach, was drin steht?“
„Das, äh, ist kompliziert. Sagt mal, habt ihr beide morgen Abend Zeit? Gut! Ich werde euch dann alles erklären. Um sieben vor der Katharinenkirche?“
Ich erhob mich. Beide folgten mir misstrauisch mit den Augen. Ich konnte ihre Fragen spüren. Verena senkte den Kopf und blickte mich durch ihre dichten Wimpern an. Mir fiel wieder ein, dass sie das immer tat, wenn sie unsicher wurde oder sexuell erregt war. „Was ist jetzt mit diesem Brief?“
Auf diese Frage hatte ich gewartet. „Verena, kann ich dich einen Moment unter vier Augen sprechen? Ja? Bitte! Es dauert auch nicht lange.“
Max sah aus, als habe er etwas dagegen, aber er räusperte sich nur und verdrehte die Augen. Verena streifte ihre Jacke über und ging auf den Ausgang zu. Als ich die Türklinke in der Hand hielt, sah ich die fragenden Blicke ihrer Freundinnen, die uns in die Dunkelheit folgten.
Wir gingen schweigend auf den Adlerflychtplatz, auf dem ich einmal als Vierjähriger meiner Mutter davongelaufen war. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, dass das das erste Angsterlebnis ist, an das ich mich erinnern kann. Und jetzt war Verena bei mir. Wir setzten uns auf eine der Kinderwippen, die mit dünnem Frost überzogen dastanden und Dinosauriergerippen glichen.
Verena und ich. Es war verrückt. Plötzlich war ich 14 Jahre älter als sie, und sie wusste nicht, wie sehr ich sie geliebt hatte. Wir begannen zu wippen, begleitet von dem leisen Quietschen der Scharniere, das wie eine Fledermaus um uns durch die Bäume jagte. Ich hätte am liebsten gar nichts gesagt, aber sie stieg plötzlich vom Sitz und ließ mich unsanft auf den nur wenig dämpfenden Autoreifen knallen. „Also, was steckt hinter all diesen verrückten Dingen?“
Ich versuchte vergeblich, in der Dunkelheit ihren Gesichtsausdruck zu deuten. Vorsichtig sagte ich: „Das meiste steht in meinem Brief. Ich möchte, dass du ihn morgen liest, ohne deine Freundinnen und ohne Max. Ich werde morgen Abend auch nicht zu eurem Treffen kommen. Aber ich bitte dich: Geh du hin. Triff dich mit Max. Sag ihm … was weiß ich … ich hätte deine beste Freundin ausgequetscht, dadurch wäre ich an all die Detailinformationen gekommen, und letztlich hätte ich dir eine Versicherung andrehen wollen. Wichtig ist, dass Max mich möglichst schnell vergisst und unter der Kategorie ‚Verrückter‘ abbucht. Tu mir den Gefallen und sprich mit ihm. Es ist für ihn, für dich und für mich von entscheidender Bedeutung.“
Verena war jetzt ernsthaft zornig: „Warum sollte ich das alles machen? Ich kenne ihn ja gar nicht!“
Meine Stimme hatte auf einmal diesen tiefen, eindrücklichen Klang, mit dem ich sie früher immer betört hatte: „Das steht in meinem Brief! Lies ihn, bitte, morgen. Mehr kann ich dir jetzt nicht sagen!“
Sie trat auf mich zu. „Und du? Wer bist du?“
„Wer weiß, vielleicht bin ich tatsächlich ein Prophet?“
Ich versuchte, die gedrückte Stimmung wegzulachen, aber es gelang mir nicht. Verena stand im Halbdunkel eines Baumes, der das Licht der Straßenlampen abhielt, und starrte mich an. Mit einem bohrenden Blick. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Sanft flüsterte ich: „Weißt du, was der griechische Schriftsteller Lukian den Gott Amor einmal sagen lässt? ‚Wenn ich euch auf das Schöne aufmerksam mache, was tu ich daran so Unrechtes? Lasst ihr euch davon hinreißen, so ist das eure Sache; was gebt ihr mir die Schuld?‘ Vielleicht ist es das, was ich will: Ich möchte dich auf die Schönheit dieses Lebens aufmerksam machen.“
„Ach, du bist also Amor!“
„Nein, natürlich nicht! Obwohl, warum nicht? Ich möchte jedenfalls gerne einer sein, der Sehnsüchte erfüllt. Lass es auf einen Versuch ankommen.“
„Also, Amor, ich werde deinen Brief lesen, und vielleicht gehe ich auch morgen zu diesem Treffen, aber ich hoffe, dass ich bis dahin eine gute Erklärung für das alles habe.“
„Das hoffe ich auch“, sagte ich und verschwand in der Nacht.
1635 Ein älterer Page betrat das Atelier und erschrak, als er Van Dyck und mich in Decken gehüllt auf zwei Kisten sitzen sah. Der Künstler wollte ihn erst brüsk hinausschicken, dann besann er sich: „Robin, zieh deine Jacke aus.“
Der Page zögerte.
„Ich brauche sie für mein Bild. Na, mach schon! Deine Jacke wird in die Ewigkeit eingehen.“
Van Dyck nahm dem betreten dastehenden Pagen die Bekleidung ab, streifte sie mir über und schob mich hinter die Staffelei.
„Sei nicht böse, aber wenn ich bis zwölf Uhr mit deinem Bild fertig sein will, nein, fertig werden soll, dann muss ich noch ein bisschen arbeiten. Du kannst ja dabei weitererzählen. Genau, da hast du gestanden. Nimm bitte den Kopf nicht ganz so hoch, vorher war das Kinn tiefer. Ja, es muss ein unsicherer und trotzdem zielgerichteter Blick in die Vergangenheit sein. Dort kommt alles her. Dort scheint das Licht, das unsere Gegenwart erhellt. Du bist derjenige, der weiß, dass hinter dem Horizont des Vergangenen ein unendlicher Reichtum wartet, von dem wir möglichst viel in die Gegenwart retten sollten, wenn wir eine Zukunft haben wollen. Ja, jetzt ist es so, wie ich es mir vorgestellt habe. Stell dich etwas breitbeiniger hin; wer die Vergangenheit kennt, der ist gut geerdet. Ja. Das linke Bein ein bisschen vor, als drängte es dich, wieder zurückzukehren in die leuchtende Historie. Genau, der ganze Schritt muss Hoffnung ausdrücken. Und zugleich hält dich die Gegenwart gefangen, denn du weißt ja, dass man nicht zurück kann. Keiner kann das.“
„Ich kann es!“
Van Dyck strich sich über die Nase: „Stimmt. Merkwürdig, mein Verstand hat das einfach ignoriert. Irgendwie wollen wir das, was wir nicht glauben können, auch nicht wahrhaben. So, wie du jetzt vor mir posierst, habe ich eben in dir wieder ein gewöhnliches Modell gesehen. Verzeih. Erzähl mir, was in diesem Brief stand, den du an deine ehemalige Mätresse geschrieben hattest.“
1985 „Ich musste in mehreren Geschäften nachfragen, bis ich die richtige Umschlagsorte gefunden hatte. Dann saß ich den ganzen nächsten Tag, es war wieder ein Dienstag, in der kalten Hütte und arbeitete an meinem Brief. Es war nicht leicht, in die Zukunft zu schreiben, aber es musste sein. Ich hatte das Schreiben in Verenas zitternden Händen gesehen, nun blieb mir keine andere Wahl, als es auch abzuschicken. Also verfasste ich einen Brief, den ich schon fertig geschrieben gesehen hatte. Ich konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, was ich damit auslösen würde. Sonst hätte ich ihn nie geschrieben oder ihn direkt nach der Fertigstellung verbrannt. An diesem Morgen glühte ich vor Begeisterung über meine vermeintlich so cleveren Schachzüge, die mir, also meinem jüngeren Ich, eine Traumfrau bescheren würden.
Ich war so naiv.
Später verfasste ich übrigens noch einige andere Briefe. Sie enthielten ausschließlich gute Ratschläge an mich selbst. Doch jedes Mal, wenn ich sie noch einmal durchlas, kamen sie mir so besserwisserisch und unverständlich vor, dass ich sie nicht abschickte.
Überhaupt schäme ich mich im Rückblick über meine unbeholfene Dummheit in dieser Zeit. Ich ließ das verwirrende Dasein geschehen, ohne darin wirklich aktiv zu werden. Mein abendlicher Enthusiasmus in dem kleinen Restaurant und der Brief an Verena waren positive Ausrutscher, Kraftanstrengungen, wie sie mir nachher nicht mehr gelangen. Schließlich schien es viel einfacher, alle Ungereimtheiten dem Schicksal in die Schuhe zu schieben und sich beleidigt zurückzuziehen. Für Maximilian den jüngeren konnte ich mich kurzzeitig aufraffen, für mich selbst fand ich keine Kraft. Ich habe mich später oft gefragt, warum ich damals nicht in der Lage war, mein Leben in die Hand zu nehmen. Es gibt keine Erklärung. Vielleicht ist es wie bei einem Sterbefall. Der Hinterbliebene bleibt derselbe, der er vorher war, und doch lähmt ihn der Verlust für lange Zeit. Das Vakuum, das entsteht, saugt alle Energie, alle Pläne und alle Hoffnungen auf und lenkt die Gedanken so sehr zu dem Vergangenen, dass für die Zukunft kein Raum bleibt. Und wer keine Zukunft sieht, der will dort auch nicht hin. Der will nur zurück. Und weil er das nicht kann, gibt er auf. Bei mir kam zu dieser Lähmung bald darauf auch noch die Angst vor den Auswirkungen meiner anachronistischen Interventionen.
Ich wollte für mich sorgen und versank doch in Lethargie. Nur meine Zeilen an Verena habe ich mit all der verschmähten Liebe, all den ungesagten Worten und all meiner Einsamkeit gefüllt, die mich damals bedrängten. Sollte ich jemals zurückkehren können, möchte ich diesen Brief auf jeden Fall meinen Unterlagen beifügen, da ich aber wenig Hoffnung habe, gebe ich hier den ungefähren Wortlaut wieder, so wie er nach vielem Nachdenken Stück für Stück in mir hervorgekommen ist:
Liebe Verena,
es klingt absurd, aber meine Zeit ist nicht deine Zeit; mein Morgen ist dein Gestern. Wenn du diese Zeilen in 365 Tagen liest, bin ich schon in einem anderen Jahrhundert. Ich weiß nicht, wie ich es verständlicher erklären sollte. Meine Jahre verlaufen jedenfalls anders als deine. Ich kann es selbst noch nicht in Worte fassen. Wie verrückt das ist, erfährst du gerade: Obwohl dieser Brief bereits zwölf Monate lang bei dir liegt, haben wir uns erst vor einem Tag im „Piccolo Giardino“ kennen gelernt. Natürlich wirst du nicht glauben, dass ich dir im Januar 1985 von Ereignissen aus dem Januar 1986 schreiben kann, aber es ist wahr: Ich kenne deine Zukunft. Ich bin aus der Zeit herausgenommen worden und falle haltlos durch die Jahre. Das ist die einzige Erklärung, die ich dir für mein Wissen über dich geben kann.
Weil ich nicht weiß, wie viel Glauben du mir schenkst, erzähle ich dir eine Episode aus deinem Leben, die du noch nie einem Menschen anvertraut hast: Als du elf Jahre alt warst, hat dich auf einer Geburtstagsfeier der Vater deiner Freundin in eine Abstellkammer gezogen und dir unter den Rock gegriffen. Du hast ihn aus Angst gewähren lassen und dich später so über deine Hilflosigkeit geschämt, dass du fortan alle Männer gehasst hast. „Verena, die Keusche“ haben sie dich im Goethe-Gymnasium genannt, weil du bei den Knutschspielchen nie mitmachen wolltest. Und es fällt dir immer noch schwer, dich von einem Mann berühren zu lassen.
Gestern habe ich mich als Propheten bezeichnet. Ich kann dir nicht sagen, ob ich einer bin. Und doch ist das, was in diesem Brief steht, deine Zukunft, dein Leben. Es ist, was es ist. Dass ich dir sage, was dich erwartet, muss sein. Auch das lässt sich nicht so einfach erklären. Um es kurz zu machen: Ich werde dir beschreiben, was in den nächsten Jahren mit dir passieren wird. Denn ich weiß, dass es passieren wird.
Keiner kann den Lauf der Geschichte verändern, ich nicht und du auch nicht. Daher kann ich nicht sagen, welche Chance du hättest, dich gegen das Kommende zu wehren. Du musst selbst entscheiden, was du mit meiner „Weissagung“ anstellst. Ich will auf jeden Fall versuchen, die Dinge nur anzudeuten, damit du nicht als Sklavin dieses Briefes leben musst.
Max, mit dem du heute Abend verabredet bist, und du, ihr werdet ein Paar werden und einige sehr erfüllte Jahre miteinander verbringen. Max ist ein feiner Kerl. Sicher noch ein bisschen unreif und unsicher, was er mit jugendlicher Arroganz zu vertuschen sucht, aber aus ihm kann etwas werden. Durch dich wird er Lust am Leben bekommen, während deine Sprunghaftigkeit etwas nachlässt. Er wird lernen, sich weniger wichtig zu nehmen, du wirst lernen, dich ernster zu nehmen. Er wird seine Zärtlichkeit entdecken, und du wirst verstehen, welches Geschenk es ist, Zärtlichkeit annehmen zu können.
Eines ist ganz entscheidend: Du wirst ihm sein Studium der Sonderschulpädagogik ausreden und ihn motivieren, mit Altphilologie zu beginnen. Er ist unzufrieden mit seiner jetzigen Situation, aber noch zu unflexibel, um sich aus den eingefahrenen Gleisen herauszubewegen. Nimm du das für ihn in die Hand. Dein eigenes Studium wird übrigens sehr erfolgreich verlaufen. Vielleicht hilft dir diese Ankündigung, dich mehr auf die großen Zusammenhänge des Daseins zu konzentrieren. Sei nicht zu schnell zufrieden, aber genieß dieses Leben in vollen Zügen.
Übrigens: Wenn du Ende Februar mit dem Fahrrad zum Reiten fährst, dann schnalle deinen Reithelm nicht auf den Gepäckträger, sondern setze ihn auf. Du wirst stürzen, dank des Helmes aber nur einige Kratzer am Arm abbekommen.
Ich muss aufhören, sonst übe ich gegen meinen Willen Macht über dich aus. Ich kann mir vorstellen, wie viele Fragen jetzt in dir hochkommen, aber ich darf sie dir nicht beantworten. Hier ist deine Zukunft. Gestalte sie.
Mit lieben Grüßen
Dein Christoph
Als ich den Brief eingeworfen hatte, verlor ich die Kontrolle über mich. Hilflos brach ich zusammen. Meine Muskeln gehorchten mir nicht mehr, und ich fiel über meine Beine, ohne den Aufprall abzudämpfen. So sank ich vor dem noch klappernden Briefkasten auf das Trottoir. Ein Häufchen Elend, über das der eisige Wind dunkle Tropfen wehte. Ich kann mich heute nicht mehr an die Umgebung erinnern. Es wurde alles schwarz. Ja, ich weiß nicht einmal, wie lange ich dort regungslos gelegen habe.
Ein älteres Ehepaar half mir auf die Beine und blieb bei mir, bis sich mein Kreislauf wieder stabilisiert hatte. In mir und um mich drehte sich alles. Ich torkelte langsam in die Gartenhütte und weinte dort mehrere Stunden leise vor mich hin. Anfangs verstand ich selbst nicht, was mich so niederdrückte, bis ich nach und nach den Grund meiner Verzweiflung entdeckte.
Nichts stimmte mehr: Ich hatte mich selbst verkuppelt und entmündigt, ich hatte mein Leben verändert und Verena beeinflusst. Ich hatte die Geschichte manipuliert. Ich hatte als winziger David den Goliath Zeit herausgefordert und ihn auch besiegt – aber er war auf mich gefallen. Bis zum Absenden des Briefes war ich der Überzeugung gewesen, ich wäre in jedem Augenblick des bisherigen Lebens Herr meiner Sinne gewesen. Nun wusste ich, wie sehr ich mich geirrt hatte. Ein anderer, ich selbst und doch nicht ich, war in mein Leben eingefallen und hatte all das gesteuert, ferngesteuert, was ich für meine eigene Leistung gehalten hatte.
Das Absenden eines Briefes machte aus einem scheinbar selbstbestimmten jungen Wissenschaftler eine willenlose Marionette. Erstaunlicherweise empfand ich es nicht als Trost, dass ja auch meine Zeitreise ein für mich unverständlicher Willkürakt darstellte, auf den ich keinen Einfluss besaß. Die brutale Vergewaltigung meines Willens durch mein zweites Ich schmerzte wie eine schwere Eisenkette an meinem Bein. Aber was hätte ich denn anderes machen sollen? Ohne mich hätte Max diese Frau doch niemals kennen gelernt.
Ich erschauderte ein weiteres Mal, als hätte in meinem Inneren der Wind gedreht. So wie einen bisweilen die Erkenntnis überrumpelt, dass man anstatt die eigentlichen Fragen zu stellen, auf Nebenschauplätzen gerungen hat. Jetzt erst wurde mir bewusst, in welche bösartige, brutale und menschenverachtende Situation ich Verena gebracht hatte. Was erlebt ein Mensch, der einen Brief bekommt, in dem ihm seine Zukunft nicht nur vorhergesagt, sondern aufgedrängt wird? Welche Freiheit hat er noch? Jedes Wort, das ich der jungen Frau geschrieben hatte, stellte eine Verletzung ihrer Persönlichkeit dar, eine tiefe Verwundung, denn ich nahm ihr den eigenen Willen.
Verena musste im Angesicht der Zeilen um ihr Leben kämpfen. Sie konnte die geheimnisvollen Andeutungen umsetzen oder versuchen, alles anders zu machen. Aber sie konnte dem Fluch der Vorhersagen nicht entgehen, ganz gleich, wie sie reagierte; die Fragen nach deren Richtigkeit würden sich wie ein Phantom an jedem Wendepunkt ihres Lebens aus dem Dunkel erheben und sie verfluchen. Instinktiv wusste ich, dass sie meine Worte akzeptieren würde, denn ich kannte ja die Zukunft. Aber wie viel Überwindung würde es sie kosten? Ich wollte mir ihre Zerrissenheit nicht vorstellen, so weh tat dieser Gedanke.
Und erst, als ich das gedacht hatte, wurde mir klar, worüber ich in diesem tristen Augenblick eigentlich weinte: über mich selbst. Über meine unendliche Dummheit und Verblendung. Ich hatte es ja gut gemeint: Ich wollte mich zu meinem Glück zwingen. Aber war mir das gelungen? Hatte ich nicht genau das Gegenteil erreicht? Hatte ich nicht zwei Personen zusammengezwungen, die sich ohne mein Eingreifen zu Recht nicht begegnet wären?
Plötzlich stand für mich, den weinenden Mann aus dem Jahr 2000, nur noch eine Frage im Raum: „Hat Verena mich jemals geliebt?“ Oder war sie nur mit mir zusammen gewesen, weil ich sie dazu gebracht hatte? Ohne mich zu kennen oder zu mögen, hatte sie auf Grund eines verdammenswürdigen Briefes eine vorherbestimmte Beziehung angefangen. Ich fand kein Taschentuch mehr, um meine verquollenen Wangen zu trocknen. Auf Grund meines eigenen Zutuns entpuppten sich die drei wegweisendsten Jahre meines Lebens als Lüge. Als verhängnisvoller Irrtum. Selbstbetrug! Eine organisierte Liebe. Ich hatte sie quasi aufgefordert, sich zu prostituieren. Und sie war aus Angst vor dem Schicksal darauf eingegangen. Das war sie und nichts anderes: eine Prostituierte der Zeit.
Hatte sie sich vielleicht nachträglich in mich verliebt? Ich glaube nicht. Nachdem ich nun wusste, wie diese Beziehung angefangen hatte, konnte ich sie zum ersten Mal ohne den Schleier der Verliebtheit betrachten; ein erschreckendes Bild.
Damals war ich verblüfft gewesen, wie schnell sich diese betörende Frau auf mich eingelassen hatte, und hatte es auf meinen unwiderstehlichen Charme geschoben. Ich war überzeugt gewesen, sie wäre mir sofort verfallen. Kein Wunder. Sie gehorchte ja nur dem brieflichen Schicksal, das sich ihr in Form eines allwissenden Orakels präsentiert hatte. Ich hasste mich für das, was ich mir und ihr angetan hatte.
Ich rang mit mir selbst und konnte doch nur verlieren. Ich wollte nicht akzeptieren, dass sich Verena wahrscheinlich die ganze Zeit wie in einem Gefängnis gefühlt hatte. Es schien mir unmöglich, dass ich mir diese liebevolle Atmosphäre nur eingebildet hatte. Das war doch eine befreiende, beglückende Beziehung gewesen. Aber wie ehrlich waren ihre Lippen, ihre Hände und ihre Augen wirklich gewesen? Diese hingebungsvollen Umarmungen, das gemeinsame Träumen und Lachen: Das hatte sie alles nicht nur vorgespielt. Oder doch? Und wenn es so war?
Ich hatte ihre sexuelle Zurückhaltung als Folge ihres Kindheitstraumas gewertet. Viele ihrer kleinen Marotten, an die ich mich im Laufe der Zeit gewöhnt hatte, konnten ebenso Zeichen einer tiefen Traurigkeit sein. Die These, dass sie mich nicht geliebt hatte, würde auch einige ihrer Entscheidungen erklären. Zum Beispiel hatte es damals für sie keinen konkreten Anlass gegeben, zum Examen nach Hamburg zu ziehen. Wollte sie einfach nur weg von mir? Und dann all diese Versuche, mich eifersüchtig zu machen: Waren das Hilferufe gewesen? War das vielleicht ihr Weg, dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen?
Sie konnte unsere Beziehung nicht beenden, denn dann hätte sie die Prophezeiung verletzt. Aber sie konnte dafür sorgen, dass ich von mir aus die Partnerschaft auflöste. Sie wollte die Verantwortung für den Bruch, für die Missachtung des Schicksals nicht übernehmen, hielt es aber auch nicht länger mit mir aus. Sie muss sehr gelitten haben. Ob es so war? Ich weiß es nicht. Im Nachhinein spricht so vieles dafür. All die verborgenen Winkel ihres Charakters, zu denen ich in unseren gemeinsamen Jahren keinen Zugang gefunden hatte, taten sich jetzt auf: Kleine Ungereimtheiten, nachlässig dahingesagte Halbsätze und scheinbar unwichtige Streitpunkte goßen sich auf einmal wie Blei in meine Seele. Je länger ich darüber nachdachte, desto mehr war ich davon überzeugt, dass sie mich nie geliebt hatte, dass sie mit mir ausschließlich zusammengewesen war, um dem geheimnisvoll-bedrohlichen Fremden zu gehorchen, der ihr schonungslos eine Zukunft aufgedrängt hatte. Ich war selbst daran schuld. Ich hatte mein und ihr Leben versaut. Ich hatte Gutes gewollt, und es war Schlechtes daraus geworden.
Erst zwei Tage später war ich wieder in der Lage, mein Refugium zu verlassen. Mit dem festen Vorsatz, nie wieder Einfluss auf den Zeitenlauf zu nehmen, keinem Menschen jemals wieder von meiner Reise zu erzählen, mich und andere in Ruhe zu lassen und mich einfach aus dieser Welt zurückzuziehen.
1635 Als ich während meiner Erzählung bei meiner selbstgewählten Isolation angekommen war, sah ich aus den Augenwinkeln, dass der Maler den Pinsel niedergelegt hatte. Er atmete schwer. Mit einem kleinen Leuchter in der Hand ging er zu einem der Fenster, öffnete es und warf einen Blick auf den Mond. Lange Zeit sagte er nichts. Dann flüsterte er: „Langsam fange ich an, dir zu glauben.“
Und als er nicht fortfuhr, fragte ich in die Stille hinein: „Warum?“
Er drehte sich um: „Warum? Warum? Frag mich etwas Leichteres. Vielleicht, weil du in deiner Geschichte das Opfer und nicht der Held bist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand ein so unglaubliches und zugleich verführerisches Märchen einfallen lässt. Wozu auch? Die Fantasie erzählt uns die unglaublichsten Geschichten. Aber dein Märchen ist Wirklichkeit geworden. Und du musst darin leben. Ich schätze, wir haben noch etwa vier Stunden, dann verschwindest du in der Vergangenheit. Wenn ich dir in irgendeiner Form helfen soll, musst du mir mehr berichten. Irgendwo muss da ein Hinweis sein, irgendetwas, an dem man einhaken kann. Hast du dich nach deinem Zusammenbruch gar nicht mehr um dein jüngeres Ich gekümmert?“
Ich atmete tief ein: „Doch, natürlich. Es war das Einzige, was ich tun konnte. Außer mir hatte ich doch keinen mehr. Ich drehte mich die ganze Zeit um mich selbst. Aber ich vermied es, zu sehr mit mir in Kontakt zu kommen. Ich sah mich mehrmals auf dem großen rechteckigen Pausenhof unserer Schule unter den Platanen stehen … damals habe ich noch geraucht … ich fuhr sogar einmal mit mir auf der Frankfurter Eisbahn. Ich konnte nicht genug von mir bekommen. Einmal habe ich mir, dem Kind – ich muss so zehn Jahre alt gewesen sein – 50 Mark in die Jacke gesteckt. Doch auch dabei hatte ich ein schlechtes Gewissen. Ich durfte nie wieder – unter keinen Umständen – das Leben eines anderen Menschen beeinflussen.
Ich wollte mir helfen und konnte es nicht. Ich wollte für mich da sein – und durfte nicht. Aber gerade weil dem so war, verstärkte ich meine Anstrengungen um dieses Kind noch. Und je mehr ich mich hineinsteigerte, desto klarer wurde mir, dass ich mich verlor. Irgendwann war ich fünf, dann nur noch vier Jahre alt. Ich bot sogar meiner Mutter einmal an, auf ihren Kleinen aufzupassen, als sie mir auf einer Parkbank erzählte, sie müsse noch schnell in den Supermarkt. Zehn Minuten lang spielte ich mit dem dreijährigen Jungen, der in mir steckte und in dem ich vorgezeichnet war. Ich genoss es. Ich konnte in meinen Zügen schon mein Lächeln erkennen. Da war mein grimmiges Zusammenziehen der Stirnmuskeln, mein jähes Aufsehen, wenn etwas mich verstimmt, und meine Angewohnheit, wenn ich unsicher bin, die Hände unter die Achselhöhlen zu schieben. Als meine Mutter wiederkam, unterhielten wir uns eine halbe Stunde angeregt, dann nahm sie den Kleinen auf den Arm und verabschiedete sich. Durch das Klettergerüst sah ich mich noch winken, mit einem strahlenden Lachen. Die nächsten drei Tage wartete ich vergeblich darauf, meine Mutter noch einmal mit dem Kinderwagen zu sehen. Sie blieb zu Hause.
Am Donnerstag, den 4. Februar 1965, wachte ich nicht wirklich auf. Ich wusste, dass ich, dass mein Lebenssinn, nicht mehr da war. Es begann die Zeit vor meiner Geburt. Aber meine depressive Stimmung hatte wahrscheinlich schon ein paar Tage früher eingesetzt. Ich musste ja zusehen, wie alles, was ich kannte, nach und nach verschwand. Meine Welt wurde jeden Tag weniger und auch ich wurde jeden Tag weniger.“
Van Dyck schloss das Fenster wieder. „Und was geschah dann?“
„Was heißt das: Was geschah dann?! Nichts geschah dann. Ich bestand nur noch aus Resignation. Seit ich nicht mehr war, wollte ich auch nicht mehr sein. Lange Tage versank ich einfach in mir, dann, Anfang der fünfziger Jahre, ging ich in die Frankfurter Stadtbibliothek, um herauszufinden, in welcher Region ich die beiden Weltkriege am sichersten überstehen würde. Wenig später nahm ich das letzte Geld, das ich noch besaß, und fuhr in den hinteren Vogelsberg. Dort schlief ich in den Scheunen bei den Tieren, bettelte um ein Stück Brot oder setzte mich am Sonntag vor die Kirche. Die Zeit zog einfach an mir vorüber. Die Geschwindigkeit, in der die Jahre vergingen, befreite alle Ereignisse von ihrer Schwere. Sogar Weltkriege, die nur wenige Tage dauern, verloren viel an Grausamkeit, aber mir war ja ohnehin alles gleichgültig. An keinem der sechs Tage, die ich während des Zweiten Weltkrieges verbrachte, sah ich auffallend viele Soldaten. Menschen feierten und Menschen starben, ohne dass es mich berührt hätte.
Es mag merkwürdig klingen, aber man kann 150 Tage verschleudern, ohne es zu bemerken. Ich wurde in diesen Jahren dreimal verprügelt, fünfmal aus einem Dorf gejagt, zweimal zum Baden aufgefordert und einmal mit dem Gewehr bedroht. Na und? Ich wollte nur eines: in Ruhe gelassen werden.
Heute würde ich sagen, dass ich mich damit vor den vielen Zweifeln und Fragen drücken wollte, die in mir ununterbrochen nach einer Antwort schrien. Man kann nicht leben, ohne zu wissen, warum. Ich jedenfalls nicht. Aber man kann sich vor den Fragen geschickt drücken. Und ich verwandte all die Energie, die ich zur Lösung meiner Probleme hätte aufwenden müssen, darauf, sie zu unterdrücken. Es war eine kalte, tote Phase. Ich fürchtete mich weniger davor, keine Antwort zu finden, als vor dem, welche Konsequenzen diese Antworten mit sich bringen könnten. Und daran hat sich im Wesentlichen bis heute nichts geändert.
Anfang des 18. Jahrhunderts begann ich wieder zu arbeiten. Da ich als Student und auch während meiner Assistentenzeit an der Universität nebenbei auf dem Bau gearbeitet hatte, verdingte ich mich als Maurer, Polier, Schreiner oder Vorarbeiter. Eben als das, was gerade gebraucht wurde. So hatte ich wenigstens etwas zu tun, bekam drei Mahlzeiten am Tag und gewann das bisschen Ehre zurück, das ich nach dem Hingang meines jüngeren Ich weggeworfen hatte. Ich denke nicht gerne an diese Zeit zurück. Allerdings fand ich im Lauf der Jahre heraus, dass ich immer öfter mit Menschen zusammenkam, die nicht lesen und schreiben konnten. Daher wandte ich mich von nun an regelmäßig direkt an den Bauleiter und erbot mich, als Schreiber zu arbeiten.
Was mir neben der Arbeit an Kraft blieb, nutzte ich, um Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Ich war überzeugt, dass ich meinen Teil am Leid der Welt bereits ausgekostet hatte. In den Pausen auf der Baustelle und am Abend befragte ich so viele Menschen wie möglich nach der jüngeren Geschichte, nicht, um mich zu bilden, sondern um mögliche Gefahren schon im Vorfeld vermeiden zu können. Ich passte mich allem an und wurde ein perfekter Vergangenheitsopportunist.
Und Ihr könnt mir glauben, Meister Van Dyck: Wer nicht leben will, kann sich auf angenehme Art davor drücken. Außerdem hatte ich genügend Zerstreuung. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell sich die Sprache, die Schrift, die Umgangsformen und die Werte entwickeln. Was heute gilt, war vor 100 Jahren undenkbar und wird in 100 Jahren undenkbar sein. Dabei sind es weniger die sich verschiebenden Laute oder die Wortwahl, die mir Schwierigkeiten bereiten. Es sind die Denkstrukturen, die sich verändern. Kaum ein Europäer des ausgehenden 20. Jahrhunderts kann sich noch in die völkischen Logismen einer nationalistischen Ideologie eindenken. Unabhängig von allen Schuldzuweisungen bemühen sich Historiker und Soziologen, diese grau-braune Zeit zu verstehen, aber es wird nicht gelingen. Sowenig wie ein Indianer einen Aufklärer, ein Sklavenhalter einen Sklavenbefreier oder ein Hexenverfolger eine Feministin versteht, sowenig ähneln sich ein Mensch der fünfziger und der zwanziger Jahre. Sie denken unterschiedlich. Darum ist es auch sinnlos, über andere Epochen zu richten. In ihrer Zeit waren die jeweils Lebenden gleichermaßen bestrebt, ihr Glück zu finden, wie heute.
Wer die Veränderungen der Geschichte während seines Lebens langsam zu spüren bekommt, der mag sich dagegen sträuben, letztlich verliert er aber doch und beugt sich. Wenn er denn überhaupt registriert, wie schnell die Welt ihr Selbstverständnis wechselt. Es ist wie bei Eltern, die meist die Entwicklungen ihrer Kinder durch den engen Kontakt gar nicht bewusst wahrnehmen und erstaunt sind, dass eine selten zu Besuch kommende Tante fröhlich bemerkt, dass ‚der Junge so groß geworden ist‘.
So ging es mir mit der Zeit: Sie kam mir nach jedem „Zurück“ verändert vor und ich musste täglich die Entwicklungen eines ganzen Jahres verkraften. Krisen, Ängste, wissenschaftliche Errungenschaften, Preise, Verkehrsmittel oder auch nur ein Medienereignis haben weitaus größeren Einfluss auf die Gesellschaft, als wir denken.
Ich torkelte durch die Jahrzehnte und bemühte mich angstvoll, nicht in ein historisches Fettnäpfchen zu treten. Natürlich begegnete ich auch Prägungen, die wenig später wieder verschwunden waren. Andere dagegen standen in einem kontinuierlichen Wandel. Die Religiosität etwa nahm stetig zu. Ich stellte überrascht, aber nur wenig verwundert fest, wie selbstverständlich es für die Menschen der vergangenen Jahrhunderte war, in ihren Tagesablauf, in ihr Denken und ihre Sprache die Allgegenwart Gottes einzubauen. Und wie sehr diese Einbeziehung überirdischer Sphären ihnen gut tat und ihr Leben aufwertete.
Zu dieser Zeit begann ich auch zu überlegen, ob meine Reise einen spirituellen Hintergrund haben könnte, verwarf den Gedanken aber bald wieder. Ich will nicht an einen personifizierten Gott glauben, der Menschen in eine solch verfluchte Existenz stürzt wie die, die ich ertragen muss. Heute aber denke ich kaum mehr darüber nach, warum mein Leben so verläuft. Ich habe genug damit zu tun, den Anschluss an die Zeit nicht zu verlieren. Das also ist heute mein Leben: arbeiten, reden und mich anpassen.“
Van Dyck bekreuzigte sich. Ich glaube, er wollte den Gestus vor mir verbergen, aber seine Bewegungen waren eindeutig. Mit fast gehauchter Stimme fragte er: „Und was willst du jetzt in London?“
Ich setzte mich auf den kalten Steinfußboden, umschlang meine Beine mit den Armen und schaute zu dem Künstler auf. „Ich bin nicht hier, weil ich etwas will, sondern weil ich etwas nicht will. Jetzt, wo ich das sage, spüre ich selbst, wie feige das klingt. Ist das nicht Schrecken erregend? Aber ich sagte ja, dass ich ein Meister im Verdrängen bin! Wer nicht weiß, was er will, fängt irgendwann an, gegen alles zu sein.
Ich weiß überhaupt nur noch, was ich nicht will. Wenn ich erklären sollte, was ich will, dann bliebe mein Mund geschlossen. Das bedrückt mich. Denn können wir überhaupt vorankommen, solange wir nur negative und keine positiven Ziele haben? Ich bin hier, weil ich den Glaubenskrieg nicht mag, weil er unberechenbar ist und die Menschen verschlingt wie ein Ameisenbär die Ameisen. Und doch sehne ich mich danach, endlich wieder zu wissen, was ich will, endlich wieder für etwas zu sein!“
Van Dyck nahm eine Stoffbahn und legte sie über die Staffelei. Das Kunstwerk verschwand wie unter einer Schneedecke.
Der Künstler blickte mich an. „Beschreibe mir das Bild!“
Die Kerzen warfen flackernde Schatten auf die weiße Fläche und verwandelten sie in ein wogendes Meer.
„Das habe ich doch schon getan, Sir!“
Der Maler trat einen Schritt auf mich zu. „Das eine Mal reicht nicht. Wenn etwas große Kunst ist, dann kannst du es beliebig oft betrachten, es wird dir immer etwas Neues erzählen. Manchmal erkennt man erst nach langer Zeit, worin sein Geheimnis besteht, und doch hättest du dieses gewisse Etwas nicht entdeckt, wenn du nicht schon vorher lange mit fragenden Augen darauf geschaut hättest. Jeder Blick sorgt dafür, dass etwas von der Kunst in dir bleibt. Und du musst reif werden zu sehen. Ob etwas ein Kunstwerk darstellt oder nicht, bestimmst du. Nur wenn du in der Lage bist, es zu sehen und zu verstehen, kann es seine Schönheit preisgeben. Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll.
Pass auf: Es ist wie mit Noten. Ein Mensch, der kein Instrument spielt, sieht nur einen Haufen seltsamer Kleckse auf einem Blatt Papier. Ein guter Musiker aber sieht nicht nur die Noten, für ihn sind die kleinen Flecken auf den Linien Botschafter einer herrlichen Welt, er hört jeden Ton, der dort notiert ist. In ihm werden die dunklen Punkte zu hellen Klängen, die die Welt zum Schwingen bringen. Und je geübter er ist, desto klarer erlebt er das Orchester mit all seinen Nuancen.
Das Gleiche gilt für dieses Bild: Im Augenblick hast du davon nur eine Vorstellung. Und weil du kein Maler bist, müsstest du es viele hundert Male betrachten, ehe du es wirklich sehen, geschweige denn nachmalen könntest. Gut, du weißt, dass darauf drei Männer und ein Pferd zu sehen sind, aber ich wette, du könntest nicht einmal sagen, ob König Charles an seinem Schultergurt ein Taschentuch oder einen Handschuh trägt. Nimm dir Zeit und lerne zu sehen.“
„Warum?“
Er hob den Kopf, sichtlich getroffen. „Jetzt enttäuschst du mich. Warum! Weil … weil du ein Kunstwerk bist.“
Ich verstand ihn nicht. „Ach!“
Einen Moment wirkte der Maler so, als wolle er mich nun verabschieden, dann aber sagte er: „Weißt du, warum die Menschen so gerne von mir porträtiert werden? Weil ich in den Gesichtern das sehe, was sie zu etwas Besonderem macht. Jeder Künstler tut das, aber mir ist dieser Aspekt wichtiger als alle anderen. Einige meiner Kritiker behaupten, ich könne keine Menschen erfinden, ich bräuchte immer Vorbilder. Ich glaube, sie haben Recht. Und ich schäme mich dessen nicht. Ich will nicht Gott sein und Neues schaffen. Nur haben das diese anmaßenden Pinselhandwerker noch nicht begriffen. Ich male das typisch Menschliche in den Menschen, die ich sehe. Und dadurch werden sie unsterblich. Denn das macht keiner so gut wie ich. Der Musiker sieht nicht nur die Note, er hört den Ton. Der Maler sieht nicht nur das Gesicht, er erkennt die Leidenschaften und Nöte des Dargestellten, er kennt dessen Geschichte.“
Er drehte sich spielerisch um die eigene Achse und ließ dabei ein Glucksen ertönen: „Hör zu. Wenn einer eine solche Geschichte hat wie du, dann ist er ein Kunstwerk. Also muss er ein großer Künstler werden, um sich zu verstehen. Du kannst im Augenblick an deinem Dasein doch gar nichts ändern. Also hast du die Wahl: Du kannst verzweifeln oder etwas aus deiner Lage machen. Du bist so, wie du bist. Dass du dich dagegen auflehnst, ist zwecklos. Ergo: Finde lieber heraus, was mit dir passiert. Und jetzt kommt der kleine geniale Hinweis: Wenn es doch eine Möglichkeit geben sollte, etwas an dir und deinem Leben zu verändern, dann entdeckst du sie nur, wenn du dich erst einmal akzeptierst.“
Ich spürte, dass ich wütend wurde. „Das versuche ich seit einem Jahr!“
Van Dyck lachte wieder sein dunkles, geheimnisvolles Lachen, dass ich zum ersten Mal auf der „Marian“ gehört hatte. Dann sagte er bedächtig: „Nein, das versuchst du nicht. Du versteckst dich vor dir. Nachdem du so viel geredet hast, wird es Zeit, dass ich dir eine Geschichte erzähle: Mein Lehrer Peter Paul Rubens, der, das habe ich heute Morgen erst gehört, in Zukunft wie ein Fürst auf seinem Landschlösschen Steen leben will, wusste genau, dass ich als sein Assistent niemals meinen eigenen Stil entwickeln würde. Aber ich war damals gerade 21 und so stolz, bei diesem verehrten Mann arbeiten zu dürfen, dass ich gar nicht auf die Idee kam, mich selbständig zu machen. Weil ich gut war, fürchtete ich mich, sehr gut zu werden. Mein eigener Erfolg stand mir im Weg. Ich hatte so viel erreicht, dass ich mich fast zu früh zufrieden gegeben und dabei meine eigentliche Berufung beinahe verpasst hätte. Darin bin ich übrigens kein Einzelfall. Ich kenne viele Menschen, die sich auf halbem Weg niederlassen und sich dort so bequem einrichten, dass sie den Gipfel aus dem Blick verlieren. Und wer wäre von dem, was ich erreicht hatte, nicht begeistert gewesen? Ich betreute die Werkstatt von Rubens im Palais in Antwerpen, ich vertrat den Meister, wenn er unterwegs war, und konnte sogar seine Signatur auf den Bildern perfekt imitieren. Ich dachte, ich hätte alles, was ich brauche. Dabei hatte ich nichts. Ob jemand ein großer Künstler wird, hängt nicht nur von seinem Talent ab, es hängt auch davon ab, ob er an sich glaubt. Ich war im Grunde ein besserer Leibeigener, einer, der sicher sehr kunstvoll, aber eben doch nur als Nachahmer lebte. Leider war ich zu schwach, um zu beurteilen, wozu ich fähig bin.
Und … ich brauchte Rubens. Zumindest dachte ich das damals. Weißt du, meine Mutter starb, als ich sieben war, und von da an waren die Künstler meine Familie. Mein Großvater zog als Kaufmann durch die Lande, und mein Vater lobte mich zwar, aber er liebte mich nicht. Ich lebte durch die Künstler, mit denen ich zusammen war. Ich umklammerte den Spatz in der Hand – diesen wunderschönen seidigen Vogel -, obwohl die Taube auf dem Dach auf mich wartete. Mehrfach versuchte Rubens, mich auf einen eigenen Weg zu bringen, doch ich lachte nur.
Da fing er plötzlich an, mich zu schikanieren. Weil ich nicht im Guten hören wollte, wählte er den brutalen Weg. Er mäkelte an meinen Motiven herum, kritisierte meinen Stil und zerschnitt sogar einmal eines meiner Bilder, weil er es für schlecht hielt. Er machte mir das Leben zur Hölle, um mich zum Himmel zu bringen. Wir schieden im Zorn, und sein letzter Satz war: ‚Du wirst mir noch einmal dankbar sein.‘ Heute bin ich es. Aber es dauerte lange, bis ich es sein konnte. Erst als ich mich nicht mehr nach Antwerpen sehnte, war ich frei, meine eigene Kunst zu finden und meinen eigenen Stil zu entwickeln.
Verstehst du: Solange du dich nicht von deiner alten Heimat löst, solange du trauerst, dass du die Welt des 20. Jahrhunderts verloren hast, solange wirst du in ihr hängen bleiben. Schneide den Faden ab und finde dich.“
Ich sprang auf. „Und wie soll ich das bitte machen?“
Van Dyck streckte mir wortlos die Hand hin, und als ich sie ergriff, zog er mich mit sich. Er führte mich zu einem Holzgestell, auf dem verschiedene Leinwände lagen. Er wühlte darin, zog einige Holzkisten hervor und brummte dabei vor sich hin. Endlich hatte er, was er suchte.
Er drückte mir einige Bögen Zeichenpapier, eine feine Feder und ein Tintenfass in die Hand: „Schreibe auf, was du erlebst. Und schärfe mit der Feder auch deinen Blick. Hier! Das dürfte für einige Zeit reichen. Wenn ich dir etwas raten darf: Zwei Türen neben meinem Atelier liegt ein kleiner Vorratsraum, in dem Kulissen und Dekorationen unserer höfischen Bühne lagern. Dort kommt nie jemand herein und du kannst in Ruhe über viele Jahre schreiben.“
Er lachte, immer lauter. Dann hob er die Hand zum Gruß und schlurfte zur Tür. Meine Stimme hielt ihn noch einmal zurück: „Sir! Vielen Dank. Ich würde … Euch gerne noch eine kleine Notiz mitgeben. Bitte lest sie erst in einigen Wochen. Und wenn Ihr mir glaubt, dann wisst Ihr, was Ihr zu tun habt.“
Ich riss einen schmalen Streifen Papier ab, schrieb die Zeilen, die mir vor fünf Tagen auf der Fleute das Leben gerettet hatten, und überreichte sie ihm.
Van Dyck grinste schelmisch: „Ganz gleich, wer du bist, ich bedanke mich meinerseits für den unvergleichlichen Abend. Jetzt muss ich aber gehen. Ich möchte mir meine Illusion gerne bewahren. Wer weiß, vielleicht erwische ich ja noch einen Reisevogel, der mich in einer Stunde nach Antwerpen bringt.“
Kichernd zog er die Tür hinter sich zu.