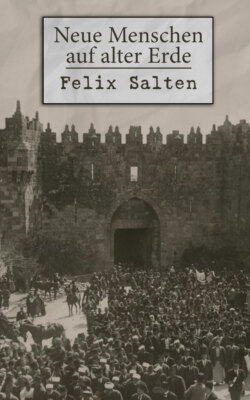Читать книгу Neue Menschen auf alter Erde - Felix Salten - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеInhaltsverzeichnis
Tage in Jaffa. Immer komme ich von Tel Awiw hierher, den Weg, auf dem die alte Stadt landeinwärts von ihrem Felsen steigt, um sich in Parks, in Boulevards, deren Mitte Gartenanlagen schmücken, zu erneuern. Aber der Eindruck Geschäftsviertel, Quartier der Spediteure, dieser vorstädtische, kleinstädtische Eindruck bleibt auch hier, im jungen Teil von Jaffa, trotz der Versuche zur Eleganz, trotz der Anläufe zu festlicher Geschmücktheit. Diese Anläufe sind, wie fast überall im Süden und besonders im Orient, bald schlapp geworden, muten an, wie verstaubt und vergessen, und stimmen eher traurig als festlich. Sie können meist nur den einzelnen Tag, meist nur die gegenwärtige Stunde feiern, die Kinder der südlichen Sonne. Dann flammt die Festlichkeit in ihren Städten auf als ein herrlicher Brand von Farben und Pracht, dann tritt die wildkühne Phantasie, tritt das Märchen lebendig geworden in die Wirklichkeit, die davon wunderbar erglüht und bis ins Zügellose berauscht wird. Die Menschen sind dann wie außer sich geraten. Es ist unmöglich, sich dieser Glut und diesem Rausch zu entziehen. Man wird hingerissen, wie man nur in die Nähe eines solchen Taifuns freudig erregter Volksleidenschaft. gelangt.
Jetzt aber ist Alltag in Jaffa. Unaufhörlich durchwandern die langen Züge von Kamelen, eines hinter dem anderen, die Straßen und bringen die Orangenernte an den Hafen.
Merkwürdig sind die Tiere in ihrer Häßlichkeit, die etwas aristokratisches hat. Den kleinen Kopf auf gebogenem Hals wiegend, gehen sie einher, lassen die lange, vorgespitzte Unterlippe wie im Ekel schlaff herabhängen, blicken mit ihren schönen, dichtbewimperten Augen hochmütig auf die Menschen rings um sich, von denen sie unterjocht sind und an denen sie sich durch eine offen zur Schau getragene, grenzenlose Verachtung zu rächen scheinen. Sie spucken auch auf alles, leicht und zielsicher, und man hält sie deshalb für boshaft, denn sie spucken meist, wenn man glauben könnte, daß sie sich ärgern. Aber sie tun es ganz verächtlich, sie spucken so erledigend, wie nur jemand, der seinen Ärger schon überwunden hat und damit fertig ist. Sie murren auch und brüllen. Beständig murren sie, grollen, brummen oder brüllen laut. Das habe ich vor zwanzig Jahren und jetzt wieder in Assuan bemerkt, in Luxor, in Komombo, in Heluan, und überall, wo man auf Kamelen reitet. Sie brüllen, wenn von ihnen verlangt wird, sie sollen sich hinlegen, damit man in den Sattel steigen kann. Und sie brüllen schrecklich, wenn sie aufstehen sollen. Unterwegs murren und maulen sie beständig und das hört sich an wie eine fortwährende Drohung, wie eine erregte Folge wüster Beschimpfungen. Ihr Gebrüll aber klingt wie das Brüllen wilder Tiere, die knapp vor dem Rasendwerden sind. Man erwartet jede Sekunde irgend einen furchtbaren Ausbruch, einen tobenden Angriff, der zerstören und töten will. Aber es folgt gar nichts. Diese Tiere schleppen geduldig und brav die schwersten Lasten, tragen Menschen auf ihrem Höcker, gehen so lang man will, legen sich gehorsam nieder, stehen gehorsam auf, so oft es gefordert wird, und erfüllen das, was der Mensch ihre Pflicht nennt, viel restloser als die meisten Menschen ihre Pflichten erfüllen. Es ist bei ihnen nur, wie bei manchen alten Dienern, die treu sind, opferwillig, unermüdlich, die es aber nicht lassen können, laut zu denken, ihren Herrn zu bekritteln und alles herauszusagen, alles vor sich hinzubrummen, was ihnen so durch den Kopf geht. Mir erschienen ihre Monologe interessant und schön. Ihre Stimme hat so viele eindringliche Modulationen und ihre Sprache ist so reich an Ausdruck und so beredsam, wie nur die Sprache irgendeines anderen Orientalen. Oft glaubte ich, sie zu verstehen, wenn sie ausrufen: „Was ist nur das wieder für eine gottverdammte Narrheit!“, glaubte, es zu hören, wenn sie knurren: „Hol’s der Teufel, ich stell’ mich gar nicht her, mit so einem Idioten streiten“, meinte sie zu verstehen, wenn sie vor sich hingrollend sagen: „Soll er schon seinen Willen haben, der Arme, der Geplagte, der Unglückliche, er ist ja doch hilflos, wenn nicht ich ihm beistehe.“ Und es ist mir immer ein großes Vergnügen, mich in ihrer Nähe aufzuhalten, ein Stück Weges mit ihnen zu gehen, um ihnen zu lauschen.
In den Städten jedoch, oder auf Landstraßen werden sie, wie die Pferde, manchmal scheu, wenn sie Autos mit knatternden Motoren begegnen. Entsetzt steigen sie kurz in die Hinterbeine, spucken, knurren, brüllen und stieben mit herausquellenden Augen in ihrem schlenkernden Paßgalopp querfeldein. Ja, das eiserne Tier, das mit eiserner Stimme gleichfalls beständig murrt und schnaubt, flößt ihnen Grauen ein. Sie erkennen ihren Todfeind oder sie ahnen ihren Befreier.
Jetzt gehen sie ruhig ans Meer. Ich folge ihnen durch den Trubel der unteren Stadt, höre ihre Selbstgespräche mit an, und ehe ich mich dessen versehe, bin ich am Hafen. Kann aber die Uferzeile von Jaffa wirklich ein Hafen genannt werden? Eine Landungsstelle ist hier freilich seit tausenden von Jahren, seit die Phöniker mit ihren Schiffen von hier aus in See stachen. Ganz offen liegt die Reede von Jaffa, ganz preisgegeben dem Sturm und der Brandung. Ein Ring von Klippen und Riffen sperrt die Zufahrt, so daß die Dampfer weit draußen vor Anker gehen müssen. Ihre Fracht und ihre Passagiere werden vom Bord in kleine Boote gelassen und diese Boote rudern einen Kilometer, anderthalb Kilometer bis sie ans Ufer gelangen. Wenn das Meer oder der Sturm hohe Wellen wirft, ist es ganz unmöglich, an den Felsklippen vorbeizukommen, und es ist selbst bei bloß unruhiger See ein schweres, mitunter ein gefährliches Beginnen. Vielen Leuten ist das Ausgebootetwerden vor Jaffa weit schlimmer als die lange Schiffsreise. Manche wären beinahe ertrunken, wie der Kaiser Franz Joseph, der auf seinem Weg nach Jerusalem hier landete. Dieser „Hafen“ ist noch genau so unangenehm, wie er zur Zeit der Kreuzzüge war und vorher, bis zurück in die graue Vorzeit. Trotzdem ist er ein belebter Platz für den Handel des Landes. Die herrliche Orange, die in Palästina wächst, die fast so groß ist, wie eine Ananas, die dicke Schalen hat, wenig oder gar keine Kerne, voll süßesten Saftes ist und zartduftenden Fruchtfleisches, und von der die englischen Ärzte herausbekommen haben, daß ihr Genuß der Grippe vorbeugt, heißt überall in der Welt Jaffa-Orange nach dem Hafen, von dem aus sie exportiert wird. Während ich hier bin, scheint es überhaupt nur Orangen zu geben. Jeden Tag trampeln von Früh bis Abend die langen Züge der Kamele durch die Stadt zum Hafen, beladen mit den netten, weißen Kisten, die voll Orangen sind. Sie kommen aus den Plantagen der Umgebung, kommen vom Bahnhof und schleppen abertausende solcher Kisten an den Uferkai, wo Boot nach Boot damit bepackt, abstößt und sacht hinausfährt zu dem großen Dampfer, der draußen liegt.
Es wimmelt und kribbelt in Jaffa von Leben, von einer kleingewerbetreibenden Geschäftigkeit. In allen Straßen und Gäßchen, in allen Basaren wühlt und wirbelt die Fülle der Gestalten stadtauf und stadtab. Einem Ameisenhaufen gleicht dieses Jaffa, das auf einem Hügel dicht am Meer erbaut ist, auf einem Kogel, der vereinzelt aus der Strandebene ragt, auf einem Gupf, der über und über bekrochen ist von Hütten und Häusern, von Moscheen und Klöstern. Nichts fordert so sehr zum Müßiggang heraus, wie das fleißige Getriebe einer fremden Stadt, in der man nur ein paar Tage zubringt. Nichts reizt so sehr zum Ausruhen als das Toben einer fremden Arbeit, in deren Lärmkreis man plötzlich für kurze Zeit eintritt.
So sitze ich denn behaglich auf der Terrasse eines kleinen arabischen Kaffeehauses, dicht am Ufer. Man kann nichts von all den Dingen, die dem Gast hier geboten werden, genießen. Kaum den Mokka, der nicht eben nach Mokka duftet. Denn es ist eine Schenke für Hafenarbeiter und Ruderknechte. Aber weil es eine Schenke für Moslims ist, wo es keinen Schnaps und sonstigen Alkohol gibt, geht es auch ohne jede Besoffenheit zu, ganz still, sehr anständig und überaus manierlich. Es ist prächtig, hier zu sitzen, Zigaretten zu rauchen und in die Sonne zu schauen. Diese Terrasse bildet den Rest einer alten Festungszinne. Irgend ein Vorwerk, ganz am Strand errichtet, hatte die niedrige, dicke Mauer hier, die einen Wehrgang trug. Jetzt trägt sie die Tischchen und die Stühle eines Kaffeesieders. Von der Seeseite lecken die Wellen an den alten, weiß grauen Quadern, und vom Land her spült das Wogen des arbeitsamen Alltagsleben mancherlei Hausierer, Bettler und andere seltsame Gestalten hier herauf.
Ich blicke behaglich rund umher, schaue auch mal zu Boden vor mich hin und plötzlich fällt es mir ein, wie viel Blut diese Steine da unter mir schon getrunken haben mögen. Gegen diese Mauer da stürmten die Kreuzfahrer in ihrer großen, aber wenig geistvollen Begeisterung, hier stürmten, viele Jahrhunderte später, die Soldaten Napoleons, in einem Enthusiasmus, der nicht viel klüger war. Immerfort ist im Lauf der Zeiten um Jaffa gestritten worden. Die Phöniker besaßen die Stadt, die Ägypter sind da Herren gewesen, Jonathan eroberte sie den Juden, denen sie erst Pompejus entriß und denen sie Julius Cäsar wieder zurückgab. Vespasianus hat die Stadt zerstört. Sie erhob sich wieder. Dann hat Beibars, der in Ägypten Sultan war, Jaffa dem Erdboden gleichgemacht und wiederum entstand es langsam. Bis in dunkle Urzeit reicht die Erinnerung an Kampf und Krieg zurück.
Hier kämpften Tiere im Namen Gottes gegen Menschen, wie der große Walfisch, der den Propheten Jonas da draußen auf dem Meere verschlang, und hier kämpften Menschen unter dem Beistand der Götter gegen Ungeheuer, wie Perseus, der ein Sohn des Zeus und der geldliebenden Danae gewesen ist. Er tötete hier den Drachen und befreite die schöne Andromeda, die da draußen an einen der Klippenfelsen gebunden war.