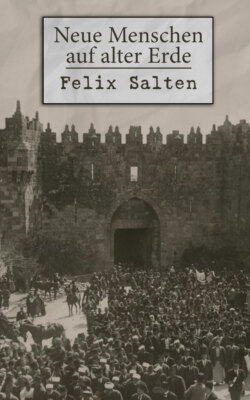Читать книгу Neue Menschen auf alter Erde - Felix Salten - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI
ОглавлениеInhaltsverzeichnis
Man sagt Kolonie, wenn man von Rischon le Zion spricht, weil man alles, was in eine fremde Bevölkerung eingepfropft ist, alles, was in dieser Art als Experiment angefangen hat, Kolonie nennt. Aber Rischon le Zion ist ein jüdisches Bauerndorf, mit seinen fünfzehnhundert Einwohnern und mit seinem Grundbesitz von etwa fünfzehntausend Dunam schon ein stattliches Bauerndorf. Es hat eine Klinik und eine Apotheke, ein Volkshaus, eine Schule, einen Kindergarten, eine Talmud-Thora-Schule und ein öffentliches Bad. Dieses merkwürdige Dorf hat auch ein Eukalyptuswäldchen und einen Park, um darin zu lustwandeln, mit herrlichen Palmenalleen, und es gibt sogar „Hotels“ da. Auf dem höchsten Platz von Rischon le Zion steht weithin sichtbar, der Tempel, und das hat dieses Dorf jüdischer Bauern mit fast allen Dörfern christlicher Bauern gemeinsam: das auf dem höchsten Punkt errichtete Gotteshaus. Sonst aber, wenn ich der Klinik, des öffentlichen Parkes, besonders aber des Bades gedenke, finde ich nur wenig Gemeinsames.
Sitzt man im Wirtshaus beim Mittagessen, ergibt sich doch wieder Ähnlichkeit. Denn da gesellt sich der eine oder andere Dorfbewohner zu dir, ein Handwerker oder ein Bauer, kann auch sein, er führt das Gespräch vom Nebentisch herüber, und er verlangt zu wissen, wer man ist, woher man kommt und so weiter. Aber es ist so unwichtig, wer ich bin, so uninteressant, woher ich komme, dafür so wichtig, wer dieser Dorfbewohner ist und so interessant, woher er einst gekommen war. Dieser Mann, der da bestaubt und gemächlich sitzt, um mich auszufragen, ist älter als Rischon le Zion, das Dorf, das gegen zwei- oder vierundvierzig Jahre zählt. Der Mann aber ist sechzig. Also, er kam aus Rußland; ein Knabe, gerettet aus dem Blutbad irgendeines Pogroms. Seither hat er hier gelebt, ein Leben der Arbeit, der Entbehrung, der Sorge, aber nicht gepeinigt vom drohenden Mord. War’s auch manchmal unruhig, es ging nie ans Leben oder doch beinahe niemals. Man hatte so viel Sicherheit wie die anderen, man durfte sich zur Wehr setzen und man war jedenfalls im Lande der Väter, „daheim“. Immer wieder ist es dasselbe Lied. Diese Schicksale sind eins dem ändern ähnlich und sie sind allzusammen das Schicksal des jüdischen Volkes.
Auch in Rischon ist es wie in anderen, alten Kolonien begegnet, daß die Söhne der ursprünglichen Ansiedler wieder in die Fremde zogen, nach Europa zurück, nach Amerika, Australien oder ins Kapland. Nicht alle Söhne freilich, aber doch genug, um sagen zu können, die Ansiedler hätten nicht Wurzel gefaßt. Je öfter ich diese Tatsache konstatieren höre, desto weniger Eindruck übt sie mir. In vielen anderen Län-dem geschieht dasselbe häufig genug: die zweite Generation verläßt die Kolonie, die von den Vätern gegründet wurde. Weil das Bebauen des Bodens zu schwierig ist und der Ertrag die harte Arbeit nicht lohnt. Weil die Zustände des besiedelten Gebietes, an mangelnder Sicherheit, an fehlenden Verkehrsmitteln der Entwicklung zu viele Hindernisse schaffen. An solchen Dingen hat, wie oft, das beste Bauernblut schon versagt.
Hier in Palästina sind die Sicherheitsverhältnisse unter der Türkenherrschaft so schwankend gewesen, daß ihnen bis heute noch eine endgültige Festigkeit nicht beizubringen war, und die Verkehrsmittel lagen gänzlich in primitiven Anfängen. Das verminderte den Ertrag, der nur durch schwere Arbeit dem Boden abgerungen werden kann.
Die heute ins Land kommen, um da zu bleiben, urteilen wohl zu streng über die alten Kolonisten und deren Söhne. Denn sie kommen heute getrieben und getragen von einer großen Idee, der die Kraft einer Religion innewohnt. Sie kommen, jedes Schiff, das neue Ansiedler bringt, als Kolonnen einer Arbeiter-Armee, deren Aufmarsch erst begonnen hat, und noch viele Jahre, wahrscheinlich Dezennien, andauern mag. Der Horizont ihres Wirkens ist nicht beschränkt durch die Grenzen ihres Ackers, der ihnen zugewiesen wird; er umfaßt das ganze Land der Verheißung, mit einem ungeheuren kühnen Arbeitsplan, hundertfach gegliedert, hundertfach veränderlich und ständig erweitert. Jeder einzelne ist hier diesem Plane eingefügt, ist ein Teil davon, ein tätig schwingendes Rad der großen Maschine, und alle Juden der Welt, siebzehn Millionen Menschen, sind dem großen Vorhaben, das Land der Verheißung in das Land der Erfüllung zu wandeln, unauflöslich verknüpft. Das ergibt eine andere Situation, innerlich und äußerlich, ideell, moralisch und praktisch, als die Lage, in der sich die ersten Kolonisten vor einem halben Jahrhundert befanden, die ihr Hiersein nur der Wohltätigkeit zu danken hatten.
Es ist eine merkwürdige Sache um die Wohltätigkeit. Sie bringt Segen, heißt es, doch selbst das Bibelwort wagt nur die Behauptung, daß sie denjenigen Segen bringe, die Wohltaten üben. Von den Unglücklichen jedoch, die Wohltaten empfangen müssen, ist nirgends ausführlich die Rede. Offenbar will sich keiner so recht darauf einlassen, diese heikle Angelegenheit näher zu untersuchen. Seit die menschliche Gesellschaft besteht, ist das Wohltun, ist das Almosengeben nur ein lächerlich schwaches Korrektivmittel, das Unrecht der sozialen Ordnung zu mildern. Selbst der liebe Gott hat kein besseres Mittel gefunden. Er befiehlt, er bittet, er verspricht ewigen Lohn, aber wie viele sich auch beeilen, dem göttlichen Gebot gehorsam zu sein, wie viel auch geholfen wird, niemals ist eine wirkliche Hilfe draus geworden. Alle geben, der Talentvolle dem Talentlosen, der Hervorragende dem Unbedeutenden, der glückliche Erbe dem Stiefsohn des Glückes, dem kein Erbteil zufiel, der Reiche dem Armen. Sicherlich, in tausend Fällen gibt der Gute dem Besseren, in tausend Fällen sogar der Schlechte dem Guten. Aber wie viel auch gegeben wird, noch nie schwand die Armut aus der Welt, und ich kann es nicht leugnen, das ist deine Schuld, du mein Gott, der du der Gute bist und ebenso gewiß der Einzige, der die soziale Frage lösen könnte. Bei aller Ehrfurcht vor dir und bei aller Liebe zu dir, mein Gott, es ist deine Schuld. Ja, noch mehr. Du hast durch dein Gebot des Wohltuns das Gewissen der Mächtigen und Reichen eingelullt, den Sinn der Armen umnebelt, und soweit eine soziale Gerechtigkeit auf Erden überhaupt denkbar ist, hast du ihr Walten so lang wie nur möglich hinausgezögert.
Zum Wesen der Wohltätigkeit gehört es, daß ihr der Dank, den sie oftmals verdient, niemals gezollt wird. Es ist schön, daß der Baron Rothschild die Kolonie Rischon le Zion und noch andere Siedlungen mit seinem Geld gegründet und dauernd gestützt hat. Aber weder Dank, noch Bewunderung gebührt ihm dafür. Man kann eben nicht der Baron Rothschild sein, während in Rumänien und Rußland arme Juden geplündert, mißhandelt und ermordet werden. Man kann das als Rothschild nicht miterleben und ruhig in seinem Pariser Palais des Daseins sich freuen, als sei nichts geschehen. Man muß etwas tun, um sich den Schlaf der Nächte wieder zu kaufen.
So sind die ersten Ansiedler nach Rischon le Zion gelangt, armseliges Menschheitsgestrüpp, von niederträchtigen Händen aus armseligem Ghettoboden gerauft, und durch Wohltätigkeit der heiligen Erde Palästinas eingepflanzt. Ein edles Werk. Doch es vollzog sich nach so unzulänglichem Gesetz, daß weder dem Gesetz, noch seinem zufälligen Vollstrecker dafür zu danken bleibt.
Jetzt wird auch dieses große Bauerndorf vom neuen Geist der Allgemeinheit, vom neuen Willen des ganzen jüdischen Volkes langsam durchdrungen und jetzt erst beginnt Rischon le Zion tiefer in der Erde zu wurzeln, sicherer in der Scholle zu ruhen. Hier hat der Weinbau geblüht und würde immer weiter, immer reicher gedeihen, wenn die Welt noch so viel trinken würde wie früher. Aber seit die Sowjets in Rußland regieren, hat dieses Reich aufgehört, ein Absatzgebiet zu sein. Und seit sie in den Vereinigten Staaten die Prohibition haben, ist auch diese Kundschaft verloren gegangen. Nun liegen in den Kellereien von Rischon le Zion herrliche Weine in riesigen Mengen und finden keinen Käufer, finden nicht mehr so viel Käufer, daß der Weinbau im früheren Umfang ferner noch lohnend wäre.
Der Küfer, der mich durch die Keller führt, ist ein schmächtiger alter Jude, er hat ein schmales, feines Gesicht, das durch den dünnen, silbergrauen Bart nur noch schmäler wird. Seine sanften, rehbraunen Augen sind voll Ergebenheit, und seine Reden haben jene ergebene Höflichkeit, in der das Persönliche dennoch im Unnahbaren gehalten und gewahrt wird.
Man trifft hierzulande bei vielen Juden, besonders bei den älteren Männern diesen Ton, der so angenehm wirkt, weil er so erbötig ist, ohne sich dabei das Geringste zu vergeben.
Der Küfer zeigt mir die ungeheuren Fässer, die voll alten Kognaks daliegen, voll Chartreuse und Benediktiner-ähnlichem Likör. Er zeigt mir die Weinbehälter im Keller, die viele Hektoliter fassen an schwerem alten Süßwein, roten, der wie Bordeaux oder Madeira oder wie Tokaier schmeckt, und weißen, der an Haute Sauterne und an manche Rheinweinsorten erinnert. Diese Behälter sind aus Beton und inwendig mit dicken, großen Glasplatten ausgelegt, und sie können von innen beleuchtet werden. Er zeigt das Schlauchsystem, das die Füllung der zum Abtransport bestimmten Fässer ermöglicht, die Maschinen, die zur Bereitung der Trauben, zum Keltern, dienen, zum Betreiben und Beobachten der Gärung, endlich die Böttcherei, das chemische Laboratorium, die Werkstätte und die Mühle. Alles ist so vollendet und so musterhaft, wie nur in irgend einem europäischen Großbetrieb.
Unterwegs erzähle ich ihm von den Memoiren des Fürsten Urussow und von der Anerkennung, die er den jüdischen Weinbauern in der Ukraine gezollt hat. Der alte Jude hört aufmerksam zu, mit bewegungslosen Mienen. Dann lächelt er nur. Aber dieses Lächeln löscht den Fürsten Urussow, löscht die ganze fürstliche Anerkennung weg; so leicht und so rasch, wie man ein wenig Staub vom Rockärmel bläst.
Er begreift die Prohibition in Amerika, und er begreift auch, wie gut es ist, wenn die Menschen wenig oder gar keinen Wein trinken; es tut ihm nur leid, daß eine Sache gut genannt werden muß, die dem Betrieb hier Schaden bringt. Man wird von nun an den Tabakbau pflegen. Alle Menschen rauchen Tabak, die Moslims wie die Christen, die Amerikaner wie die Europäer, es gibt also keine Absatzschwierigkeiten. Dennoch ist der Tabak ebenso schädlich wie der Wein, vielleicht noch schädlicher, weil ja das starke Rauchen viel mehr verbreitet ist als das unmäßige Saufen. Aber man darf der Menschheit nicht alle Gifte entziehen, wenigstens nicht alle auf einmal.
Und so kann einstweilen noch Tabak gebaut werden.