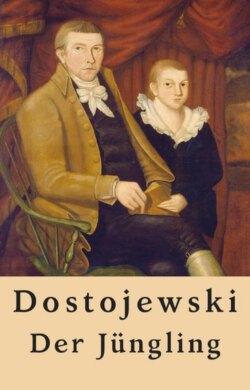Читать книгу Fjodor Dostojewski: Der Jüngling - Fjodor Dostojewski - Страница 23
Viertes Kapitel I
ОглавлениеKrafft hatte früher irgendein Amt bekleidet und war gleichzeitig dem verstorbenen Andronikow (gegen eine Entschädigung) bei der Führung gewisser Privatgeschäfte behilflich gewesen, mit denen sich dieser beständig neben seiner Amtstätigkeit abgab. Für mich war schon der Umstand von Wichtigkeit, daß Krafft infolge seines besonders nahen Verhältnisses zu Andronikow manches von dem wissen konnte, was mich interessierte. Aber ich wußte von Marja Iwanowna – der Frau jenes Nikolai Semjonowitsch, bei dem ich als Gymnasiast so viele Jahre lang gewohnt hatte –, welche eine Nichte, Pflegetochter und Favoritin Andronikows gewesen war, daß Krafft sogar den »Auftrag« erhalten hatte, mir etwas zu übergeben. Ich hatte auf ihn schon einen ganzen Monat gewartet.
Er hatte eine kleine, nur aus zwei Zimmern bestehende Wohnung, in der er vollständig allein wohnte, und in diesem Augenblick, wo er eben erst zurückgekehrt war, war er sogar ohne Bedienung. Seinen Koffer hatte er zwar schon geöffnet, den Inhalt aber noch nicht weggeräumt; die Sachen lagen auf den Stühlen umher, und auf dem Sofatisch lagen eine Reisetasche, ein Reisenecessaire, ein Revolver und mehr dergleichen.
Als wir eintraten, war Krafft tief in Gedanken versunken, als hätte er mich vollständig vergessen; vielleicht hatte er auch gar nicht bemerkt, daß ich unterwegs nicht mit ihm gesprochen hatte. Er begann sogleich etwas zu suchen, aber als er im Vorbeigehen einen Blick in den Spiegel warf, blieb er stehen und betrachtete eine ganze Minute lang unverwandt sein Gesicht. Ich bemerkte dieses sonderbare Benehmen zwar (später erinnerte ich mich an alles nur zu gut), aber ich war in trüber Stimmung und in großer Verwirrung. Ich war nicht imstande, meine Gedanken zu sammeln. Einen Augenblick lang wurde in mir plötzlich der Wunsch rege, ohne weiteres davonzugehen und diese ganze Sache nie wieder anzurühren. Und was war diese ganze Sache denn, wenn ich's recht besah? War sie nicht eine Sorge, die ich ohne Not auf; mich genommen hatte? Es brachte mich in Verzweiflung, daß ich aus purer Sentimentalität eine Menge von Energie vielleicht für wertlose Kleinigkeiten verschwendete, während ich doch selbst eine Aufgabe vor mir hatte, zu der die höchste Energie erforderlich war. Und dabei hatte sich meine Unfähigkeit zu ernsten Geschäften durch die Vorgänge bei Dergatschew deutlich herausgestellt.
»Werden Sie denn noch einmal zu diesen Leuten hingehen, Krafft?« fragte ich ihn auf einmal. Er drehte sich langsam zu mir um, als hätte er mich nicht ordentlich verstanden. Ich setzte mich auf einen Stuhl.
»Verzeihen Sie ihnen!« sagte Krafft plötzlich.
Es schien mir natürlich zunächst, daß das Spott sei; aber als ich ihn aufmerksam anblickte, gewahrte ich in seinem Gesicht einen so merkwürdigen, geradezu staunenerregenden Ausdruck von Gutherzigkeit, daß ich selbst ganz erstaunt darüber war, wie er mich so ernsthaft hatte darum bitten können, ihnen zu »verzeihen«. Er rückte einen Stuhl heran und setzte sich neben mich.
»Ich weiß selbst, daß ich vielleicht ein Mischmasch aller möglichen Selbstgefälligkeiten bin und weiter nichts«, begann ich, »aber um Verzeihung bitte ich nicht.«
»Es ist auch gar keiner da, den Sie um Verzeihung zu bitten hätten«, erwiderte er leise und ernsthaft. Er sprach die ganze Zeit leise und sehr langsam.
»Mag ich mich auch in meinen eigenen Augen schuldig gemacht haben ... Dieses Schuldbewußtsein ist mir angenehm ... Verzeihen Sie, Krafft, daß ich Ihnen gegenüber solches Zeug schwatze! Sagen Sie, gehören Sie wirklich ebenfalls diesem Kreis an? Danach hatte ich Sie fragen wollen.«
»Diese Leute sind nicht dümmer und nicht klüger als andere; sie sind eben geistesgestört wie alle.«
»Sind denn alle geistesgestört?« fragte ich mit unwillkürlichem Interesse.
»Die Besseren sind jetzt alle geistesgestört. Kräftigen Lebensgenuß leistet sich nur die Mittelmäßigkeit und die Unbegabtheit ... Übrigens, es lohnt nicht, von alledem zu reden.«
Während er sprach, blickte er in die Luft, begann Sätze und brach sie wieder ab. Besonders fiel mir der mutlose Ton seiner Stimme auf.
»Gehört denn auch Wassin zu ihnen? Wassin besitzt Verstand, Wassin hat eine sittliche Idee!« rief ich.
»Sittliche Ideen gibt es jetzt überhaupt nicht; es hat sich jetzt auf einmal herausgestellt, daß keine da ist, und, was die Hauptsache ist, es sieht so aus, als ob auch nie eine dagewesen sei.«
»Auch früher nie?«
»Lassen wir dieses Thema lieber!« sagte er; er war sichtlich ermüdet.
Seine ernste Traurigkeit rührte mich. Ich schämte mich meines Egoismus und begann auf seinen Ton einzugehen.
»Die jetzige Zeit«, begann er selbst wieder nach zwei Minuten Schweigen, immer noch irgendwohin in die Luft blickend, »die jetzige Zeit ist die Zeit der goldenen Mittelmäßigkeit und Unempfindlichkeit, der Abneigung gegen die Bildung, der Trägheit, der Unfähigkeit zur Arbeit; man möchte alles ohne eigene Bemühung fix und fertig vorfinden. Niemand denkt ordentlich nach; selten bildet sich jemand eine Idee ...«
Er brach wieder ab und schwieg ein Weilchen; ich wartete gespannt.
»Man fällt jetzt in Rußland die Wälder, erschöpft den Boden, verwandelt ihn in eine Steppe und bereitet ihn für die Kalmücken vor. Wenn sich jemand findet, der auf die Zukunft hofft und einen Baum pflanzt, so verlachen ihn alle: »Wirst du noch so lange leben, bis er Früchte trägt?« Andererseits reden diejenigen, die das Gute wünschen, von dem, was nach tausend Jahren sein wird. Kräftigende Ideen sind ganz verschwunden. Alle befinden sich gleichsam in einer Herberge und schicken sich an, Rußland morgen zu verlassen; alle leben in dem Gedanken: ›Wenn es nur für uns noch reicht!‹ ...«
»Erlauben Sie, Krafft, Sie sagten: ›Manche machen sich Sorgen um das, was nach tausend Jahren sein wird.‹ Nun aber, Ihre Verzweiflung ... über das Schicksal Rußlands ..., ist das denn nicht eine Sorge ähnlicher Art?«
»Das ... das ist die brennendste Frage, die es überhaupt gibt!« erwiderte er gereizt und stand schnell von seinem Platz auf.
»Ach ja! Das habe ich ganz vergessen!« sagte er auf einmal in ganz anderem Ton und sah mich überrascht an. »Ich habe Sie ja in einer besonderen Angelegenheit zu mir gebeten, und dabei ... Ich bitte vielmals um Entschuldigung.«
Es war, als käme er plötzlich von einem Traum wieder zu sich, so verwirrt war er. Er nahm aus einer Brieftasche, die auf dem Tisch lag, einen Brief heraus und gab ihn mir.
»Hier! Das sollte ich Ihnen übergeben. Es ist das ein Schriftstück, das eine gewisse Wichtigkeit hat«, begann er, nunmehr mit gesammelter Aufmerksamkeit und durchaus geschäftsmäßiger Miene. Noch lange nachher hat mich bei der Erinnerung daran diese seine Fähigkeit (noch dazu in Stunden, die für ihn selbst von solcher Bedeutung waren!) beeindruckt, an einer fremden Angelegenheit so herzlichen Anteil zu nehmen und sie mit solcher Ruhe und Bestimmtheit auseinanderzusetzen.
»Es ist dies ein Brief eben jenes Herrn Stolbejew, nach dessen Tode wegen seines Testaments der Prozeß zwischen Wersilow und den Fürsten Sokolskij entstand. Dieser Prozeß steht jetzt vor der gerichtlichen Entscheidung und wird wahrscheinlich zu Wersilows Gunsten entschieden werden; das Gesetz ist auf seiner Seite. In diesem Brief jedoch, einem Privatbrief, der vor zwei Jahren geschrieben ist, setzt der Erblasser selbst seine wahre Willensmeinung oder, richtiger gesagt, seine Wünsche mehr zugunsten der Fürsten als zu Wersilows Gunsten auseinander. Wenigstens erhalten diejenigen Punkte, durch welche die Fürsten Sokolskij ihre Anfechtung des Testaments begründen, in diesem Brief eine starke Unterstützung. Wersilows Gegner würden viel für dieses Schriftstück geben, das übrigens keine ausschlaggebende juristische Bedeutung hat. Alexej Nikanofowitsch« (Andronikow), »der sich mit Wersilows Prozeß beschäftigte, bewahrte diesen Brief bei sich auf und händigte ihn mir nicht lange vor seinem Tode ein mit dem Auftrag, ihn ›in Verwahrung zu nehmen‹ – vielleicht ahnte er seinen baldigen Tod und fürchtete für die Sicherheit seiner Papiere. Ich möchte mir jetzt über Alexej Nikanorowitschs Absichten in dieser Sache kein Urteil erlauben, und ich muß gestehen, ich befand mich nach seinem Tod in einer etwas peinlichen Ungewißheit, was ich mit diesem Schriftstück machen solle, besonders im Hinblick auf die nahe bevorstehende Entscheidung dieses Prozesses vor Gericht. Aber Marja Iwanowna, der Alexej Nikanorowitsch, wie es scheint, zu seinen Lebzeiten sehr viel Vertrauen geschenkt hat, half mir aus meiner schwierigen Lage heraus: sie schrieb mir vor drei Wochen mit aller Entschiedenheit, ich solle das Schriftstück gerade Ihnen übergeben; es scheine (dies war ihr Ausdruck), daß dies auch mit Andronikows Absichten zusammenfallen werde. Also hier ist das Schriftstück, und ich freue mich sehr, daß ich es Ihnen endlich einhändigen kann.«
»Hören Sie mal«, sagte ich, durch eine so unerwartete Neuigkeit nicht wenig bestürzt, »was soll ich jetzt mit diesem Brief anfangen? Wie soll ich mich verhalten?«
»Das steht ganz in Ihrem Belieben.«
»Unmöglich, ich bin dabei in hohem Grade unfrei, das müssen Sie doch selbst sagen! Wersilow hat so auf diese Erbschaft gewartet ... und wissen Sie, er geht ohne diese Beihilfe zugrunde ... und nun existiert plötzlich ein solches Schriftstück!«
»Es existiert nur hier, in diesem Zimmer.«
»Wirklich?« fragte ich, indem ich ihn aufmerksam anblickte.
»Wenn Sie in diesem Falle nicht selbst wissen, wie Sie sich verhalten sollen, was kann ich Ihnen dann für einen Rat geben?«
»Aber dem Fürsten Sokolskij den Brief übergeben, das kann ich doch auch nicht: damit würde ich alle Hoffnungen Wersilows vernichten und außerdem an ihm zum Verräter werden ... Andrerseits, wenn ich den Brief Wersilow einhändige, bringe ich unschuldige Menschen an den Bettelstab und versetze dennoch Wersilow in eine verzweifelte Lage: er muß entweder auf die Erbschaft verzichten oder zum Dieb werden.«
»Sie übertreiben die Bedeutung, die die Sache hat.«
»Sagen Sie mir nur eines: hat dieses Schriftstück einen ausschlaggebenden, entscheidenden Charakter?«
»Nein, den hat es nicht. Ich bin kein großer Jurist. Der Advokat der Gegenpartei würde natürlich wissen, wie er sich dieses Schriftstücks zu bedienen hätte, und würde daraus soviel Vorteil ziehen wie nur möglich, aber Alexej Nikanorowitsch war entschieden der Ansicht, daß dieser Brief, wenn er präsentiert würde, keine große juristische Bedeutung haben würde, so daß Wersilow seinen Prozeß trotzdem gewinnen könne. Dieses Schriftstück stellt eher sozusagen eine Gewissenssache dar ...«
»Aber das ist ja gerade das allerwichtigste«, unterbrach ich ihn, »ebendeswegen wird sich Wersilow in einer verzweifelten Lage befinden.«
»Er kann aber doch das Schriftstück vernichten; damit befreit er sich von jeder Gefahr.«
»Haben Sie besonderen Grund, eine solche Handlungsweise von ihm zu erwarten, Krafft? Eben das möchte ich,gern wissen: gerade darum bin ich bei Ihnen!«
»Ich glaube, daß jeder an seiner Stelle so verfahren würde.«
»Und würden Sie selbst so verfahren?«
»Ich mache keine Erbschaft, und darum weiß ich es von mir nicht.«
»Nun gut«, sagte ich, indem ich den Brief in die Tasche schob. »Wir wollen diese Sache vorläufig abgetan sein lassen. Hören Sie, Krafft: Marja Iwanowna, die, wie ich Ihnen versichern kann, mir vieles enthüllt hat, hat mir gesagt, daß Sie, und nur Sie, mir die Wahrheit über das mitteilen könnten, was vor anderthalb Jahren in Ems zwischen Wersilow und den Achmakows vorgefallen ist. Ich habe auf Sie gewartet wie auf die Sonne, die mir alles aufhellen soll. Sie kennen meine Lage nicht, Krafft. Ich bitte Sie inständig, mir die ganze Wahrheit zu sagen. Ich will nämlich wissen, was er für ein Mensch ist, und jetzt, gerade jetzt ist es mir wichtiger denn je, dies zu wissen.«
»Ich wundere mich, daß Marja Iwanowna Ihnen nicht alles selbst mitgeteilt hat; sie hatte die Möglichkeit, alles von dem verstorbenen Andronikow zu hören, und hat es selbstverständlich auch gehört und weiß vielleicht mehr als ich?«
»Andronikow ist, wie mir Marja Iwanowna ausdrücklich gesagt hat, selbst über diese Sache sehr im unklaren gewesen. Es scheint, daß niemand diese Sache zu entwirren imstande ist. Da wird kein Teufel draus klug! Ich weiß aber, daß Sie damals selbst in Ems waren ...«
»Ich habe nicht alles mit angesehen, aber was ieh weiß, will ich Ihnen meinetwegen gern erzählen; es fragt sich nur, ob Sie mit meiner Darstellung zufrieden sein werden.«