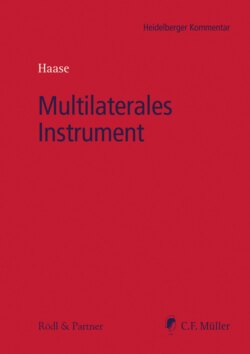Читать книгу Multilaterales Instrument - Florian Haase - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Internationaler (schädlicher) Steuerwettbewerb
Оглавление1
Nie war es einfacher als heute, binnen Sekunden erhebliche Vermögenswerte in das Ausland zu transferieren. Auch die Mobilität der Steuerpflichtigen hat ein nie gekanntes Ausmaß angenommen. Beides zusammen führt, auch und gerade vor dem Hintergrund der Globalisierung und dem dadurch bewirkten verschärften Wettbewerb zwischen Unternehmen, aber auch dem Wettbewerb um qualifizierte, hochbezahlte Arbeitskräfte, nahezu zwangsläufig dazu, dass Steuerpflichtige – vor allem im unternehmerischen Bereich – auch nach Möglichkeiten suchen, ihre Steuerlast zu minimieren oder eine solche im Extremfall sogar gänzlich zu vermeiden, sei es nun über Verrechnungspreise, über klassische Steuerarbitrage, über hybride Vehikel oder Instrumente, über Basisgesellschaften, Trustkonstruktionen und dergleichen mehr. Den beteiligten Fisci ist dies naturgemäß ein Dorn im Auge, auch wenn die Steuerminimierung bzw Steuervermeidung jedenfalls nach deutschem Recht ausdrücklich legal ist.[1]
2
Abseits dessen gilt aber ebenso, dass die Staaten, die sich in der Staatengemeinschaft jedenfalls im Ausgangspunkt als gleichberechtigte Rechtssubjekte gegenüberstehen, miteinander in punkto Steuervergünstigungen in einen Steuerwettbewerb nach Art eines „race to the bottom“ eingetreten sind, dessen Ende noch immer nicht absehbar ist. All dies führt letztlich dazu, dass die Staaten um wirtschaftlich rege und finanzkräftige Steuerpflichtige konkurrieren, weil sich der stetig steigende Finanzbedarf anderenfalls nicht mehr hinreichend decken lässt. In einem Wohlfahrtsstaat wie der Bundesrepublik Deutschland, die als Hochsteuerland in besonderem Maße auf Wettbewerbsneutralität und außersteuerliche Anreize zur Attraktion von Steuerpflichtigen angewiesen ist, zeigt sich dies beinahe täglich aufs Neue und erklärt wahrscheinlich auch die Verve, mit der das BMF sich dieser Themen in der Vergangenheit trotz der stetig steigenden inländischen Steuereinnahmen angenommen hat.
3
Vor diesem Hintergrund nimmt es nicht Wunder, dass die internationale Steuerplanung in den vergangenen Jahren stark an Attraktivität und Praxisrelevanz gewonnen hat. Die zunehmende Regelungsdichte, das Nebeneinander nationaler Steuerhoheiten, die Verteilung von Besteuerungsansprüchen zwischen den Staaten durch Doppelbesteuerungsabkommen und auch rein faktische Schwierigkeiten (etwa Sprachbarrieren oder unterschiedliche Kulturen) haben dabei zu einer Komplexität geführt, die auch von dem Kundigen nicht immer leicht zu durchschauen ist. Hinzu kommt, dass die internationale Beweglichkeit von Steuerpflichtigen und Einkunftsquellen gegenläufige Reaktionen der Finanzverwaltungen hervorruft, die nicht eben zur Vereinfachung des Steuerrechts und einer praxistauglicheren Anwendung führen. Der § 50i EStG und seine Genese sind ein „schönes“ Beispiel für eine gänzlich misslungene Norm, die letztlich mehr Probleme aufwirft als sie löst.
4
Das im Grundsatz verständliche Buhlen der Staaten um Steuerpflichtige und Besteuerungssubstrat ist aber nur die eine Seite der Medaille. Erreicht die Gesamtheit der staatlichen Maßnahmen nämlich eine Intensität, die geeignet ist, die Steuerpflichtigen gezielt an Investitionen in anderen Staaten zu hindern, kommt es zu einem schädlichen Steuerwettbewerb, der aus der Sicht der Staatengemeinschaft und auch aus der Sicht der OECD nicht mehr wünschenswert sein kann (harmful tax competition). Nur im Extremfall handelt es sich bei den damit angesprochenen Staaten um typische Steueroasen. Auch innerhalb der Europäischen Union sind von der OECD bereits eine ganze Reihe schädlicher Steuerpraktiken der Mitgliedsstaaten identifiziert worden.[2]