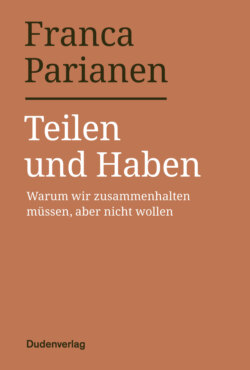Читать книгу Teilen und Haben - Franca Parianen - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWenn uns ohnehin weder der kleine Dino noch irgendeine höhere Macht wirklich dazu bringt, zu teilen, könnten wir die Moralpredigten doch genauso gut bleiben lassen.
Natürlich war es zu Sankt Martins Zeiten mal wichtig, seinen Mantel mit einem frierenden Armen zu teilen. Der hatte mit Sicherheit keine Krankenversicherung. Heute hat sich aber doch der Staat dieses Problems angenommen, und wir persönlich müssen nichts weiter tun, als Parteien zu wählen, die dafür sorgen, dass das so bleibt. (»Bin ich wie Mutter Teresa? Na ja, sagen wir, ich habe noch nie die FDP gewählt.«) Was also, wenn wir unsere individuellen Bemühungen im Bereich großzügiges Teilen und unser ewiges schlechtes Gewissen einfach mal runterschrauben?
Das Geld für die Bedürftigen ließe sich jedenfalls auch anders organisieren. Durch Steuern und Strafzettel oder so. Thomas Hobbes würde den Vorschlag sofort abnicken. Der Philosoph hatte im 17. Jahrhundert allgemein niedrige Erwartungen an unser Sozialverhalten und sah den Menschen als fundamental egoistisch. Ohne die Fesseln der Zivilisation würde die Gier laut Hobbes von der Leine gelassen, und die Menschheit endete im ewigen Krieg aller gegen alle. Dagegen hilft nur das beherzte Eingreifen eines absoluten Herrschers (oder mindestens einer Steuerbehörde). Na, das passt zumindest zu unserem neu gefundenen Pessimismus.
Sollten wir unseren inneren Egoisten einfach anerkennen und unser schlechtes Gewissen über Bord werfen, würde uns eine nicht ganz so bunte Mischpoke aus Kapitalismusfreunden und Marktradikalen entschieden zustimmen (und wo sie schon dabei ist, noch etwas über Blockchain erzählen). Weniger begeistert wären sie von der Idee eines absoluten Herrschers, denn wenn aus ihrer Sicht irgendetwas fürs Gemeinwohl kontraproduktiv ist, dann Gängelung! Stattdessen schwören sie auf die unsichtbare Hand des Marktes nach Adam Smith. Die zugrunde liegende Argumentationskette ist ziemlich geradeheraus: Menschen bauen aus finanziellem Eigeninteresse genau das an, was andere Menschen essen wollen, eröffnen Läden, in denen sie einkaufen, und schreiben Bücher, die sie lesen (hoffentlich). Einfach, weil man mit unerwünschtem Gemüse weitaus weniger Geld macht (»Du hast unser Vermögen in Rosenkohl investiert!?«). Die Nachfrage bestimmt das Angebot, die Konkurrenz drückt die Preise, und alles zusammen bringt der Allgemeinheit mehr Nutzen als jede prosoziale Motivation. Oder, grob zusammengefasst nach Smith: Wir erwarten unser Abendbrot nicht von der Wohltätigkeit des Metzgers, Brauers und Bäckers, sondern von deren Augenmerk auf ihr eigenes Interesse.
Weil Kaufentscheidungen der Kundschaft außerdem ein ziemlich direktes Feedback sind, ist der Smith’sche Markt besser koordiniert als jeder staatliche Bepflanzungs-, Konsum- und Literaturplan, der nie weiß, wann das Volk gerade Tretroller oder Traktoren braucht. Das Gegenteil von »gut gemacht« ist ziemlich oft »gut gemeint«. Wenn wir also so viel Gutes aus purem Eigeninteresse schaffen können, warum sollen wir dann diese wunderbare Kraft zügeln, indem wir an andere denken?
Die Philosophin und Hausintellektuelle Libertärer und sonstiger Marktradikaler Ayn Rand (1905–1982) würde uns in diesem Gedankengang sicherlich bestärken. Die Frankfurter Allgemeinen Zeitung bezeichnet sie einmal als »Hohepriesterin des Egoismus«.2 Ayn Rand würde uns von Teilen und Großzügigkeit dringendst abraten und am liebsten gleich allen Besitz in private Hände verlagern – einschließlich den der amerikanischen Ureinwohner.
Sie ist natürlich auch nicht die Erste, die so denkt. Schon im 18. Jahrhundert fragte Ökonom und Brite Thomas Robert Malthus, ob Nahrung für Hungernde nicht zu Überpopulation und noch mehr Hungernden führt. Er wurde prompt Bestsellerautor. Im 19. Jahrhundert erklärte der Sozialdarwinismus Hungernde gleich zu einem Fehler der Evolution. In den 1970ern und 1980ern wurde Malthus’ Überpopulation wiederentdeckt, mit Blick auf hungernde Menschen in Afrika. Inzwischen hatte auch das Lob des Eigeninteresses ein Comeback erlebt. Seit den 1960er-Jahren erklärte der Ökonom Milton Friedman jedem Präsidenten, der es hören wollte, dass der Markt sich von allein regelt und die einzige soziale Verpflichtung jedes Unternehmens im Profit besteht. Damit begeisterte er erst das Pinochet-Regime in Chile und dann das Komitee für den Wirtschaftsnobelpreis. Und als der Staat in den 1980ern schwächelte, schlug die Stunde des Neoliberalismus. Bis heute beherrscht er Politik und Institutionen in den USA und im Rest der Welt.
Passenderweise ist Ayn Rand immer noch Pflichtlektüre im Bücherregal der US-Republikaner, und in Deutschland weckt Friedrich Merz neoliberale Hoffnungen. Offensichtlich fällt der Vorschlag »Wie wär’s, wenn wir nicht teilen?« über Jahrhunderte hinweg immer wieder auf sehr fruchtbaren Boden. Die Idee des Teilens steht unter Beschuss.
Was inzwischen allerdings auch unter Beschuss steht, ist der Neoliberalismus selbst. Immerhin muss sein Markt 2020 zum x-ten Mal gerettet werden, die meisten Menschen haben ihm 2008 noch nicht verziehen, und der Papst hat dessen Grundsätze gerade erst ein Märchen genannt. Spätestens seit wir an die Grenzen unserer Ressourcen stoßen, wankt der Glaube an die Kraft des Eigennutzes. Klar liefert Adam Smith’ Metzger Nahrung für alle, aber vorher trägt er mit seinen Kühen zum Klimawandel bei, Antibiotika im Futter belasten das Grundwasser, und kürzlich sind Dutzende Leute in der Schlachterei an Corona erkrankt. Zur Lösung dieser Probleme appellieren wir dann doch wieder an all das, was die freie Marktwirtschaft angeblich nicht nötig hat: Verantwortungsbewusstsein, Mitgefühl und Solidarität. Was die durchaus berechtigte Frage aufwirft: »Ja was denn nun!?«
Selten kollidiert unser Eigeninteresse mit dem der anderen so offensichtlich wie in einer Pandemie, und man fragt sich, ob unsere Fixierung darauf gerade nicht ganz und gar schädlich ist. Tatsächlich verweigern Anhänger des Sozialdarwinismus häufiger Masken.3 Was, wenn uns kein innerer Widerstand, sondern die politische Kultur vom Teilen abhält?
Auch dafür gibt’s eine Philosophen- und eine Kinderbuchfraktion. In der Sage »Die kleinen Leute von Swabedoo« teilen die Menschen von sich aus und mit Freude, bis ein böser Kobold sie vom Gegenteil überzeugt – und später von der Geldwirtschaft. In der Ecke der Philosophen steht Rousseau und erklärt uns, dass der Mensch nicht ganz so unleidlich wäre, wenn es in seinem Leben weniger staatliche Kontrollen gäbe und generell weniger Maschendrahtzaun. Am besten wäre es ihm zufolge gelaufen, wenn die Menschheit dem Ersten, der versucht hat, einen Zaun um ein Stück Land zu ziehen, ratzfatz eins übergezogen hätte. Irgendwo in Berlin liegt dieser Vorschlag wahrscheinlich als Petition aus.
Die Rousseau-Seite hat kürzlich frischen Rückenwind vom Soziologen Rutger Bregman bekommen (Sie kennen ihn vielleicht aus seiner Rolle als »der Mann, der in Davos über Steuern sprach« oder aus seinem aktuellen Bestseller Im Grunde gut). Bregman ist viel herumgereist, um das rätselhafte Sozialverhalten der Spezies Mensch zu erkunden und der Frage nachzugehen, ob die Zivilisation daran schuld ist.
Eine der spannendsten Geschichten, auf die er dabei gestoßen ist, handelt von drei Jungs, die mit einem Boot durchbrennen, weg von ihrem Internat im Allgemeinen und dem dortigen Essen im Besonderen. Sie geraten in einen Sturm und stranden ausgehungert auf einer einsamen und sehr ungastlichen Insel. Wie verhalten sich drei Jungs so mutterseelenallein, fernab von Eltern, Bibeln und auch sonst jeglicher ordnenden Instanz? Wie werden sie miteinander umgehen? Wenn Sie das an den Plot von Herr der Fliegen erinnert, haben Sie recht. Und falls Sie noch wissen, wie das Buch ausgeht, erwarten Sie jetzt wahrscheinlich nichts Gutes. Sie lägen mit dieser Prognose aber ziemlich daneben.
Noch während die Jungs orientierungslos auf dem Ozean treiben, teilen sie das Regenwasser, und auf der Insel teilen sie die Arbeit. Sie wechseln sich ab mit dem Fischen genauso wie mit der Verantwortung für das Feuer, und wenn sie sich streiten, setzen sie sich zum Abkühlen der Gemüter an unterschiedliche Enden der Insel. Anders als in Herr der Fliegen geht das Feuer nie aus, und es wird auch niemand von einem Felsbrocken überrollt. Nach ihrer Rettung heuern die Freunde gemeinsam auf einem Krabbenfischer an, und das ist mehr, als man von den meisten WGs behaupten kann.
Menschen teilen also selbst dann, wenn sie keine zivilisatorische Instanz dazu zwingt. Zumindest diese drei. Dass sie damit jedoch nicht völlig aus der Art schlagen, zeigen die Beobachtungen von Menschen, deren Städte, Häuser und Polizeistationen gerade von Flutwellen überrollt oder von Erdbeben verschüttet wurden.4 Stellt sich raus: Wenn die Zivilisation zusammenbricht, suchen sich die meisten Menschen keinen Laden zum Plündern, sondern ihre Verwandten und die Schlange zu den Toiletten. Danach wahrscheinlich die zur Essensausgabe.
Selbst nach dem ersten Schock folgt auf Katastrophen kein abrupter Anstieg von Eigennutz, sondern eine Horde von Hilfstrupps. Catastrophe Compassion nennt sich die plötzliche Welle von Altruismus und Solidarität, die dann oft zu beobachten ist. Dicht gefolgt von einem anderen merkwürdigen Phänomen namens Disaster convergence: Statt sich wie vernünftige Menschen vom chaotischen Krisengebiet fernzuhalten, machen sich alle möglichen Helfer auf den Weg dorthin. Das muss man sich mal vorstellen! Menschen teilen also nicht nur da weiter, wo Recht und Ordnung gerade zerfallen, mitunter gehen sie zum Teilen extra in Richtung des Chaos. Und auch vor Ort lassen sie dann üblicherweise nicht alle Hemmungen fallen, um einen Schmugglerring mit THW-Hilfsgütern aufzumachen.
Auch wenn man Menschen an Kampf und Krieg nachweislich alles Übel zutrauen kann, scheint sich ausgerechnet die chaotische Hobbes’sche Jeder-gegen-jeden-Regellosigkeit nie so richtig einstellen zu wollen. Wer will sich auch mit einem Waldbrand und einem Krieg aller gegen alle abmühen müssen? Den meisten von uns fehlt dafür ohnehin die Oberarmmuskulatur.
Davon abgesehen gibt es handfeste Gründe, gerade unter Druck an Teilen und Solidarität festzuhalten. In der äthiopischen Dürrezeit sichern zum Beispiel besonders die Ärmsten ihre Handlungsfähigkeit durch Zusammenarbeit.5 Diese Art Selbstwirksamkeit gehört, genauso wie Verbundenheit, zu unseren absoluten Grundbedürfnissen.
Überhaupt kann man nicht sagen, dass Teilen ein Schönwetterphänomen ist. Afghanische Bauern lockern in der eher mageren Jahreszeit zwar ihre Erwartungen an die Freigiebigkeit der Nachbarn, teilen aber dennoch genauso viel.6 Chinesische Bauern investieren bei Wasserknappheit mehr Geld in den Gemeinschaftstopf.7 Und chinesische Kinder aus ärmeren Familien teilen mehr Sticker – selbst dort, wo Armut bedeutet, dass Eltern ihre Kinder der städtischen Arbeit wegen zurücklassen müssen.8 Einer der wenigen Berichte, in denen Großzügigkeit massiv sinkt, beschreibt das Bergvolk der Ik aus Uganda – mitten in einer schweren Hungersnot. Aber selbst dort kehrte die Großzügigkeit später wieder auf einen Durchschnittslevel zurück.9
Es mag also einen Punkt geben, an dem wir das Teilen dauerhaft infrage stellen. Aber die Norm zur Großzügigkeit ist resilienter als angenommen.
Das macht doch Hoffnung. Oder vielleicht macht es uns auch misstrauisch. Immerhin sind die Bilder von den leeren Supermarktregalen noch sehr frisch im Gedächtnis. Während der anfänglichen Panik sind wir dankbar für jede höhere Macht, die den Verkauf von Toilettenpapier und feuchten Tüchern auf zwei Packungen pro Person begrenzt. Allerdings sagt uns der kurzfristige Engpass wahrscheinlich mindestens ebenso viel über den Menschen wie über gesellschaftliche Organisation und engmaschige kommerzielle Lieferketten. Selbst Hilfsorganisationen mit besten Absichten fällt das Teilen manchmal schwer, wenn die Ressourcenlieferungen knapp koordiniert sind (oder exzessiven Überschuss liefern).10 Im Gegensatz zu den Beispielen oben bilden Leute, die im Supermarkt einkaufen, auch keine gewachsenen Strukturen. Und auch auf etablierte Normen können wir uns beim Einkauf nur begrenzt verlassen (»Darf ich die letzte Pasta-Packung nehmen, wenn es noch Lasagneplatten gibt?«).
So oder so: Menschen teilen auch dann, wenn es eng wird und ihnen keine regelnde Instanz auf die Finger schaut. Hat Hobbes also schon deshalb unrecht, weil Menschen gar nicht teilen müssen, sondern wollen, und sei es nur zum Schrottwichteln? Würde das Ayn Rands Ratschläge nicht überflüssig machen? Wenn ja, warum verkaufen die sich dann so gut? Und überhaupt, wenn Teilen so toll ist, warum gibt es dann Jeff Bezos?
Was sagt eigentlich die aktuelle Forschung zu alldem?