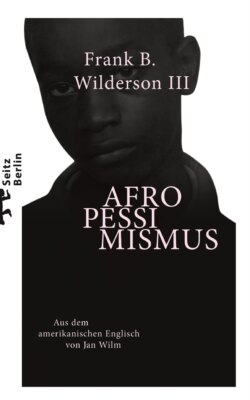Читать книгу Afropessimismus - Frank B. Wilderson III - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL ZWEI Saft aus einem Halsknochen
Оглавление1
Im Alter von elf Jahren lag ich nachts allein im Dunkeln auf dem Fußboden unseres Wohnzimmers und lauschte gregorianischen Gesängen, Tonbandaufnahmen des Chors, in dem meine Mutter sang, des Chors in der Basilica of Saint Mary in der Innenstadt von Minneapolis. Allein im Dunkeln sah ich mich zehn Jahre in der Zukunft, in eine weiße Soutane gehüllt, gerahmt von zwei Ministranten, die mir den kalten steinernen Gang nachfolgten. Die kühle Kathedralenluft war mit einer Spur Weihrauch gewürzt. Im Sommer 1967 war es schwül in Minnesota. Der Sommer der Liebe an der Küste Kaliforniens war im Land der zehntausend Seen eine luftfeuchte, von Moskitos durchschwärmte Jahreszeit. Doch auf dem Boden war es kühl, sodass ich ohne Hemd auf dem Teppich lag und meine Haut den volltönenden Klängen überließ, Kielwasser um Kielwasser aufsteigender Wellen, die ich durchtauchte und mich als Priester imaginierte. Sanktuarium.
Im Alter von elf Jahren war ich kein Afropessimist, und meinem Wissen über das, was mir so viel Angst machte, fehlte ein Critical-Race-Vokabular. Doch ich wusste, dass ich Schwarz war; nicht weil der Geruch von Filé-Pulver und Räucherwurst, die in einer angedickten Gumbo-Mehlschwitze köchelten, aus meinem und keinem anderen Haus in der Nachbarschaft aufstieg, sondern weil wir die Einzigen waren, die sie Negro nannten. Erst im folgenden Jahr, 1968, als ich zwölf wurde, würde ich zu einem Schwarzen. Im Dunkeln, als ich mit elf Jahren auf dem Boden des Wohnzimmers lag, wusste ich, dass ich ein Negro war, nicht aufgrund meiner Kultur, sondern weil diese Tatsache die Quelle meiner Scham war; einer Scham, die in der Nachbarschaft niemand teilte. Die gregorianischen Gesänge zitterten in meiner Brust und weiteten die Dunkelheit zu breiten, kavernenhaften Katakomben aus, die sich durch mich hindurch und aus mir hinaus erstreckten zur anderen Seite hin, zu jener Seite, wo ich mich in der Zukunft sah, einer Zukunft, in der ich von meinen Gemeindemitgliedern verehrt würde, anstatt geschmäht zu werden, wie mich in der ersten Klasse ein kleines Mädchen geschmäht hatte, das meine Hand nicht halten wollte aus Angst, dass der Ruß meiner Haut sie beflecken könnte. Im Klangtunnel meiner Zukunft fielen die Kinder und meine Lehrerinnen und Lehrer vor mir auf die Knie, wenn ich an ihnen vorbeiging, sie standen und knieten auf meinen Befehl hin, sie beichteten mir ihre Sünden, bevor sie des Leibes Christi würdig wurden. Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Ich wollte seine Hand nicht halten, weil sein Ruß auf mich abfärben würde. Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Ich nannte ihn einen Affen, als er im Sportunterricht das Tau hochkletterte. Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Ich drückte meine Zunge zwischen Zähne und Oberlippe und kratzte mir die Achseln, als er sich herunterhangelte. Vergib mir, Vater, denn wir haben gesündigt. Wir lachten. Vergib mir, Vater, denn wir haben gesündigt. Wir drückten sein Gesicht in den Schnee. Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Ich nannte ihn »Freund« und brachte ihn aufgrund der Neugier meiner Mutter mit nach Hause. Wie fühlt es sich an, fragte sie, ein Negro zu sein? Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Ich brachte ihn dazu, sich vor die Klasse zu stellen und uns den Treueschwur auf die Vereinigten Staaten aufzusagen.
Meine Brust, meine Arme und der cabernetfarbene Teppich saugten ihre Beichten auf wie ein Weizenfeld, das den Klang des Regens wiedergibt. Wenn meine Tanten und Onkel aus New Orleans oder von jenem Ort mit dem süßlich-beißend riechenden Boden vierzig Meilen flussaufwärts von New Orleans zu Besuch kamen, fragten sie mich, ob ich das Licht eingeschaltet haben wollte. Im Süden brüteten Kinder nicht im Dunkeln vor sich hin. Nein, Tante Joyce, ich will die Dunkelheit. Entspannst du dich, Ba-by? Ja, antwortete ich, ich entspanne mich. Was ich wirklich meinte, war, dass ich meine Hymne der Erlösung komponierte.
Ich ruhte mich aus, doch ich entspannte nicht. Entspannung ist ein Zustand, in der Gegenwart zu ein, in Szenen der Gegenwart zu leben. Als Junge lebte ich nur selten in der Gegenwart. Es schmerzte mich zu sehr, in der Gegenwart zu sein. Wenn ich an mich dachte, befand ich mich selbst in der Zukunft. Die Gegenwart war die Buße, das, was ich für meinen Ruß ableisten musste. Ich träumte, eines Tages würde die Gegenwart vorbeigehen. Doch jedes Jahr, das ich erreichte, musste ich feststellen, dass die Gegenwart ihre Koffer längst gepackt und sich auf den Weg zu mir gemacht hatte. Sie wartete mit meinem Zimmerschlüssel in der Lobby auf mich. Noch während ich auf dem Boden unseres Wohnzimmers lag und den Sünder:innen der Gegenwart in ihrer Inkarnation als Bittstellende von morgen die Beichte abnahm, wusste ich an irgendeinem untergründigen Ort hinter den Gesängen, dass die Gegenwart immer auf mich warten würde: Am Ende dieses Sommers wäre die sechste Klasse nicht anders als das langsame, saure Dahintropfen vergangener Jahre; ein weiteres Jahr, in dem ich mich selbst mit den Augen anderer sehen würde: Unser junger Negro-Nachbar. Der Wilderson-Bub. Gepflegter, als man gedacht hätte. Höflich. Kann sich gut ausdrücken. Wohlriechend. Kämpferisch. Kommt in Rechtschreibung nicht mit. Hat den andern in Rechtschreibung was voraus. Kann besser lesen als seine Klassenkameraden. Hinterher mit seinen Mathe-Hausaufgaben. Gräuliche Beine. Gorilla-Lippen. Als Bettnässer bekannt.
Die gerade vergangene Weihnacht legte mir meine Lehrerin nahe, die fünfte Klasse zu wiederholen. In der vierten Klasse sagten sie, ich sei so klug, dass ich die fünfte Klasse überspringen könnte; allerdings gefiel es meinen Eltern nicht, dass Kinder Klassen überspringen. In der fünften Klasse ging es schließlich los, dass ich ins Bett machte, und mein Verstand war lahmgelegt. Ich konnte oder wollte morgens nicht mehr aufstehen. Ganze Monate vergingen, ohne dass ich ein einziges Mal Hausaufgaben machte. Als ich in jenem Sommer den gregorianischen Gesängen lauschte, staunte ich nicht schlecht, dass ich die fünfte Klasse geschafft hatte. Im März hatte ich meine Lehrerin um all die Hausaufgaben gebeten, die ich nicht abgegeben hatte.
Sie sagte: »Wie wär’s mit den Aufgaben von Oktober an?«
In den Osterferien verbarrikadierte ich mich in meinem Zimmer und erledigte die Mathe- und Leseaufgaben von sechs Monaten innerhalb von einer Woche. Im April klatschte ich sie ihr auf den Schreibtisch. Sie korrigierte sie alle, und ich bekam nur Einsen und Zweien. Es dauerte eine Woche, bis sie alles korrigiert hatte, und sie schimpfte mit mir, dass ich ihr das ganze Jahr über solche Angst um mich gemacht hatte. Ich bekam mein Lob auf indirektem Weg.
Wäre ich weiß gewesen, hätten mich meine Sportlichkeit und mein Charme beliebt gemacht. Auch hätte ich beliebte Freunde gehabt. Doch meine Freunde stammten aus dem Land der ungeeigneten Spielzeuge. Liam Gundersen fühlte sich genauso bedroht von einem Bären wie von einem Schmetterling. Er hyperventilierte und biss sich in den Arm, wenn jemand die Hand gegen ihn erhob. Sein Vater und seine Mutter kamen aus Norwegen und waren in einem japanischen Internierungslager gefoltert worden, als sie Missionare in China waren. Die Kinder auf dem Spielplatz drehten durch, wenn Liam sich in die Arme biss. Er war der Jüngste von dreizehn Kindern, die alle erwachsen und ausgezogen waren. Seine Brüder hatten ihm Romane von Graham Greene, John le Carré und Ian Fleming im Haus hinterlassen. Liam und ich verbrachten viele Stunden damit, sie auf seinem Dachboden zu lesen. In den drei Jahren von meinem elften bis zu meinem dreizehnten Lebensjahr auf Liams Dachboden verstand ich diese Bücher nicht ganz so gut wie Liam; ebenso wenig konnte ich die Brocken von französischen Wörtern übersetzen, die Graham Greene wie Kleingeld auf seinen Seiten verteilte. Liam allerdings schon. Oskar Nilsens Vater war Chiropraktiker, was mit »Hexendoktor« gleichbedeutend war in der reichen weißen Enklave von Kenwood, wo die Eltern leitende Angestellte waren und Bankiers, Architektinnen, Anwälte, Ärztinnen und Staatsmänner wie der Senator und künftige Vizepräsident Walter Mondale sowie Mark Dayton, ein Politiker, dessen Familie die Läden Target und B. Dalton Bookseller gehörten. Dann war da noch Elgar Davenport, der klein und klobig war und die Welt durch lupendicke Brillengläser betrachtete, mit einem linken Auge, das wie verloren umherirrte. Elgar war ein stiller Grund zur Scham für seine Mutter, die blond, schlank und sportlich war und immer vor ihm herging. Elgar hatte rotes Haar und Sommersprossen. Mister Davenport fuhr eine rote Corvette und »spekulierte an der Börse«. Ich glaubte, es wäre cool, wenn mein Vater einen Sportwagen in meiner Farbe kaufen würde; dann aber, so schnell mir der Gedanke in den Sinn gekommen war, erschloss sich mir die Kehrseite. Ich spürte die Kehrseite davon, einen Sportwagen in meiner Farbe zu besitzen, ohne dass ich Worte dafür besaß. Wissen ist häufig weit mehr, als sich in Worten ausdrücken lässt.
Elgar Davenport, Liam Gundersen, Oskar Nilsen und ich spielten Geheimagenten auf dem Gelände einer dunklen Steinvilla gegenüber von unserem Haus. Die Villa hatte einen Aufzug und, wie man mir erzählte, zehn Schlafzimmer, wobei ich in den sechzehn Jahren, die ich gegenüber wohnte, nie in der Villa gewesen war. Sie wechselte ihre Besitzer:innen: einmal eine wohlhabende Familie mit fast so vielen Kindern wie Schlafzimmern (auch wenn sie zu jung waren, um mit mir zu spielen); ein anderes Mal Senator Mark Dayton. Es war der Wohnsitz seiner Familie, wenn sie nicht in Washington waren, und sie lebten dort, bis er Gouverneur wurde und den Gouverneurssitz in St. Paul bezog. Wir spielten Geheimagenten am Ende dieses Grundstücks, weit entfernt vom Hauptgebäude, in der Nähe einer Ein-Zimmer-Remise am Ende der breiten Kiesauffahrt. Die Remise erfüllte ihren Zweck; sie war für die Inszenierung unserer Spionagegeplänkel von entscheidender Bedeutung. Manchmal war sie die sowjetische Botschaft in einer dunklen, bewaldeten Ecke von Washington, D. C. Manchmal war sie eine SMERSH-Division zur Ausbildung von Attentätern, die für den Mord an James Bond trainiert wurden. Unsere Spionagespiele hatten eher etwas von Salvador Dalí als von Ian Fleming. Zum Beispiel säumte ein niedriger Drahtzaun, der den Hinterhof eines kleineren Herrenhauses von der Dayton-Villa trennte, ein Ende des Grundstücks. Wir nannten diesen Drahtzaun die Berliner Mauer, ohne irgendwelche geografischen Korrekturen vorzunehmen, wie etwa die Verlegung des Herrenhauses von Washington, D. C. nach Berlin. Die Surrealisten in uns waren stärker als die kartografischen Realisten.
Wenn wir keine Streichhölzer zogen, waren wir am Ende einfach vier Jungs, die alle CIA-Agenten spielten, ohne einen einzigen Kommunisten. Eines unfreundlichen Tages zogen Elgar und ich die Streichhölzer, die uns zu sowjetischen Spionen machten. Liam und Oskar waren die Guten. Unser Spiel beinhaltete zwei rennende und schreiende einfältige Sowjets und zwei einfältige Amerikaner, die ebenfalls rannten und schrien, während sie versuchten, den niedrigen Drahtzaun der Berliner Mauer zu überwinden und zum Checkpoint Charlie zurückzugelangen, bevor die Sowjets sie erwischten.
Elgar und ich kauerten hinter der Remise am Ende der Kiesauffahrt. Die Amerikaner würden von irgendwo in der Nähe der Remise kommen, doch wir wussten nicht, von welcher Seite des Gebäudes aus sie auftauchen würden. Gewöhnlich war einer der Jungen, die die Guten spielten, der Lockvogel, derjenige, der hinter einem Baum an der Seite der Remise hervorkommen und mit halsbrecherischer Geschwindigkeit zu einer weit entfernten Stelle des Zaunes laufen würde, während der andere Junge wartete, bis beide Sowjets abgezogen wären. Dann würde er versuchen, zu entkommen. Elgar und ich lugten hinter der Remise hervor und warteten auf die beiden amerikanischen Spione. Unsere Daumen und Zeigefinger formten wir zu Ringen und hielten sie als Ferngläser vor unsere Augen.
»Hey«, raunte Elgar mir zu.
»Ja«, flüsterte ich zurück.
»Meine Mom hat mir gesagt, ich soll dich mal fragen, wie du dich als Negro fühlst.«
»Keine Ahnung«, sagte ich nicht mehr ganz so leise.
»Warum denn?«
»Ziemlich gut … schätze ich.«
»Da kommen sie!«
Oskar und Liam hatten sich in Bewegung gesetzt! Wir erwischten Liam, während es Oskar gelang, sich bis zum Checkpoint Charlie im Garten der McDermotts durchzuschlagen.
Das nächste Mal, als ich Elgar sah, teilte er mir mit, dass seiner Mutter meine Antwort nicht gefiel. Ich war besorgt. Ich fragte ihn, ob sie wütend sei. Nein, sagte er. Ich fragte ihn, ob er sich ganz sicher sei. Sicher, ich bin ganz sicher, sagte er, sie will, dass du zu uns zum Mittagessen kommst. Ich sagte, okay, aber ich müsste erst meine Mom fragen.
Celina Davenport war wesentlich größer als ihr Mann, Elgar senior. Sie hatte kein rotes Haar, wie Elgar junior und Elgar senior es hatten. Bevor wir uns zum Mittagessen hinsetzten, nahm sie mich mit ins Wohnzimmer und zeigte mir den Kaminsims mit ihren Tennistrophäen eines Colleges, von dem sie sagte, es sei eines der »Seven Sisters« an der Ostküste, wo keine Jungen studieren dürften. Mit ihrer heiseren Stimme, die nach zahllosen trockenen Martinis klang, sagte sie, dass sie an diesem Ort geradezu die Wände hochgegangen war.
»Elgar weiß, wie ich die Wände hochgehe«, sagte sie und verstrubbelte seine Haare.
Sie führte uns in die Küche. Ich war so verkrampft, dass ich überhaupt hier war, und ich wusste nicht, warum ich hier war, sodass ich ihr nur halb zuhörte und so bloß halb verstand, was sie meinte. Doch war mir beigebracht worden, dass man, wenn man nicht weiß, was man zu jemandem sagen soll, anstatt eine unbe hagliche Stille aufkommen zu lassen, einfach eine Frage in die Stille stellen solle. Also fragte ich sie, warum sie die Wände hochgehen wollte. Sie sah mich an, als hätte ich sie gefragt, ob zum Abendessen Katzenfutter auf den Tisch komme. Dann lachte sie und rief ihr Dienstmädchen, Mrs. Szymanski, um das Mittagessen zu servieren. Wir aßen in der Küche, Celina Davenport, Elgar und ich. Mrs. Szymanski stellte einen Teller mit Sandwiches auf den Tisch und goss Limonade für Elgar und mich ein. Auch Mrs. Davenport trank Limonade, allerdings mit einem Schlückchen Gin. So verstohlen, wie ich konnte, hob ich eine Seite der Brotscheibe an, um einen Blick darunter zu werfen. Ich war nicht verstohlen genug gewesen.
»Stimmt was nicht mit dem Sandwich, Frankie?«, fragte Mrs. Davenport.
»Der Name gefällt ihm nicht, Mom.«
»Welcher Name gefällt dir, Schätzchen?«
»Frank«, sagte ich und versuchte, nicht so schroff zu klingen wie Elgar.
»Deine Mutter nennt dich Frankie, wenn sie dich bittet, ins Haus zu kommen.« Das erschreckte mich, denn mir war nicht klar gewesen, dass sie meine Mutter überhaupt kannte. Ich wusste, dass meine Mutter ihr bekannt war, denn die Davenports hatten eine Petition mit fünfhundert Haushalten unterzeichnet, um uns aus Kenwood fernzuhalten; und die meisten der Nachbarinnen und Nachbarn hatten nie ein Wort mit meiner Mutter gewechselt. Ich sagte nichts.
Sie fragte noch einmal: »Was stimmt nicht mit dem Sandwich … Frank?«
»Nichts, Mrs. Davenport.«
»Nun sag schon. Ich bin nicht beleidigt, wenn du meine Sandwiches nicht magst.« Die Ironie ihrer Aussage entging mir damals, denn es waren nicht ihre Sandwiches. Mrs. Szymanski hatte sie zubereitet.
»Ich wollte nur mal sehen, wo das Fleisch ist, damit ich es in die Mitte schieben kann.«
Amüsiert sagte Elgars Mutter: »Es ist ein italienisches Sandwich: Provolone, Spinat und Tomaten und eine Idee Pesto. Man bekommt Blähungen, wenn man bei dieser Hitze Fleisch isst.«
»Meine Mutter sagt das auch«, meinte ich. »Sie macht die auch manchmal.«
»Ach, tut sie das?« Mrs. Davenport nickte und zündete sich eine Pall Mall an. »Quäl dich bitte nicht. Du brauchst es nicht zu essen.«
Das war eine vorübergehende Gnadenfrist vor dem Todesurteil, bis ich mich daran erinnerte, dass meine Mutter mir aufgetragen hatte, ich solle mich von meiner besten Seite zeigen. Ich nahm einen großen Bissen. Eine Übelkeit kitzelte meinen Magen, als ich versuchte zu schlucken. Die Mayonnaise, der gummiartige Käse und die sauren Tomaten, kombiniert mit diesem Hauch von Pesto, kämpften sich in teigigen, halb zerkauten Pfropfen meine Speiseröhre runter.
Dann stellte Celina Davenport die Frage, die Elgar mir an der Remise vor der Berliner Mauer gestellt hatte. Auf einem Stuhl direkt gegenüber von mir nippte sie an ihrer mit Gin gespickten Limonade, nahm einen weiteren Zug an ihrer Zigarette und starrte mir ins Gesicht, während sie auf meine Antwort wartete.
Ich hörte auf zu essen. (»Ich würde nie einen Mann einstellen, der eine Mahlzeit vor dem Essen salzt.« Einer der Grundsätze meines Vaters. »Das bedeutet, dass du nichts Unüberlegtes sagen oder voreilig handeln solltest, Frankie. Wenn du die Antwort nicht weißt, denke nach und nimm dir einen Moment Zeit, um herauszufinden, was gefragt wurde.«) Aufmerksam sah ich mich in dem Raum um. Ihre Spitzenvorhänge, die sich im Wind vor den Küchenfenstern wölbten; ihr polierter grüner Gasherd mit antiken goldenen Knöpfen; ihr Frigidaire-Kühlschrank, der wie der Silver Surfer im Marvel Comic schimmerte, mit einem Eiswürfelbereiter in der Tür und einem Wasserspender, sodass Eis und Wasser ausgegeben werden konnten, ohne dass man das Gerät öffnen musste, etwas, das ich noch nie zuvor gesehen hatte; ihr weißer Tennisrock mit Bügelfalten, ihre weißen Turnschuhe, ihre wohlgeformten Beine und die Art und Weise, wie sie wartete, ohne zu blinzeln. Sie starrt mich an wie ein ostdeutscher Grenzsoldat. Die falsche Antwort, und du wirst es nicht zurückschaffen. Sie ist nicht nur eine hübsche Tennislady, und das sind nicht nur hübsche Tennisschuhe; in den Spitzen ihrer Schuhe sind ausfahrbare Messerklingen verborgen, und sie wird dich ins Schienbein treten, wenn du Papas Grundsatz vergisst und etwas Unüberlegtes sagst.
»Mutter«, sagte Elgar, »ich habe dir schon gesagt, was er gesagt hat.«
»Ich kann dir nicht mal vertrauen, dass du das richtige Wechselgeld nach Hause bringst, Elgar. ›Ziemlich gut. Schätze ich‹? Elgar, du redest so. Sein Vater ist Pädagoge.«
»Ich hab noch mehr sagen wollen,« entschuldigte ich mich.
»Na sicher wolltest du das. Elgar hat dir nicht die Möglichkeit dazu gegeben.«
Sie wirkte zufrieden. Ich wollte, dass das so bleibt. Jeder Spion weiß, wie man die Wachleute bei Laune hält.
Ich erzählte ihr, es sei nett, ein Negro zu sein. Sie stieß einen weiteren schmalen Rauchzyklon aus. Sie guckte nicht gerade erfreut drein. Also sagte ich ihr, dass Negros coole Sachen machen dürfen.
»Was zum Beispiel?«, fragte sie aufgeweckter.
Ich war aus der Fassung gebracht, und so erzählte ich ihr vom Masongate Resort am Gull Lake in der Nähe von Brainerd, Minnesota. Ich erzählte, dass unsere Familie und eine ganze Menge anderer Negro-Familien dort jeden August eine Woche zusammenkämen zum Angeln, Schwimmen, Boot- und Wasserskifahren. Das Masongate Resort war ihr bekannt, doch irgendetwas von meiner Geschichte passte nicht zu dem, was sie darüber wusste. Sie fragte mich, ob ich das Masongate Resort vielleicht mit einem anderen Ort verwechselte.
Sie stand auf und lehnte sich auf den Tresen, mit dem Rücken zum Fenster. Mit ihrer ersten Zigarette zündete sie sich eine weitere an und schnippte den Stummel der ersten zum Fenster raus.
»Was würde Smokey der Bär denn dazu sagen?«, fragte Elgar alarmiert.
»Irgendwann wird aus dir mal ne richtig gute Ehefrau, Elgar«, sagte sie, schaute während ihrer Worte jedoch zu mir.
Das erste und einzige Mal, dass sie ihre Augen von mir abgewandt hatte, war, als sie ihr Feuerzeug benutzte, um sich ihre erste Zigarette anzustecken. Jetzt löste sie ihren Blick von mir und blies den Rauch zur Seite aus. Als sie mich wieder ansah, war in ihrem Gesicht noch immer kein Anflug von Wärme zu spüren.
Ich log, und sie wusste es. Wir hatten nie im Masongate Resort gewohnt; wir wohnten in den Twilight Loon Cabins, zwei Meilen entfernt von Masongate, am Ufer des Sees mit Sümpfen anstatt Sandstränden. An einem Teil des Sees, wo es keine Schnellboote gab, keine Grand Lodge mit Abendunterhaltung, keine Wassersportarten wie Jetskiing, kein elegantes Restaurant, in dem Amerikanischer Hecht mit Bratkartoffeln serviert wurde. Statt der üppigen, klimatisierten Räume von Masongate gab es in den Twilight Loon Cabins Selbstversorgerhütten mit Fliegengittertüren, von denen die Farbe abblätterte, und die Geräusche, wenn sie geschlossen wurden, erschallten klatschend über den gesamten See. Die Lichter auf dem Gelände lagen so weit auseinander, dass man nachts eine Taschenlampe brauchte, um von einer Hütte zur nächsten zu gelangen. Erst im Jahr zuvor, 1966, hatten die vier Negro-Familien begonnen, die Kinder mit nach Masongate zu nehmen, um dort zu Abend zu essen und die dort angebotenen Freizeitmöglichkeiten zu nutzen. Wir wohnten jedoch nicht dort, und irgendetwas sagte mir, dass Mrs. Davenport das wusste. Sie löschte die Glut der neuen Zigarette unter dem Wasserhahn.
»Elgar senior glaubt nicht, dass es die Twins dieses Jahr in die World Series schaffen werden«, sagte sie, als spräche sie mit jemandem, der nicht anwesend war. Sie ließ ein Glas mit Wasser aus dem Hahn volllaufen und trank einen Schluck davon. »Was ist aus seinem Stolz für seine Heimatmannschaft geworden?«
2
Pappige Klümpchen aus Mayonnaise, Tomaten, Käse und blanken Nerven, gut vermengt mit der neuen Erfahrung von Pesto, schwappten mir im Magen herum, während ich von Elgars Haus hügelaufwärts zu meinem Haus eilte. Als ich die hintere Verandatreppe hinaufkam, hörte ich im Radio ein Lied von Dinah Washington. Die grünen S&H-Rabattmarken und ein Sammelbüchlein zum Einkleben lagen auf dem Küchentisch neben einem Lehrbuch über Statistik fürs Psychologiestudium. Mom machte gerade eine Lernpause und klebte Rabattmarken in das Buch ein.
»Und?«, sagte sie.
»Die haben kein Fleisch in ihren Sandwiches.« Mom lachte und drehte das Radio runter.
»Wir sind in Minnesota«, sagte sie, »aber wir sind nicht aus Minnesota. Bull Connor hätte sich das Geld für seine Kampfhunde sparen können, wenn er das Essen dieser Frau gehabt hätte.«
»Mom?«
»Ja?«
»Ach, nichts.«
»Was ist los?«
»Wie fühlst du dich?«
»Ich fühle mich, als sollte ich mit einem Mint Julep auf meiner Veranda stehen und mir kühle Luft zufächern, anstatt mir wegen Statistiken den Kopf zu verrenken oder Rabattmarken abzulecken.«
Ich hatte mich nicht geregt.
»Warum fragst du?« Sie saß auf genau der richtigen Höhe, um mir in die Augen zu schauen.
»Damit ich weiß, was ich das nächste Mal sagen muss.«
»Welches nächste Mal?«
»Das nächste Mal, wenn Mrs. Davenport mich fragt, wie es sich anfühlt, ein Negro zu sein.«
»Nein!« In ihrem Gesicht stand ein wütender Wunsch. »Nein, das hat sie dich nicht gefragt.« Sie presste ihre Handflächen auf den Tisch, als wollte sie unmittelbar aufstehen und Mrs. Davenport außer Gefecht setzen. Und was dann?, muss sie sich gefragt haben, denn sie blieb sitzen. Und was dann?
Sie lernte etwas Wichtiges über weiße Nordstaatler:innen der Oberschicht, etwas, das sie vor ihrem Umzug nach Kenwood nicht für möglich gehalten hätte: wie sich ein Krieg stellvertretend durch das Kind einer anderen führen ließ. Sie wusste nun, wie es sich anfühlen musste, von einer Lenkrakete getötet zu werden. Was für eine Frau würde dich mithilfe deines Kindes verletzen? »Das Gute, das Schöne und das Wahre«, lautete ein Grundsatz von Du Bois, den meine Mutter sehr schätzte. »Dies müssen unsere Bestrebungen sein. Und alles beginnt damit, wie man Menschen behandelt.« Dieses Langstrecken-Herumgepfusche mit meinem Verstand, und mein Sohn als deine Lenkrakete; falls es das war, was sie dachte, als ich nach Hause kam, dann hatte die Celina Davenport tief in ihrem Kopf meine Mom auch daran erinnert, wie sie Elgar und all die Kinder in dieser Nachbarschaft dazu brachte, sich zu Hause zu fühlen, wenn sie bei uns zu Besuch waren; wie sie die Eistüten für die Kinder immer mit einer halben Kugel extra vollschöpfte; wie sie am vierten Juli rote, weiße und blaue Malerhüte für die Kinder bastelte und ihnen die Wunderkerzen anzündete, wenn sie in einer Parade den Hügel hinaufstolzierten. Aber du verdrehst meinem Sohn den Magen und machst ihm Angst.
Eines Nachts, als ich älter und kurz davor war, allein zu leben, kam ich spät und leise nach Hause. Mutter war allein im Dunkeln vor einem Kaminfeuer. Vater lag auf dem Sofa ausgestreckt und schlief. Das weiche Glühen im Kamin war das einzige Licht im Raum. Mom steckte Nadeln in kleine Stoffpüppchen und gab ihnen die Namen von zwei ihrer weißen Kolleginnen. »Und die hier«, sagte sie lustvoll, als sie die Puppe piekte, »wird zittrig und gelähmt.« Ich lächelte und ging ins Bett, und sie ahnte nicht, dass ich sie gesehen hatte. Sie ist geistig gesund geblieben, dachte ich, als ich ins Bett ging. Nach allem, was sie durchgemacht hat, ist sie geistig gesund geblieben.
3
Das nächste Mal, als wir auf dem Villengelände gegenüber Geheimagenten spielten, zog ich ein Sowjet-Streichholz.
»Schon wieder?«, beschwerte ich mich.
Liam Gundersen war zusammen mit mir sowjetischer Agent; Elgar und Oskar waren beim MI6. Ich erwischte Elgar an der Berliner Mauer und sperrte ihn ins Wachhaus mit den imaginären Mauern aus Luft. Ich rannte am Zaun entlang, um Liam beim Fangen von Oskar behilflich zu sein, bevor Oskar nach Westberlin gelangen konnte. Ich war noch nicht weit gekommen, als ich Elgar schreien hörte.
»Ich bin entkommen!«
Sein kurzer, kräftiger Körper rollte über den Zaun.
Ich schrie zurück: »Du bist gefangen, du musst im Wachhaus bleiben!«
Er schrie: »Du hast mir keine Handschellen angelegt!«
Nun befand er sich hinter dem Zaun und raste durch den Garten der McDermotts, auf dem Weg in den Garten der Tysons. Ich war fuchsteufelswild.
»Bleib stehen, du Arschgesicht!«
Sein rotes Haar wellte sich im Wind. Er drehte sein sommersprossiges Gesicht zu mir um und lachte.
Mein Fuß stieß gegen etwas Festes auf der Erde neben dem Zaun. Es war eine Plastikflasche mit smaragdfarbener Palmolive-Spülseife. Ich bückte mich und hob sie auf. Ihre Schwere in meiner Hand war beträchtlich, denn sie war noch fast voll. Ich umklammerte die Flasche am Hals. Ich fühlte, wie mein Arm nach hinten schwang und sich dann nach vorne schleuderte. Die grüne Flasche drehte sich wirbelnd durch die Luft, bald ein Tomahawk, bald ein Zauberstab, während sie auf die Sonne zuschoss; das Zwölf-Uhr-Mittagslicht stieß durch die grüne Flüssigkeit wie durch ein Prisma, bis die Flasche im Schlund der Sonne verschwand. Um nicht zu erblinden, schloss ich meine Augen.
Plopp! Platsch!
Elgars Knie knickten ein. Er lag mit dem Gesicht nach unten im Garten der McDermotts.
Wir rannten an seine Seite. Grüne Spülseife sickerte aus einem Riss in der Plastikflasche ins Gras. Blut sickerte aus Elgars Schädel. Einer der Bügel seiner lupendicken Brillengläser war aus dem Scharnier gebrochen und lag neben seinem Kopf auf der Erde.
Doch es bedurfte einiger Augenblicke, bis das Wort Blut zu mir durchkam. Zuerst sah ich auf der Rückseite seines Schädels eine Haarlocke, ein rotes Haarbüschel, das schief abstand. Dann sah ich es als einen kleinen Wasserstrahl, wie den Wasserstrahl aus dem Trinkbrunnen vor Mrs. Andersons Klassenraum, der so klein war, dass die Lippen den Wasserhahn berührten, wenn man trank.
Liam und Oskar liefen los, um Hilfe zu holen.
Ich stand still, die Sonne starrte auf meinen Nacken, meine Augen starrten auf Elgar hinab, während er blutete. Es wäre falsch zu sagen, dass ich ihn hatte verletzen wollen. Doch jetzt, wo er verletzt war, wollte ich ihm nicht helfen. Ich wusste, dass ich ihm helfen wollen sollte; doch das war ein Wissen, dem das Verlangen entzogen war, und es äußerte sich in der zweiten und dritten Person – du solltest ihm helfen wollen, oder der Wilderson-Bub sollte ihm helfen wollen. Stimmen auf der Hintertreppe und ein wenig abseits von dem, was ich wirklich fühlte.
Das winzige Gluckern von Blut aus der weichen Stelle in seinem Hinterkopf verstummte in Sekundenschnelle, doch ich blieb stehen und wartete auf die Rückkehr des winzigen Geysirs. Elgar Davenport blutet. Wenn Elgar blutet, blutet auch seine Mutter. Bis zu diesem Zeitpunkt wirkten die Menschen um mich herum in Kenwood blutleer und unvergänglich.
(Drei Jahre später, im Frühjahr 1970, als wir in Berkeley wohnten, überreichte mir ein Black Panther Frantz Fanons Die verdammten dieser Erde während einer Seminarsitzung, die er und andere für Kinder der Mittelstufe veranstalteten. An jenem Abend las ich, was ich konnte, aus dem Kapitel »Von der Gewalt«, worin Fanon über den Moment schreibt, in dem der Algerier den französischen Kolonialherrn bluten sieht, jenen Moment, in dem der Algerier »entdeckt, daß die Haut eines Kolonialherrn nicht mehr wert ist als die Haut eines Eingeborenen. Diese Entdeckung teilt der Welt einen entscheidenden Stoß mit«,11 und dann stieg mir die Erinnerung an jenen Tag mit Elgar ins Bewusstsein.)
Ich spürte ein Stechen zwischen meinen Beinen. Dasselbe Stechen der Glückseligkeit, das ich nachts fühlte, wenn ich halb wach und halb schlafend ins Bett pinkelte; die Freude der Erlösung, die so lange andauern konnte, bis ich den nassen Fleck wahrnahm.
Als die Sanitäter die Geschichte aufdröselten, sagte einer zum anderen: »Auf der Fontanelle aufgetroffen.«
»Das erklärt die Blutung.« Sein Partner nickte.
Bei drei hievten sie Elgar auf die Trage. Einer von ihnen sagte, Elgar habe Glück gehabt, dass seine Fontanelle nicht so weich war wie die eines Babys, sonst wäre die Verletzung viel ernster gewesen. Elgars Augen waren offen, doch er sagte nichts. Der erste Sanitäter schüttelte den Kopf.
»Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es so glimpflich verläuft, wenn eine Fontanelle getroffen wird?«
»Eins zu einer Million.«
»Noch nicht mal.«
Als ich sah, wie Mrs. Davenport die Sanitäter anflehte, sie im Krankenwagen mitzunehmen, wusste ich, dass meine Eltern mich verprügeln würden. Doch sie verprügelten mich nicht. Sie waren zu benommen, ihre Arme waren zu schlaff und unbrauchbar, um etwas so Schweres wie einen Gürtel zu heben. Nicht nur, dass ich nicht verprügelt wurde, meine Eltern bestraften mich nicht einmal. Am nächsten Tag waren sie immer noch erschüttert, und doch stritten sie, wie sie mir Elgars Verletzung erklären sollten.
Mein Vater, der Latein konnte und Führungskräften von Unternehmen das Schnelllesen beigebracht hatte, um während seiner Promotion Geld zu verdienen, sprach mit mir, als wäre ich eine seiner Doktorand:innen.
»Es ist eine Lücke im Schädel, wo die Verknöcherung noch nicht abgeschlossen ist, Frankie, und die natürlichen Nähte noch nicht ausgebildet sind.«
»Die empfindlichste Stelle des Babys«, sagte Mom mit einem Seufzen.
»Gugugaga zu reden wird sein Vokabular nicht verbessern, Ida-Lorraine.« Vater legte die Stirn kraus.
Sie sagte, wir müssten zusammen bei den Davenports vorbeischauen. Doch bevor wir das taten, wollte sie, dass ich ihnen noch einmal erzählte, was sich zugetragen hatte. Sie saßen nebeneinander auf dem Sofa im Wohnzimmer. Ich stand vor ihnen und erzählte ihnen alles ein weiteres Mal. Wie Elgar an der Berliner Mauer geschnappt wurde. Wie Elgar die Regeln gebrochen hatte, als er das Wachhaus verließ. Wie ich nach unten griff und die Spülmittelflasche am Hals zu fassen bekam.
»Und ich warf sie. Nicht auf ihn, Mom. Ich habe sie einfach geworfen.«
Mein Vater hatte vor einigen Jahren mit dem Zigarettenrauchen aufgehört. Nun versuchte er, auch noch von der Pfeife wegzukommen. Sie war nicht angezündet. Mit geschlossenem Mund nagte er sanft an ihrem Stiel. Als wäre ich eines der Kinder in der Psychiatrie, die er einst geleitet hatte, sah er mich mit einer Mischung aus Bewunderung und Entsetzen an.
»Zwanzig Meter oder mehr, und du hast seine Fontanelle angeknackst.« Dad musste fast lächeln. Seine Stimme klang merkwürdig, als spräche er über jemanden, der einen Leichtathletikrekord gebrochen hatte.
Ich schaute zu meiner Mutter. »Ich hab das nicht gewollt, Mom.« Dann schluchzte ich.
Sie umarmte mich. »Ich weiß. Ich weiß«, sagte sie. »Du bist ein guter Junge. Ich weiß, wie schlecht du dich gefühlt hast.«
Durch ihre Worte war ich daran erinnert, dass meine ersten Gefühle nichts von Reue besessen hatten. Doch wie konnte ich ihr das sagen und trotzdem ein »guter Junge« bleiben?
Mom machte einen Auflauf mit extra Hackfleisch und extra Käse.
Ich sagte ihr: »Mrs. Davenport macht kein schweres Essen.« Ich sagte es dreimal; und jedes Mal sagte Mom: »Es ist der Gedanke, der zählt.« Mom sagte diese Worte, ohne mich dabei anzusehen. Rückblickend frage ich mich, ob der »Gedanke, der zählt«, mehr mit meinem Verhör durch Mrs. Davenport und weniger mit dem Angriff auf ihren Sohn zu tun hatte, oder ob beides untrennbar miteinander verbunden war. Anstatt dich durch die Woche zu prügeln, habe ich dir ein Essen zubereitet, das dir im Hals stecken bleiben kann. Bon appétit!
Mom und ich gingen den Hügel hinunter zu den Davenports. Elgar war immer noch zur Beobachtung im Krankenhaus, doch Mrs. Davenport sagte, es gehe ihm gut. Ich sagte Mr. und Mrs. Davenport, wie leid es mir tue, was die Wahrheit war. Allerdings gab es noch eine andere Wahrheit, die nicht ausgesprochen werden konnte, nicht einmal meinen Eltern gegenüber. Wohin, fragte ich mich, würde es führen, dieses Duell im Herzensinnern zwischen Bedauern und Begehren?
4
Das darauffolgende Jahr 1968 überlebte ich durch Zitate von Filmstars, Spionageromanen und ab Ende August mit Zitaten des Großen Vorsitzenden Mao. Wie ein Mönch seine Perlen aus Malachit umklammerte ich die Worte anderer. Doch während meines unbeholfenen Taumels durch die weiße Grundschule – war es da Stevenson oder Poe oder irgendein anderer Wein-und-Revolver-Schreiber, den ich auswendig gelernt und mit nach Hause zu meiner Mutter gebracht hatte?
»›Bevor ein Mann stirbt, muss er ein Buch schreiben, eine Frau lieben und einen Mann töten.‹«
Sie beäugte mich, als wäre ich ein Paket, das fürs Nachbarhaus bestimmt war. Sie fragte: »Meinst du: ›Was bedeutet das‹?«
»Nein. Ich meine, ist das wahr?« Wir waren allein. Die Fenster im Wohnzimmer waren geöffnet. Die Vorhänge schüttelten sich ganz sanft und weigerten sich zu sagen, warum sie sich abgewendet hatte.
Im Jahr 1968 zerbrach etwas in mir. Ich lag immer noch im Dunkeln auf dem Boden des Wohnzimmers und hörte Musik wie im Sommer davor, als ich elf Jahre alt war. Doch die gregorianischen Gesänge waren durch die Musik und die Stimme von Curtis Mayfield ersetzt worden, die mich drängten, ein »winner« zu sein, ein Gewinner der guten schwarzen Erde, »the good black earth«. Als ich Curtis Mayfield zum ersten Mal singen hörte: »No more tears do we cry / And we have finally dried our eyes«, kamen mir die Tränen. Ich dachte, wenn ich lange und aufmerksam genug zuhörte, würde Curtis Mayfields Stimme klar und fest durch die Nadel des Phonographen hervordrängen und mich vor einer Hölle bewahren, von der die Leute sagten, ich sei gesegnet, sie bewohnen zu dürfen. (»Es gibt Jungs im Getto, die es nicht so gut haben.«)
Als das Jahr begann, belagerte die Tet-Offensive unser Wohnzimmer. Kurz vor Mitternacht knisterte der Raum mit weißem Rauschen, wenn meine Eltern, im Glauben, sie seien allein, an der Stereoanlage drehten und nach einem Radiosignal suchten. Manchmal versteckte ich mich auf der Vordertreppe und versuchte, durch die Sprossen der Brüstung einen Blick auf sie zu erhaschen. Häufig saßen sie auf dem Boden; ich konnte ihre ausgestreckten Beine sehen. Ich wagte es nicht, weiter als bis zum ersten Treppenabsatz zu gehen, aus Angst, entdeckt zu werden, und auf dem ersten Absatz war ich nahe genug, um das Radio hören zu können und auf den Namen meines Onkels unter der Liste der Gefallenen zu warten.
Die Musik endete. Der Moderator kündigte an, dass die Sendezeit bald enden würde; doch zuerst das nächtliche Bulletin aus Vietnam.
»Ein mechanisierter Infanteriekonvoi der Zweiten Brigade, Vierte Infanteriedivision der USA, wurde zwei Meilen nordwestlich von Plei Mrong in der Provinz Kon Tum in einen Hinterhalt gelockt. Sicherheitsleute des Konvois erwiderten das feindliche Feuer, während Hubschrauber der Armee und Artillerie den Angriff unterstützten. Ein UH-1-Hubschrauber wurde von Bodenfeuer getroffen und stürzte über feindlichem Gebiet ab, wobei alle fünf Insassen verwundet wurden.«
Dann folgte die Liste der Namen. An diesem Punkt verstummte das Klingeln der Eiswürfel in der Cola meiner Mutter. Die Knochen meines Vaters dorrten in meinen Knochen. Sie rührten sich nicht. Sie schienen nicht zu atmen. Alles, was am Leben war, war das Radio.
»Dienstag, der 29. August.« Der Sprecher hielt inne. Nahm er einen Schluck Wasser? Ruhte seine rechte Hand auf dem Mikrofon, während seine linke Hand ein Husten kaschierte? »In dieser Woche haben 242 Soldaten im Kampf ihr Leben verloren. Wie jeden Abend beschließen wir diese Sendung mit den Namen derer, die heute gefallen sind, gefolgt von einer Auswahl der Nachrichten, die unsere Zuhörer auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen haben. Die Ansichten und Meinungen spiegeln weder die Ansichten und Meinungen des Managements von WGBH noch die Ansichten und Meinungen der Radiosender wider, die diese Sendung ausstrahlen.
Specialist William C. Gearing, 22, East Lansing, Michigan.
Lance Corporal Joseph L. Rhodes, 22, Memphis, Tennessee.
Captain Michael C. Volheim, 20, Hayward, Kalifornien.
Private First Class Craig E. Yates, 18, Sparta, Michigan.
Private First Class Ramon L. Vazquez, 21, Puerto Nuevo, Puerto Rico.
Private First Class Calvin R. Patrick, 18, Houston, Texas.«
Nachdem der Sprecher die Namen verlesen hatte, fuhr seine Stimme auf ihre schlafliedleise Art fort, als würde er die toten Soldaten in den Schlaf sprechen.
»Nun«, sagte er beruhigend, »folgt eine Auswahl Ihrer Stimmen von unserem Muttersender.«
Ein leises Pfeifen ertönte, als er einen Knopf betätigte, um die Nachrichten vom Anrufbeantworter des Senders abzuspielen.
Eine Frau mit dem nasalen Dialekt einer Kohlenstadt dankte dem Sender dafür, dass er ihr zwei Tage, bevor die Marines an ihre Tür klopften, vom Tod ihres Sohnes berichtet hatte. Auf diese Weise brach sie nicht zusammen, als sie vor ihrer Tür standen. Zusammengebrochen war sie bereits, als sie allein war. Ihre Nachbarin am Ende der Straße war auf ihrer Veranda vor den Füßen dieser beiden Marines zusammengebrochen.
»Es ist eine Schande«, sagte sie, »dass sie einen nicht festhalten oder vom Boden aufheben dürfen. Danke, dass Sie mir diese Demütigung erspart haben.«
Ein Mann aus Tulia in Texas forderte den Radiosender auf, die Namen nicht mehr in der Sendung vorzulesen. »Sie unterstützen damit die Antikriegsdemonstranten, die Verräter dieser Nation sind.«
Vor zwei Nächten sagte ein Mädchen aus Seattle, sie habe den Namen von jemandem gehört, der im vergangenen Jahr seinen Abschluss an ihrer Highschool gemacht habe. »Er hat damals den alles entscheidenden Touchdown erzielt, und wir haben das Homecoming-Spiel gewonnen. Wir sind der Meinung, wir sollten die Homecoming-Parade in diesem Jahr absagen und stattdessen eine Mahnwache bei Kerzenlicht abhalten. Bitte beraten Sie uns.«
Eine Frau aus Ohio sagte: »Ich bin eine weiße Frau, aber ich frage mich immer, wie viele Schwarze Jungs unter den Namen sind, die Sie jeden Abend vorlesen. Wofür sind sie gestorben? Für Hütten aus Teerpappe, Unterernährung, Erniedrigung und Arbeitslosigkeit? Bitte, kann mir das jemand beantworten?«
Ich hörte das Klackern von Eiswürfeln, als meine Mutter es wagte, wieder an ihrer Cola zu nippen. »Dein Bruder ist am Leben«, sagte sie leise.
Mein Vater sagte: »Ja, ein weiterer Tag Leben.«
Ich hörte, wie sie zusammen das Vaterunser beteten, und ich wusste, dass sie auf Knien waren.
Einer von Vaters Schülern war nach Kanada geflohen, um der Einberufung zu entkommen. Die Kanadier hatten ihn aufgenommen, ohne Fragen zu stellen. Ich fragte mich, ob sie mich aufnehmen würden, ohne Fragen zu stellen, wenn ich vor meinem eigenen Krieg in Kenwood fliehen würde.
Im April wurde ich zwölf Jahre alt, am selben Tag, an dem der Kongress den Fair Housing Act verabschiedete, und sieben Tage nach der Ermordung von Martin Luther King. Ich verfolgte die Unruhen im Fernsehen mit meiner Großmutter zusammen, einer Katholikin aus New Orleans, die eine zweite Klasse unterrichtet und zeitweise mit der Preservation Hall Jazz Band Klavier gespielt hatte. Großmutter Jules liebte jede Art von Sport. Ihr Ehemann »2-2 Jules« (benannt nach seiner Fähigkeit, jedes Mal einen Schlagmann rauszuschlagen, wenn es zwei Bälle und zwei Strikes sein mussten) hatte eine Einladung in die Negro National League abgelehnt und arbeitete anschließend bei der Eisenbahn als Portier und dann, nach Beginn der Großen Depression, als Gipser. Wenn Großmutter Jules in den Norden kam, um uns zu besuchen, verbrachte sie mit mir und meinem Vater viel Zeit damit, Baseball-, Football- und Basketballspiele anzuschauen, anstatt mit meiner Mutter, ihrer Tochter, auch nur ein einziges Mal auf Antiquitätenjagd zu gehen. Sie liebte eingelegte Schweinefüße und ein Bier namens Hamm’s, das auf der anderen Seite des Flusses in St. Paul gebraut wurde.
Der Mord an Martin Luther King und die Tet-Offensive veränderten das Verhältnis meiner Familie zum Radio und zum Fernsehen. Meine Eltern lauschten auf den Namen meines Onkels in den nächtlichen Sendungen über die Todesopfer. Meine Großmutter und ich sahen uns die Unruhen an.
Eines Abends schossen ihre Füße vom Sessel hoch und traten beinahe ihr Bier und ihre Schweinefüße vom Klapptisch. Als ich den Tisch festhielt, lachte sie, wie ich sie noch nie zuvor hatte lachen sehen.
»Na, mach schon, mein Junge!«, rief sie.
Ich hatte sie das schon häufiger sagen hören, wann immer Tony Oliva einen Base-Hit machte oder Gale Sayers zum Touchdown anlief. Doch weder Oliva noch Sayers waren jetzt auf dem Bildschirm zu sehen. Ich war von ihrer Freude angesteckt worden und musste ebenfalls laut auflachen. In meiner Brust löste sich ein Knoten, ein Phantomtumor, der seit der ersten Klasse in mir hing. Wir sahen uns die Unruhen an, und meine Großmutter lachte meinen Schmerz davon. Wenn ich gesagt hätte, dass ich in den letzten sechs Jahren die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler sowie die Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer an meiner Schule zutiefst gehasst hatte, hätte ich gelogen; so einfach war es nicht. Allerdings wäre es richtig zu sagen, dass ich mich in ihrer Gegenwart niemals wohlgefühlt hatte; und da ihre Gesichter bei mir waren, selbst wenn ich nicht bei ihnen war, wäre es auch richtig zu sagen, dass ich mich selten, wenn überhaupt, wohlfühlte.
»Na, mach schon, mein Junge!«
Sie sprach nicht mit mir, sondern mit dem Mann auf dem Bildschirm; doch in diesem Moment verschmolzen wir mit diesem Mann auf dem Bildschirm. Und ich fühlte mich geliebt.
Ich wünschte, ich könnte sagen, die Stadt auf der Leinwand war Cleveland, doch es hätte auch Detroit, D. C., Cincinnati, Chicago, Kansas City, Baltimore, Pittsburgh, Trenton, New Jersey oder Wilmington in Delaware sein können. Es hätte allerorts und überall sein können. Es waren keine Brände zu sehen, doch der Rauch bauschte sich über zerstörten Gebäuden. Bremsspuren vernarbten die Straße, wo ein Mann ohne Hemd und mit einem Kopftuch, das um seine Conk-Frisur geschlungen war, einen Einkaufswagen den Boulevard entlangdonnerte. Großmutter Jules lachte, als krachte ihre Brust von Kohlensäure. Ich verstand sofort, dass das Priestertum für mich dahin war. Ich wollte zu einem Plünderer heranwachsen und meine Grandma stolz machen.
Unser Krach rüttelte die gigantischen Spielverderber wach, denen das Haus gehörte. Meine Mutter kam nach unten und sagte ihrer Mutter, sie solle so etwas nicht sagen. Ich sah meine Mutter als Silhouette, das Licht aus dem Esszimmer stand in ihrem Rücken, sie war von den französischen Schiebetüren des Wohnzimmers gerahmt. Sie war anmutig, selbst wenn sie stillstand. Sie und Vater modelten in Modenschauen, die veranstaltet wurden von der Boulé und der Links, zwei der Schwarzen bürgerlichen Gruppen, denen meine Eltern angehörten. Der ganze Raum fiel in Schweigen, wenn die beiden den Laufsteg entlangstolzierten. Moms Freundinnen sagten, sie sehe aus wie Donyale Luna, die 1966 die Welt im Sturm erobert hatte, als sie zur ersten Schwarzen Frau wurde, die das Cover der Vogue zierte. Und ich mühte mich ab, zu verstehen, wie das Blut in der hellen Haut und dem schlanken Körper meiner Mutter dasselbe Blut sein konnte, das durch meine Großmutter floss, die klein und dunkel war wie der aus einem Halsknochen gesogene Saft, und die auf dem Dämpferpedal herumstampfte, wenn sie Klavier spielte. Im Alter von 36 Jahren stand meine Mutter auf der Schwelle, eingerahmt von ihrem Vorwurf, und sprach mit ihrer 63-jährigen Mutter, als wären ihre Lebensalter umgekehrt. Meine Großmutter und ich sahen sie an wie zwei Kinder, die beim Schabernack erwischt worden waren. »Sag das nicht, Mutter. Als Nächstes sagt er so was in der Schule. Er ist schon eigenwillig genug.«
Als wir uns wieder dem Fernseher zuwandten, war der Mann mit dem der Conk-Frisur, dem Kopftuch und dem Einkaufswagen verschwunden. Mom ging nach oben, und wir machten weiter unsere Mätzchen.
»Warum sind wir verrückt vor Wut?«, fragte ich meine Großmutter, während wir die Rauchfahnen ansahen, die von den Flachdächern emporstiegen.
»Weil wir keinen Job ham?«, sagte ich mit einem Kichern und schaute vorsichtig auf die französischen Türen, ob dort meine Mutter stünde, um mich für mein ham zurechtzuweisen.
»Nein«, antwortete Großmutter, »es geht nicht um Jobs.«
»Weil wir kein warmes Wasser ham?«
»Es geht nicht um Wasser, Kind.«
»Weil wir im Getto leben.«
»Frankie, du bist nicht im Getto«, sagte sie leise lachend, »und du bist verrückt.« (Woher sie das wusste, war mir ein Rätsel, denn ich kann mich nicht erinnern, ihr jemals erzählt zu haben, was in der Schule vor sich ging).
Dann sagten wir auf drei: »Wir sind wütend auf die Welt!« Oben auf der Treppe hörten wir: »Mutter, bitte!«
Es wäre zu weit hergeholt zu sagen, dass meine Großmutter eine Afropessimistin war. Doch Afropessimismus ist keine Kirche, in der man betet, und auch keine Partei, die man wählt oder abwählt. Afropessimismus sind Schwarze in ihrem bestmöglichen Zustand. »Wütend auf die Welt«, das sind Schwarze in ihrem bestmöglichen Zustand. Afropessimismus gibt uns die Freiheit, laut auszusprechen, was wir sonst flüstern oder leugnen würden: dass keine Schwarzen in der Welt leben, dass es aber ebenso wenig eine Welt ohne Schwarze gibt. Die Gewalt, die gegen uns verübt wird, ist keine Form von Diskriminierung; sie ist eine notwendige Gewalt; ein Stärkungsmittel für alle, die nicht Schwarz sind; eine Ansammlung von sadistischen Ritualen und von sadistischer Gefangenschaft, die nur dann über all jene Menschen, die keine Schwarzen sind, kommen könnte, wenn sie dieses oder jenes »Gesetz« brächen. Diese Art von Gewalt kann einem empfindungsfähigen Wesen unter zwei Umständen widerfahren: Eine Person hat das Gesetz gebrochen und ist also angesichts der geltenden Regeln aus der Reihe getanzt; oder die Person ist ein Sklave, und es sind keinerlei Vorbedingungen erforderlich, damit sich ein Akt der Brutalität vollziehen kann. Es gibt keinen Antagonismus wie den Antagonismus zwischen Schwarzen und der Welt. Dieser Antagonismus ist der Kern dessen, was Orlando Patterson als »sozialen Tod« bezeichnet, in den Worten von David Marriott: deathliness,12 eine Tödlichkeit, eine Todhaftigkeit. Es ist das Wissen und die Erfahrung alltäglicher Ereignisse, in denen die Welt dir sagt, dass du gebraucht wirst als Ziel ihrer Aggressivität und ihrer Erneuerung.
Der Antagonismus zwischen dem postkolonialen Subjekt und dem Siedler (Sand-Creek-Massaker oder palästinensische Nakba) kann – und sollte – nicht mit der Gewalt des sozialen Todes analogisiert werden: mit der Gewalt der Sklaverei, die 1865 nicht endete, aus dem einfachen Grund, weil die Sklaverei 1865 nicht endete. Sklaverei ist eine relationale Dynamik – kein Ereignis und schon gar kein Ort im Raum wie der Süden; genau wie der Kolonialismus eine relationale Dynamik ist – und diese relationale Dynamik kann fortbestehen, auch wenn der Siedler die Regierungsmacht zurückgelassen oder abgetreten hat. Und beide Beziehungen werden durch radikal unterschiedene Gewaltstrukturen gesichert. Der Afropessimismus bietet eine analytische Linse, die als Korrektiv zur logischen Vorannahme des Humanismus wirkt. Er stellt einen theoretischen Apparat zur Verfügung, der es Schwarzen erlaubt, nicht durch die List der Analogie belastet zu werden, denn Analogie mystifiziert das Leiden der Schwarzen, anstatt es zu klären. Die Analogie mystifiziert die Beziehung der Schwarzen zu anderen People of Color. Der Afropessimismus bemüht sich, diese Mystifizierung aufzulösen – ohne Furcht vor den Klüften und Rissen, die sich während dieses Prozesses ergeben.
Großmutter Jules würde sich im Grabe herumdrehen, wenn sie wüsste, dass ich sie für eine Afropessimistin halte. Sie war eine Katholikin, die keine Beichte ausließ. Als sie jedoch in den Ruhestand ging, wurde ihre Sprache von der List der Analogie befreit, was bedeutete, dass sie getrost sagen konnte, wir seien nicht aus den Gründen wütend, aus denen es Menschen waren, die unter Klassenunterdrückung, Geschlechterdiskriminierung oder Kolonialherrschaft litten. Ihre Wut hatte Erdungsdrähte tief im Inneren der Welt. Wir waren diese Erdungsdrähte der Welt. Wir waren die Zielscheibe von Wut, die sich sonst gegen sich selbst richten müsste. Schwarze Menschen waren der lebendige, atmende Widerspruch des Lebens an sich. Und insofern wir zu alt (wie Großmutter Jules) oder zu jung (wie ich) waren, um zu wissen, was meine Mutter wusste, wiesen wir die List der Analogie zurück und ließen unsere Wut ihre Wahrheit sprechen: Für seine Existenz und für seinen Zusammenhalt ist das Leben der Menschheit vom Tod der Schwarzen abhängig. Blackness und slaveness, das Schwarzsein und das Sklavesein, die »Sklavigkeit«, sind derartig untrennbar miteinander verschlungen, dass Sklavesein zwar von Schwarzsein getrennt werden kann, Schwarzsein aber niemals als etwas anderes existieren kann denn als Sklavesein. Es gibt keine Welt ohne Schwarze, und doch gibt es keine Schwarzen, die in der Welt sind. Du musstest sehr jung oder sehr alt sein, damit diese Eucharistie deine Lippen berühren konnte.
Ein Schisma keilte sich bald zwischen mich und meine Eltern. Ich hatte mehr Verachtung als Mitleid für sie übrig. Meine Mutter war gerade dabei, ihre Doktorarbeit abzuschließen, und irgendwann während dieser Zeit arbeitete sie als Verwaltungsangestellte für die öffentlichen Schulen von Minneapolis. Mein Vater war Professor und stellvertretender Dekan an der Universität von Minnesota. Sie arbeiteten als Psychologin und Psychologe, die neben ihren wissenschaftlichen Tätigkeiten tagsüber eine private Praxis führten; und sie stürzten sich in Martin Luther Kings Traum von der Rassengleichheit und in Lyndon Johnsons Traum von der »Great Society«, der Großen Gesellschaft. Dies bedeutete, dass sie ihre Fähigkeiten als Stipendienschreibende an Basisinitiativen verliehen und unendlich viele soziale und politische Versammlungen in unserem großen Wohnzimmer veranstalteten, wo ein Flickenteppich von Menschen zusammenkam, die sich sonst vielleicht nie getroffen hätten (Universitätsverwalter, liberale Geschäftsleute, Stadtplanerinnen, Aktivistinnen und Studierende), um in der Black Community Berufsausbildungszentren, Outreach-Programme für Native Americans sowie Programme für die psychologische Behandlung mittelloser Menschen ins Leben zu rufen.
Im Jahr 1968, dem Jahr der Verabschiedung des Fair Housing Act, marschierten meine Eltern in Kenwood von Tür zu Tür und verteilten Flugblätter, in denen das Gesetz so erklärt wurde, dass es, wie meine Eltern hofften, keine Bedrohung darstellte und dieselben Leute, die so hart daran gearbeitet hatten, meine Eltern aus Kenwood fernzuhalten, dazu ermutigt wurden, ein oder zwei weitere Schwarze Familien in die Gemeinde aufzunehmen. Meine Eltern veranstalteten mehrere Workshops über faires Wohnen in den Häusern wohlhabender Kenwoodianer und baten sie, die hölzernen Pflöcke mit Schildern für FAIR HOUSING in ihren Rasen zu treiben. Bald wurde klar, dass sich diese Workshops aus weißen Frauen zusammensetzte, deren Ehemänner im Büro waren. Die Hausfrauen liebten meinen Vater und tolerierten meine Mutter, auch wenn sie beide wunderschön waren. Dad war über zwei Meter groß. In Marmorfoyers zog er seinen langen Ledermantel aus, unter dem er Manschettenhemden und Anzüge trug, die wie maßgeschneidert aussahen. Er schaute ihnen in die Augen, während er sprach, und sie lächelten ihn an und nickten wie Bettelfrauen. Als meine Mutter an der Reihe war zu sprechen, flaute die Aufmerksamkeit der Frauen ab, und das Geklimper von Mokkatassen und Untersetzern salzte die Luft.
Mutter hatte versucht, sich die Zeiten, so gut es ging, zu eigen zu machen. Zu diesem Zweck hatte sie sich eine Afro-Perücke gekauft und trug sie nun auch. Am Ende jedes Workshops war es Zeit für die große Frage: »Wie viele von Ihnen möchten die Schilder für FAIR HOUSING, die wir im Auto haben, mitnehmen und auf ihrem Rasen platzieren?« Eine Frau hob die Hand. Um das Thema zu umgehen, fragte sie meinen Vater, ob er jemals als Model gearbeitet habe. Falls nicht, fuhr sie fort, kenne sie einen Mann, der einen Mann kenne, der eine Agentur leite.
Mit einem gepressten Lächeln versuchte Mom, das Gespräch wieder aufs faire Wohnen zu lenken. Eine andere Frau hob die Hand, um zuzustimmen, dass Papa ein so hübsches Model abgäbe. Dann schoss eine weitere Hand hoch, und noch eine weitere Frau fügte hinzu, auch wenn sie ja liebend gerne eines der Schilder auf ihrem Rasen aufstellen würde, so wäre ihr Mann sicher dagegen. Mom verließ das Zimmer. Den Model-Vorschlag umgehend, sagte Dad, dass er und Mom gerne für ein Einzelgespräch nach Hause kommen und mit den Ehemännern sprechen könnten. Mom beobachtete sie vom Foyer aus, wo sie auf der untersten Treppenstufe saß. Sie streifte die Perücke von ihrem Kopf ab und legte sie neben sich auf die Stufe.
5
Das Jahr 1968 war auch das Jahr, in dem das American Indian Movement in South Minneapolis gegründet wurde, drei Meilen entfernt von Kenwood.
Über Nacht wurden Fragen der Souveränität der Native Americans und die Forderungen des American Indian Movement zum Teil des Campuslebens an der University of Minnesota. Dad leitete ein Programm in einem Reservat einige Meilen außerhalb der Stadt; es war ein gemeinsames Projekt mit der Stammesregierung. Die Vorstandssitzungen wurden mit städtischen Native Americans, Stammesführern aus dem Reservat und meinem Dad in South Minneapolis abgehalten. Wie bei den Workshops über faires Wohnen durfte ich meine Eltern zu diesen Treffen begleiten. Sofort wurde deutlich, dass die Menschen im Reservat einige der Anforderungen der Universität von Minnesota, die das Projekt finanzierte, nicht erbringen wollten. Aus politischer Sicht hielt ich die institutionellen Interessen meines Vaters für falsch und die Interessen der indigenen Völker für richtig. Ich war der Meinung, die Universität solle ihre Ressourcen den Native Americans zur Verfügung stellen, ohne darauf zu beharren, dass sie Rechenschaft darüber ablegten, wozu sie das Geld verwendeten.
Der Raum war brechend voll. Alle 20 Plätze an dem großen Konferenztisch waren besetzt. Weitere 15 bis 20 der Native Americans standen an der Wand oder saßen auf den breiten Fensterbänken. Spöttische Bemerkungen und Beleidigungen wurden meinem Vater entgegengeschleudert, wenn er zu sprechen versuchte, doch er spöttelte nicht ein einziges Mal zurück. Der Raum war aufgeladen mit Affekten – eine Stimmung, die mehr damit zu tun hatte, dass mein Vater ein Schwarzer war, als damit, dass er ein Vertreter der Universität war. Irgendwann taumelte ein Ureinwohner, mit dem ich mir einen Fensterbanksitz teilte, auf meinen Vater zu.
»Wir wollen nicht, dass uns ein Nigger-Mann wie du sagt, was wir zu tun haben!« Aus den gedrängten Gruppen an den Wänden explodierte der Applaus.
Was ich damals nicht verstehen konnte und auch nicht verstehen wollte, war, dass die wohlhabenden weißen Hausfrauen in den Workshops für faires Wohnen den gleichen psychischen Raum bevölkerten wie die Native Americans in den unterversorgten Vierteln von South Minneapolis, und dass, obwohl die Frauen, die an den Workshops meiner Eltern teilnahmen, in einem Stadtteil lebten, der von den Straßen, denen das American Indian Movement entwachsen war, so weit entfernt waren wie Atlantis vom Mars. Der Mythos von »Manifest Destiny«, der göttlich verfügten Verbreitung weißer amerikanischer Ideologie und somit der Erschließung des indigenen Landes, dieser Mythos, an den jene weißen Frauen von Kindheit an gewöhnt worden waren, war ganz gewiss untrennbar mit der Beinahe-Auslöschung des Lebens der Ureinwohnerinnen und Ureinwohner verbunden. Es wäre falsch zu sagen, dass die weißen Frauen von Kenwood und der indigene Mann, der auf dem Fensterbrett neben mir saß und meinen Vater »Nigger« nannte, derselben Kirche huldigten. Doch in letzter Instanz wurden ihre beiden Welten von dem Bedürfnis getragen, sich von ein und derselben fremden Verkörperung zu unterscheiden. In den plüschigen Salons von Kenwood nährten die Frauen ihre Negrophilie am Fleisch meines Vaters, während sie meine Mutter verdrängten. In der Versammlungshalle hatten die Native Americans keine Verwendung für meine Eltern: Egal, ob wir weiß und reich sind oder Rot und arm, wir wollen nicht, dass ein Nigger uns sagt, was wir zu tun haben. Die weißen Frauen drückten ihre Weigerung, von Blackness autorisiert zu werden, durch ihre unbewusste Negrophilie aus (»Haben Sie jemals als Model gearbeitet, Professor Wilderson?«), und diese war verbunden mit der Notwendigkeit, meine Mutter aus der Szene in ihrer Fantasie zu tilgen. Die Native Americans drückten ihre Weigerung durch ihre unbewusste Negrophobie aus (»Wir wollen nicht, dass uns ein Nigger-Mann wie du sagt, was wir zu tun haben!«). Sowohl die Kraft des weißen als auch des indigenen Affekts sprach aus derselben Kehle, im Chor der libidinösen Ökonomie. Im kollektiven Unbewussten der indigenen Imagination stellte das Gespenst von Blackness eine größere Bedrohung dar als die Siedlerinstitution, die einen Schwarzen Professor zur Erledigung ihrer Drecksarbeit bestellt hatte.
Mein Vater sah vom Tisch auf. Er hielt Augenkontakt zu dem Native American, der neben mir saß, während der Raum in seinen Ohren donnerte, doch zeigte er keine Wut; und Schmerz erschien in seinen Augen erst, nachdem sein Blick den meinen traf und in meinen Augen eine Billigung jener lag, die ihn verspotteten. Ein Vater starrte in die höhnischen Augen seines Sohnes. Ich labte mich an seinem Schmerz, denn sein Ruin machte mich zum Mitglied einer Gemeinschaft. Indem ich diesen »Nigger« verhöhnte, verschmolz ich mit dem »Wir«.
Anschließend saßen mein Vater und ich für einige Minuten im Auto. Der Schlüssel steckte in der Zündung. Er sprach nicht mit mir. In der Öffentlichkeit zeigte mein Vater niemals Schmerz oder Zorn, und ich gehörte jetzt genauso zur Öffentlichkeit wie die Native Americans, die ihn aus diesem Raum vertrieben hatten. Ich konnte die Ausdehnung und das Zusammenziehen seiner Brust erkennen. Er atmete lange und gemächlich aus.
»Warum gibt man ihnen nicht einfach, was sie wollen? Es ist ihr Land. Es ist ihr Geld«, sagte ich.
Er seufzte. Er drehte den Schlüssel in der Zündung. Er legte den Gang ein. Ich war zu jung, um zu wissen, dass die Feindseligkeit gegen Blackness das Streben nach Souveränität ebenso antreibt wie den Wunsch, die Kolonialherren loszuwerden. Dad war zu benommen, um es mir zu erklären. Die Ureinwohnerinnen und Ureinwohner Amerikas sprachen als Souveräne zu einem, der nicht souverän war. Das wesentliche Problem liegt nicht in dem Wort, mit dem sie meinen Vater bezeichnet hatten, und das bedeutet auch, das wesentliche Problem liegt nicht im Ausleben ihrer feindseligen Gefühle, sondern in der Struktur einer feindseligen Beziehung zwischen Native Americans, die etwas zu retten hatten, und einer Schwarzen Person, die nichts zu verlieren hatte.
Meine Eltern trugen ihre Wut wie Fläschchen Nitroglyzerin, die in Watte gepackt waren, mit sich herum. Im Gegensatz zu mir kannten sie die Folgen der Wut von Schwarzen. Sie wussten Bescheid. Sie unterrichteten die Menschen, die niedergeschossen wurden, und die Studierenden, die nach Kanada flohen, um der Einberufung zu entgehen. Und sie wussten, dass sie selbst vom FBI beobachtet wurden. Ich, der ich nur wenig von dem Amboss wusste, der auf ihnen lastete, dachte, sie seien einfach nur Verräter:innen. Ich glaubte, sie hielten ihre Zunge im Zaum, wenn ihre weißen Kolleginnen und Kollegen rassistische Äußerungen machten, weil ihnen die Revolution, die um sie herum toste, gleichgültig war. Nachdem ich jahrelang mit ihnen im Streit gelegen hatte, änderte sich meine Sicht auf sie langsam, als ich in die Wissenschaft ging und aus erster Hand von dem getroffen wurde, was Jared Sexton bezeichnet als »die verborgene Struktur der Gewalt, die so viele Gewalttaten, ob spektakulär oder alltäglich, untermauert«.13
Verstellung war ein Überlebenswerkzeug gewesen, ein Hilfsmittel, das sie verwendeten, um weiterzuleben und Essen auf den Tisch bringen zu können. Sie wussten, dass Schwarze Intellektuelle nur so weit gehen konnten, wie ihre nicht-Schwarzen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner bereit waren, es sich gefallen zu lassen. Sie wussten auch, dass sie sich der Grenzen dessen bewusst sein mussten, was ihre weißen Kolleginnen und Gesprächspartner zu dulden bereit wären, insbesondere wenn diese Gesprächspartnerinnen und Kollegen nicht wussten, wo ihr eigenen Grenzen lagen. Meine Eltern waren genötigt, es stellvertretend für sie zu wissen. »Stelle dir den Schwarzen Mann vor, der du für den weißen Mann sein sollst […], und werde zu ihm (oder spiele vor, dass du zu ihm geworden bist)«,14 schreibt David Marriott in seiner Abhandlung über das Lynchen. »Unser Unbewusstes […] wird der Arbeit des Zweifels überlassen, der Wetten und der Gegenwetten. Hier ist kein Platz für das, was der Schwarze Mann will, und ebenso wenig für ein Schwarzes Unbewusstes, getrieben von seinen eigenen Begierden und Aggressionen.«15
Ich sah mit an, wie die Welt die Wünsche meiner Eltern einkerkerte, während ich meine Großmutter und ihre gefängnisausbrecherische Rhetorik vergötterte. Schwarzes Begehren ist ein Verbrechen wie Flucht. Amerika brauchte meine Großmutter nicht mehr für die Erziehung, für die Bestätigung oder um eine Frau zu haben, der man die Schuld daran geben konnte, dass die Nation an den Nähten auseinanderging – doch Amerika brauchte meine Mutter noch. »Ich bin eine gezeichnete Frau«, schreibt Hortense Spillers, »doch nicht jeder kennt meinen Namen. ›Peaches‹ und ›Brown Sugar‹, ›Sapphire‹ und ›Earth Mother‹, ›Aunty‹, ›Granny‹, ›God’s Holy Fool‹, eine ›Miss Ebony First‹ oder ›Black Woman at the Podium‹: Ich beschreibe einen Punkt verworrener Identitäten, einen Treffpunkt von Belangen und Entbehrungen in der nationalen Schatzkammer des rhetorischen Reichtums. Mein Land braucht mich, und wenn es mich nicht gäbe, müsste man mich erfinden.«16
Amerika war fertig mit meiner Großmutter als seiner Erfindung. Es stand ihr frei, sich zurückzulehnen und Amerika zu töten, wenn auch nur in ihren Träumen oder mit mir zusammen, während wir 1968 die Unruhen im Fernsehen verfolgten. Doch Amerika war noch nicht fertig mit meiner Mutter, einer 36-jährigen Schwarzen Frau in ihren besten Jahren. Nur drei Jahre zuvor, im Jahr 1965, hatte Daniel Moynihan die Imago meiner Mutter als Quelle einer destruktiven Ader in der »Getto-Kultur« und in der Schwarzen Familie bezeichnet.* Sie betrat einen Raum nicht als promovierte Frau, sondern als der Hauptgrund, weshalb sich Männer kastriert fühlten – als ein Hindernis, das für Amerika belastender war, als es die Anti-Blackness für den Traum des Schwarzen Mannes war, der sich nach einem fernen Horizont sehnte. Meine Freudenausbrüche beim Anblick eines Plünderers würden nur bestätigen, was die Welt bereits über sie wusste. Für Moynihan war ich ein von meiner Mutter geschaffenes Monstrum.
6
In jenem Sommer reisten wir nach Seattle. Ein Sommer für ein Sabbatical meines Vater, ein Sommer zum Forschen für meine Mutter. Nicht ein Tag verging, an dem ich nicht mürrisch war. Als an einem frischen Mittwochabend ein Bischof in den Katechismusunterricht kam und das Gewühl aus zwölf- und dreizehnjährigen Mädchen und Jungen bat, sich in dieser Woche von ihrem Taschengeld zu trennen, um es für seine Mission in Afrika zu spenden, hob ich die Hand. Wie in meinen Katechismuskursen in Minneapolis war ich das einzige Schwarze Gesicht im Raum. Schwester Mary Alvin strahlte. Der Bischof nickte in frommer Ermutigung. Ein Nicken, das mir aus sechs Jahren in einem rein weißen Gymnasium zu Hause in Minneapolis bestens bekannt war: Schauen Sie, der Negro-Bube will etwas sagen. Schauen Sie, wie höflich er seine Hand gehoben hat.
»Haben die Menschen in Afrika Sie gebeten, zu ihnen zu kommen?«, platzte ich heraus.
Der Bischof sah Schwester Mary Alvin an. Dann blickte er mich an.
»Der Heilige Geist bedarf keiner Einladung. Selbstredend muss man Buße tun und das Sakrament der Taufe empfangen.«
Ich sagte dem Bischof, dass ich meine fünfunddreißig Cent gern in ein Snickers verwandeln würde. Aber nächste Woche könnte er mein Taschengeld bekommen, wenn er in der Zwischenzeit nach Afrika fliegen und anschließend mit einem Brief der Menschen in Afrika zurückkommen würde, in dem verbürgt stand, dass sie ihn dort als Missionar bei sich haben wollten.
Die Nachricht über diese Geschehnisse war noch vor mir zu Hause, wo eine Tracht Prügel auf mich wartete.
Jedem war klar, dass ich ein überragender Sportler war, und meine Eltern müssen gedacht haben, dass die schiere Anstrengung von Football und Baseball die Verdrießlichkeit aus meinen Poren herausschwitzen müsste. Auf dem Weg zur University of Washington setzte mich meine Mom in einem Gemeindezentrum ab. Es war eher ein Jungenclub. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine jüngere Schwester dabei war, und sehe vor meinem geistigen Auge keine Mädchen, wenn sich diese Tage wieder in meiner Erinnerung einstellen. Ich vermute, dass sie und mein Vater geglaubt hatten, es müsse mir guttun, einmal Teil einer Gruppe Schwarzer Männer zu sein. Die Schwarzen Männer in meiner Nachbarschaft wollten mit mir nichts zu tun haben – eigentlich waren es Schwarze Bübchen, doch wenn man nicht gerade in einen Kiefernorthopäden verliebt war, nannte man sie lieber nicht Bübchen. Als Teil des »Jungenclubs« kam ich dem nahe, was ich nur im Fernsehen mit meiner Großmutter gesehen hatte. Ich verstand nicht nur, dass »mürrisch« nicht nur ein Persönlichkeitsdefizit von mir allein war, sondern vielmehr ein kollektives Erbe, so wie Wut und heftiges Lachen über all die Dinge, die die meisten Weißen traurig machten; in diesem »Jungenclub« hörte ich zum ersten Mal auch von den Black Panthers. Ich hörte die Vollgasrhetorik über Gedanken, die ich als wortlose Wünsche gehegt hatte, wie zum Beispiel: »I’m three seconds off a honky’s ass!« – »Ich werde mir diesen weißen Arsch jetzt gleich mal vorknöpfen!«
Als ich diese Worte zum ersten Mal im Gemeindezentrum in Seattle hörte, musste ich laut auflachen. Wie konnte ein Wort so viel Freude bereiten? Honky als Wort für einen Weißen! Es amüsierte mich tagelang. I’m three seconds off a honky’s ass! Ich wusste, dass es meine Eltern nicht amüsieren würde, wenn sie es von meinen Lippen hörten. Dass ich mir einen weißen Arsch vorknöpfen werde, war nicht, was sie im Sinn hatten, als sie beschlossen, dass Seattle der geeignete Ort war, um junge Schwarze Männer als Vorbilder kennenzulernen. Ich war clever genug, um zu wissen, dass mich dieser Satz für den Rest unseres Sommers in Seattle in ein weißes Gemeindezentrum verfrachten könnte. Doch ich konnte nicht anders. Nicht mehr seit dem »Na, mach schon, mein Junge!« von meiner Großmutter war ich derartig von Worten inspiriert gewesen!
Ich ging in die hinterste Ecke unseres Gartens, um all die verschiedenen Arten zu hören, wie ich diese wenigen Worte zum Singen bringen konnte. Ich sang sie tief und warm, mit der Baritonstimme von Barry White. Ich sang sie wie Aretha, die auf R-E-S-P-E-C-T bestand. Ich sang sie wie Eddie Kendricks’ Falsett, das Gläser zersingen konnte. Allein im Garten ging ich auf Konfrontationskurs mit dem Honky-Tree und ließ ihn wissen: »Groß heißt nicht gemein. Ich werd mir deinen weißen Arsch gleich mal vorknöpfen, du honky!«
Mom kam auf die Veranda zum Garten. Ich weiß nicht, wie lange sie dort schon gestanden hatte. Alles, was sie hörte, war das Geräusch meines Lachens. Alles, was sie sah, war, dass ich mit einem Baum redete. Mit ihrer Therapeutinnenstimme fragte sie mich, ob es mir gut gehe. Ja klar, alles bestens, sagte ich. (Will dem Honky-Bäumchen hier nur ma’ bisschen die Rinde vom Leib ziehen, sonst nix.) Und ich musste mich zusammenreißen, dass mein Bauch nicht vor Lachen platzte. Schön, dich lächeln zu sehen, mein Sohn, rief sie mir zu, bevor sie wieder ins Haus ging.
Es gab auch einen »Honky«, der kein Baum war. Er leitete das größtenteils von Schwarzen besuchte Gemeindezentrum in Seattle. Sein Name war Reg, doch wir nannten ihn nur selten beim Namen (außer, wenn wir mit ihm sprachen), was ja Sinn machte, da wir nicht mit seinem Namen sprachen. Reg hatte die Aura eines kräftigen, aber durchtrainierten und bärtigen Polizisten, den ich mehrere Male sah, als ich später in Südafrika lebte; ein Mann, der in die Schwarzen Spelunken, die sogenannten Shebeens, in Soweto ging und den Menschen dort Bier spendierte. Er hatte einige von ihnen gefoltert, und als es vorbei war, hatte er sie dazu gebracht, das Fleisch auf dem Barbecue-Grill zu wenden. Er setzte sich mit ihnen an den Picknicktisch, um ihnen zu zeigen, dass sie die Art und Weise, wie er sie gefoltert hatte, nicht persönlich nehmen brauchten. Reg schob sein Kinn hervor, wenn er sprach, entweder um die Jüngeren wie mich zu loben, oder um die Älteren zu warnen. Ob bewegt oder ruhend, immer schossen kurze, instinktive Atemzüge zwischen seine Worte. Er eilte vom Spielplatz über den Parkplatz und durch die Turnhalle, mit der Kaltblütigkeit eines Mannes, der regiert.
Auf dem Parkplatz unter einem regenlosen Himmel kam es zu einer Auseinandersetzung. Ich befand mich im Gemeindezentrum und spielte Völkerball, als jemand schrie: »Jetzt geht der Scheiß los!« Was war der Scheiß und warum ging er los? Jeder, der zur Tür lief, schien es zu wissen. Nur ich hatte nicht die leiseste Ahnung. Ich kannte – jeder kannte – die verschwommenen Umrisse dessen, was passiert war. Die ganze Welt des Gemeindezentrums drehte sich um die Regeln von Reg. Reg entschied, wer die Basketbälle nutzen durfte und wer nicht. Reg entschied über die wöchentlichen Aktivitäten. Reg notierte sich in seinem Buch einen Strafpunkt neben deinem Namen, wenn du aus der Reihe tanztest oder auch nur zu laut sprachst. Drei Strafpunkte, und du bekamst eine Woche lang Gemeindezentrumsverbot. Reg hatte Luke, einem siebenjährigen Jungen, seinen dritten Strafpunkt verpasst. Reg wies Luke an, das Grundstück zu verlassen. Das war mein Wissensstand, als ich nach draußen eilte, denn die beiden waren noch drinnen gewesen, als Reg Luke seine dritte Verwarnung erteilt hatte. Luke hatte sich von Reg zum Parkplatz begleiten lassen. Dann war er allerdings stehen geblieben, als hätte er seine Meinung geändert, und sich umgedreht, um wieder zurück ins Gebäude zu gehen. Regs Hand umklammerte Lukes Ellbogen und führte ihn davon. Eine Menschentraube begann sich, um sie zu formen. Ich bahnte mir einen Weg durch den Schwarm von Halbstarken, die alle wollten, dass Luke Reg in ihrem Namen das Fell über die Ohren zog.
»Fass mich noch einmal an«, hörte ich Luke sagen.
Luke und Reg standen sich direkt gegenüber. Mit Erstaunen sah ich zu, wie Reg näherkam. Reg war ein Mann von mindestens 25 Jahren und sah wie ein Gewichtheber aus, während Luke den Körperbau eines schmächtigen Forwards in einem Highschool-Basketballteam hatte.
Reg sagte: »Die Regeln gelten für alle, selbst für mich.« Worauf Luke sagte: »Fass mich noch einmal an, okay.«
Luke steckte seine Hand in die Tasche. Regs Gesichtsausdruck deutete darauf hin, dass er haargenau wusste, was passieren würde, wenn Lukes Hand wieder hervorkäme, und wie sehr das Ergebnis nicht nur von Luke, sondern von allen anwesenden Jungen herbeigesehnt wurde. Und Reg schien zu wissen, dass sein verzweifelter Mut niedergemetzelt werden würde, wenn er nur eine einzige falsche Bewegung machte. Einen Augenblick lang starrte Reg uns an, und er kam den Tränen oder einer Entschuldigung näher, als ich es jemals bei ihm gesehen hatte.
Ich war mir bewusst, wie klein ich im Vergleich zu den anderen war, von denen die meisten richtige Teenager waren. Ich musste aufschauen, um zu sehen, wer sprach, als jemand Reg beschimpfte oder Luke sagte, er solle hinmachen. Vögel bombardierten die Sonne, als würde eine Faustvoll Pfeffer in das letzte gesunde Auge Gottes geschleudert. Luke sah aus, als kitzelte er sich mit seiner Hand von der Innenseite seiner Hosentasche am Oberschenkel. Regs Stimme brach, doch er konnte nicht aufhören, die Regeln vorzuleiern. Ich konnte das Klicken von Lukes Springmesser hören, bevor ich seinen kerzengeraden, straffen Glanz sah.
Mom scherzte immer, dass man in dem Teil von New Orleans, wo sie aufgewachsen war, wegen eines Erdnussbuttersandwichs erstochen werden konnte. Obwohl sie lachte, wenn sie es sagte, überzeugte mich das Funkeln in ihren Augen (und das »ganz genau« meines Vaters), dass sie wusste, wovon sie sprach. Allerdings hatte ich noch nie eine Messerstecherei gesehen, bei der Blut vergossen wurde. (Das Blut, das ich von Elgar Davenport vergossen hatte, war eine Folge der Windstille und der Gravitation der Erde, keine Folge der Kraft meiner Absichten. Die vorgezeichnete Absicht von Lukes Springmesser hatte kaum Ähnlichkeit mit dem zufälligen Parabelflug einer Seifenflasche, die sich bogenförmig durch die Luft schob, hinunterfiel und Elgars Kopf spaltete).
»Ja, mach nur, fass mich noch mal an.«
Hinter mir sagte jemand: »Der Arsch soll bluten.«
Dann sagte zu meiner Linken jemand: »Der Arsch soll bluten.«
Dann stimmte ein Dritter in die Worte ein wie in eine Hymne.
Reg schüttelte den Kopf, scheinbar mehr im Gebet, als aus Trotz. Er blickte nach oben, doch die Wolken waren in Deckung gegangen.
Ich hörte eine Frauenstimme.
»Nein! Nein! Das kannst du nicht wollen!« Ich kannte diese Stimme. Wenn ich manchmal in der Kirche die Augen schloss, wob sie den reichen Stoff gregorianischer Gesänge und berührte mich in der Kirchenbank. Meine Mutter hatte sich nach vorne durchgekämpft und schob uns alle beiseite wie eine Windböe, die durch hohes Gras ging.
»Das könnt Ihr alle nicht wollen«, sagte sie wieder und wieder.
Sie stellte sich zwischen Reg und Luke, das heißt zwischen Reg und Lukes Klinge.
Aus der Menge fragte jemand: »Wer ist diese Lady?« Und bevor ich mich wieder in die Mitte schlängeln konnte, sagte eine andere Stimme: »Ach, das ist die Mama von Lil’ Man.«
Sie sagte Luke, er solle alle ins Gebäude bringen. Zu meinem Erstaunen klappte er sein Springmesser ein und gehorchte ihr. Das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass sie mich auf dem Parkplatz mit dem Honky warten ließ, während sie reinging, um mit Luke zu sprechen.
Als sie aus dem Gebäude trat, sagte sie nur ein Wort: »Komm.«
Sie beförderte Reg auf den Vordersitz ihres Wagens. Ich musste mich auf den Rücksitz setzen. Als wir wegfuhren, zuckte Regs Wange. Sein Pony hing schweißverklebt an seiner Stirn. Meine Mutter fragte ihn, in welcher Straße er wohne, und er antwortete ihr. Danach sagte niemand ein weiteres Wort. Wir setzten ihn bei ihm zu Hause ab und fuhren davon, ohne dass ich auf den Vordersitz durfte.
Für den Rest des Sommers verachtete ich sie; und Vater verachtete ich noch viel mehr dafür, dass er sagte, sie habe richtig gehandelt. Heute weiß ich, sie versuchte nicht, Reg zu retten, sie versuchte, uns vor einer beschnitten Zukunft zu retten, die uns sicher gewesen wäre, wenn Reg Blut gelassen hätte.
So wie meine Mutter hatten wir unser ganzes inhaftiertes Leben noch vor uns.
*Dies geht zurück auf einen Bericht, der meist als »Daniel-Moynihan-Report« bezeichnet wurde: Daniel Patrick Moynihan, »The Negro Family. The Case For National Action« (1965).