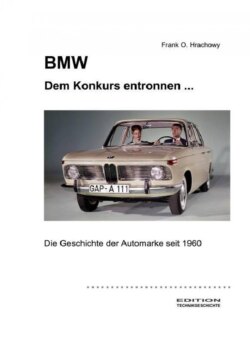Читать книгу BMW – Dem Konkurs entronnen ... - Frank O. Hrachowy - Страница 7
Оглавление1970–1979: BMW positioniert sich
Auf Gerhard Wilcke folgte zum 1. Januar 1970 Eberhard von Kuenheim{22} als neuer Vorstandsvorsitzender, der allerdings erst 41 Jahre alt war und noch nicht einmal aus der Autobranche stammte. Eberhard von Kuenheim hatte in Stuttgart Maschinenbau studiert und sich kontinuierlich nach oben gearbeitet. Bereits 1965 war von Kuenheim als »Stabsmann für technische Fragen« in der Quandt-Gruppe tätig, er war für Herbert Quandt der Mann für schwierige Aufgaben. Zum neuen Vorstandsvorsitzenden schrieb das HANDELSBLATT: »Von Kuenheim erhält Respekt allein durch Präsenz. Um zu überzeugen, braucht und gebraucht er kaum polternde Rhetorik. Er lässt Worte eindringen, nicht Töne. Ihm hört man auch dann ganz genau zu, wenn er ganz leise spricht.«{23}
Von seinem Auftreten her war Eberhard von Kuenheim völlig anders als der burschikose BMW-Vertriebschef Hahnemann, der mittlerweile zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden aufgestiegen war und in der Öffentlichkeit als »Mister BMW« wahrgenommen wurde. Dies, so wurde ihm unterstellt, vielleicht nicht ganz ohne Hoffnung darauf, der nächste BMW-Vorstandsvorsitzende zu werden. Denn bereits unter Karl-Heinz Sonne und auch während seiner Zeit unter Gerhard Wilcke hatte sich Hahnemann auf Kosten der Vorstandsvorsitzenden in den Vordergrund gedrängt.
Der zurückhaltende Jurist Wilcke »legte dem publicityhungrigen Hahnemann keine Fesseln an, als dieser sich in der Öffentlichkeit durch unkonventionelle Auftritte und markige Bonmots immer mehr als der eigentliche Wortführer des Vorstandes profilierte. Jedem, der es hören wollte, erzählte der ruppige Verkaufschef, daß er nie einen anderen als den schwachen Wilcke über sich akzeptiert hätte.«{24} Die Frage war, wie viel Freiraum Hahnemann nun vom neuen Vorstandsvorsitzenden erhalten würde.
Diese Frage war schnell beantwortet, denn es entstand sofort eine Front zwischen dem erfolgreichen, resolut und selbstbewusst auftretenden Hahnemann und dem von einem traditionsreichen ostpreußischen Trakehnergestüt stammenden Eberhard von Kuenheim. Angeheizt wurde der Konflikt durch die Tatsache, dass Hahnemann in der Öffentlichkeit seinen neuen Vorgesetzten ungeniert als »teuersten Lehrling der Firma« diskreditierte.
Und der schien sich das gefallen zu lassen, denn »mit seiner schmalen Statur, dem sauber gescheitelten, mausblonden Haar und dem glatten, etwas fülligen Gesicht sah er aus wie ein geschniegelter High-School-Absolvent, der sich für das Jahrbuchfoto fein gemacht hatte. Das schwache Lächeln, das fast ununterbrochen seine schmalen Lippen umspielte und zu einem V formte, trug wenig zur Zerstreuung dieses Eindrucks bei«{25}.
Fakt war, dass Eberhard von Kuenheim die ehrgeizigen Expansionspläne von Hahnemann stoppte, weil sie ihm zu gewagt erschienen. So war 1969 beschlossen worden, die Fabrik in Landshut, die gemeinsam mit dem Werk in Dingolfing von der Hans Glas GmbH an BMW gefallen war, stark zu vergrößern. In den deutlich erweiterten Montageanlagen sollten in Landshut von 2.000 bis 3.000 Beschäftigten täglich 400 BMW-Automobile produziert werden. Eberhard von Kuenheim hielt die dafür eingeplante Investitionssumme von rund 400 Millionen DM (ca. 200 Millionen Euro) für zu groß und zu gewagt für die kleine Marke BMW.
Der Widerruf dieser bereits beschlossenen Pläne schwächte Hahnemanns Position im Hause BMW. Hinzu kam, dass die Absatzzahlen der neuen Modell BMW 2500 und 2800 im Jahr 1970 hinter den Erwartungen zurückblieben. Nach anfänglich sehr guten Verkäufen folgte bald die Ernüchterung, eben doch noch nicht in der Liga von Mercedes-Benz zu spielen. Mit anderen Worten: Wohl wurden die neuen Modelle als Alternativen in der Oberklasse wahrgenommen – doch im Vergleich zu den Modellen des »Platzhirschen« Mercedes-Benz blieben die beiden selbstbewusst ausgepreisten BMW-Modelle eher Randerscheinungen.
Von Stuttgart aus, so ein Branchengerücht, sollte gar die süffisante Verhöhnung verbreitet worden sein, dass BMW nun eine Nische gefunden habe, in der bereits jemand zuhause sei. Auch der Export von BMW-Fahrzeugen ins Ausland, für den Hahnemann eine Steigerung von fünf bis sechs Prozent prognostiziert hatte, blieb 1970 deutlich hinter den Erwartungen zurück. Gerade mal ein halbes Prozent betrug der Zuwachs.
Für Herbert Quandt schien es deshalb kaum der richtige Weg, stärker in die Oberklasse vorzustoßen und den fertig entwickelten V8-Motor oder gar den bereits auf dem Prüfstand laufenden V12-Motor in den Markt zu bringen. Stattdessen galt es, den gelobten Sechszylinder-Reihenmotor weiterzuentwickeln. Dies geschah 1971 mit dem BMW 3.0 S, der aus einem erhöhten Hubraum 180 PS (132 kW) bei 6.000 U/min schöpfte. Mit dem BMW 3.0 Si wurde der hubraumstärkere Motor durch eine Benzineinspritzung ergänzt, womit die Leistung nochmals stieg.
BMW Touring: Unter dem Namen »Touring« war eine coupéhafte Schrägheckversion der zweitürigen 02er-Modelle entwickelt worden. Schon ab Frühjahr 1971 standen die Modelle Touring 1600, Touring 1800, Touring 2000 und Touring 2000 tii in den Schauräumen. (Bild: Stahlkocher / Wikimedia Commons)
Obwohl von den Stuttgarter Verantwortlichen genauso dementiert wie von Eberhard von Kuenheim, so fanden doch hinter verschlossenen Türen Gespräche über eine Zusammenarbeit zwischen BMW und Mercedes-Benz statt. Eine solche Zusammenarbeit war einleuchtend und schien für beide Seiten vorteilhaft: Mit Mercedes-Benz hätte BMW einen starken Partner für künftige Entwicklungsarbeiten an der Seite, während Mercedes-Benz davon profitieren würde, dass sich BMW ganz zum Wohlgefallen von Daimler-Benz-Chefplaner Hanns Martin Schleyer wieder aus der Oberklasse zurückziehen würde.
Unterdessen war bei BMW Geld in die Entwicklung einer neuen Modellvariante geflossen, denn unter dem Namen »Touring« war eine coupéhafte Schrägheckversion der zweitürigen 02er-Modelle entwickelt worden. Schon ab Frühjahr 1971 standen die Modelle Touring 1600, Touring 1800, Touring 2000 und Touring 2000 tii in den Schauräumen. Das Modell 1502 und auch der später präsentierte 2002 turbo waren jedoch nicht als Schrägheckvarianten erhältlich – aus guten Gründen: Beim kostengünstigen Einstiegsmodell 1502 wäre der Kaufpreis zu sehr nach oben getrieben worden; beim 2002 turbo hätte die Schrägheckvariante das aggressive Sportwagenimage verwässert. Zwar bot diese Schrägheckvariante bei umgeklappter Rücksitzbank erheblich mehr Laderaum als die 02er-Limousine mit Stufenheck, doch schnell zeigte sich, dass die Kunden für die neue Modellvariante nicht zu begeistern waren.
Geld benötigte BMW auch für eine ganz neue Entwicklung, die vom Gesetzgeber eingefordert wurde: das Sicherheitsauto. Anlass für die Entwicklung dieses Versuchsfahrzeugs waren in den USA erlassene Vorschriften, nach denen alle Modelle für den US-Markt zukünftig mit einer Fülle von Sicherheitsvorrichtungen und -systemen ausgerüstet sein mussten. Diese Systeme umfassten beispielsweise üppige Prallpolster, neuartige Stoßfänger vorne und hinten sowie ein Rückhaltesystem durch Gurte für jeden Sitz. Ziel des US-Verkehrsministeriums war, das Überleben der Fahrzeuginsassen bis zu einem Aufprall von 80 km/h zu gewährleisten. Bei diesem zeit- und geldaufwändigen Unterfangen wollte BMW mit Mercedes-Benz kooperieren, um die Entwicklungskosten klein zu halten.
Gleichzeitig war dieses Kooperationsvorhaben ein Indiz dafür, wie wenig eine Zusammenarbeit mit VW in Betracht gezogen wurde. Ungeachtet der Tatsache, dass zwischen den Führungsetagen in München und Wolfsburg offene Abneigung herrschte, kam eine Zusammenarbeit aufgrund der finanziellen Situation von Volkswagen nicht infrage. Denn VW stand vor dem finanziellen Ruin – es rächte sich die über Jahre gepflegte Monokultur von Fahrzeugen mit Luftkühlung und Heckmotor. Die Absatzkrise in den USA, dem wichtigsten Auslandsmarkt von VW, verschärfte die Situation zusätzlich.
Beginn einer neuen Ära in München
Während VW im Herbst 1971 ums Überleben kämpfte und der in Kollegenkreisen unbeliebte Vorstandsvorsitzende Kurt Lotz zum 1. Oktober 1971 durch Rudolf Leiding ersetzt worden war, sammelten unterdessen bei BMW die Prototypen der neuen Mittelklasse eifrig Testkilometer. Die Nachfolger sollten laut Gerüchten BMW 2004/2006 heißen, was darauf schließen ließ, dass sie mit Vier- und Sechszylindermotor auf den Markt kommen würden.
Darüber hinaus gelangte Herbert Quandt zu der Einsicht, dass BMW einen neuen, moderneren Kurs einschlagen musste. BMW sollte dazu klarer strukturiert werden, auch wenn dies die Spielräume von verdienten Mitarbeitern wie Vertriebschef Paul Hahnemann, Produktionsvorstand Wilhelm Gieschen oder Entwicklungschef Bernhard Osswald einengte. BMW sollte wachsen, und dazu war statt Kreativität und Improvisation zukünftig eine straffe Führung und Organisation vonnöten.
Die Krise im BMW-Vorstand spitzte sich bis Herbst 1971 weiter zu und Hahnemanns Position wurde dabei schwächer. Nicht zuletzt waren zahlreiche Unregelmäßigkeiten bei der Auftragsvergabe ans Licht gekommen, durch die sich Hahnemann seit Jahren systematisch bereichert hatte. Schließlich zog Eberhard von Kuenheim die Konsequenzen und stellte Herbert Quandt vor die Wahl, ob er Hahnemann behalten wolle oder ihn. Der Aufsichtsratsvorsitzende Hermann Karoli, der bei dem Gespräch zwischen Herbert Quandt und Eberhard von Kuenheim zugegen war, teilte Paul Hahnemann dann bei seiner Ankunft mit, dass seine Laufbahn bei BMW beendet sei. Ohne nochmals mit Herbert Quandt geredet zu haben, erklärte Hahnemann seinen Rücktritt.{26}
Diese Nachricht des mehr oder minder unverhohlenen Rausschmisses von Hahnemann schlug hohe Wellen – nicht nur in Bayern. Aus München war zum Abgang Hahnemanns von einem BMW-Manager zu hören: »Das war ein gewaltiger Fehler. Den ersetzt dort keiner.« Auch die Wettbewerber jubelten, ein Daimler-Benz-Manager frohlockte beispielsweise: »Der Sturz von Hahnemann hat bei der gesamten Konkurrenz Freude ausgelöst, weil der beste Mann weg ist.«{27} Offensichtlich aber war dabei auch geworden, dass Hahnemann den bedächtigen und schwach wirkenden Eberhard von Kuenheim unterschätzt hatte.
Nachfolger Hahnemanns wurde zur Jahreswende 1971/1972 ein junger Manager aus den USA, der erst 39-jährige Opel-Verkaufsleiter Robert (»Bob«) Lutz. Statt seine deutlich vorgezeichnete Karriere bei Opel beziehungsweise GM voranzutreiben, wechselte der ehemalige Kampfjetpilot der US Marines von Rüsselsheim nach München. Herbert Quandt ging bei seiner Verjüngung des Vorstands noch weiter, auch der 63-jährige Produktionschef Wilhelm Gieschen wurde durch den 41 Jahre alten Techniker Hans Koch ersetzt.
Bob Lutz schrieb zur psychologischen Wirkung des Rauswurfs Hahnemanns auf den Vorstand: »Die BMW-Spitze aber hatte eines verstanden: Man durfte sich vom Dauerlächeln, vom jungenhaften Auftreten, von der leisen Stimme und der kultivierten Sprache des jungen Freiherrn nicht täuschen lassen. Er war gerissen und knallhart.«{28}
Wie aus gut informierten Kreisen verlautete, war Lutz nicht zuletzt nach München gekommen, weil ihm Herbert Quandt genau das doppelte Gehalt von Hahnemann geboten hatte. Mit Bob Lutz war nun ein Manager für den Vertrieb verantwortlich, der weniger wie Hahnemann gefühlsgeleitet arbeitete, sondern planvoll und wissenschaftlich unterfüttert. Die zukünftige Aufgabe für Bob Lutz war klar umrissen: Die Fahrzeuge von BMW mussten ihr hohes Image beibehalten, um die überdurchschnittlichen Kaufpreise zu rechtfertigen. Nur so konnte BMW als kleiner Hersteller auf Dauer selbstständig bleiben. Gleichzeitig musste die Baukastenstrategie strikt umgesetzt werden, um die Produktionskosten nicht ausufern zu lassen.
Im Laufe des Jahre 1972 konkretisierten sich die Daten und Fakten zur neuen Automobilgeneration der Mittelklasse. Allerdings sollte die neue Baureihe mitnichten die Modelle der »Neuen Klasse« nur ersetzen, vielmehr sprach Eberhard von Kuenheim davon, die neue Baureihe eine Klasse höher anzusiedeln. Damit stünden sie in der Oberen Mittelklasse über den etablierten Modellen der »Neuen Klasse« und unterhalb der großen Modelle mit Sechszylindermotor.
Die Vorstellung der neuen Modellreihe (E12) erfolgte nach den Olympischen Spielen, die 1972 in München stattfanden. Bei der Namensgebung hatte sich Bob Lutz durchgesetzt und die Baureihe als 5er-Reihe tituliert. Diese Rückbesinnung auf alte Typbezeichnungen wurde teils kritisch gesehen, denn noch zu gut war in Erinnerung, dass BMW 1960 mit Modellen der damaligen 5er-Reihe (501/502, 503, 507) fast in den Ruin gefahren war. Viele der Kritiker waren jedoch versöhnt, als die Fahrzeuge der neuen Generation schließlich präsentiert wurden. Kurzum: Die »Neue Klasse« hatte eine würdige Nachfolgergeneration erhalten.
Der neue BMW 520 war als viertürige Limousine konzipiert und sofort als typischer Markenvertreter erkenntlich, denn die Gestalter waren der Designlinie der »Neuen Klasse« gefolgt. Bei den stilistischen Vorarbeiten war nichts dem Zufall überlassen worden. Demgemäß hatten bereits 1970 Pietro Frua und Nuccio Bertone ihre 1:1-Modelle nach München geschickt, wo sie mit den hauseigenen Modellen der Münchner Designabteilung verglichen wurden.
Verantwortlich für die finale Formgebung des 5ers war schließlich der BMW-Chefdesigner Paul Bracq, der 1970 die Nachfolge von Wilhelm Hofmeister angetreten hatte und dessen Designlinie nahtlos fortsetzte.{29} Ein durchaus würdiger Nachfolger für Wilhelm Hofmeister, denn Paul Bracq hatte zuvor zehn Jahre als Chefdesigner bei Mercedes-Benz gearbeitet. Wenn Paul Bracq auch die Designlinie von Wilhelm Hofmeister äußerlich fortführte, so setzte er im Innenraum allerdings seine eigenen Vorstellungen um.
Auch der BMW 520 erhielt ein aufwändiges Fahrwerk, das eine hervorragende Straßenlage mit Komfort und Sicherheit verband. Zu Beginn wurden zwei Motoren angeboten, so im BMW 520 der weiterentwickelte 2-l-Motor, der 115 PS (85 kW) leistete, darüber hinaus im BMW 520 i der mit einer Kraftstoffeinspritzanlage aufgerüstete 2-l-Motor mit einer Leistung von 130 PS (96 kW). Weitere Motorisierungen sollten baldmöglichst folgen.
BMW 5er-Reihe: Die 1972 präsentierten Modelle der 5er-Reihe waren als viertürige Limousine konzipiert und sofort als typische Markenvertreter erkenntlich, denn die Gestalter waren konsequent der Designlinie der »Neuen Klasse« gefolgt. (Bild: Charles01 / Wikimedia Commons)
Nicht ganz offensichtlich war, wie denn die neue Modellbezeichnung eigentlich ausgesprochen werden sollte: Fünfhundertzwanzig? Fünf-Zwei-Null? Fünfzwanzig? Die BMW-Designer ließen sich daraufhin einen Trick einfallen, indem sie die vorangestellte 5 um 15 Prozent größer gestalteten als die nachfolgenden zwei Ziffern. Somit war klar, dass »Fünfzwanzig« die richtige Benennung war. Allerdings kehrte BMW bereits 1974 wieder zu gleich großen Zahlen zurück, denn die korrekte Bezeichnung hatte sich bereits etabliert.
Bei der Entwicklung hatte die Unfallsicherheit eine besondere Rolle gespielt. So gab es nun programmierte Verformungszonen im Fahrzeugheck wie im -bug, zudem zwei breite, integrierte Überrollbügel im Dach und solide ins Schloss fallende Türen. Das gesamte Fahrzeug hatte eine Käfigstruktur erhalten, die die Insassen bei einem Unfall vor Verletzungen schützte. Gebaut werden sollte der BMW E12 im BMW-Stammwerk München-Milbertshofen, ab 1973 dann auch im neuen Werk 2.4 in Dingolfing.
Der Sommer 1972 und die Olympiade waren vorbei – in München wurde es wieder ruhiger. Endlich durften auch die BMW-Logos wieder am äußerlich bereits vollendeten zentralen Verwaltungsgebäude am Petuelring angebracht werden. Denn um Schleichwerbung zu unterbinden, war BMW im Vorfeld gezwungen worden, an den in der Nähe des Olympiageländes stehenden BMW-Gebäuden die Firmenlogos zu entfernen. Gleiches galt für die zur Olympiade mit Elektroantrieb ausgerüsteten Modelle des BMW 1602, die als Begleitfahrzeuge bei den Marathonläufen ebenfalls ohne BMW-Logo zum Einsatz kamen.
Im Sommer 1972 präsentierte BMW noch ein weiteres Auto, das gleichfalls auf großes Medieninteresse stieß: den BMW Turbo X1. Der von Designer Paul Bracq entworfene Prototyp war ein mit 1.100 mm Höhe extrem flach bauender Zweisitzer mit Flügeltüren und Klappscheinwerfern, der als »Versuchslabor auf zwei Rädern« dienen sollte. Die Karosserie bestand ganz konventionell aus Stahl, vorne wie hinten waren die Stoßfänger jedoch aus Kunststoff gefertigt und optisch bündig in die Karosserie integriert. Ganz selbstbewusst prangte das BMW-Logo gleich zweimal – einmal ganz links und einmal ganz rechts – am Fahrzeugheck.
Besonders hervorgehoben wurde die Sicherheit des Prototyps. So schreibt BMW im hauseigenen BMW JOURNAL FÜR MEHR FREUDE AM FAHREN: »Schon lange experimentieren die Münchener Autobauer mit einem ureigenen Fahrzeug, an dem sich viele wesentliche Maßnahmen, die heute der Sicherheitsforschung dienen, in der Praxis erproben lassen. Mit dem BMW Turbo als zweisitzigem Hochleistungsfahrzeug will BMW eine praxisnahe, technisch und wirtschaftlich realisierbare Sicherheitsentwicklung betreiben. Dieser Wagen soll Erkenntnisse aus Theorie und Praxis verwirklichen, die nicht utopischen sondern realistischen Zielen dienen, nämlich Bauelemente aus diesem Forschungsobjekt laufend in die Serienwagenfertigung einfließen zu lassen.«{30}
Konzipiert war der BMW Turbo X1 als Mittelmotorfahrzeug, wobei der eingebaute Antrieb mit seinen 200 PS (148 kW) wenig spektakulär schien. Denn im gummigelagerten Fahrschemel hing der 2-l-Motor mit vier Zylindern. Allerdings hatten die Ingenieure den Motor mit einer Turboaufladung aufgerüstet, wodurch die Leistung mittels höherem Ladedruck auf bis zu 280 PS (206 kW) gesteigert werden konnte. Mit seiner günstigen Aerodynamik waren damit echte 250 km/h als Höchstgeschwindigkeit und eine Beschleunigung von 0–100 km/h in ca. 6,6 Sekunden realistisch.
BMW Turbo X1: Der von Designer Paul Bracq entworfene Prototyp war ein mit 1.100 mm Höhe ex-trem flach bauender Zweisitzer mit Flügeltüren und Klappscheinwerfern, der als »Versuchslabor auf zwei Rädern« dienen sollte. (Bild: Norbert Schnitzler / Wikimedia Commons)
Der in nur sechs Monaten entwickelte BMW Turbo X1 entsprach in seinem Entwurf durchweg den zeitgenössischen Vorstellungen von einem Sportwagen – doch obwohl BMW hier einen voll funktionstüchtigen Wagen auf die Räder gestellt hatte, war eine Serienfertigung nicht vorgesehen. Als kleiner Trost blieb die Ankündigung, die im Prototyp verbauten neuen Technologien sukzessive in die Serienfahrzeuge einfließen zu lassen. Aufgrund der großen Nachfrage auf internationalen Messen, die den BMW Turbo X1 ihrem Publikum zeigen wollten, wurde noch ein zweites Exemplar gebaut.
Der Erfolg des BMW Turbo X1 brachte allerdings den Vorstandsvorsitzenden der Daimler-Benz AG, Dr. Joachim Zahn, so in Rage, dass er eine Unterredung mit Eberhard von Kuenheim und Bob Lutz in Stuttgart einforderte. Dort angekommen, mussten sich die beiden BMW-Vertreter anhören, dass es ein Unding sei, nach dem C-111 von Mercedes-Benz ebenfalls ein Konzeptfahrzeug mit Flügeltüren zu präsentieren. Außerdem müsse BMW mit dem Verkauf von Automobilen mit Sechszylindermotoren aufhören, denn das sei eine ureigene Domäne von Mercedes-Benz, in die BMW unrechtmäßig eingedrungen sei. BMW solle sich fortan auf Vierzylindermotoren beschränken. Eberhard von Kuenheim versprach Dr. Zahn widerspruchslos, sich zukünftig den Wünschen von Mercedes-Benz zu fügen.
Bob Lutz hatte mit Verwunderung zur Kenntnis nehmen müssen, dass sich Eberhard von Kuenheim ohne jeglichen Widerspruch oder ein Gegenargument vom Stuttgarter Vorstandsvorsitzenden hatte maßregeln lassen. Doch Bob Lutz hatte Eberhard von Kuenheim verkannt. Denn auf der Rückfahrt erklärte Eberhard von Kuenheim dem verdutzten Bob Lutz, dass Dr. Zahn etwas altmodisch sei und dieses Gespräch keinerlei Bedeutung gehabt habe. Lutz solle die Vermarktung der Sechszylindermotoren weiter vorantreiben.{31}
Allerdings waren sich die Verantwortlichen bei BMW durchaus darüber bewusst, dass die Marke BMW vor allem über die Werte »Individualität« und »Sportlichkeit« wahrgenommen wurde. Es hatte sich längst herumgesprochen, dass sich die BMW-Modelle bestens für den Rennsport eigneten. Dies wurde bereits durch den Erfolg des BMW 700, vor allem aber durch die Omnipräsenz der »Neuen Klasse« auf den Rennstrecken unterstrichen. Um dieses Wesensmerkmal weiter auszubauen, bündelte BMW im Jahr 1972 alle Motorsportaktivitäten in der Submarke BMW Motorsport GmbH. Die Aufgabe der von Rennfahrer Jochen Neerpasch geleiteten Gesellschaft war die Entwicklung von Sportwagen für Motorsport-Veranstaltungen. Ziel war, die Dominanz der italienischen Hersteller zu brechen sowie dem direkten Wettbewerber Alfa Romeo Paroli zu bieten.
Das Jahr 1972 war geprägt von zahlreichen Unsicherheiten hinsichtlich der Frage, wohin sich die Automobiltechnik in den nächsten Jahren entwickeln würde. So verdichtete sich das Gerücht, dass Mercedes-Benz bald einen Wankelmotor in einem Serienfahrzeug auf den Markt bringen wollte. Auch andere Hersteller, die eine Fertigungslizenz für diesen »Wundermotor« erworben hatten, traten mit konkreten Plänen an die Öffentlichkeit: Bei GM wurde die Markteinführung eines Wankelmodells für das Jahr 1974 geplant, ebenso bei Citroën. In Japan baute der Hersteller Toyo Kogyo für seine Modelle der Marke Mazda bereits Modelle in Großserie.
Auch zahlreiche Motorradhersteller sprangen auf den fahrenden Zug und entwickelten Modelle mit Wankelmotor. So beispielsweise der japanische Hersteller Suzuki, aber ebenso BSA/Triumph in Großbritannien. Sogar die Ingenieure von Fichtel & Sachs tüftelten an einem eigenen Wankelmotor für ihre Marke Hercules. Bei NSU indes war es aufgrund der kostspieligen technischen Probleme beim Ro 80 eher ruhiger geworden – die Wankel-Euphorie war längst verflogen. Es war ein offenes Geheimnis, dass der VW-Konzern bei jedem verkauften NSU Ro 80 mehrere tausend Mark zulegte.
Immer stärker wurde zudem der Dieselmotor als alternativer Antrieb für Personenkraftwagen diskutiert. Opel hatte sich bereits mit seinen Weltrekordfahrten, die mit einem serienreifen Vierzylinder-Dieselmotor stattgefunden hatten, in der öffentlichen Wahrnehmung werbewirksam positioniert. Schon ab Herbst 1972 wollte Opel das Erfolgsmodell Rekord mit einem 60 PS starken Selbstzündermotor in den deutschen Markt einführen. Diese Entwicklung wurde von zahlreichen Fachleuten als verkehrstechnischer Rückschritt bezeichnet – ungeachtet dessen arbeiteten auch in Wolfsburg und bei Ford in Köln Ingenieure unter Hochdruck an einem eigenen Dieselmotor. Einzig BMW-Pressesprecher Werner Zentzytzki erklärte es kategorisch für ausgeschlossen, einen Selbstzündermotor zu entwickeln, denn »ein BMW mit Dieselmotor wäre für mich ein grauenhafter Gedanke«{32}.
Zum Ende des Jahres 1972 hatte BMW erstmals einen Jahresumsatz von über 2 Milliarden Mark (ca. 1 Milliarde Euro) erreicht. Entsprechend stolz gingen die Münchner aus dem Erfolgsjahr und meldeten: »Täglich werden in Milbertshofen und den angeschlossenen Produktionsstätten zur Zeit 800 Automobile und knapp 100 Motorräder produziert: Angesichts der ansonsten rückläufigen Produktionstendenz in der deutschen Automobilindustrie ein glänzendes Indiz für die marktnah konzipierten BMW Karossen. Während man bei BMW das hohe Produktionsniveau vom Herbst 1971 hat halten können, verlor die gesamte deutsche Automobilindustrie bei den PKW binnen Jahresfrist (von Juni 1971 auf Juni 1972) immerhin 3 % an Produktion.«{33}
1973 – Die Ölkrise verändert den Automobilmarkt
So gut die Verkäufe bei BMW liefen, so schlecht lief die 1969 gegründete BMW-Autovermietung GmbH. Das von Paul Hahnemann ausgetüftelte Geschäftsmodell, mit der Mietwagentochter Rent a BMW neue Kunden für die Marke BMW zu begeistern, war gescheitert. Die defizitäre Mietwagenfirma galt inzwischen in München als ungeliebte Tochter und die Verantwortlichen nahmen die Gelegenheit wahr, die BMW-Autovermietung GmbH im Februar 1973 an den expandierenden Autovermieter Europcar zu verkaufen. Zum 1. März war das Geschäft abgeschlossen und die BMW-Autovermietung GmbH vollständig in den Händen von Europcar, die wiederum zu 100 Prozent dem staatlichen französischen Autohersteller Renault gehörte.
Ungeachtet dessen galt es gerade auch für BMW, weiter zu wachsen und sich so gegen die Herausforderungen des Wettbewerbs zu wappnen. Diesem Ziel folgend, eröffnete BMW 1973 im südafrikanischen Rosslyn bei Pretoria das erste ausländische Montagewerk. Allerdings war das südafrikanische Werk keine Fertigungsstätte in herkömmlichem Sinne, sondern ein Montagewerk, in dem pro Jahr rund 6.000 aus München angelieferte CKD-Fahrzeugbausätze (CKD = Completely Knocked Down) zusammengebaut wurden. Der Vorteil dieser Vorgehensweise lag auf der Hand: BMW konnte durch die Anlieferung der Fahrzeuge als Bausatz hohe Importzölle vermeiden, zudem konnte auf ein teures Vollwerk mit Presswerkzeugen, Karosseriebau und Lackiererei verzichtet werden. Dass die Lohnkosten in Südafrika zudem nur ein Bruchteil der Lohnkosten in Deutschland betrugen, war ein weiterer gewichtiger Punkt in der Kalkulation. Ungeachtet dessen sollte das südafrikanische Werk ab 1974 auch eigene Komponenten produzieren.
Parallel dazu wurde über eine Expansion in die Länder des sozialistischen Ostblocks diskutiert, denn aufgrund des größer gewordenen technischen Abstands lockte dort ein gewaltiger Markt. Diskutiert wurden beispielsweise Lizenzverträge für Motoren. Wie gut eine solche Zusammenarbeit funktionieren konnte, zeigte die seit Jahren dauerende Kooperation von BMW mit dem sozialistischen Ungarn, das im Tausch gegen Waren oder Dienstleistungen von BMW die großen Sechszylinder-Modelle geliefert bekam. Dass eine solche Zusammenarbeit mit einem sozialistischen beziehungsweise kommunistischen Land auch in ganz großem Stil gelingen konnte, zeigte beispielhaft die Kooperation der UdSSR mit Fiat in Togliatti.
Auch in Deutschland wurden die Kapazitäten erweitert. Nicht nur, dass im Mai 1973 der »Vierzylinder«, das neue zentrale Verwaltungsgebäude in München, bezogen werden konnte. Endlich war auch das neue Werk in Dingolfing fertiggestellt; am 27. September 1973 lief der erste BMW vom Band. Nun fehlte nur noch qualifiziertes Personal, weshalb BMW bereits im Frühjahr 1973 in der WESTDEUTSCHEN ALLGEMEINEN ZEITUNG (WAZ) und im Fußballmagazin KICKER großformatig eine ungewöhnliche Werbeaktion gestartet hatte, mit der Mitarbeiter aus der mutmaßlich rußgeschwärzten Zechenlandschaft des Ruhrgebiets nach Bayern gelockt werden sollten. So titelte die Überschrift der im Rahmen des »BMW-Facharbeiter-Auswanderungsprogramms« entstandenen Anzeige: »Du lebst nur einmal, Jupp! Darum raus aus Ruß-Land. Komm nach Bayern. Nach Dingolfing. Zu BMW.«
Im Text der mit weidenden Kühen illustrierten Anzeige zogen die Verantwortlichen alle Register zeitgenössischer Theatralik: »Bei uns gibt es keine Hochöfen und keine Fabrikschornsteine. Und die Autos – die sind auch noch zu zählen. Die Luft ist sauber und Dingolfing (die kleine Stadt in der Du vielleicht bald leben wirst) auch. Drumherum ist Natur. Grün im Sommer – weiß im Winter. Hier wachsen Blumen und Pilze und Schneemänner.
Und jetzt zu den Kühen, Jupp! Die haben wir nämlich wegen Deinem Sohn in diese Anzeige gesetzt. Hat er schon mal eine angefaßt, oder kennt er sie nur aus dem Lesebuch! Jupp, Dein Sohn hätte es hier schöner. Oder bist Du gerne in den Hinterhöfen Winnetou gewesen? Übrigens, um seine Ausbildung brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. Realschule und Gymnasium gibt's in Dingolfing schon viele Jahre.« So groß der Werbeaufwand war – die Resonanz enttäuschte. Die Werbekampagne erwies sich als Flop, denn nur 30 »Jupps« wechselten nach Dingolfing.
Schön war für BMW zu sehen, wie sich der Stellenwert des Motorrads veränderte. Längst waren Motorräder kein Transportmittel mehr für Minderbemittelte, die sich kein Auto leisten konnten. Vielmehr rückten sie immer mehr als Spielzeug zur Freizeitgestaltung in den Fokus, wie es der Erfolg der japanischen Hersteller in den USA und in Europa zeigte. Diese Begeisterung fürs motorisierte Zweirad schlug sich auch in den Zahlen von BMW nieder, denn seit 1967 hatte sich die Zahl der verkauften Motorräder mit 24.000 Stück mehr als verdreifacht. Grund genug, sich mit einer neuen »Strich-Sechs«-Baureihe rund um die BMW R 90 S für künftiges Wachstum zu positionieren.
Unterdessen waren die Rufe nach neuen und vor allem stärkeren Motoren für den 5er lauter geworden. Zahlreiche Kunden bemängelten, dass die potenten Sechszylindermotoren nicht im 5er angeboten würden. BMW reagierte, indem ab Sommer 1973 der BMW 525 in den Verkauf kam. In dessen Fahrzeugfront arbeitete nun der Reihensechszylinder mit einer Leistung von 145 PS (107 kW) und einem maximalen Drehmoment von 212 Nm bei 4.000 U/min.
Wem diese Leistungssteigerung nicht ausreichte, für den gab es neben der 1973 gegründeten BMW Motorsport GmbH eine weitere empfehlenswerte Adresse in Deutschland. Dies war der Tuner Burkard Bovensiepen mit seiner auf BMW-Fahrzeuge spezialisierten Tuningfirma Alpina. Die dort modifizierten BMW-Modelle überzeugten nicht nur auf der Rennstrecke, sondern ebenso durch die hohe Qualität der Umbauten. Aus diesem Grund gewährte BMW den bei Alpina umgerüsteten Fahrzeugen volle Werksgarantie. Nicht nur das, denn die BMW Motorsport GmbH griff beim Aufbau ihrer Rennsportfahrzeuge ganz offiziell auf die Spezialisten von Alpina zurück.
BMW 2002 turbo: Angesichts der Ölkrise wurden sportliche Automobile nicht mehr nur positiv gesehen. Die eigentliche technische Sensation, das erste Serienfahrzeug mit Benzinmotor und Abgasturbolader auf den Markt gebracht zu haben, fiel dabei fast unter den Tisch. (Bild: Lothar Spurzem / Wikimedia Commons)
Geprägt wurde das Jahr 1973 durch die im Herbst beginnende Ölkrise, bei der die Organisation der Erdöl exportierenden Länder (OPEC) die Fördermengen drosselte, um die westlichen Länder politisch unter Druck zu setzen. Die dadurch steigenden Energiepreise verursachten eine Schwächung der Konjunktur und führten die westlichen Länder in eine Wirtschaftskrise, von der alle wichtigen Industrienationen betroffen waren.
Parallel dazu verschärfte der steigende Ölpreis die Inflation, wodurch die US-Wirtschaft sogar in eine Stagflation (wirtschaftliche Stagnation gepaart mit Inflation) geriet. In Deutschland markierte die Ölkrise das Ende des Wirtschaftswunders. Bereits im März 1972 war die Höchstgeschwindigkeit auf Bundes- und Landstraßen auf 100 km/h beschränkt worden, während der Ölkrise wurde auch auf Autobahnen eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h verordnet.
Angesichts der Ölkrise und der zahlreichen Unfallopfer im Straßenverkehr wurde das von BMW geförderte Image der Sportlichkeit nicht mehr nur positiv gesehen. Öffentlich wurden Stimmen laut, die insbesondere die zum aggressiven Fahren animierende Werbung von BMW kritisierten. Vor allem der BMW 2002 turbo mit seinem spiegelverkehrt auf dem voluminösen Frontspoiler angebrachten »Turbo-2002«-Schriftzug wurde von der Öffentlichkeit als angeberisch und vulgär wahrgenommen. Die eigentliche technische Sensation, das erste Serienfahrzeug mit Benzinmotor und Abgasturbolader auf den Markt gebracht zu haben, fiel dabei fast unter den Tisch.
Zum unzeitgemäßen Auftritt des BMW 2002 turbo schrieb das Fachmagazin AUTO BILD: »Fortan galten Turboautos als Untersätze für Halbstarke. Ihr Ruf war grundlegend ruiniert. Auch weil BMW noch dick „2002 turbo“ drauf schrieb, in Spiegelschrift! Das war nicht gerade sensibel und politisch unkorrekt. Damals gab es nicht nur Diskussionen wegen des Benzinverbrauchs, sondern auch über die Verkehrssicherheit. Der peinliche Spoiler führte gar zu einer Anfrage im Bundestag, worauf BMW den Schriftzug flugs wieder entfernte und in der Versenkung verschwinden ließ – den größten Druck-Fehler der BMW-Geschichte.«{34}
Parallel dazu rückte die BMW-Werbung immer stärker in das öffentliche Bewusstsein. Selbst unter BMW-Aktionären wurde die hauseigene Fahrzeugwerbung und -positionierung mittlerweile in einer Weise für unangemessen gehalten, dass diese Angelegenheit auf der BMW-Hauptversammlung zum Thema wurde. Schon wurden erste Stimmen laut, die glaubten, dass der gerade erst zu BMW gekommene Verkaufschef Bob Lutz wohl schon bald seinen Hut nehmen müsse. Aus Stuttgart kam bereits das Gerücht, dass die Verantwortlichen nur noch mit einer Schamfrist für den Abgang von Bob Lutz rechneten. Von anderer Seite kam der hämische Kommentar, dass sich der ehemalige Kampfjetpilot ja bestens mit Schleudersitzen auskenne ...
Ende des Jahres 1973 wurde bei BMW eine neue Mitarbeiterzeitschrift eingeführt. Unter dem Titel BAYERNMOTOR wurden den Mitarbeitern im Boulevardstil in schlichtem Layout mit fetten Schlagzeilen, kurzen Sätzen und dick unterstrichenen Schlagworten BMW-interne Themen auf wenigen Seiten nähergebracht. Damit unterschied sich die BAYERNMOTOR in jeder Hinsicht vom anspruchsvollen hauseigenen BMW JOURNAL FÜR MEHR FREUDE AM FAHREN, das von BMW seit 1962 herausgegeben wurde.
BMW »Vierzylinder«: Der BMW-Turm ist das Hauptverwaltungsgebäude und Wahrzeichen von BMW in München. Baubeginn war im Jahr 1968, eingeweiht wurde das Hochhaus am 18. Mai 1973. (Bild: Herbert Ziegelmeier jun. / PIXELIO)
Die Ölkrise des Jahres 1973 mit ihrem Tempolimit von 100 km/h und den autofreien Sonntagen hatte die gesellschaftliche Einstellung zum Auto verändert – große, schwere Fahrzeuge mit großen Motoren waren ebenso wenig gefragt wie leistungsstarke Sportwagen. Bei BMW wurde die Belegschaft auf ein schweres neues Jahr eingeschworen. Insgesamt waren die wichtigen Kennzahlen wie Umsatz und Produktionszahlen moderat gestiegen, wobei der Jahresüberschuss nahezu unverändert geblieben war. Stärker vom Abschwung betroffen war das Motorradgeschäft, das in den letzten Monaten so jäh zurückgegangen war, dass unterm Strich ein Verlust stand.{35}
Das Jahr 1974 begann entsprechend schwierig, Eberhard von Kuenheim rechnete übers Jahr gesehen mit einem Absatzrückgang von 10 bis 25 Prozent: »eine restriktive Konjunkturpolitik, Benzinverteuerung, Tempobeschränkung, vorübergehendes Sonntagsfahrverbot, höhere Versicherungsprämien und Reparaturkosten«, so definierte der BMW-Vorsitzende im Gespräch mit einem Redakteur des Nachrichtenmagazins DER SPIEGEL die Faktoren der Krise. Im Februar standen bei BMW für zwei Wochen alle Bänder still. Etwas Hoffnung lag in stabilen Exportzahlen, auf die der Chef hoffte.
Interessant war die Kehrtwende in der Außendarstellung der Marke BMW, die vom Redakteur angesprochen wurde. Nach dem abrupten Ende der Werbestrategie von Bob Lutz, die durch ihre Betonung von Sportlichkeit und schnellem Fahren als zu aggressiv und nicht zeitgemäß kritisiert worden war, verfolgte das Marketing von BMW nun eine andere Linie. Auf dieses neue gewünschte Image von BMW angesprochen, erklärte Eberhard von Kuenheim relativierend: »Uns geht es wie einem Schauspieler, der früher einmal eine bestimmte Rolle gespielt hat und von dem das Publikum erwartet, daß er diese Rolle immer weiterspielt. Wir haben schon vor Jahren diese Rolle abgelegt. Wir haben Sportlichkeit im Sinne von Raserei nie herausgestellt.«{36}
Mittlerweile war das Tempolimit von 100 km/h einer Richtgeschwindigkeit von 130 km/h gewichen. Diese Regelung wurde von allen Seiten begrüßt, so auch vom BMW-Management, das in der Hauspostille BAYERNMOTOR unter der Titelzeile »Tempo 130 geht uns alle an« nachdrücklich an seine Mitarbeiter appellierte: »Sollte die Zahl der Unfälle auf den Autobahnen in den nächsten Monaten deutlich ansteigen, wird die Diskussion um Geschwindigkeitsbegrenzungen, die der Automobilindustrie in der jüngsten Vergangenheit schweren Schaden zufügte, erneut anheben. Wir richten an alle Betriebsangehörigen den nachdrücklichen Appell, sowohl im eigenen Fahrzeug wie auch beim Einsatz auf Werkswagen selbst vorbildliches Verhalten an den Tag zu legen, d. h. also, sich weitestgehend an die vorgeschriebene Richtgeschwindigkeit von 130 km/h zu halten.«{37}
Augenfällig war, dass insbesondere die deutschen Marken Mercedes-Benz, BMW und vor allem Porsche unter der Situation litten. Auch der kleine Schwelmer Sportwagenhersteller Erich Bitter, der Opel-Technik mit italienisch eleganten Karosserien einkleidete, hatte sein 1973 präsentiertes Sportcoupé Bitter CD zur Unzeit auf den Markt gebracht. Die von den Wissenschaftlern des Club of Rome prognostizierten »Grenzen des Wachstums«, schienen erreicht – der Trend zum sparsamen Kleinwagen oder zumindest zu kleineren Wagen mit verbrauchsgünstigeren Motoren war unverkennbar.
Die Planer bei BMW reagierten schnell und rüsteten den 5er mit einem kleineren Motor aus. Der so entstandene BMW 518 war bereits ab Mai 1974 verfügbar und leistete gerade einmal 90 PS (66 kW) bei 5.500 U/min. Mehr als 160 km/h Höchstgeschwindigkeit war damit kaum möglich. Diese schnelle Reaktion war ungemein wichtig, denn von den Dingolfinger Bändern rollten bislang täglich gerade einmal 140 Fahrzeuge der 5er-Baureihe. Fortan wurde der 5er nur noch im neuen Werk in Dingolfing gebaut, in München standen die frei gewordenen Kapazitäten nun einer neuen Modellreihe zur Verfügung.
Ohnehin war die Stimmung bei BMW zu dieser Zeit angespannt, denn Herbert Quandt hatte mit Bernd Kalthegener einen alten Vertrauten in die Münchner Zentrale gesandt, der Eberhard von Kuenheim direkt unterstellt und als Chef der Gesamtplanung mit zahlreichen Vollmachten ausgestattet war. In Folge wurden zahlreiche Manager gekündigt oder aber kündigten selbst. Auf Vorstandssitzungen wurde unterdes offensichtlich: Auch das Verhältnis zwischen Vertriebschef Bob Lutz und Bernd Kalthegener war nicht von Vertrauen und Sympathie geprägt.
Einen Wechsel gab es unterdessen in der Designabteilung, da Chefdesigner Paul Bracq BMW in Richtung Frankreich verließ, um bei Peugeot als Chief of Interior Design zu arbeiten. BMW stand nun ohne Chefdesigner da. Auch Bob Lutz kündigte bei BMW seinen Posten und stieg gleichzeitig auf der Karriereleiter eine Sprosse nach oben. Er wechselte zum kriselnden Hersteller Ford in Köln, wo er als Deutschland-Chef erfolgreich die Modernisierung der Modellpalette vorantrieb und später zum Chef von Ford Europe aufstieg. Sein Nachfolger bei BMW wurde Hans-Erdmann Schönbeck, bisher in Ingolstadt als Vorstand der VW-Tochter Audi-NSU AG zuständig für den Vertrieb in Deutschland.
Zu seinen Gründen, von BMW zu Ford zu wechseln, gab Bob Lutz in einem Interview zur Antwort: »Allerdings – nach etwa zweieinhalb Jahren in München habe ich irgendwie den Gedanken an die zukünftige Herausforderung vermißt. Und da habe ich mich gefragt, ob ich wirklich mit 40 Jahren bereit sei, für den Rest des Lebens, der beruflichen Laufbahn, genau an diesem Ort zu sitzen und genau diese Funktion auszuüben. Und da mußte ich mir sagen: nein.«{38}
Auch in den USA gab es einen Personalwechsel, denn BMW trennte sich vom Generalimporteur Max E. Hoffman. Gemäß offizieller Begründung sollte Hoffman seine Rechnungen an BMW zu zögerlich bezahlt haben, darüber hinaus kritisierten die Münchner das Marketing in den USA, das sie als unzureichend bemängelten. Maximilian E. Hoffman sollte jedoch als leitendes Mitglied des Board of Directors der BMW of North America weiterhin für BMW tätig bleiben. Hinter vorgehaltener Hand galten die Gründe für die Kündigung jedoch als Ausflüchte, denn BMW wollte fortan sein lukratives USA-Geschäft über ein firmeneigenes Verkaufs- und Servicenetz selbst in die Hand nehmen. Dieser Umbau war in Europa bereits in vollem Gange. Konsequent wurden BMW-Tochtergesellschaften für den Import und den Vertrieb von BMW-Automobilen und -Motorrädern gegründet.
Am Ende des Jahres 1974 stand bei BMW im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzrückgang im In- und Ausland von insgesamt 4,4 Prozent. Immerhin war die Motorradproduktion um 11 Prozent gestiegen und hatte so die Verluste aus dem Pkw-Geschäft etwas gedämpft. Der Jahresüberschuss war hingegen im Jahr 1974 von 63,2 Millionen DM auf 42,0 Millionen DM (von ca. 31,5 Millionen Euro auf 21 Millionen Euro) um rund 30 Prozent zurückgegangen.{39}
Aufhebungsverträge, Entlassungen, Kurzarbeit – das waren Anfang 1975 die Hauptthemen in der deutschen Industrie. Auch bei BMW war klar, dass das Jahr 1975 nicht ohne Kurzarbeit starten würde – zu schlecht waren die Absatzzahlen. Die Werke in München, Landshut und Dingolfing arbeiteten weit unter ihrer Auslastung, weshalb für Februar und März Kurzarbeit beantragt wurde.
Im Frühjahr 1975 deuteten indes erste Indikatoren darauf hin, dass die Ölkrise abflaute. Die Auftragseingänge stiegen bei BMW so überraschend in die Höhe, dass die beantragte März-Kurzarbeit nicht umgesetzt wurde. Stattdessen waren bereits seit Februar 200 neue Mitarbeiter eingestellt worden, 70 offene Stellen galt es nun schnellstens zu besetzen. Das war noch aus einem anderen Grund dringend notwendig, denn im Januar waren 300 Mitarbeiter aus dem Werk München nach Dingolfing versetzt worden, um dort zeitlich begrenzt auszuhelfen.
Trotz der finanziellen Zulage von 16 DM (ca. 8 Euro) am Tag, die diese Mitarbeiter erhielten, war ein hoher Anteil mit der Versetzung nicht einverstanden. Geklagt wurde über das Kantinenessen in Dingolfing und das Schlafen im Hotel oder im Wohnheim. Gerade bei verheirateten Mitarbeitern war der Unmut nachvollziehbar, denn diese Mitarbeiter sahen ihren Lebenspartner so nur an den Wochenenden. Für Unmut sorgten auch die fehlenden Unterhaltungsmöglichkeiten nach Feierabend, die denen in München in vielerlei Hinsicht nachstanden.
Das Ende der Ölkrise zeichnete sich ab und die Konjunktur zog an. Der Blick auf das erste Quartal 1975 sorgte für erstaunte Gesichter, denn mit 78.000 Neufahrzeugen hatte BMW den alten Rekord von 1973 um rund 50 Prozent übertroffen. Besonders gut hatten sich dabei die Modelle 1502 und 518 verkauft – die allerdings so knapp kalkuliert waren, dass BMW zu diesem Erfolg schrieb: »Besonders bitter: gerade der 1502 und der 518 sind die Wagen, an denen BMW vergleichsweise weniger verdient. Das Unternehmen hat zwar neue Kunden, aber deshalb noch nicht recht viel mehr Geld in der Kasse.«{40}
Zweifellos hatte die Ölkrise den Markt in Bewegung gebracht und die Kräfteverhältnisse verschoben. Vor allem in die Reihen der größeren Hersteller mit ihren Volumenmodellen war Bewegung gekommen, denn die Volkswagen AG hatte sich von der Monokultur der heckgetriebenen Fahrzeuge mit Gebläsekühlung zugunsten von neuen Modellen mit wassergekühltem Frontmotor verabschiedet. Mit diesen neuen Modellen hatte der Wolfsburger Konzern endlich gängige moderne Technikkonzepte umgesetzt, was sich in überbordenden Verkaufszahlen niederschlug.
Dieser durchaus grandios zu nennende Erfolg von VW, direkt nach der verheerenden Ölkrise, brachte die Automobilkonzerne in Deutschland in Verlegenheit. Gerade die traditionellen Anbieter von Mittelklassemodellen wie Ford und Opel mussten erkennen, dass mit Volkswagen plötzlich ein ernstzunehmender Wettbewerber auf den Plan getreten war, über den man vorher eher gelächelt hatte. Fakt war: Während viele Autohersteller in Deutschland unter der Ölkrise stark gelitten hatten, ging VW aus dem vorangegangenen Desaster gestärkt hervor.
Unterdessen hatte Bob Lutz seit seinem Weggang von BMW die Marke Ford durch »Fortschritt durch Feinschliff« auf Kurs gebracht. Durch eine Verdoppelung der Neuwagengarantie von einem halben auf ein ganzes Jahr, eine deutlich umfangreichere Grundausstattung, strengere Qualitätskontrollen und eine modernisierte Optik der Fahrzeuge ging auch Ford gestärkt in die zweite Hälfte des Jahrzehnts. Ford war zwar kein direkter Wettbewerber von BMW – trotzdem dämmerte es in München manchem Manager, dass es wohl ein Fehler gewesen war, Bob Lutz nach so kurzer Zeit gehen zu lassen.
Abschied von der »Nischen-Modellpolitik«
Aus München verdichteten sich mittlerweile die Gerüchte bezüglich einer neuen Fahrzeugreihe, die unterhalb der 5er-Reihe angesiedelt sein sollte. Erwartet wurde eine Baureihe, die die kompakte zweitürige 02-Reihe beerben würde. Im Sommer 1975 schließlich rollten die ersten Modelle der 3er-Reihe von BMW (Werkscode E21) von den Bändern. Ebenso wie die 02-Modelle waren die Modelle der 3er-Reihe nur zweitürig lieferbar.
Vorerst sollte es die neuen Modelle ausschließlich mit den weiterentwickelten Vierzylindermotoren des Vorgängers geben. Wahlweise gab es ein Vier- oder Fünfganggetriebe. Was es grundsätzlich nicht gab, waren vier Türen, denn hier sollte der neue 3er ganz bewusst Distanz zur 5er-Reihe halten. Als kostengünstiges Einstiegsmodell behielt BMW jedoch die mit vereinfachter Ausstattung konzipierte Sparversion 1502 bis Juli 1977 im Programm.
Von ihren Proportionen und ihrem Design her kam die neue Baureihe gut bei den Kunden an, allerdings wurde die karge Optik der Stufenhecklimousine, die weitgehend auf Schmuckelemente an Front und Heck verzichtete, kritisiert. Von vorne gesehen wirkte der 3er wohl gut gelungen – von hinten jedoch wurde der direkte Blick auf das lackierte Rückblech zwischen den Heckleuchten kritisiert. »Nacktarsch«, so lautete die gängige despektierliche Bezeichnung für diesen Design-Fauxpas. Aus diesem Grund wurde schon wenige Monate nach Serienanlauf zwischen den Heckleuchten eine schwarze Kunststoffblende montiert, die auch nachträglich bestellt werden konnte.
BMW 3er-Reihe: Die Modelle der 3er-Reihe (E21) bildeten die Nachfolger der erfolgreichen 02er-Klasse. Aus diesem Grund waren die Modelle der 3er-Reihe ebenso wie die 02-Modelle nur zweitürig lieferbar. (Bild: Jeroen Coebergh / Wikimedia Commons)
Technisch und von seinem Fahrwerk her wurde der 3er von der Fachpresse und den Kunden mit Lob überhäuft. Auch optisch gefiel der Wagen, denn er wirkte repräsentativ und modern, ohne protzig zu sein. Im Innenraum war das Konzept des »fahrerbezogenen Cockpits« erstmals konsequent umgesetzt worden, denn im 3er wurden die Bedienelemente und Anzeigen in der Mittelkonsole halbkreisförmig zum Fahrerplatz hin angeordnet.
Optisch hatten die Entwickler die kleinmotorigen Baureihen 316 und 318 von den leistungsstärkeren Modellen 320 und 320i durch eine unterschiedliche Frontpartie unterscheidbar gemacht. Während die stärker motorisierten Versionen mit Doppelscheinwerfern und der zusätzlich im Kühlergrill montierten Modellbezeichnung beeindruckten, mussten die leistungsschwächeren Modelle mit schlichten Einfachscheinwerfern auskommen. Doch egal ob mit Einfach- oder Doppelscheinwerfern – schnell zeigte sich, das BMW mit der neuen 3er-Baureihe den Kundengeschmack getroffen hatte.
Im Sommer 1975 war die Ölkrise vorbei und die Konjunktur zog kräftig an. In Zahlen: Bei BMW waren seit Jahresbeginn 1975 bereits 1.300 neue Mitarbeiter eingestellt worden, darüber hinaus wurden Sonderschichten mit dem Gesamtbetriebsrat vereinbart. Das Planungsziel war, erstmals über 200.000 Fahrzeuge pro Jahr zu bauen. Ein Wermutstropfen war allerdings die Kostenentwicklung in der Fahrzeugindustrie, von der BMW im Hochlohnland Deutschland ebenso betroffen war wie die heimischen Wettbewerber.
In eine ganz andere Richtung zielte das Projekt BMW ART CARS, das 1975 begonnen wurde. Mehr aus Spaß verwandelte der amerikanische Künstler Alexander Calder für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans einen BMW 3.0 CSL in ein kunterbunt gelb, weiß, rot und blau lackiertes »Kunstwerk auf Rädern«. Die Idee, Rennsport mit Kunst zu verbinden, kam gut an – der BMW 3.0 CSL legte damit den Grundstein für eine bis ins Jahr 2010 reichende Tradition von insgesamt 17 BMW ART CARS, die von unterschiedlichen Künstlern in den kommenden Jahren gestaltet werden sollten.
Zu diesem Projekt erläutert BMW: »Die BMW Art Car Collection verbindet Kunst, Design und Technik und nimmt damit einen besonderen Platz in der Welt der Kunst ein. Die „rollenden Kunstwerke“ entstammen sowohl dem Rennsport als auch der Serie, sind Limousinen, Coupés und Roadster. Allesamt spannen sie den Bogen von der Pop Art der 70er Jahre über die „Idee der Kontinente“ bis hin zu neuen Konzepten des 21. Jahrhunderts.«{41} Von dieser von ihm begründeten Tradition bekam Alexander Calder indes nichts mit, denn er verstarb nur wenige Monate nach der Präsentation seines Kunstwerks auf Rädern.
Das Ziel, bis Jahresende 200.000 Fahrzeuge zu produzieren, war schneller erreicht als erhofft. Schon am 24. November gab Eberhard von Kuenheim bekannt, dass trotz Kurzarbeit im Januar und Februar schon mehr als 200.000 Autos gebaut worden waren. Nun sollten bis Jahresende 220.000 BMWs von den Bändern rollen und damit ein Rekordumsatz von über 3 Milliarden DM (ca. 1,5 Milliarden Euro) erreicht werden.
Unterm Strich standen im Geschäftsbericht für das Jahr 1975 nicht weniger als 226.688 verkaufte Fahrzeuge im In- und Ausland. Im Inland war das eine Steigerung um 40,8 Prozent. Der Jahresüberschuss war um 76,2 Prozent von 42 Millionen DM (ca. 21 Millionen Euro) auf 74 Millionen DM (ca. 37 Millionen Euro) gestiegen. Der einzige Wert des Geschäftsberichts, der sich verschlechtert hatte, war der Motorradabsatz im Ausland, der um 2,1 Prozent zurückgegangen war.{42}
Zu Beginn 1976 endete in München eine Ära, denn Alexander von Falkenhausen, der seit 1. Mai 1957 für die Motorenentwicklung bei BMW verantwortlich war, ging in Ruhestand. In seine Fußstapfen trat Paul Rosche, der bei BMW bereits jahrelang mit Alexander von Falkenhausen zusammengearbeitet hatte. Immerhin, so tröstete die Mitarbeiterzeitung die Angestellten, sollte Alexander von Falkenhausen auch im Ruhestand weiter als externer Berater für BMW arbeiten.
Zum 1. Januar 1976 ordnete BMW sein Motorradgeschäft neu. Fortan sollte die BMW Motorrad GmbH, bislang eine Tochtergesellschaft der BMW AG, selbständig und eigenverantwortlich geführt werden. Das bedeutete, dass zukünftig alle Aufgaben in den bayerischen BMW-Werken und in der Münchener Verwaltung, die den Bereich Motorrad betrafen, der BMW Motorrad GmbH zugeordnet wurden. Laut BMW-Management war diese Umstrukturierung notwendig, da mit einer massiven Steigerung des Motorradgeschäfts gerechnet wurde. Bis 1985 sollten die Produktionszahlen verdoppelt werden.
Allerdings – auch das wurde deutlich gesehen – wuchs der Wettbewerb durch die immer stärker werdenden japanischen Hersteller Honda, Yamaha, Suzuki und Kawasaki mittlerweile bedrohlich. Die vier Marken beherrschten bereits 75 Prozent des Weltmarkts, während das Sterben der europäischen Motorradindustrie voranschritt. Ein Blick nach England, der einstigen Hochburg des Motorradbaues war trostlos, aber auch in Deutschland, Spanien und Italien kämpften die wenigen verbliebenen Hersteller um ihr Überleben.
BMW 6er Coupé: Zum Genfer Salon 1976 wurde mit dem 630 CS / 633 CSi ein neues Coupé (E24) als Nachfolger der alten E9-Baureihe auf den Markt gebracht. Als Basis diente die Bodengruppe des BMW 5er, dessen Radstand für das Coupé gekürzt wurde. (Bild: Kroelleboelle / Wikimedia Commons)
Bereits im Frühjahr zeigte sich, dass das Jahr 1976 für die deutschen Automobilhersteller ein Rekordjahr werden würde. Lieferfristen von mehreren Monaten wurden zum Regelfall – Opel, Ford, VW, Mercedes-Benz und BMW kamen mit der Produktion trotz Sonderschichten nicht mehr nach. Angestachelt durch die enorme Nachfrage nutzten die Hersteller die Gunst der Stunde und erhöhten die Verkaufspreise um rund 5 Prozent. Dieses Verhalten der Hersteller wurde gemeinhin als Dreistigkeit interpretiert, denn bereits im Jahr 1975 hatten sie ihre Preise kräftig erhöht. BMW beispielsweise gleich zwei Mal, namentlich im März 1975 und kurz darauf im August 1975 ein weiteres Mal.
Zum Genfer Salon 1976 wurde mit dem 630 CS / 633 CSi ein neues Coupé (E24) als Nachfolger der alten E9-Baureihe auf den Markt gebracht. Auch das neue Coupé war auf den ersten Blick der Oberklasse zuzuordnen, zumal es länger und breiter war als das Vorgängermodell. Als Basis diente die Bodengruppe des BMW 5er, dessen Radstand für das Coupé gekürzt wurde. Lieferbar war das Coupé zur Serieneinführung als 630 CS mit einem 3,0-l-Vergasermotor sowie als 633 CSi mit einem 3,2-l-Einspritzmotor. Obwohl noch kein Händler ein Auto auf dem Hof stehen hatte, war die Produktion gleich nach der Präsentation bis zum Herbst ausverkauft. Unerwünschter Nebeneffekt: Die Markteinführung in den USA musste auf Februar 1977 verschoben werden.
Sicher bediente auch das neue Coupé wiederum eine Nische – angesichts des breiten Markterfolgs der 5er- und vor allem der neuen 3er-Reihe konnte aber kaum mehr von einer Nischenpolitik gesprochen werden. Ein Kleinserienhersteller war BMW ohnehin schon lange nicht mehr. In Zahlen ausgedrückt: Neben den rund 1.000 BMW-Händlern in Deutschland verkauften weitere 2.400 Händler in insgesamt 110 Ländern BMW-Fahrzeuge. Im Sommer verkündete Eberhard von Kuenheim demgemäß den Abschied der Münchner von der »Nischen-Modellpolitik« der vergangenen Jahre.
Hierzu konkretisierte der Vorstandsvorsitzende: »Die Bayerischen Motoren Werke, so zeigt sich mit jedem neuen Modell, das auf den Markt kommt, verlassen mehr und mehr jene berühmte Nische, in der sie jahrelang ihre spezifische Kundschaft und damit ihren Rückhalt gefunden hatten. BMW begibt sich in die offene Arena. Mit drei breit aufgefächerten Modellreihen treten wir dort gegen vergleichbare Angebote der anderen Automobilhersteller an. Die Konkurrenz wird härter. Aber unsere Chancen sind groß, und wir werden sie wahrnehmen.«{43} Angesichts der Tatsache, dass BMW seinen Export im ersten Halbjahr 1976 um 50 Prozent gesteigert hatte, klangen die Worte von Eberhard von Kuenheim noch nicht einmal überheblich.
Unterdessen gab es eine gravierende Personalveränderung bei BMW, denn Paul Bracq, der München bereits 1974 verlassen hatte, erhielt nun einen offiziellen Nachfolger. Neuer BMW-Chefdesigner wurde der von VW/Audi kommende 42 Jahre alte Claus Luthe, der bereits als Gestalter des optisch und technisch außergewöhnlichen NSU Ro 80 aufgefallen war. Nicht wenige Autokenner sprachen aufgrund des Designs des Ro 80 gar von einem Meilenstein in der Automobilgeschichte. Doch es war ein offenes Geheimnis, das Paul Bracq bei BMW bereits an einer weiteren Modellreihe gearbeitet hatte, die alsbald präsentiert werden würde.
Im Sommer 1976 wurde dem 5er ein erstes, jedoch tiefgreifendes Facelift zuteil; insgesamt 41 Veränderungen und Verbesserungen wurden vorgenommen. Bei den Sechszylindermotoren wurde die Leistung um 5 PS (3,6 kW) angehoben. Optisch war der Facelift an der geänderten BMW-Niere im Kühlergrill zu erkennen, die jetzt wie beim 3er bis in die Motorhaube reichte und sich dort als Wölbung bzw. Hutze bis zur Frontscheibe fortsetzte. Weiterhin wurden größere Heckleuchten montiert, zudem war der Tankdeckel nun rechts hinten im Kotflügel montiert und nicht mehr rechts neben dem Nummernschild.
Auch wenn sich viele der Änderungen auf nebensächliche Bauteile wie Lüftungsgitter, Abdeckungen oder Klapptaschen bezogen, so war doch unterm Blech mehr verändert worden als es die optischen Modifikationen vermuten ließen. Neugestaltet wurden folgende Blechteile: »Gepäckraumboden, Abdeckung des Tankeinfüllstutzens, Vorderwand, Abschlusswand, Heizung, Luftleitblech, Trennwand Gepäckraum, Frontverkleidung Oberteil, Frontverkleidung Unterteil, Heckspiegel, Seitenwand hinten rechts und die Fronthaube.«{44}
Auch die Wettbewerber schliefen nicht: Neu waren die Anstrengungen, die Audi mittlerweile an den Tag legte. Das formulierte Ziel des Managements war, das Image eines Audi-Fahrers mit Hosenträgern, Hut und Wackeldackel auf der Heckablage abzustreifen. Stattdessen sollte Audi als Technologieführer im Automobilbereich aufgebaut und deutlich von VW abgegrenzt werden. Bei diesen Ambitionen mussten nicht nur Fachleute schmunzeln – dies vor allem mit Blick auf den technisch anspruchsvollen NSU Ro 80, der nur Verluste einfuhr.
Und war schon der alte Audi 100 als »Prokuristen-Mercedes« tituliert worden, so galt diese Einschätzung erst recht für den 1976 vorgestellten neuen Audi 100 C2. Er wurde in der oberen Mittelklasse direkt auf Augenhöhe der Platzhirsche Mercedes W 123 und 5er-BMW positioniert. Dabei konnte der Audi 100 im direkten Vergleich mit einem günstigen Preis und ansprechenden Fahrleistungen punkten.
Wie ernst es dem Audi-Marketing mit dem Imagewechsel war, zeigte sich in der Anstrengung, den Händlern angesichts der anspruchsvollen Klientel die entsprechenden Umgangsformen zu vermitteln. Statt leutselig Stammtischsprüche zu klopfen, wurde den Verkäufern in der zu diesem Zweck aufgelegten Verkaufsfibel beispielsweise geraten, mit dem neuen Audi 100 zu Tennisvereinen, Ausflugslokalen, Pferderennen, Yacht- und Jagdclubs zu fahren.
Im Bereich Motorrad reagierte BMW auf den Boom, indem zur IFMA (Internationale Fahrrad- und Motorradausstellung) im Herbst 1976 die neue BMW R 100 RS präsentiert wurde. Damit war sie eine der ständig von Besuchern umlagerten Hauptattraktionen der Veranstaltung. Unter dem Sammelnamen »Strich-Sieben« hatten die Ingenieure ein Modell konstruiert, in dessen Rahmen der traditionelle, per Fahrtwind gekühlte Boxermotor hing. Gemäß der BMW-Tradition erfolgte der Antrieb über eine Kardanwelle, gebaut wurde das neue Modell im Motorradwerk Berlin.
Neu war die von Motorrad-Chefdesigner Hans-Albrecht Muth im Windkanal ausgetüftelte Vollverkleidung, die weltweit erstmals bei einem Serienmotorrad rahmenfest montiert war. Damit bot die BMW R 100 RS nicht nur optimalen Wetterschutz, sondern blieb auch bei hohen Geschwindigkeiten beherrschbar und spurtreu. Neben einer stattlichen Reduzierung der Seitenwindempfindlichkeit hatte das Designerteam den Anpressdruck auf das Vorderrad um 20 Prozent gesteigert. Laut Angaben von BMW konnte so die Gierrate um 64 Prozent gesenkt und damit die Fahrstabilität unmittelbar verbessert werden. Beileibe keine Banalität, denn: Gerade die Beherrschbarkeit bei Geschwindigkeiten über 130 km/h war 1976 keineswegs selbstverständlich – die tödlichen Unfälle mit dem schweren Tourer Honda Goldwing legten davon beredtes Zeugnis ab.
Der mit Spannung erwartete Geschäftsbericht glänzte mit Superlativen, wobei im Geschäftsbericht 1976 erstmals zwischen der »BMW AG«, dem »BMW Konzern« sowie der »BMW Gruppe« unterschieden wurde. Die Umsätze der BMW AG waren darin um 31,7 Prozent gestiegen, das Gesamtkonzernergebnis sogar um 35,5 Prozent höher angegeben. Ebenso waren die Fahrzeugverkäufe deutlich gesteigert worden, was sich in Verbindung mit den Preiserhöhungen der letzten Monate in einem satten Jahresgewinn von 126 Millionen DM (ca. 63 Millionen Euro) niederschlug. Wie bereits im Vorjahr bildete der mit 0,3 Prozent rückläufige Motorradabsatz im Ausland die einzige negative Zahl des Jahresvergleichs im Geschäftsbericht.{45}
Zur Situation von BMW schrieb die FAZ anerkennend: »Der bayerische Wunderknabe der Automobilindustrie kann sich derzeit ohne Mühe auch als wirtschaftspolitischer Musterschüler präsentieren. BMW schafft neue Arbeitsplätze, investiert so viel wie noch nie und ist zudem ausgesprochen innovationsfreudig. Das Unternehmen ist auch keiner jener „opinion leaders“ in der Industrie, die bei günstiger eigener Situation den Hintergrund grau in grau ausmalen.«{46}
Ende der Modelloffensive
Das Jahr 1977 startete mit der Nachricht, dass in Berlin-Spandau auf dem bereits vorhandenen Gelände ein neues Motorradwerk gebaut würde. Parallel dazu sollten die bereits vorhandenen Gebäude saniert und bis 1978 ein zentrales Ersatzteillager für BMW-Motorräder errichtet werden. Insgesamt 100 Millionen DM (ca. 50 Millionen Euro) wollte die BMW Motorrad GmbH dort bis zum Jahr 1982 investieren. Bei der Motorenentwicklung zeigte sich Motorrad-Entwicklungschef Dr. Dietrich Reister konservativ. Statt wie die japanischen Hersteller die technische Entwicklung voranzutreiben, wollte Reister unverändert den luftgekühlten Boxermotor mit einem Kardanantrieb kombinieren, denn die »Zeit der großen Steigerungen bei Leistung und Höchstgeschwindigkeit der Motorräder werde zu Ende gehen«{47}.
Während BMW im Motorradbereich expandierte, war unterdessen im Automobilbereich die Spannung groß: Nach 5 Jahren Entwicklungszeit und über 3 Millionen Testkilometern machte BMW im Frühjahr 1977 schließlich ernst mit dem Angriff auf Mercedes-Benz und präsentierte ein eigenes Automobil für die Oberklasse. Dies war eine durchaus spannende Entwicklung auf dem deutschen Automarkt, denn Opel verabschiedete sich gerade aus der prestigeträchtigen Oberklasse, in der die Rüsselsheimer keine Zukunft mehr sahen. Die drei Modelle Kapitän, Admiral und der mit V8-Motor ausgerüstete Diplomat (KAD-Klasse) wurden fortan durch den deutlich kompakteren Opel Senator und das biedere Coupé Opel Monza ersetzt.
Bei einem Blick auf die Optik der 7er-Reihe (E23) zeigte sich die logische und konsequente Fortführung des eingeschlagenen Designwegs der vergangenen Jahre. Auf der einen Seite sportlich und repräsentativ – andererseits klar, schnörkellos und ohne jeglichen barocken Zierrat. Natürlich kam als kennzeichnendes Merkmal auch der »Hofmeister-Knick« wieder zum Einsatz, wobei das 1976 vorgestellte 6er Coupé bereits viele Design-elemente vorweggenommen hatte.
BMW 7er-Reihe: Nach 5 Jahren Entwicklungszeit und über 3 Millionen Testkilometern machte BMW im Frühjahr 1977 schließlich ernst mit dem Angriff auf Mercedes-Benz. Mit dem 7er (E23) präsentierten die Münchner ein ansprechendes Automobil für die Oberklasse. (Bild: nakhon100 / Wikimedia Commons)
Auch aus technischer Sicht brauchte sich der BMW 7er nicht vor dem Stuttgarter Wettbewerber verstecken, denn die Münchner Ingenieure hatten alle Register ihres Könnens gezogen. Mit dem Einsatz von digitaler Motorelektronik hatten die Entwickler zudem ein klares Zeichen gesetzt. Stolz fasste die BMW-Mitarbeiterzeitung BAYERNMOTOR die Serienausstattung zusammen:
»Serienmäßig sind der BMW 730 und der 733i mit Zentralverriegelung und alle drei Modelle [mit 728] mit Fond- und Vordertürenseitenbeheizung, integriertem Überrollbügel, elektronischem Tachometer und Tourenzähler und 85-Liter-Tank ausgestattet. Die Hohlraumversiegelung und der Unterbodenschutz, die eingearbeitete Service- und Reparaturfreundlichkeit, die Unterbringung des Erste-Hilfe-Kastens in der Mittelarmlehne, elektrisch einstellbarer Außenspiegel (auf Wunsch auch an der Beifahrertür), vorbereiteter Telefoneinbau, Rückstrahler an den Türen, getönte Rundumverglasung vervollständigen das Angebot.«{48}
Besonderes Augenmerk hatten die Entwickler zudem auf die Innenmaße gelegt, wobei sich diese bei allen wichtigen Werten wie Kopffreiheit und Raumangebot mit der S-Klasse mindestens ebenbürtig zeigten. Zum Marktstart waren die drei Modelle 728, 730 und 733i im Programm, die durchgängig mit den aus dem Vorgängermodell E3 übernommenen M30-Motoren ausgerüstet wurden. Eine Sparversion mit vier Zylindern, so wie beim BMW 520 bereits vorexerziert, sollte es vom 7er nicht geben.
Bei Mercedes-Benz wurde durchaus registriert, mit welcher fahrzeugbauerischen Kompetenz das neue Münchner Flaggschiff konstruiert und gefertigt worden war. Nach dem Misserfolg des BMW »Barockengel« und der nachfolgenden Modellreihe Reihe E3 war der 7er nun unbestritten auf Augenhöhe mit der S-Klasse – eine neue Sachlage, die in Stuttgart nicht offen kommentiert wurde. Doch auch in München hielten sich Eberhard von Kuenheim und der Verkaufsvorstand Hans-Erdmann Schönbeck bedeckt. Als Angriff auf Mercedes-Benz, so erklärten beide unisono, sei der BMW 7er nicht zu werten, denn BMW und Mercedes-Benz seien ja zwei ganz eigenständige Marken.{49} Was BMW allerdings nicht zu bieten hatte, das war ein V8-Motor.
Besondere Sorgfalt und Energie wurde der Fertigungsqualität und der Verarbeitung des 7ers zuteil. Dies nicht ohne Grund, denn hier bildeten die Fahrzeuge von Mercedes-Benz immer noch die Messlatte, an die BMW bislang nicht heranreichte. Dies sollte sich nun mit dem 7er ändern, weil eine spürbar höhere Fertigungsqualität ganz oben auf der Prioritätenliste stand. Zum Vorgehen von Eberhard von Kuenheim erläuterte DER SPIEGEL: »Schon deshalb wird der neue BMW nicht im Münchner Stammwerk gefertigt, wo überwiegend Gastarbeiter werkeln. Im bayerischen Dingolfing dagegen, wo die „Siebener-Reihe“ vom Band laufen soll, legen überwiegend akkurate Niederbayern Hand an. Allein dieser Ortswechsel soll nach den Erfahrungen der Münchner die Fertigungsqualität spürbar verbessern.«{50}
Schließlich endete im Juli 1977 auch die Produktion des BMW 1502, der seit 1975 im Programm verblieben war. Immerhin 72.635 Exemplare waren von diesem Sparmodell von den Fließbändern gerollt. Als neues Einstiegsmodell fungierte nun der 316. Auch am anderen Ende der Leistungsskala gab es zum neuen Modelljahr Veränderungen, denn der Vierzylindermotor im BMW 320 wurde durch einen Motor mit sechs Zylindern ersetzt. Für die Entwicklung dieses Motors hatte BMW 110 Millionen DM (ca. 55 Millionen Euro) aufgewandt. Dabei hatten die Konstrukteure den neuen Motor so konstruiert, dass er schneller und kostengünstiger produziert werden konnte als die alten Motoren mit vier Zylindern.
Das präsentierte, inoffiziell als 320/6 bezeichnete Modell erhielt erstmals den neu entwickelten kleinen Sechszylindermotor M20{51}, der deutlich kürzer baute als der seit 1968 verwendete große M30-Motor. Der neue M20-Motor sollte künftig Hubraumvolumina von 2.000 bis 2.700 cm3 abdecken. Technisch gesehen unterschied sich der M20-Motor vom größeren M30-Motor grundlegend durch den Nockenwellenantrieb über Zahnriemen statt über Steuerkette. Auch dieser Motor eignete sich bestens für Tuningarbeiten, allerdings zeigte sich bald, dass der Zylinderkopf bei nicht regelgerecht warmgefahrenen Fahrzeugen zu Rissen neigte.
Neben dem Modell 320 mit 122 PS (90 kW) stand mit dem 323i, der den 320i ersetzen sollte, ein weiteres neues Modell der 3er-Reihe auf dem Messestand der IAA im Herbst 1977. Diese beiden 3er mit ihren Sechszylindern waren während der Messe von BMW-Enthusiasten umlagert – ein sicherer Hinweis darauf, dass das BMW-Marketing den Geschmack der Kunden wieder richtig eingeschätzt hatte. Mit seiner Bosch K-Jetronic-Benzineinspritzung leistete der 323i immerhin 143 PS (105 kW).
Eine weitere Attraktion war eine Cabrioversion des 3er-BMW, die bei der Baur Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH in Stuttgart-Berg entstehen sollte. Dieses Baur Topcabriolet war ungewöhnlich konzipiert, denn statt eines Roadsterdaches rollte diese Version als »Sicherheits-Cabrio« mit zu öffnendem Targa-Dach und Überrollbügel zum Kunden. Die Fensterrahmen blieben erhalten, der hintere Teil des Daches konnte via Faltverdeck geöffnet werden. Baur-Chefkonstrukteur Hermann Wenzelburger und Karl Baur hatten sich damit für eine Konstruktion entschieden, wie sie bereits in ähnlicher Form beim BMW 2002 Baur Cabriolet von 1971 realisiert worden war. Allerdings waren von 1971 bis 1975 gerade einmal 2.317 Stück dieses Modells entstanden.{52}
BMW Baur Topcabriolet: Diese offene Version rollte mit Targa-Dach und Überrollbügel zum Kunden. Die Fensterrahmen blieben erhalten, der hintere Teil des Daches konnte via Faltverdeck geöffnet werden. (Bild: Boekenwurm / Wikimedia Commons)
Die Planer bei BMW vertrauten darauf, dass es unter den BMW-Kunden einen wachsenden Markt für ein solches Baur-Cabriolet gäbe, auch wenn der Preis deutlich über dem eines herkömmlichen Modells liegen würde. Fakt war: Der Porsche 911, bei dem diese offene Dachkonstruktion »Targa« getauft worden war, verkaufte sich recht ordentlich. Vertrieben werden sollte das Baur Topcabriolet ganz regulär mit voller Werksgarantie über das BMW-Händlernetz.
Expansion mit Licht und Schatten
Im Juni 1977 wurde von BMW mit einem Kapitaleinsatz von 3 Millionen DM (ca. 1,5 Millionen Euro) eine weitere Firma gegründet, die BMW Marine GmbH. Dort wurden Bootsmotoren entwickelt, die schon im Frühjahr 1978 auf den Markt kommen sollten. Diese Motoren entstanden auf der Basis der vorhandenen Vier- und Sechszylindermotoren mit einer Leistungsspanne von 120 bis 190 PS (86 bis 136 kW). Gekoppelt wurden diese »marinisierten« Motoren mit einem neu entwickelten Z-Antrieb, den BMW in Zusammenarbeit mit der Firma Hurth entwickelt hatte.
Zu diesen marinisierten Motoren erläuterte BMW in der Mitarbeiterzeitschrift BAYERNMOTOR: »Unter dem Stichwort „Marinisierung“ von BMW-Motoren läuft hier ein Projekt, das sich in den nächsten Monaten zu einer kleinen, aber leistungsfähigen Fabrik auswachsen wird. Denn Marinemotoren müssen in vielen Einzelheiten anders aussehen als Motoren für Luft oder Straße:
So erhalten die BMW-Bootsmotoren andere Kolben (für Regularbenzin) als die Ausführungen im Milbertshofener Werk.
Sie laufen mit maximalem Drehmoment (andere Ansaugkrümmer) bei niedrigeren Drehzahlen.
und mit einer Zweikreiskühlung, weil sie ihre überschüssige Wärme an das Salzwasser abgeben, in dem sie fahren.
Bootsmotoren bekommen andere Vergaser als Automotoren
und in der Benzin-Version statt eines Luftfilters lediglich einen Flammenschutz; denn Seeluft ist noch sauber.
Auch eine spezielle Lichtmaschine brauchen die Bootsmotoren.«{53}
So ganz fremd war BMW der maritime Sektor nicht, denn schon vor dem Zweiten Weltkrieg gab es zum Bootsbetrieb umgebaute Motoren bei BMW zu kaufen, ganz zu schweigen von dem später marinisierten 3,2-l-V8-Monstrum des BMW 502. Neben der Motorenentwicklung galt es nun vordringlich, in den wichtigsten Märkten in Europa, somit Skandinavien, Italien, Frankreich und England, darüber hinaus in den USA, für den Bootssektor ein separates Vertriebsnetz aufzubauen.
Das Jahr 1977 bildete gleichzeitig Höhepunkt und vorläufigen Abschluss der Modelloffensive, die Eberhard von Kuenheim zu Anfang der siebziger Jahre eingeleitet hatte. Parallel dazu war es gelungen, das angeschlagene Image von BMW als Marke für Verkehrsrüpel zu verändern. Hierzu bestätigt DER SPIEGEL: »Den Weg aus der engen Marktnische der betont sportlich-aggressiven Autos in das breitere Segment der anspruchsvollen, auf Luxus und außergewöhnliche Technik getrimmten Wagen hatte das BMW-Management in den letzten Jahren bei allen fälligen Renovierungen des Modellprogramms bewußt forciert.«{54}
Auch der Geschäftsbericht des Jahres 1977 war mehr als zufriedenstellend ausgefallen. Allerdings war der Jahresüberschuss ganz leicht von 126 Millionen DM (ca. 63 Millionen Euro) auf 125,3 Millionen DM (ca. 62,7 Millionen Euro) gefallen. Doch der Geschäftsbericht hielt auch ein handfestes Ärgernis parat, denn die Motorradverkäufe waren 1977 für BMW in Deutschland weiter rückläufig gewesen: 17,1 Prozent weniger als im Vorjahr – das bedeutete, dass in Deutschland (BRD) gerade einmal noch 6.668 BMW-Zweiräder verkauft worden waren. Allerdings wurde diese negative Zahl durch den starken Zuwachs an Motorradverkäufen im Ausland mehr als ausgeglichen. In Zahlen: Unterm Strich standen mit einem Zuwachs von 11,7 Prozent insgesamt 31.515 gebaute Motorräder, und das war nichts anderes als das bislang höchste Produktionsergebnis. {55}
BMW startete ins Jahr 1978 mit einer vollständigen Produktpalette, die unten bei der 3er-Reihe begann und über die facegeliftete 5er-Reihe schließlich in der Oberklasse bei der 7er-Reihe endete. Vor allem die Nachfrage nach Modellen der 3er-Reihe hatte alle Erwartungen übertroffen und hielt unverändert an. Als richtige Verkaufsrenner erwiesen sich die 3er-Modelle mit dem neuen Sechszylindermotor. Dazu verkaufte sich auch der 520 überdurchschnittlich gut. Bis Ende 1978 – so viel war abzusehen – würde BMW bei der Fertigung an seine Kapazitätsgrenzen stoßen, weshalb bereits Anfang des Jahres nach einer Lösung des Problems gesucht wurde.
BMW benötigte Platz, und zwar in jeder Hinsicht. In diesem Sinne wurde im Frühjahr 1978 nach nur 18 Monaten Bauzeit das neue Hochregallager in Dingolfing fertiggestellt. Dieses 155 m lange und 40 m hohe, elektronisch gesteuerte Hochregallager bot Raum für rund 36.000 Gitterboxpaletten. Die Materialbewegungen geschahen darin vollautomatisch und von einem Systemrechner überwacht, der aus Sicherheitsgründen redundant ausgelegt war. Dieser Rechner steuerte die gesamte Fördermechanik und die Vergabe der Lagerplätze. Trotz der enormen Menge von täglich 2.000 Ein- und Auslagerungen saßen in der Steuerzentrale lediglich zwei Mitarbeiter zur Überwachung der Abläufe.
Immer schwieriger zeigte sich das Motorradgeschäft, das mittlerweile in beängstigender Weise von den japanischen Herstellern dominiert wurde. Neben der aggressiven Preispolitik, mit der die Japaner ihre Motorräder in die Märkte drückten, war ein weiterer Faktor bedeutsam geworden: der Abschied der japanischen Hersteller von großvolumigen Zweitaktmotoren, die aufgrund ihres Emissionsverhaltens und ihrer aufdringlichen Akustik nicht mehr zeitgemäß waren. Wohl gab es Ende der siebziger Jahre noch zwei- und dreizylindrige Zweitaktmotorräder – aber der Höhepunkt der Marktakzeptanz war überschritten. Die Zukunft gehörte Viertaktmotorrädern.{56} Aus diesem Grund hatten die japanischen Hersteller die Entwicklung von großvolumigen Viertaktmotorrädern vorangetrieben.
Die Ergebnisse dieser Entwicklungsarbeit konnten sich nicht nur sehen lassen, sondern sie bedrohten in ihrer Quantität und Qualität direkt die BMW-Motorradsparte. Wenn auch die Fahrwerke der asiatischen Modelle oftmals der Leistungsstärke der eingebauten Motoren nicht gewachsen waren, so machten die vier- und sogar sechszylindrigen Maschinen doch klar, dass sich die Machtverhältnisse im Motorradsektor in den letzten Jahren gravierend verschoben hatten. BMW begegnete dieser Herausforderung mit den zwei neuen, hubraum- und leistungsschwächeren Modellen R 45 und der R 65, die ab Juni in Berlin-Spandau gebaut werden sollten.
BMW stieß mit der R 45 und der R 65 in die Mittelklasse vor, wo die Modelle mit Zuverlässigkeit, einfacher Wartung, Langlebigkeit und Qualität punkten sollten. Konsequent hatten die Entwickler dabei auf komplexe Hochleistungstechnik verzichtet. Mit 5.880 DM bzw. 7.290 DM (ca. 3.000 bzw. 3.600 Euro) waren die beiden neuen BMW-Modelle im Vergleich nicht gerade preisgünstig – trotzdem haperte es an der Marge. Hinsichtlich der heiklen Preisgestaltung der kleineren Modelle sprach der BMW-Motorrad-Vertriebsleiter ganz offen von einer Mischkalkulation, bei der die kleineren Modelle durch die großen subventioniert würden. Zur Kölner IFMA im Herbst war mit der R 100 RT zudem ein Tourenmodell angekündigt worden.
Trotzdem wurde im Herbst 1978 offensichtlich, dass das Geschäft mit den Motorrädern schlechter lief als geplant. Dies nicht zuletzt, weil neben den starken Wettbewerbern der Dollar ständig an Kaufkraft verlor und die in die USA exportierten Motorräder damit immer teurer wurden. Es wurde deshalb mittlerweile bei BMW kein Hehl daraus gemacht, die Produktion zu reduzieren. Eine Einstellung der Motorradfertigung wurde jedoch nicht erwogen.
Unter BMW-Fahrern sorgte indes eine weitere Meldung für Erstaunen: Es war bekanntgegeben worden, dass BMW in Kooperation mit der Steyr-Daimler-Puch AG in Österreich Dieselmotoren für den stationären und den mobilen Betrieb entwickeln und herstellen wollte. Ein Dieselmotor in einem BMW? Hatte nicht der BMW-Pressesprecher erst vor wenigen Jahren einer solchen Kombination eine rigorose Absage erteilt?
Schon kurz darauf verdichteten sich die Gerüchte um den Dieselmotor, denn am 28. Juni 1978 unterzeichneten die Verantwortlichen den Vertrag zum Bau einer gemeinsamen Fabrik für die Fertigung von Dieselmotoren in Österreich. Ab dem Jahr 1982 sollten die dort von der gemeinsamen Tochtergesellschaft produzierten Dieselmotoren für BMW-Automobile sowie für den maritimen Einsatz verfügbar sein. Spätestens damit war klar, dass diese Ankündigung kein Aprilscherz gewesen war. Nicht zuletzt zeigte ein Blick über den Tellerrand zu den anderen deutschen Herstellern, wie gut ein Dieselmotor zu einem modernen Automobil passte.
Auf der Jahreshauptversammlung verwies Eberhard von Kuenheim auf die anstehenden US-Abgasgesetze, deren scharfe Grenzwerte voraussichtlich nur mit einem Dieselmotor zu erfüllen seien. 300 Millionen DM (ca. 150 Millionen Euro) würden in die Entwicklung der Dieselmotoren fließen. Unterstützt werden sollten die bayerischen Ingenieure bei ihrer Entwicklungsarbeit durch den Dieselexperten Prof. Dr. Helmut List, dem Leiter der Grazer Anstalt für Verbrennungsmotoren.
Während im Motorradsektor schwierige Zeiten angebrochen waren, wurde der Automobilbau bei BMW von einer Welle der Euphorie getragen. Schon verdichtete sich das nächste Gerücht – denn im Herbst 1978 sollte eine straßentaugliche Serienversion eines Mittelmotor-Sportwagens von BMW als Serienfahrzeug angeboten werden. Bereits im Herbst 1977 hatten erste Bilder ihren Weg in die Redaktionen der Fachmagazine gefunden. Bekannt war, dass Jochen Neerpasch, der Leiter der BMW Motorsport GmbH, einen Wagen (E26) für die Gruppe 4 aufbaute, der für das Jahr 1979 von der FIA homologiert werden sollte. Hierzu mussten laut Reglement in 24 Monaten 400 Exemplare gebaut werden, wobei intern mit einer Produktion von 800 Exemplaren gerechnet wurde.
Weiter bekannt war, dass Giorgio Giugiaro am Design mitgearbeitet hatte und bei Lamborghini in Italien bereits die ersten Prototypen montiert wurden. In München sollte der »BMW M1« getaufte Wagen dann mit einem Sechszylindermotor versehen und komplettiert werden. Allerdings funktionierte die Zusammenarbeit mit Lamborghini nicht wie geplant, so dass die Produktion des Gitterrohrrahmens anderweitig vergeben wurde. Lamborghini war aufgrund von Geldproblemen gegenüber BMW in Lieferschwierigkeiten geraten, weil die italienische Firma wegen nicht bezahlter Rechnungen keine Teile mehr von ihren Zulieferern erhielt.
Hierzu konkretisiert das Fachmagazin MOTOR KLASSIK: »BMW ließ dann bei Marchesi den Rahmen schweißen, die GFK-Karosserie entstand bei T.I.R., vormontiert wurde der BMW M1 bei ItalDesign – der Firma von Giorgio Giugiaro. [...] So wurden die Karosserien und der Gitterrohrrahmen der letztlich insgesamt 453 Exemplare in Italien hergestellt, danach kamen sie per Express nach Deutschland. Nicht etwa nach München, sondern in die Stadt von Mercedes und Porsche, denn die Endmontage übernahm Baur in Stuttgart.«{57} Im Herbst rollten schließlich die ersten BMW M1 für 100.000 DM (ca. 50.000 Euro) vom Band.
Der BMW M1 sorgte für weltweites Medienecho. Seine Optik erinnerte an den 1972 von Paul Bracq entworfenen BMW Turbo X1, selbst die beiden BMW-Embleme am Heck waren als Designelement übernommen worden. Auf Flügeltüren hatten die Entwickler jedoch verzichtet. Statt eines aufgeladenen Motors mit vier Zylindern kam für das Serienmodell ein Reihensechszylinder-Saugmotor mit 3,5 Litern Hubraum (M88) und einer Leistung von 277 PS (204 kW) zum Einsatz, bei dem pro Zylinder 4 Ventile für den Gaswechsel zuständig waren.
BMW M1: Der 1978 vorgestellte BMW M1 sorgte für weltweites Medienecho. Seine Optik erinnerte an den 1972 von Paul Bracq entworfenen BMW Turbo X1. Auf Flügeltüren hatten die Entwickler jedoch verzichtet. (Bild: Mr.choppers / Wikimedia Commons)
Der M1 war zwar als reines Rennfahrzeug konzipiert worden, trotzdem war er im Straßenverkehr alltagstauglich. Sogar ein kleiner Kofferraum für die Fahrt ins Wochenende war unter der Fronthaube vorhanden. Als homologiertes Serienfahrzeug besaß der BMW M1 eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE), weshalb die Ingenieure im Vorfeld durch Crashtests die passive Sicherheit nachweisen mussten. Der BMW M1 war also nicht nur optisch und technisch ein Leckerbissen, sondern auch noch sicher und mit seiner Klimaanlage zudem noch leidlich komfortabel. Für das Jahr 1979 wurde mit der Procar-Serie sogar eine eigene Rennserie für den BMW M1 geschaffen.
Das Jahr 1978 endete versöhnlich, auch wenn die Zahlen beim 7er hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. BMW war damit zwar aufgestiegen – aber auf Augenhöhe mit Mercedes-Benz waren die Münchner noch lange nicht. Wie es schien, hatten die BMW-Planer die Markentreue der Kunden im Premiumsegment unterschätzt. Auch die rückläufige Motorradproduktion blieb ein Quell des Ärgers, hier waren die Stückzahlen 1978 um weitere 6,1 Prozent auf 29.580 Stück gesunken. Zum Vergleich: BMW hatte im Jahr 1978 rund 30.000 Motorräder gebaut, während bei Honda in diesem Zeitraum 2,4 Millionen Zweiräder aus den Fabriken gerollt waren. Der Geschäftsführer der BMW Motorrad GmbH, Rudolf Graf von der Schulenburg, hatte BMW bereits Anfang Oktober 1978 verlassen.{58}
Und tatsächlich zeigten Vergleichstests beispielsweise von BMW-Modellen mit dem neuen Mittelklassetourer Honda CX 500, dass BMW kaum als Technologieführer zu bezeichnen war. Alle Trends in diesem Bereich – so der Trend zu vierzylindrigen Motoren, der Trend zur Wasserkühlung, der Trend zu Softchoppern oder der neue Trend zu geländegängigen straßenzulassungsfähigen Motorrädern (neuerdings »Enduro« genannt) – waren bislang von den BMW-Motorradplanern ignoriert worden. Angesichts der schlechten Zahlen und des eher negativen Ausblicks war 1979 eine Trendwende überfällig.
Für die deutschen Automobilhersteller stand hingegen die Frage im Raum, ob sich die bereits etwas abkühlenden Verkaufszahlen im Jahr 1979 weiter verschlechtern würden. Auch hier mussten sich die Planer von BMW angesichts der Verkaufserfolge der Wettbewerber fragen lassen, ob sie nicht den Trend zum Dieselmotor verschlafen hatten. Zur Erinnerung: Erst 1982, so die Planung, sollten erstmals BMW-Automobile mit einem Dieselmotor produziert werden. Auf der anderen Seite standen bei BMW unverändert solide Auftragseingänge, die teilweise monatelange Lieferfristen nach sich zogen.
Intern wurde deshalb 1979 von einem Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich ausgegangen. Der Jahresverlauf zeigte jedoch, dass der vergangene, mehrjährige Boom vorbei war. Drastische Preiserhöhungen auf den Weltrohölmärkten sowie eine erhebliche Verteuerung der Rohstoffimporte machten der Automobilindustrie zu schaffen. Die Auftragseingänge gingen 1979 zurück, und schon trübte die Angst vor einer neuen Krise die Stimmung. Gerade die Anbieter von großen Modellen, so Mercedes-Benz und BMW, spürten die Kaufzurückhaltung. Bei BMW kam der Umstand hinzu, dass der große 7er ohnehin eher zögerlich gekauft wurde.
DER SPIEGEL brachte die Situation beim 7er auf den Punkt: »Statt der sonst bei der Stammkundschaft so geschätzten sportlichen Raffinesse und einer schnittigen Form zeigte die neue Limousine nur ein gefälliges Allerweltskleid und bot Fahreigenschaften nach Art des Hauses Mercedes. Trotz aufwendiger Werbekampagnen konnten die 7er-BMW im Verkauf nicht Anschluß an die Mercedes-Limousinen finden. Noch schwieriger wurde die Situation für BMW, als sich im vergangenen Jahr ein dritter Konkurrent nach jahrelangen Mißerfolgen im Markt der Großen etablierte: Opel mit den neuen Sechszylinder-Modellen Senator und Monza. Von den spurtstarken, aber im Preis um etliche Tausender billigeren Opel sahen die Münchner in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres nur die Rücklichter. Opel verkaufte in der Prestigeklasse 8.427 Senator-Limousinen, BMW nur 6.018 seiner 7er-Modelle. Mercedes verbesserte seine Position in der Neuzulassungstabelle um 10 Prozent auf 11.596 S-Klasse-Limousinen.«{59}
Und noch ein weiteres Problem plagte die deutsche Automobilindustrie am Ende des Jahrzehnts: der Ansturm der japanischen Automobilhersteller auf Europa, die dank des günstigen Wechselkurses des Yen ihre Klein- und Kompaktwagen trotz Zoll- und Frachtkosten bemerkenswert kostengünstig auf den Markt bringen konnten. Sechs Hersteller hatten sich in Deutschland bereits etabliert: Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan, Mazda und Suzuki.
Jeder zehnte Neuwagen in Westdeutschland war mittlerweile japanischen Ursprungs, in den USA bereits jeder vierte. Angesichts dessen, wie aggressiv die Japaner die europäische Uhren-, Kamera- und Motorradindustrie angegriffen hatten, entstand hier speziell für die in den unteren Fahrzeugklassen vertretenen Automobilhersteller Europas ein existenzbe-drohendes Potenzial.
Tatsächlich hatte die BMW AG das Jahr 1979 versöhnlich abgeschlossen, denn alle relevanten Kennzahlen waren gestiegen, so beispielsweise der Umsatz um 10,1 Prozent. Auch der Jahresüberschuss war deutlich nach oben geklettert. Sorgenkind blieb unverändert die Motorradproduktion, die 1979 dramatisch um 17,5 Prozent zurückgegangen war. Statt 29.580 Motorräder waren nur noch 24.415 Exemplare verkauft worden. Der Blick in den Geschäftsbericht zeigte zudem, dass etliche der im Jahr 1978 produzierten BMW-Motorräder erst im Jahr 1979 verkauft wurden.{60}
In München stand Eberhard von Kuenheim nun am Ende des Jahrzehnts vor der Entscheidung, BMW strategisch neu auszurichten. Bei einem Rückblick zeigte sich, dass das Unternehmen BMW in seiner Zeit als Automobilhersteller in der Vergangenheit bereits zwei Mal mit einer antizyklischen Investitionspolitik gut gefahren war: Erstens bei der Übernahme des finanziell maroden Automobilherstellers Glas im Jahr 1966, durch die für einen vergleichsweise geringen Kaufpreis dringend benötigte Fertigungskapazitäten geschaffen worden waren. Zweitens beim Bau eines neuen Werks in Dingolfing mitten in der Ölkrise 1973, der von vielen Beobachtern mit ungläubigem Kopfschütteln quittiert worden war. Da Eberhard von Kuenheim mit einem neuen Boom spätestens 1983/1984 rechnete, galt es nun, für das neue Jahrzehnt die Weichen zu stellen.