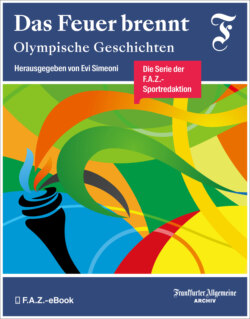Читать книгу Das Feuer brennt - Frankfurter Allgemeine Archiv - Страница 10
„Ich muss, muss, muss!“ Willi Holdorf war der erste deutsche Olympiasieger im Zehnkampf. Sein Zusammenbruch nach dem 1500-Meter-Lauf 1964 in Tokio ist legendär geblieben.
ОглавлениеVon Hartmut Scherzer
Wie betrunken torkelt Willi Holdorf auf den letzten zehn Metern. Der „Sterbende“, so die dramatische Metapher des französischen Journalisten Edouard Seidler in seiner preisgekrönten Reportage über die Olympischen Spiele 1964 in Tokio, taumelt quer über die Aschenbahn. Der wie ums Überleben kämpfende deutsche Athlet erreicht die Ziellinie hart an der Balustrade. Dann bricht er zusammen.
Der Este Rein Aun im roten Trikot der Sowjetunion hebt den Sieger auf, der nichts vom Goldgewinn weiß. Noch halb bewusstlos und noch immer schwankend, klammert sich Holdorf an ihn. Ich habe die Szene von der Pressetribüne im Medji-Nationalstadion aus beobachtet. Weil es ein „German final“ sei, hat der amerikanische Sportchef der Nachrichtenagentur United Press International (UPI) seinen deutschen Reporter zusätzlich – und erstmals – zu den Leichtathleten geschickt. „The balding German“ (balding = schütteres Haar) führt nach dem ersten Tag. „He could win.“ Chancen hatte auch Hans-Joachim Walde. Es ist der frühe Abend des 20. Oktober, kühl und feucht. Am Himmel hängt der gelbe Vollmond. Das Flutlicht ist eingeschaltet. Nur ein paar tausend schweigsame Japaner haben ausgeharrt. Deutsche Olympia-Teilnehmer und die Jungen und Mädchen des deutschen Jugendlagers machen sich lautstark bemerkbar.
„Es muss ein Sadist gewesen sein, der den mörderischen 1500-Meter-Lauf an das Ende des Zehnkampfes gesetzt hat“, kommentiert die Frankfurter Journalisten-Legende Richard Kirn die finale Qual. Seidler hat das „Happy End“ wunderbar beschrieben: „Aun sagt zu Holdorf: ,Olympic champion – you olympic champion.’ Holdorf sah ihn fragend an, blieb aber stumm und brach abermals zusammen. Aun wartete lange. Er blieb wie ein Wachposten bei seinem siegreichen und ausgepumpten Rivalen. Dann hob er ihn ein zweites Mal auf und sagte ihm noch einmal, dass er gewonnen habe. Holdorf verstand ihn jetzt und lächelte ihm zu. Von Aun gestützt ging er einige Schritte auf den Rasen zu, wo der alte Meister Yang noch immer ausgestreckt lag. Jetzt richtete auch er sich auf, er war vielleicht noch erschöpfter. Yang hängte sich bei seinem jungen Bezwinger ein, und beide wankten fest umschlungen und taumelnd auf den Ausgang zu. Der olympische Zehnkampf klang mit einem ,Ballett zweier Betrunkener’ aus.“
Yang Chuan-Kwang, 31 Jahre alt, startete für Formosa, wie Taiwan damals hieß, studierte und trainierte seit Jahren an der University of California in Los Angeles (UCLA). Rafer Johnson, der hünenhafte afroamerikanische Olympiasieger von 1960, war sein Trainingskamerad. C. K. Yang, Achter 1956 in Melbourne und Zweiter in Rom hinter seinem Freund, war der große Favorit gewesen. Für Tokio wurde aber kurzfristig eine neue Punktwertung eingeführt, um mehr Ausgeglichenheit bei den zehn Disziplinen zu schaffen.
Ungünstig für Yang, dessen Weltrekord von 9121 auf 8089 Punkte schrumpfte. Er konnte nicht länger seine Wurfschwäche durch seine Sprungstärke ausgleichen – wie mit 4,84 Meter (Bestleistung) im Stabhochsprung. Im Kampf um die Medaillen hatte er kaum noch Chancen und wurde auch nur Fünfter. Willi Holdorf siegte mit der persönlichen Bestleistung von 7887 Punkten – als erster Deutscher. Der Vorsprung vor Aun: knappe 45 Punkte. Er beendete die Hegemonie der Amerikaner, die seit 1932 alle sechs olympischen Zehnkämpfe gewonnen hatten. Großen Wert legte Holdorf stets auf den Vergleich, „dass ich auch nach der alten Wertung Olympiasieger geworden wäre“. Mit 8119 Punkten.
Willi Holdorf ist der „König der Leichtathleten“, mit 7887 Punkten gewann er die Goldmedaille im olympischen Zehnkampf. Über die Bronzemedaille freut sich ein weiterer Athleten der gesamtdeutschen Mannschaft: Hans-Joachim Walde. Silber ging an den für die Sowjetunion startenden Esten Rein Aun. Foto: picture alliance / dpa
Dank Satellitenübertragung schaut die Welt zu – erstmals sogar in Farbe.
Ausgerechnet in Yangs Spezialdisziplin, der drittletzten, droht Holdorf zu scheitern. Die Latte liegt in 4,10 Meter Höhe. Zweimal hat er sie heruntergerissen. Bei einem dritten Fehlsprung würden nur 3,70 Meter zu Buche stehen. Holdorf (Bestleistung 4,30 Meter) weiß: „Schaffe ich die Höhe nicht mehr, kann ich eine Medaille vergessen.“ Ihm sei „der Arsch auf Grundeis gegangen“, erzählte er mir bei einem Besuch in Achterwehr. Bundestrainer Friedel Schirmer habe ihm signalisiert, zum Anlauf den rechten Fuß zurückzunehmen. Walde, direkt bei ihm, rät: „Setze den rechten Fuß vor.“ Holdorf hört auf den Kameraden und genießt das „erlösende Gefühl, wenn man unten im Schaumgummi liegt und sieht, wie die Latte oben bleibt“.
Das Hightech-Zeitalter ist angebrochen. Durch Satellitenübertragung kann die ganze Welt zusehen – erstmals sogar in Farbe. Die vollelektronische Zeitmessung hat Premiere. Die aktuellen Zwischenstände im Zehnkampf aber müssen noch anhand der Wertungstabellen erstellt werden. Fieberhaft rechnen Schirmer und Heimtrainer Bert Sumser nach dem Speerwerfen die Situation vor dem 1500-Meter-Finale aus. Eine riskante Rechnung: Maximal 17 Sekunden – 14 wären sicherer – darf Holdorf langsamer sein als Aun. Bei 18 Sekunden ist der Este Olympiasieger.
Wer könnte das nun folgende Drama besser schildern als Willi Holdorf? In seinem 1965 erschienenen Buch „König der Athleten“ lässt er den Leser mit ihm leiden, sich quälen – und kämpfen: „Ich nehme gleich die Spitze, achte auf gleichmäßige, raumgreifende Schritte. Natürlich versuche ich, das Tempo zu drosseln. Ich spüre noch den Stabhochsprung in den Beinen. Doch Aun merkt sofort, was ich versuche, und geht vorbei. Er will ,sein’ Tempo laufen. Ich spüre, wie gegen Ende der ersten Runde meine Kräfte nachlassen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich die restlichen zweieinhalb Runden noch schaffen soll. Hans-Joachim geht vorbei. Damit nimmt er mir den Wind. Bei 800 Meter sehe ich Aun weit vorn. Wenn ich noch gewinnen will, muss ich unbedingt zulegen. Bei jedem Schritt spüre ich die Schwere meines Körpers. Doch ich muss schneller werden – ich muss, muss, muss! Hans-Joachim macht mir Platz. Ich gehe vorbei. Ich höre weder die Rufe der Zuschauer noch die Zeit, die mir mein Trainer zuruft. Ich sehe nur noch Aun. Leicht wie eine Feder läuft er vor mir her. Nein, er fliegt. Es ist wie ein Wunder – die Entfernung bleibt konstant. Das gibt mir Auftrieb. Jetzt wird die letzte Runde eingeläutet. Wir haben etwa 100 Meter Abstand. Ich sehe, wie der Russe schneller wird. Ich versuche, den Abstand zu halten. Meine Beine sind schwer wie Blei. Ich muss mich zu jedem Schritt zwingen.“
In Tokio beendet Holdorf seine Karriere, was er später bereut.
„Plötzlich finde ich mich auf der Zielgeraden wieder. Eben verschwindet Aun im Ziel. Meine letzte Chance. Ich werfe den Kopf zurück und versuche einen Endspurt. Kurz vor dem Ziel verlassen mich die Kräfte. Ich wanke schräg hindurch – sehe die Bahn auf mich zukommen und falle der Länge nach hin. Ich kann es nicht fassen. Das Rennen ist zu Ende. Ich bin erlöst. Ich will liegen, nur liegen und mich ausruhen.“ Der Rückstand: 12 Sekunden, die Gold wert sind.
Zur anschließenden Siegerehrung – barfuß nach Zehnkämpfer-Brauch und ohne Trainingsanzug – springt Holdorf aufs Treppchen, rutscht aus und wäre fast auf Willi Daume gestürzt. Der deutsche Spitzenfunktionär hängt ihm die Goldmedaille um den Hals, dann Rein Aun das silberne und Hans-Joachim Walde das bronzene Schmuckstück. Horst Beyer, der Sechste, schwärmt: „So schön hat Musik noch nie in meinen Ohren geklungen, wie Beethovens Ode an die Freude.“ Die Mannschaft trat 1964 noch gesamtdeutsch auf, mit neutraler Hymne und Fahne (die olympischen Ringe auf Schwarz-Rot-Gold). Auf der anschließenden Pressekonferenz – eine eher interne deutsche Plauderrunde – fragt Holdorf plötzlich: „Wo ist Aun?“ Der Este fühlte sich nicht gefragt und war davongeschlichen.
In Tokio beendete Willi Holdorf mit 24 Jahren seine Karriere, was er vier Jahre später in Mexiko bereute: „Die neue Kunststoffbahn wäre mir entgegengekommen. Ich war ja ein bisschen schwer und habe tiefe Löcher in die Aschenbahn getreten.“ Dennoch gewinnt er 1968 eine Silbermedaille – als Leverkusener Trainer von Claus Schiprowski im Stabhochsprung. Von da an zieht sich die Zwei als rote Zahl durch sein bewegtes Leben: zwei Ehen, zwei Söhne, zwei Diplome (Sport- und Fußball-Lehrer), EM-Zweiter im Zweierbob, zwei Schlaganfälle, zwei Knieoperationen, zwei neue Gelenke. Die außergewöhnliche Eins steht für den Bundesliga-Trainer von Fortuna Köln.
Der Zehnkampf, klagte Holdorf, habe leider an Bedeutung verloren.
Willi Holdorf ist am 17. Februar 2020 80 Jahre alt geworden. „Ich habe achtzig Jahre lang Glück und Spaß gehabt. Da kann es mir jetzt auch mal nicht so gut gehen“, sagte er am Telefon, als wir uns vier Monate später für den 29. Juni um 11 Uhr bei ihm zu Hause in Achterwehr bei Kiel verabredeten. Wir kannten uns näher, seit er von 1965 bis 1967 in dem Taunusort Ober-Erlenbach lebte, als Immobilienmakler den Lebensunterhalt für seine Familie verdiente und für die „SGO“ in der Bezirksliga Rechtsaußen spielte.
Ländliche Idylle umgibt das Dorf vor den Toren Kiels. Die weiße Traumvilla am Ende der abschüssigen Straße überstrahlt die dunkelroten Klinkerhäuser. Danach grünt nur noch weite Natur. Holdorf, als Sportler und Trainer ein Leverkusener, war bekennender Holsteiner. Geboren in Blomesche Wildnis bei Glückstadt an der Elbe, verbrachte er seinen Lebensabend mit seiner zweiten Frau Sabine in der Abgeschiedenheit und Beschaulichkeit von Achterwehr. Er legte zum Gespräch im großräumigen, hellen Wohnzimmer mit Panoramafenster ein Buch auf den Couchtisch, das im Oktober 2014 zum 50. Jahrestag seines historischen Triumphes von Tokio erschien. „Der Titel gefällt mir nicht“, sagte er. „Da steht die Welt still.“ Ein Zitat, das Holdorf im Interview mit dem Autor so dahingesagt hatte.
Das Gesicht war hager und ernst. Kaum ein Lächeln. An den epischen Wettkampf 1964, an jedes Detail, konnte er sich erinnern, „als wäre es gestern gewesen“. Er redete klar, aber ohne Emotion. Mit seiner Frau wollte er zu „Tokyo 2020“ fliegen. Wegen Niklas Kaul, weil er dem Weltmeister zutraute, nach 56 Jahren als dritter Deutscher – nach ihm und Christian Schenk 1988 für die DDR – Olympiasieger zu werden.
Der Zehnkampf habe leider an Bedeutung verloren, klagte Holdorf. Wie wahr: Der zweite Sieg des Amerikaners Ashton Eaton in Rio 2016 ging völlig in der Erwartung des 200-Meter-Finales mit Usain Bolt unter. Doping? „Ich bin froh, dass zu unserer Zeit das kein Thema war.“ Der Amateurstatus war das Problem.
Nach einer knappen Stunde fragte ich nach seiner Gesundheit. Die Antwort war ein Schock. „Nicht so gut. Ich habe ein Karzinom am Übergang der Speiseröhre zum Magen. Ich werde künstlich ernährt. Das kannst du ruhig erwähnen.“ Den Krebs, vor einem Jahr erkannt. Willi Holdorf nahm sein Schicksal sehr gefasst. „Meine Frau macht sich mehr Sorgen als ich. Die meisten schaffen die achtzig nicht. Ich bin der Einzige der ersten sechs von Tokio, der noch lebt. Von dem Amerikaner Herman weiß ich das allerdings nicht.“
Zum Abschied umarmte ich Willi Holdorf auf dem Sofa und flüsterte ihm ins Ohr: „Kämpfe wie vor 56 Jahren!“ Er antwortete ruhig: „Ja. Wenn es geht, will ich nächstes Jahr zu den Olympischen Spielen nach Tokio fliegen.“ Er starb an einem Sonntagabend, nur fünf Tage nach meinem Besuch.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.07.2020, Nr. 155, S. 30
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de