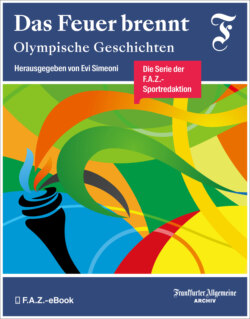Читать книгу Das Feuer brennt - Frankfurter Allgemeine Archiv - Страница 14
Leuchten und Dunkelheit Am Morgen will ich beschwingt über Ulrike Meyfarths Triumph schreiben. Da treffen die ersten Nachrichten von der Geiselnahme in München ein.
ОглавлениеVon Steffen Haffner
Lang, lang her! Doch immer, wenn das Kürzel „München 1972“ auftaucht, läuft in meinem Kopf ein Film ab. Blenden wir zurück auf den 4. September. Gut eine Woche schon haben wir mit Olympia gelebt, haben bis jetzt unter einem konstant weißblauen Himmel die Spiele genossen. Es sollen heitere Spiele werden, ist das Diktum von Willi Daume, dem Vater der Münchner Spiele. Die Welt soll ein neues, unverkrampftes Deutschland erleben. Aus der Brache im Münchner Norden ist eine vielfältige Landschaft entstanden. Im zentral gelegenen Olympiapark haben sich schon vierzig Vogelarten eingenistet.
Ich bin Stammgast im Olympiastadion. Hier schlägt mit der Leichtathletik das Herz der Spiele. Unter dem luziden Zeltdach Günter Behnischs feiern täglich 80 000 Zuschauer ohne fanatische Töne das Fest Olympia. Das Publikum lässt die Irin Mary Peters, die Weitsprungsiegerin Heide Rosendahl im Fünfkampf auf Platz zwei verwiesen hatte, mit Sprechchören hochleben. Und den erfolgreichen DDR-Athleten wird so fair applaudiert, als wäre dies trotz aller politischer Spannungen selbstverständlich. Doch bei aller Fairness: Es gibt nichts Schöneres, als die „eigenen“, die bundesdeutschen Athleten siegen zu sehen. Und das war am Tag zuvor in einem ungewöhnlichen Maße gelungen. Hildegard Falck stürmte über die 800 Meter der Konkurrenz voraus. Der nur 1,76 Meter große Klaus Wolfermann schleuderte den Speer zwei Zentimeter weiter als der für die Sowjetunion startende Lette Janis Lusis, seines Zeichens Olympiasieger und Weltrekordler. Und der Geher Bernd Kannenberg erschien nach 50 Kilometern Hitzemarsch als Erster im Stadion. Die Arena erbebte in freudiger Erregung. Dreimal Gold in einer Stunde!
Heute verspricht das Programm keine (bundes-)deutschen Medaillen. Alle erwarten, dass „unsere“ Hochspringerinnen, zum Beispiel, nicht mit den Favoritinnen werden mithalten können. Die knapp zwanzigjährige Renate Gärtner, zweimalige deutsche Meisterin, steht für solides Mittelmaß. Von der siebzehnjährigen Ellen Mundinger, die vor einem Jahr hier in München den deutschen Titel gewann, sind auch keine Supersprünge zu erwarten. Und schon gar nicht von der Jüngsten, der sechzehnjährigen Ulrike Meyfarth. Die Gymnasiastin aus Wesseling bei Köln ragt allenfalls mit ihrer Länge von 1,86 Metern heraus.
14.20 zeigt die Uhr, als 23 Hochspringerinnen in das grelle Licht der Arena treten. Alle haben sie in der sogenannten Qualifikation die ominöse Querlatte mit einer Höhe von 1,76 Metern überwunden. Es gehört Mut dazu, die Hochsprunglatte anzuspringen wie einen Gegner. Und besonders verwegen ist es, rücklings einen Blindflug ins Ungewisse zu wagen. Unter jungen Mädchen ist dieser Fosbury-Flop, benannt nach dem Olympiasieger von 1968, populär geworden. Auch die deutschen Teenager Meyfarth und Mundinger springen auf diese Weise. Die Favoritinnen Jordanka Blagoewa aus Bulgarien, Rita Schmidt aus der DDR und die österreichische Weltrekordlerin Ilona Gusenbauer, alle schon über 20, halten sich nach wie vor an den bewährten Straddle- oder Tauchstil, bei dem der Körper sich in Querlage um die Latte dreht.
Nach drei Stunden Wettkampf haben fünfzehn Springerinnen 1,82 Meter, nach dreieinhalb Stunden sieben 1,85 Meter geschafft. Und zur allgemeinen Verwunderung ist als einzige Westdeutsche Ulrike Meyfarth noch dabei. 1,85 Meter – das ist bundesdeutscher Rekord. Was ist denn nur los mit der langen Rheinländerin? Der Beifall für sie zeigt: Die 80 000 werden neugierig. Die Höhe von 1,88 Meter wird aufgelegt. Die Spannung steigt. Dann beginnen die Ovationen. „Meyfarth! Meyfarth!“ Medaillenträume werden wach. Und tatsächlich: Die Sechzehnjährige überspringt die Höhe, hat Bronze sicher. Nach vier Stunden sind nur noch drei Springerinnen unter sich: Ilona Gusenbauer, Jordanka Blagoewa und – Ulrike Meyfarth. Unfassbar! Eben noch als Außenseiterin eine Randfigur, steht die Jüngste nun im Zentrum des Interesses – der Zuschauer im Stadion und vieler Millionen Fernsehzuschauer.
1,90 Meter: Eine nach der anderen reißt die Latte. Die Hürde zum Glück scheint einfach zu hoch zu sein. Die Spannung knistert. Der zweite Versuch: Ulrike Meyfarth läuft entschlossen an und fliegt, beflügelt vom Aufwind der Begeisterung, über die Latte. Grenzenloser Jubel des staunenden Publikums. Neben uns erhebt sich feierlich Bruno Dechamps, der vornehm-zurückhaltende Mitherausgeber dieser Zeitung, und spendet mit leuchtendem Gesicht Beifall. Der dritte, der letzte Versuch: Alles wartet auf Jordanka Blagoewa. Die Bulgarin springt genauso hoch. Doch streift ihr Körper die Latte ganz leicht, sie vibriert und fällt doch noch herunter. Kurz darauf springt Ilona Gusenbauer entmutigt gegen die Latte. Die Spiele haben ihre Sensation: eine Sechzehnjährige ist Olympiasiegerin.
Ulrike Meyfarth schlägt die Hände vors Gesicht, das gleich darauf ein glückliches, erstauntes Lachen überzieht. Doch damit nicht genug, lässt sie die Latte auf 1,92 Meter legen: Ilona Gusenbauers Weltrekord. Und mit wunderbarer Leichtigkeit nimmt sie auch diese Hürde. Die chancenlos scheinende Außenseiterin ist Olympiasiegerin und Weltrekordlerin. Eine Berühmtheit, die noch nicht ahnt, dass Ruhm Lust und Last zugleich ist.
Am anderen Morgen sehen wir dem neuen Tag beschwingt entgegen. Ich werde gleich den Triumph Ulrike Meyfarths journalistisch nachfeiern. Doch schlimme Gerüchte stören unsere Hochstimmung: In der vergangenen Nacht sei die israelische Olympiamannschaft überfallen worden. Nein, bitte nicht! Beklommen laufe ich hinüber zum Pressezentrum. Hier reißt mich die schreckliche Wahrheit aus meinem olympischen Traum.
Palästinensische Terroristen der Gruppe „Schwarzer September“ sind in den frühen Morgenstunden in das Quartier der israelischen Olympiamannschaft eingedrungen. Sie haben einen Gewichtheber erschossen und einen Trainer der Ringer so schwer verletzt, dass er kurz darauf stirbt. Neun Athleten sind in der Gewalt der Geiselnehmer. Entsetzen breitet sich aus und erfasst die ganze Welt. Um 4.30 Uhr waren die Terroristen in Trainingsanzügen und mit Sporttaschen, vermutlich voller Waffen, über den Maschendrahtzaun geklettert, wie zwei Postbeamte, die Telefonleitungen überprüften, beobachtet hatten. Sie dachten, es wären Sportler, die den Zapfenstreich überschritten hätten. Das Olympische Dorf ist nicht allzu streng bewacht: ganz nach den Vorstellungen der Gastgeber, der Welt das Bild eines friedfertigen Deutschlands zu bieten. Eine verhängnisvolle Fehleinschätzung!
Im Foyer des Pressezentrums flimmern Live-Bilder vom Dressurreiten und vom Boxen über die Fernsehschirme. Daneben verliest Regierungssprecher Conrad Ahlers eine Erklärung zum Geiseldrama. Ich kann es kaum ertragen, dass im Schatten des Schreckens weiter Sport getrieben wird. Um 15.35 Uhr werden die Wettkämpfe endlich ausgesetzt. Für immer?
Gemeinsam mit zahlreichen anderen Reportern beobachte ich von einem Damm aus das Haus Connollystraße 31. Hier sind die israelischen Athletinnen und Athleten gefangen, zwischen Todesangst und verzweifelter Hoffnung. Als Sportler und Ordner getarnte Sicherheitskräfte gehen auf den umliegenden Dächern mit ihren Gewehren in Stellung. Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher verhandelt auf einem Balkon mit einem Mann mit breitkrempigem Hut, wohl dem Chef des Terrorkommandos. Genscher, Walther Tröger, der Bürgermeister des Olympischen Dorfs, und Münchens Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel haben sich, wie zu hören ist, zum Austausch mit den Geiseln angeboten. Vergebens!
Im Transistorradio kommt die Nachricht, die Geiselnehmer forderten, dass 200 inhaftierte Palästinenser und die beiden RAF-Terroristen Andreas Baader und Ulrike Meinhof sofort freigelassen würden. Dazu freies Geleit. Die Regierungen in Tel Aviv und Bonn hätten die Forderung abgelehnt. Mittlerweile ist alles in Dunkelheit gehüllt. Nur einige Lampen tauchen das Haus der Geiseln in schummriges Licht. Gegen 22 Uhr rollt ein Bus der Bundeswehr in die Autoebene, auf die ich freien Blick habe. Die Spannung steigt. Was wird jetzt geschehen? Wird geschossen werden? Eine Gruppe von vierzehn Personen kommt durch einen Versorgungsschacht, eskortiert von einem Mann mit Maschinenpistole. Es müssen die neun Geiseln und fünf Terroristen sein. Alle steigen in den Bus, der gleich losfährt. Um 22.15 Uhr sind über dem Olympischen Dorf Helikopter zu sehen. In einem werden die israelischen Sportler sein. Unsere Hoffnungen begleiten sie. Und tatsächlich: Während der Taxifahrt hinüber zum Pressezentrum kommt im Radio die Nachricht: „Alle Geiseln sind befreit!“ Gott sei Dank!
Die Gedenkstätte „Einschnitt“ für die Opfer des Olympia-Attentats vom 5. September 1972 wurde nach langer Diskussion am 6. September 2017 im Münchner Olympiapark von Israels Staatspräsident Reuven Rivlin und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Beisein von Hinterbliebenen eröffnet. Foto: picture alliance / Sven Hoppe/dpa
Doch das Gefühl des Glücks währt nicht lange. Mein Kollege Thomas Meyer von der politischen Redaktion und andere Reporter, die vom Militärflughafen Fürstenfeldbruck zurückkehren, berichten, wie sie aus der großen Distanz der Absperrung das Geknatter automatischer Handfeuerwaffen und den Knall einer Explosion gehört hätten. Weit nach Mitternacht kommt in einer gespenstischen Pressekonferenz die grausame Wahrheit ans Licht: Alle Geiseln sind ums Leben gekommen. Elf junge Menschen aus Israel ermordet. Daume, Genscher, tausend Journalisten und viele Millionen in der ganzen Welt verfallen in eine Schockstarre des Schreckens.
Erst am anderen Tag wird das Ausmaß der gescheiterten, dilettantischen Befreiungsaktion offenbar. Und ein ausgebrannter Hubschrauber wird zum Symbol des Desasters. Nur wenige Stunden nach der nächtlichen Pressekonferenz verwandelt sich das Olympiastadion in eine Stätte der Trauer. Auf dem Rasen sind die Särge mit den Leichen der elf israelischen Sportler aufgebahrt. Es werden bewegende Reden gehalten. Shmuel Lalkin, der Chef de Mission der israelischen Mannschaft, verspricht nach Worten emotionaler Erschütterung: „Ich darf Ihnen hier versichern, dass die Sportler Israels … auch weiterhin an olympischen Wettkämpfen … teilnehmen werden.“ Dann sagt IOC-Präsident Avery Brundage den zukunftweisenden Satz: „The games must go on!“ Wir jungen Reporter empfinden diese Forderung im Angesicht der ermordeten Sportler als Zumutung.
Die Olympischen Spiele „danach“ wirken so leblos, als hätte ihnen jemand den Strom abgestellt. Nur einmal kehrt die Begeisterung zurück. Beim mitreißenden Duell in der Sprintstaffel zwischen den Schlussläuferinnen Heide Rosendahl und Renate Stecher, der zweifachen DDR-Olympiasiegerin, vergesse ich für ein paar Minuten den Albtraum.
Heute, fast ein halbes Jahrhundert danach, sind in mir die düsteren Bilder von München noch lebendig. Doch über die Szenen des Schreckens und der Trauer triumphiert in meiner Erinnerung das glückliche Lachen eines jungen Mädchens.
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 26.07.2020, Nr. 30, S. 31
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de