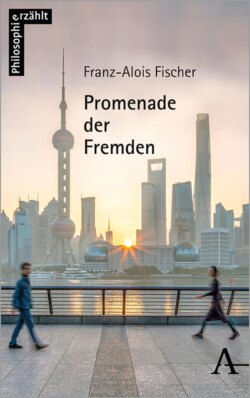Читать книгу Promenade der Fremden - Franz-Alois Fischer - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eins
Die letzte Weißwurst
ОглавлениеJetzt kommt meine Lieblings-Szene im Film, eine klassische Feelgood-Montage. Rachel lässt sich von ihrer ausgeflippten Freundin neu einkleiden, unterstützt vom lustigen schwulen Cousin. Ziel der Aktion ist es, Rachels Schwiegermutter in spe dazu zu bringen, sie endlich zu respektieren. Rachel Chu nämlich, das muss man wissen, ist Professorin für Spieltheorie. Und: Sie sieht auch noch super aus. Trotzdem ist sie der Schwiegermutter nicht gut genug, um ihren Sohn zu heiraten und Teil ihrer superreichen Familie aus Singapur zu werden. Mit vereinten Kräften wird das gar nicht mal so hässliche Entlein Rachel nun in einen wunderschönen Schwan verwandelt. Um sie herum scharwenzeln aufgeregte Chinesen, der Cousin hat ein ganzes Team von Mode-Profis mit Clipboards und Headsets mitgebracht und der Vater der ausgeflippten Freundin (der lustige Kokstyp aus Hangover) ist ebenfalls dabei, macht Trockenbumsbewegungen und begrapscht eine Frau. Im Hintergrund läuft eine chinesische Version von Material Girl. Rasch erkenne ich die bekannten Anfangstakte, der Song wird lauter, der Gesang setzt ein. Zuerst bin ich kurz irritiert, dann begeistert, nach ein paar Takten singe ich schon mit. Da heißt es in etwa: »Tschütschi dong man no do hop hap …«
Im weiteren Verlauf der Szene sieht man Rachel Kleider anprobieren und schließlich vor der Kirche vorfahren, um dort sogleich alle Blicke der asiatischen Presse auf sich zu ziehen. Als sie aus dem Wagen aussteigt, wird das Lied noch einmal lauter: »… to ta pöi da tin gei hanhi (hanhi!)« Und dann kommt’s:
»He wan ke ji jang tü twohundred degrees Mio to jeja when you hold me.«
Und wieder und wieder. Ich höre dreimal hin, aber die singen das wirklich. Meinen die vielleicht die Temperaturen da im Sommer – twohundred degrees? Oder geht’s um Liebe? Als ich zurückklicke, um die zweite Hälfte der Montage noch einmal zu sehen, spüre ich ein Säuseln an meinem rechten Ohr. Ich schrecke auf. Eine zierliche chinesische Stewardess fragt mich, wohl schon zum zweiten, dritten Mal, zurückhaltend zart und doch bestimmt, mit nur leichtem Akzent: »Western or Chinese?«
Ich überlege, ob sie mich meint und streiche mir dabei über den rötlichen Bart; das sollte doch offensichtlich sein: Western. Dann aber fällt mein Blick auf den Servierwagen und mir wird klar, dass es ums Essen geht. Ich lasse mir kurz die Auswahl erklären. Es gibt eine warme Laugensemmel mit eingebackener Miniweißwurst, Senf und Krautsalat, der mir verdächtig nach Kimchi aussieht, oder einen chinesischen Eintopf mit Kartoffeln. Beides wird mit Stäbchen und einer Gabel serviert. Da ich die letzte Weißwurst schon hinter mir habe, nehme ich den Eintopf und dazu einen Weißwein. Alles a bissl weich, aber nicht schlecht, oder? Beim Essen frage ich mich, ob ich nicht selbst die letzte Weißwurst bin, hier zwischen all den Chinesen. Die husten und schlürfen in einem fort und ich hock ganz weich dazwischen herum. Kurz muss ich albern kichern.
Nach dem Essen hole ich den Bildschirm wieder aus seiner Versenkung und klicke erneut auf Crazy Rich Asians. Ich muss unbedingt sehen, wie sich Rachel auf der Hochzeit schlägt und ich drücke ihr wirklich die Daumen. Es sind noch vier Stunden bis zur Landung in Shanghai und laut Info-Monitor sind wir irgendwo über Russland im weiteren Sinne. Mir wird bewusst, dass wir um die halbe Welt fliegen und dabei immer über Land bleiben. Ist das eigentlich eher beruhigend oder beängstigend? Ich strecke meine Beine weit aus, die Fudan-Universität hat uns die guten Plätze am Übergang zur Business-Class gebucht. Noch nicht die kleinste Turbulenz. Vielleicht ist es der Weißwein, das Essen, der Film oder doch eine Spätfolge der letzten Weißwurst vom Flughafen Franz Josef Strauß: Zum ersten Mal seit Monaten fühle ich Ruhe. Freilich, der Reisestress hat mich ein bisschen kirre gemacht, ich bin ein bisschen aufgekratzt, aber doch ruhig: Die Heimat scheint ebenso weit weg zu sein wie das Ziel in der Ferne: Shanghai. Dabei hatte ich ja überhaupt keine Ahnung, was auf mich zukommen sollte!
Noch vor ein paar Monaten wusste ich beinahe gar nichts über Shanghai und musste mir übers Internet erst einmal das Gröbste zusammensuchen: 25 Millionen Einwohner, größter Containerhafen, dritthöchstes Gebäude der Welt. Fünf Universitäten, von denen zwei in der chinesischen Version der Ivy League sind. Der Bürgermeister heißt Ying Yong. Erstmals sah ich, wo genau Shanghai eigentlich liegt. Auf der Online-Karte musste ich ganz China nach links wischen, bis ich es endlich fand. Sofort wurde ich nervös: Shanghai liegt also, im wahrsten Sinne des Wortes, am anderen Ende der Welt. Ich war schon lange nicht mehr geflogen und erst einmal in meinem Leben eine vergleichbar weite Strecke. Als nächstes las ich übers Wetter und erfuhr, dass die schlechteste Reisezeit für Shanghai der August sei: Bis zu 40 Grad, bis zu 100 Prozent Luftfeuchtigkeit; immerzu Gewitter, zuweilen ein Taifun als Bonus. Natürlich war der August eben der Monat, in dem unsere Summer School stattfinden sollte. Schon die Gedanken ans Wetter trieben mir die ersten Schweißperlen auf die Stirn. Kurz zuvor hatte mir mein Doktorvater auf einem unserer gemeinsamen Weinabende mitgeteilt, dass es »jetzt klappt mit Shanghai«.
Es war schon seit zwei, drei Jahren im Raum gestanden, dass uns ein Ruf aus China nach China ereilen könnte. Ich hatte das allerdings nie als besonders konkrete Gefahr wahrgenommen, da solche allgemeinen Ankündigungen im universitären Kontext üblicherweise im Sand verlaufen. Immerhin war mein Doktorvater schon ein paarmal »drüben« gewesen, in Peking und in Shanghai. Wann immer wir darauf zu sprechen gekommen waren, hatte er sich stets sehr positiv über China geäußert – was mich ehrlicherweise überrascht hatte. Zum einen weil wir in Deutschland ja eher ein negatives Bild von China haben: Menschenrechte, Überwachung, Technologieklau und all die weiteren Schlagwörter aus den Zeitungsartikeln. Zum andern weil mein Doktorvater meist weit über den Dingen zu schweben schien – mehr den großen Geistern nachfliegend als dem Zeitgeist nachlaufend –, und dementsprechend selten positiv, noch seltener mit Emotionen über die Dinge der Welt sprach. Bei Shanghai indes war er an jenem Abend richtiggehend ins Schwärmen geraten. Er hatte vom »besseren New York« gesprochen und dem unbedingten Gefühl, auf dem Gipfelpunkt der Gegenwart zu sein – einer sehr dynamischen Gegenwart freilich, die sich in rasender Geschwindigkeit auf dem Boden einer jahrtausendalten Tradition entfalte. Auch das Essen hatte er in für ihn ungewöhnlich vielen Worten gelobt: Die chinesische Küche vereine eine unermessliche Fülle an fremden Produkten, Texturen und Kochstilen in sich, die sie dann wiederum in einer riesigen Bandbreite von Regionalküchen ausdifferenziere.
Im Grunde hatte ich ihn nur einmal ähnlich euphorisch erlebt: Bei unserem allerersten Weinabend, als wir eine Trockenbeerenauslese aus Escherndorf getrunken hatten, die ich ihm als »etwas Besonderes aus der fränkischen Heimat« angekündigt hatte. Damals war es die Überraschung darüber gewesen, dass ein Wein von Weltformat ebenso gut aus einem kleinen fränkischen Bauerndorf wie aus dem Burgund oder dem Bordeaux stammen konnte. Im Fall von China war ich mir über die Gründe seiner Begeisterung nicht ganz im Klaren. Die Begeisterung war zweifellos groß und echt und ihr mussten ganz besondere Erfahrungen zugrunde liegen. Aber ich konnte jenseits der konkreten Einzelheiten, die er mir erzählt hatte und die sicherlich faszinierend waren, dieses Mehr noch nicht genau identifizieren, welches das Interesse für die Teile zur Begeisterung fürs Ganze erheben könnte.
Am meisten hatte mich an seinen Erzählungen überrascht, wie sehr er betont hatte, dass die Chinesen durchaus an der Sache interessiert seien – wobei er vor allem den Gegensatz zu den USA vor Augen gehabt hatte, wohin ja doch immer noch die meisten Akademiker zum weiteren Karriereschliff gingen. Zwar seien die Chinesen im Zweifel noch kapitalistischer als die Amerikaner und man wisse als aufmerksamer, aus dem Ausland eingekaufter Philosoph jederzeit genau, dass man eben das sei: eingekauft. Aber im Unterschied zu den Amerikanern seien ihnen die Äußerlichkeiten von Journal-Rankings, Connections und aufgeplusterten Lebensläufen nicht allzu wichtig. Nein, da sei ihnen die Sache wichtiger, denn schließlich wolle man ja wissen, was genau man eingekauft hat. Das war sicherlich ein ambivalentes Kompliment gewesen. Aber ist es letztlich denn so wichtig, woher das Interesse an der Sache kommt? Hauptsache, ein Interesse ist vorhanden.
Den übrigen Abend hatten wir, wie stets an den Weinabenden, vor allem über Kulinarisches gesprochen. Ich hatte erfahren, dass die Chinesen gern auf knorpligem Zeug herumkauen – für uns ungewohnt, aber doch lohnend, weil es den Raum der Texturen erweitert. Außerdem hatte mir mein Doktorvater erzählt, dass es in China im Prinzip keine gehobene Küche gebe, die man mit der europäischen Sterneküche vergleichen könne. Zwar erschlössen sich mittlerweile auch europäische Gastronomen den chinesischen Markt und eröffneten Sternetempel – die zielten aber letztlich nur auf Touristen und Businessfritzen. Demgegenüber sei die Qualität einfacher Restaurants um ein Vielfaches höher als in Europa, insbesondere in Deutschland. Und die regionalen Unterschiede seien beachtlich: In Shanghai etwa gebe es vor allem Fisch und Meeresfrüchte, alles in allem eine eher leichte, nahezu mediterrane Küche. Er hatte mich außerdem ermutigt, auch das verrückte Zeug mal zu probieren. Am Ende des Abends hatte er mich dann noch einmal gefragt, ob ich wirklich nach Shanghai zur Summer School möchte. Da ich die Jahre zuvor auf die allgemeinen Ankündigungen hin stets Interesse bekundet hatte, den Abend über nun seine begeisternden Erzählungen gehört hatte und überdies in jener weinseligen Stimmung gewesen war, die sich aus einem schönen Weinabend zwangsläufig ergibt, hatte ich, ohne zu zögern, ja gesagt.
Erst nachdem mein Doktorvater gegangen war, dämmerte mir, worauf ich mich eigentlich eingelassen hatte: der Flug, das Wetter, vor allem aber Vorlesungen auf Englisch an einer äußerst renommierten Universität für chinesische Studenten. »Elite-Studenten aus ganz China«, um genau zu sein, denn so wurde es mir mitgeteilt in einer Mail von Shuangli, der Organisatorin der Summer School in Shanghai. Wie ich bald erfuhr, hatten die Verantwortlichen in Fudan monatelang nicht auf Mails aus Deutschland geantwortet, sodass die ganze Zeit über unsicher war, ob die angedachte Summer School überhaupt würde stattfinden können. Die erste Mail aus Fudan beinhaltete dann jedoch gleich ein fertiges Programm und die höfliche, aber bestimmte Bitte, sich doch jetzt ganz schnell, ohne weitere Verzögerungen, um alles zu kümmern. Die chinesischen Gastgeber wollten gern alles bezahlen, im Gegenzug erwarteten sie allerdings auch Sofortzusagen, Vorlesungsthemen, Literaturlisten, Skripte – alles am besten schon am gleichen Tag.
Die weitere Planung ergab, dass wir insgesamt drei Dozenten fürs Team Alt-Europa zur Summer School senden würden. Daniel, ein Münchner Kollege, den ich bereits flüchtig kannte, sollte über Kant lehren; Roland, ein österreichischer Kollege, über Fichte und ich selbst über Hegel. In der Themenwahl waren wir frei: Daniel entschied sich für die Freiheit, Roland für das Selbstbewusstsein und ich mich für den Staat. »Das ist ein tolles Programm für China!«, dachte ich und wurde gleich unsicher, ob man »das machen kann«. Doch mein Doktorvater winkte es durch. Es könne schon sein, dass da ein paar von der Partei zuschauten, aber die Chinesen wollten deutsche Philosophen, die klassische deutsche Philosophie unterrichten – und sie wüssten auch, was sie dann bekommen. Was sie anschließend daraus machten, sei ja nicht unser Problem.
In den Folgewochen hatte ich gesundheitliche Probleme, musste sogar eine Woche ins Krankenhaus, und als es gerade wieder bergauf zu gehen schien, bekam ich eine äußerst schmerzhafte Fußentzündung, wegen der ich einige Zeit gar nicht mehr laufen konnte. Je näher Shanghai rückte, desto schlechter wurde mein Zustand. Eine Woche vor dem Abflugtermin musste ich ernsthaft überlegen, meine Teilnahme an der Summer School abzusagen. Ich ging die möglichen Konsequenzen durch, um zu dem Ergebnis zu gelangen, dass eine Absage schon möglich wäre. Ich habe ohnehin nie eine Karriere machen wollen und habe dementsprechend auch nichts zu verlieren. Aber irgendetwas sträubte sich in mir gegen die Absage. Einige Tage vor dem Abflug beklebte dann mein Physiotherapeut mein gesamtes linkes Bein mit langen blauen Kinesio-Tapes und ich erinnerte mich daran, dass ich noch während der Zeit meines Studiums davon ausging, »Kinesiologie« bedeute so viel wie chinesische Heilkunde. Die Bedenken, die ich gegenüber der Reise nach China vorbrachte, wischte der Physiotherapeut rasch beiseite: »Notfalls kommst am Tag vorm Abflug nochmal her, dann mach ich dir ne Schiene dran.« Nach einer kurzen Pause stellte er klar: »Du fährst nach Shanghai!«
Und so bin ich zusammen mit Daniel, anderthalb Stunden vor unserem Flug, im Airbräu im Münchner Flughafen gesessen beim letzten Weißwurstfrühstück für die nächsten drei Wochen. Der Kollege hat so nervös gewirkt, wie ich mich gefühlt habe, was gut war, weil ich dann im Vergleich zu ihm den Ruhigen spielen konnte. Ich habe so getan, als sei ich Vielflieger, irgendwie ein Mann von Welt, obwohl ich natürlich – über mein Wikipedia- Wissen hinaus – auch keine Ahnung hatte, was uns erwartet. Ich kann wieder laufen, habe aber zur Sicherheit meine Krücken mitgebracht. Ein sehr zu empfehlender Trick, denn wir durften an allen Schlangen vorbei direkt nach vorn gehen.
So kurz vor dem Abflug haben wir das Gefühl gehabt, als müssten wir Weißbier und Weißwurst jetzt noch einmal so richtig genießen, weil wir sie für Münchner Verhältnisse äußerst lange entbehren müssten. Aber irgendwie wollte mir das schon nicht mehr recht gelingen: Die Wurst weich, der Senf weich, die Brezn weich, das Bier weich – ich kann nicht sagen, es hätte geschmeckt.
Was sich trotzdem eingestellt hat, wie stets beim Weißwurstfrühstück, ist die namensgebende Wurstigkeit. Nachdem man bei den ersten Schlucken noch aufstoßen muss, legt sich das Bier wie ein sanfter, leicht prickelnder Schleier über das Gemüt. Die Last des Gedankens nimmt ab. Das ist, was die Bayern Gemütlichkeit nennen: Ein Zustand des Wohlvertrauten, aber auch der Langeweile. Dieser Zustand sollte sich in den kommenden Wochen tatsächlich grundlegend ändern.