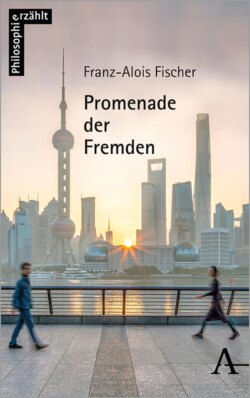Читать книгу Promenade der Fremden - Franz-Alois Fischer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Drei
Es gibt nur ein Willy Hegel
ОглавлениеDie ersten Tage liegen hinter mir und waren aufregend und neu. Zusammen mit Daniel war ich früh morgens gelandet, gegen die nassheiße Wand und hinein gelaufen in die überwältigende Weite der Stadt, die in keine Richtung ein Ende findet. Jetzt, da uns die Stadt aufgenommen hat, ist alles um uns herum Shanghai – rechts, links, oben, unten. Wo immer wir hinblicken, ragen die Hochhäuser in den Himmel, wo immer wir entlanglaufen, nässen sie auf uns herunter. Und trotzdem fühle ich mich frei. Befreit. Das Lasche meiner Münchner Existenz ist verschwunden und etwas Neues ist an seinen Platz getreten, das ich noch nicht genau benennen kann. Ich würde diesem Neuen gern denkend nachspüren, doch kann ich kaum einen Gedanken festhalten: Alles ist neu und nass und heiß, und meine Gedanken rasen, unkontrollierbar, in alle Richtungen davon. Ich komme ihnen kaum noch nach, dabei sind da schöne dabei, flüchtig zwar, doch aufregend, sie tragen eine Hoffnung in sich, die ich lange nicht empfunden habe. Ein erstes Selfie, das ich lieber für mich behalten werde, zeigt, wie mein Gesicht rot in angestrengte Denker-Falten geworfen ist – vergeblich, denn unter diesen Bedingungen bekomme ich einfach keinen klaren Gedanken zu fassen. Vielleicht, so schwirrt es mir durch den Kopf, habe ich ja das Nachdenken verlernt. Das wäre schön, oder?
Abgesehen vom drückenden Gefühl, in eine Waschküche geraten zu sein, sind unsere ersten Eindrücke seit der Landung ausnehmend positiv. Wir sind begeistert vom Hotel, das auf jedem Zimmer einen Glastisch mit breitem Ledersessel davor hat, sodass man sich beim Vorbereiten aufs Seminar wie ein Vorstandsvorsitzender fühlen kann. Unsere Gastgeber sind von einer aufopferungsvollen Freundlichkeit beseelt, die uns fast beschämt. Obwohl sie uns hier alles bezahlen, bedachten sie uns schon zur Ankunft mit Geschenken. Für die armseligen Minikrüge mit München-Wappen, die ich schnell noch als Mitbringsel am Flughafen gekauft hatte, schämte ich mich beim Überreichen. Ich habe jetzt noch das Gefühl, dass es besser gewesen wäre, gar nichts mitzubringen.
Eine Widrigkeit, für die Shanghai im Speziellen nichts kann, kam an den ersten Tagen noch hinzu, nämlich der Jetlag. Wir waren über Nacht geflogen. Den Fehler, während des Tages unserer Ankunft zu schlafen, konnte ich bei all dem Trubel vermeiden, aber natürlich bin ich am ersten Abend früh ins Bett gefallen. Um ein Uhr nachts war ich dann schon wieder wach; oder sagen wir: bei Bewusstsein. Irgendwie müde und doch aufgekratzt, zu erschöpft, um ernsthaft arbeiten zu können, zu kirre, um mich auszuruhen. Im Verlauf der Nacht drohte dann das diffuse Durcheinander der rasenden Gedanken, die ich seit der Ankunft hier habe, mich gänzlich zu verschlingen. Den Gedanken nachzugehen, war nicht mehr unterhaltsam, sondern furchteinflößend. Kein Gedanke hatte Bestand und so rasch, wie sie einander ablösten, mussten sie letzten Endes ins Nichts führen. Mir wurde mit einem Mal bewusst, wie weit entfernt von daheim ich wirklich war, sodann auch, wie hoch über dem Boden ich mich befand. Bevor ich mich in eine Panik hineinsteigern konnte, raffte ich mich lieber auf und ging zum Fenster. Vielleicht war es ja gar nicht gar so hoch? Ich schaute hinaus auf die dunkle Promenade und meine Beine wurden zu Gummi. Zum Glück sind die Hürden, die der chinesische Staat vor den westlichen Teil des Internets gesetzt hat, nicht allzu schwer zu umgehen. Mit einem VPN-Client konnte ich mich übers hoteleigene WLAN so mit dem Netz verbinden, als säße ich mit meinem Laptop in Europa. Dann konnte ich Netflix schauen und ein bissl den bewährten Zerstreuungsritualen frönen. Irgendwann in der Früh – es war schon lange hell – bin ich doch noch einmal eingeschlafen, nur um kurz darauf wieder von meinem Handy geweckt zu werden, mit starken Kopfschmerzen.
Die zweite Nacht war düster. Man konnte nur ein paar Häuserblocks weit sehen, denn überall war Nebel oder Smog, wobei mir der Unterschied während meines Aufenthaltes nie ganz klar wurde. Das linderte zwar das Gefühl von Verlorenheit in der Weite, rief jedoch das Gefühl des Eingeschlossenseins hervor; ein Gefängnis im Hochnebel. Da war es schön, dass ich mit ein paar Leuten in der Heimat schreiben konnte, die aber auch irgendwann ins Bett mussten, sodass ich wieder bei Netflix landete. In der Früh war es auch damit zu Ende, weil der VPN seinen Geist aufgab. Er ließ sich noch zweimal für ein paar Minuten verbinden, dann war er dauerhaft gesperrt. Vielleicht war der chinesische Staat doch etwas wehrhafter als zunächst vermutet. In jedem Fall waren damit Youtube, Netflix und all die anderen Zerstreuungsplattformen für mich unerreichbar. Die Gedanken waren mir die Nacht über geblieben, drängend und rasend wie die Nacht zuvor, aber noch unbestimmter und diffuser. Es war, als jagte ich Geistern hinterher, die mit jeder Minute der Schlaflosigkeit weiter an Kontur einbüßten. Sie verdichteten sich zu einem Nebel, der mir den Blick auf die Wirklichkeit zu nehmen drohte. Zum Schluss war eine chinesische Version von CNN meine letzte Ablenkungsmöglichkeit; es war der einzige englischsprachige Sender, der im Hotelfernseher zu finden war. Die Moderatoren sahen sehr asiatisch aus und sprachen sehr amerikanisch. Sie berichteten von Unwettern in Japan und Indien, standen vor großen animierten Wetterkarten, und analysierten die Lage smart und elanvoll. Seit meiner Ankunft sah ich außer meinen Kollegen keinen einzigen Westler und begegnete überall nur Chinesen. Vielleicht war es aber doch übertrieben und irgendwie auch typisch westlich, sich über diesen Befund in China ernsthaft zu wundern. Im Fernsehen hatten sie die Unwetter abgehandelt und zeigten nun Bilder von Menschenmassen und Polizisten, irgendwie ging es wohl um Hongkong. Plötzlich wurde das Bild schwarz. Damit war mir also auch die letzte Zerstreuung genommen und merkwürdigerweise fühlte sich das genauso an, als wäre die letzte Verbindung zur Außenwelt gekappt worden. Ich war auf mich selbst zurückgeworfen. Später erfuhr ich, dass das die Zensur der Hongkong-Reportagen gewesen war. Doch in jenem Moment bezog ich es auf mich. Für eine ganz formlose Zeitspanne – ich kann nicht sagen, waren es Sekunden, Minuten oder die restlichen Stunden der schlaflosen Nacht –, für eine unbestimmte Dauer war der Unterschied zwischen meinem Gedankennebel und mir selbst aufgehoben. Derjenige, der diesen Gedanken, erst spaßig-sportlich, dann immer verzweifelter, hinterherjagte, wurde eins mit ihnen. Ich war die. Es lag auf der Hand, dass irgendetwas Grundsätzliches nicht stimmen könne. So war ich mir in jenem zeitlosen Augenblick ganz sicher, mein Leben ändern zu müssen.
Am nächsten Tag weiß ich noch von meinem Entschluss, aber die unmittelbare Verzweiflung, die zu ihm führte, ist verflogen. Heute besuche ich Daniels erste Kant-Vorlesung. Es geht um Freiheit und um die Frage, ob es denn wirklich zwei Welten braucht, um die Freiheit zu sichern: eine Welt der Erscheinungen, in der wir bloße Spielbälle der Naturgesetze sind wie die Tiere, und eine ominöse andere Welt, in der Freiheit möglich ist. So, wie ich das verstehe, brauchen wir die zweite Welt überhaupt nur, weil sie die Freiheit ermöglicht. Die chinesischen Studenten wirken in der Mehrzahl brav und sind insgesamt ein wenig undurchsichtig; man ist sich nie ganz sicher, ob etwas gut bei ihnen ankommt oder nicht. Fast vollständig fehlen diese alternativen Typen, die in unseren Seminaren in Deutschland so häufig sind. Solche, die durch besonders auffällige Frisuren, extravagante Kleidung oder Kosmetik, gerne aber auch einfach durch allgemeine Ungepflegtheit ihr Anderssein und ihren Tiefsinn nach außen zu tragen versuchen – und die dann inhaltlich manchmal doch eher lasch und enttäuschend sind. Die Studenten im Vorlesungssaal der Fudan-Universität könnten auch – nach unseren Maßstäben – fast alle BWL oder Jura studieren, was mich an eine Freundin in Deutschland erinnert, die sich sehr darüber wunderte, dass es überhaupt chinesische Philosophiestudenten geben soll, weil Philosophie doch nichts bringe. Beim Anblick der hiesigen Studentenschaft denke ich mir, dass man in der Philosophie natürlich genauso Karriere machen kann wie in der Raketentechnik. Professor ist schließlich Professor. Ein weiterer Unterschied in den allgemeinen Äußerlichkeiten besteht darin, dass hier kaum dicke Leute zu sehen sind, obwohl doch alle die ganze Zeit am essen sind. Nur wenn man ganz genau hinschaut, findet man ein paar Personen im Auditorium, die für die chinesischen Maßstäbe einen Hauch von Alternativität versprühen. Einer von ihnen zeichnet sich durch eine große Kastenbrille aus, die ihm etwas Nerdiges verleiht. Er meldet sich jetzt schon zum dritten Mal. Er spricht schlechtes Englisch, aber immerhin spricht er, und er verbreitet mit seinen Fragen eine große Unruhe im übrigen Publikum, das sonst still und etwas gehemmt wirkt. Wenn ich ihn recht verstehe, will er darauf hinaus, dass die Beschreibung der ersten Welt – also der Welt der Naturgesetze, in der wir uns als Tiere begreifen müssen – doch bereits fehlerhaft sei.
»You cannot say: one, two, three, four, six!«, sagt er mehrfach, »There is always something between, that cannot be determinated.« Dann rekurriert er irgendwie auf Quantenphysik. Daniel gibt sich die größte Mühe, sein Anliegen zu verstehen, aber ein echter Dialog kommt nicht zustande. Trotzdem ist etwas im Hörsaal zu spüren: ein Funke? Der Anfang eines Gedankens? Ich weiß nicht. Es ist heiß, alle sind müde und erschöpft von den Anstrengungen eines ganzen Tags mit Kant … Was auch immer da war, es ist rasch erloschen.
Nach der Vorlesung werden wir, die Gäste aus Europa, von unseren Assistenten in ein Restaurant in Uninähe eingeladen. Die Speisen sind wieder so vielfältig, die Portionen so reichlich, dass man es ein opulentes Mahl nennen muss. Am späteren Abend sitze ich dann bei einem Bier zusammen mit den Kollegen an der Hotelbar. Die anderen Hotelgäste sind sämtlich Chinesen und so ist die Bar jeden Abend verwaist, denn die Chinesen trinken nichts und gehen auch nicht weg. Ein Student, etwa Mitte zwanzig, erzählte uns in der Mittagspause, dass er noch nie in einer Bar war. Dafür hatte er während seines letzten Deutschland-Aufenthalts das Gesamtwerk von Thomas Mann gelesen. Daraufhin machte ich reflexhaft einen Witz über torture (dass das Gesamtwerk von Thomas Mann in Deutschland als Folterwerkzeug für Studenten gelte), strich aber nur ein paar Höflichkeitslacher ein. Hoffentlich hatten sie das nicht auf Hongkong bezogen! Bei uns in Deutschland wäre es jedenfalls leichter, ein paar Studenten zu finden, die noch nie im Hörsaal waren, als einen einzigen, der noch nie in einer Bar war. Beides irgendwie verrückt.
Der Kellner, großgewachsen und etwas dümmlich dreinblickend – und damit eine außergewöhnliche Erscheinung –, hat uns jetzt schon zum wiederholten Mal das falsche Bier gebracht. Diesmal gibt es Tsingtao statt Heineken. Taugt aber und ist auch grad egal. Wir haben jetzt die erste Vorlesungseinheit hinter uns und sind nun ein wenig schlauer, wie das hier läuft. Einige Einheiten Kant, Fichte und Hegel stehen zwar noch aus, aber wir haben alle das Bedürfnis nach einem ersten Zwischenfazit und tragen daher unsere Anekdoten der ersten Tage zusammen. Über manches lachen wir, über manches wundern wir uns. Uns verbindet die schöne Klammer des gemeinsamen Erlebens auf Zeit. Fast komme ich mir vor wie in einer dieser Filmszenen, wenn sich alte Freunde ein letztes Mal wiedersehen und über die alten Zeiten sprechen. Dabei sind wir doch mittendrin, und eigentlich kennen wir uns auch nicht wirklich, das ist schon komisch. Beim dritten Bier – Asahi statt Tsingtao, das wir eigentlich nachbestellen wollten, weil es wirklich geschmeckt hat – stecken wir beim Zuprosten konspirativ die Köpfe zusammen. Das geht von Daniel aus und es ist klar, dass jetzt eine wichtige Frage von ihm kommen muss. »Ganz ehrlich«, beginnt er, um nach langer denkerischer Pause zu vollenden, »können die was?«
Wir schauen uns an und brechen in nahezu hysterisches Gelächter aus. Die ganze Anspannung der zurückliegenden Tage prusten wir aus uns heraus. Der große Chinese und seine Kollegin hinter der Bar schauen uns irritiert an, ganz kurz, ehe sie sich wieder ihrer Aufgabe zuwenden: Seit bald einer Stunde sind sie dabei, den Kaffeevollautomaten zu reinigen, wobei sie ihn mit einer Mischung von Akribie und Faszination behandeln, wie man sie von einem NASA-Wissenschaftler erwartete, der ein UFO untersucht.
Wir nehmen unser Gespräch wieder auf, indem ich davon erzähle, wie nach der Kant-Vorlesung ein Student zu mir kam, um mir eine Frage zu stellen.
»Normalerweise«, sage ich, »kommen da ja Fragen zu irgendwas Konkretem und ich hatte mich daher schon darauf eingestellt, die Frage nicht beantworten zu können. Aber der hat mich ganz eindringlich angeschaut und gefragt: ›Pro fä so, one question. What äh is äh metaphysic?‹ Was willst du da sagen? Des is, wie wenn einer am Ende des Jurastudiums herkommt und sagt: ›Alles gut, ich hab das ja alles verstanden, nur eine Frage noch: Was ist denn eigentlich dieses Grundgesetz, von dem immer alle reden?‹ – Manche Leute, die hast schon verloren, bevor du das erste Wort gesagt hast.«
Roland, dem Wiener Kollegen, gefällt das außerordentlich. Ein wenig später wird er dann allerdings ernster und meint, dass unter den Studenten schon einige sehr schlaue dabei seien und er alles in allem positiv vom Niveau überrascht sei. »…, oder?«, in typisch Wiener Art schließt er nicht fragend, sondern bestätigend. Und in gewisser Hinsicht hat er auch recht. Dann will er sich abermals zum Rauchen verabschieden, doch Daniel und ich beschließen, mitzukommen. Zum Rauchen muss man einen kleinen Bereich links neben dem Hoteleingang aufsuchen, der von einem sich bückenden roten Plastikmännchen bewacht wird. Roland bietet mir eine Zigarette an, die ich jedoch ablehne. Eine Weile schaue ich den anderen beiden beim Rauchen zu, dann will ich es aber doch wissen. »Ne, jetzt mal ernst«, sage ich, »Können die was? – Ich mein jetzt nicht, ob die schlau sind oder fleißig oder gebildet. Das ist ja offensichtlich. Aber können die auch Philosophie? Meint ihr, dass der nächste große Philosoph – und da rede ich jetzt von der Gewichtsklasse Kant und Hegel –, dass der in vielleicht zwanzig oder fünfzig Jahren aus China kommen könnte? Bei uns entstehen die ja offenbar nicht mehr.«
Die beiden wiegeln ab. Kant und Hegel werde es sobald nicht nochmal geben, die kämen aus der Glanzzeit der Philosophie und die sei zweihundert Jahre her. Aber ich muss nachbohren, schließlich ist das der erste halbwegs klare Gedanke, den ich hier zu fassen bekomme: »Der heutige Kant und der heutige Hegel, die wären ja kein bisschen wie Kant oder Hegel. Kant und Hegel sind ja alte Säcke aus einer anderen Zeit!« Aber die anderen beiden lassen sich nicht mehr aus der Reserve locken und so geht jeder bald auf sein Zimmer.
Ich nehme meine Unruhe mit ins Bett und schalte den Fernseher ein, wieder einmal auf Ablenkung hoffend. Erst zeigen sie Regen, dann Hongkong, fünf Minuten später wird das Bild schwarz. »Das ist doch scheiße«, denke ich. »Wer kann denn jetzt bitte schlafen, solange meine Frage noch unbeantwortet im Raum steht.« Also rufe ich – auch wenn es mit dem Handy pervers kostspielig ist – einen guten Freund in München an. Der ist zunächst ganz erschrocken, weil ich mich so unverhofft bei ihm melde, und befürchtet schon, es wäre etwas passiert, bis er merkt, dass es sich um ein dringliches philosophisches Problem handelt. Er erfasst sofort, worum es geht, und wir können uns das ganze Drumherum, das philosophische Gelaber und Geziere, sparen. Er, der selbst bereits mit Philosophie im Gepäck in China war, weiß auch nicht, wie es die Chinesen unterm Strich mit dem freien Denken halten wollen. Ob dort ein großer Geist entstehen kann? Er ist unsicher. Aber er ist sich ganz sicher, dass in China gerade etwas entsteht, und zwar etwas Neues und Großes. Und allein deswegen müsse man solche Chancen, wie sie unsere Summer School bietet, nutzen, und sei es auch nur, um diesen neuen Geist kennenzulernen. Und eines sei sicher: Wer auch immer es sein wird, der oder die diesen neuen Geist verkörpert, Hegel wird es nicht sein. Der ist nämlich schon seit zweihundert Jahren tot. – Das waren meinerseits gut investierte 30 Euro.
Für mich ist das nämlich doppelt beruhigend. Zum einen heißt das ja, dass sie uns den Hegel, anders als den Transrapid, ja gar nicht wegnehmen können. Der ist ja schon lange vorbei. Und zum andern heißt das für uns, dass wir hier ja vielleicht Geburtshelfer für jemanden sein können, der zwar nicht der Hegel und auch nicht der Kant, aber vielleicht der Song oder die Xiang sein wird. Und den Song oder die Xiang können die uns dann in zweihundert Jahren nach Europa bringen. Das ist doch schön. Ich beschließe, meinen Studenten morgen das Lied »Es gibt nur ein Willy Hegel« beizubringen. Da freu ich mich schon drauf. Jetzt ist mein Kopf leer. Ich schlafe wie ein Baby.