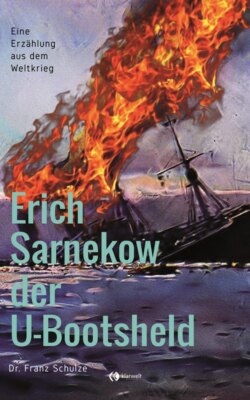Читать книгу Erich Sarnekow der U-Bootsheld - Franz Schulze - Страница 4
Erstes Kapitel. Bei Kriegsausbruch.
ОглавлениеEs war gegen Ende Juli 1914. Ächzend drehten sich die Riesenschrauben am Heck des großen Handelsdampfers der Atlantiklinie. Auf dessen Kommandobrücke stapft der wohlbeleibte Kapitän von Backbord nach Steuerbord und denselben Weg wieder zurück. Bald nimmt er den „Kieker“ zur Hand, bald mustert er mit unbewaffnetem Auge die durch die eigene Fahrt des Schiffes sich scheinbar langsam verschiebenden Gegenstände am Ufer. Ein leiser Fluch ringt sich von seinen Lippen, dann bleibt er, plötzlich in seinem Pendelspaziergange innehaltend, mittschiffs stehen, blickt ganz mechanisch auf den Kompass, wie er’s so zwanzig Jahre lang zu tun gewohnt ist, seit er als Wachoffizier und später als Schiffsführer die Planken einer Kommandobrücke unter den Füßen gehabt hat. Er wendet sich zu gleicher Zeit an den neben dem Steurer stehenden Kompanielotsen und meint gemütlich:
„Na, Petersen, werden wir’s holen? Der vermaledeite Kahn kriecht ja förmlich, als wenn er durch dicken Sirup statt durch Salzwasser führe. Ich habe beim Ober-Ingenieur schon zweimal anfragen lassen, ob er statt Heizer diesmal Zuckerbäcker zur Bedienung der Feuer mitgenommen habe. Aber da unnen is allens in bester Konfusion, wie Herr Neuhold, der oberste der Dampfbereiter, mir sagen lässt. Er habe richtigen Dampfdruck und gute Füllung. Die Kohlen wären auch keine Tannäppel, sondern vorzügliches Heizmaterial! In’n Dock, bie Blohm unn Voß hebb se em den Bodden ook good rein schropt! Woran liegt es nun in aller Welt, mien goode Petersen, datt wie nich voran kom’m? Unn von’n Kontor da is mi höchste Eile auf das energischste anempfohlen. De Generoldirektor sülbn hat mie nochmol na boben ropen loten un n ook nochmal sienen Semp datoo geben. Kep’n Rohde seggt he, wir verlassen nns ganz auf Sie und Ihre oft bewiesene Fähigkeit, Schwierigkeiten zu überwinden. Diesmal liegt uns ganz besonders daran, dass Sie früh genug aus Antwerpen wieder wegkommen. Füer häff he mi förmlich achtern Heck mokt, un’n nu löppt de oll „Düsternwald“ afs’lut nich mehr as ‘n ol Kräft met Podagra. Sehn Se, Petersen, so lang as ik nu met Se snakkn doh, sünd wi liebsterwelt keen söstein Meter vörut kom’m; ik seh dat doch dütli an de Hüs dor an’n linken Ober; de Eck von dat rode Dack wiest noch ümmer recht in den breeden hogen Boom. Dat Schipp kümmt nix öbern Grund; de Tid löppt to hatt äff!“ — Unwillkürlich war Kapitän Rohde bei dieser in ein Selbstgespräch auslautenden Unterhaltung in sein geliebtes Platt verfallen, das die ältere Generation der Seefahrer auch heute noch für die einzige auf ein Schiffsdeck gehörende Sprache ansieht. Trotz alledem wird aber der Kapitän heutzutage oft gezwungen, dem Maschinenpersonal gegenüber, das vielfach der niederdeutschen Mundart nicht mächtig ist, Hochdeutsch zu reden. Zur Überraschung alter Seebären, die eigentlich nur noch in Geschichtsbüchern weiterleben, denn der moderne Kapitän eines großen Dampfers ist ein wohlerzogener und gut unterrichteter Mann, stellt es sich hie und da heraus, dass ein Fahrzeug wirklich auch in letztgenannter Sprache navigiert werden kann. Der Verkehr mit den vielen Passagieren, den zu ihrer Bedienung an Bord beschäftigten Stewards, wie man die Schiffskellner nennt. Schlachtern, Böttchern, Klempnern, Schlossern, Elektrikern und anderen Angestellten, die nicht an de „Waterkant“ geboren sind, schließt so oft den Gebrauch des altgewohnten, gemütlichen Salzwasserplatt aus, so dass sich die hochdeutsche Sprache auf Dampfschiffen mehr und mehr einbürgert.
Kapitän Rohde hatte seinen Quermarsch von einer Brückennock zur andern wieder aufgenommen, aber seine Ungeduld ist umso weniger gezügelt, als der alte Petersen, der Kompanielotse, statt einer Antwort nur gebrummt und die Achseln gezuckt hatte. „Ja, Kapitän Rohde, die Scheide ist nun einmal mit ihren starken Tiden ein schlimmes Revier. Um den Strom tot zu laufen, muss da unten wohl tüchtig eingeheizt werden. Übrigens möcht’ ich mal genau wissen, wann heute eigentlich Stauwasser oben an der Schleuse ist? Die verdammte Ecke zwischen Fort Isabell und Austrüwell ist noch die schlimmste. Wenn wir da den rechten Dreh kriegen, ohne ankern zu müssen, dann haben wir gewonnen! Sie können in diesem Falle direkt an den Bremer Kai anlegen und die dort für Sie klarliegende Ladung schnell genug in die „Düsternwald“ hineinwerfen. Der Lloyddampfer, der Ihnen Platz gemacht hat, ist schon draußen in See. Weiß der Himmel, was in die Herren auf all den Kontoren gefahren ist. So schlimm war doch die Hundstagshitze bisher nicht in diesem Jahr? Ich meine, man konnte sie bisher ganz gut aushalten. Ihr Herr Direktor will wohl bald nach Karlsbad? Mexiko kann ihm doch so viel Kopfschmerzen nicht verursachen? Aber fragen Sie mal Ihre Kollegen von den andern Linien! Eile, Treiben, Schieben überall. Keiner hat Zeit.“
Der alte Lotse wies nach dieser für ihn langen Rede stromauf und fuhr nach einer Weile fort: „Da kommt uns schon wieder einer entgegen; ich dachte gestern nicht, als ich flussabwärts ging, dass der stromabkommende Dampfer zu heute. fertig würde. — Gerade links vom Turm der Kathedrale seh’n Sie den Rauch, der sich allmählich weiter nach Backbord hinüberschiebt. Stürbord, ‘n beten! So! Stüddi! Recht up den Torn to, as he nu geiht“, wies er inzwischen nach altem Lotsenbrauch, immer ein bisschen wegen des Steuerns zu quesen, den Rudersmann an, und wandte sich wieder an den Kapitän: „Es sieht doch recht verdächtig aus in der Welt! Was sich da in Serbien wohl noch zusammenbraut bei den Prinzenmördern?“ „Ja“, meinte Kapitän Rohde, „diese ganze Eile hängt damit zusammen. Haben wir hier auch wohl nichts zu fürchten an der Wasserkante, namentlich ihr hier nicht in Belgien, dann wirkt die Ungewissheit der politischen Lage doch sehr auf Handel und Wandel in der ganzen Welt ein. Der Kaufmann will seine schwimmende Ware möglichst bald in Händen haben! Dann kann er freier darüber verfügen.“ — „Aber“, brach er plötzlich ab, „ich muss mich doch mal selber überzeugen, wie das heute mit den Tiden ist; wann wir eigentlich Hochwasser haben.“ Dabei hatte er die Signalpfeife schon an die Lippen gesetzt und rief durch ihren Trillerton den freien Steurer, der grade im Ruderhause die Messingteile der Kompasshauben und Maschinentelegraphen putzte, herbei. „Kurschus, purren Sie den vierten Offizier. Seine Wache zur Koje ist sowieso um. Es müssen doch gleich alle Mann an Deck! Sagen Sie ihm, er solle, ehe er aus die Brücke kommt, sofort die Hochwasserzeit für heute Nacht und morgen Vormittag ausrechnen und mir das Resultat in das Kartenhaus mitbringen. Ich will auch selber nochmal wegen der Strömung nachsehen.“
„Bet’n good utkieken, Herr Hoffmann“, wandte er sich an den an der Backbordseite der Brücke stehenden zweiten Offizier, der zum Zeichen, dass er verstanden, die rechte Hand grüßend an die Mütze legte. „Petersen, ik bün gliek wedder buten, in’n poor Sekunden.“ Es war noch keine halbe Minute verflossen, als der zum vierten Offizier hinuntergesandte Kurschus, ein braver Ostpreuße, fast atemlos wieder oben auf der Brücke erschien und seinem Wachoffizier meldete: Der „Vierte“ wär näch in der Koje. — „Ek ha äm öberall gesöcht unn kunn äm näch finde. Zuletzt meint’ eck, er sie doch in seine Kammer unn woll äm da herut hole!“ — Doch lassen wir des guten Kurschus Mämeler Dialekt beiseite und schildern rascher, was er vorfand. Der Steurer war beim zweiten Versuch, den vierten Offizier zu entdecken, nicht imstande gewesen, dessen Kammertür mehr als eine Handbreit zu öffnen; von innen hinderte irgendetwas Elastisches, Weiches und doch Schweres, den schmalen Spalt zu erweitern. Beharrlichem und schließlich energischem Drucke gelang es, das widerstrebende Hindernis, das auf dem Fußboden der Kabine zu liegen schien, beiseitezuschieben. Der Steurer zwängte seinen dicken Kopf durch die verbreiterte Öffnung und erblickte nun den von ihm Gesuchten, bewusstlos an Deck in dem kleinen Räume liegend. Dass es sich nicht um einen Betrunkenen handeln konnte, war dem Boten des Kapitäns sofort klar; denn Erich Sarnekow, der vierte Offizier, war allen an Bord als sehr mäßiger und ordentlicher Mann bekannt. Man hatte ihn, einerseits wegen seiner Bartlosigkeit, also seines Milchgesichts wegen, andrerseits aber, weil er einen Trunk frischer Milch dem zweifelhaften Genuss lauwarmen und — wenigstens in Westindien — recht teuren Bieres vorzog, „Fräulein Milchmann“ getauft. Man nannte ihn mit Vorliebe so, doch nur, wenn der im Übermut also Getaufte sich außer Hörweite befand. Denn seine Fäuste hatten durchaus nichts Mädchenhaftes und „sangen eine vernehmliche Handschrift“, wie Kameraden gern erzählten, die schon früher mit ihm „vor dem Mäste“, d. h. während der praktischen Vorbereitungszeit zum Steuermannsexamen, zusammen gefahren hatten.
Mitten in seiner kleinen, aber mit außerordentlichem Geschmacks ausgestatteten Kammer lag der junge Seemann in tiefer Ohnmacht. Kurschus hatte rasch, bevor er seine Meldung auf der Brücke abstatten konnte, den Offizierssteward herbeigerufen, auch in der Nachbarkammer Bescheid gegeben, und war dann erst, wie wir bereits wissen, zum Wachoffizier zurückgeeilt, um weitere Hilfe zu gewinnen. Der „Zweite“ durfte die Kommandobrücke nicht verlassen und musste sich daher damit begnügen, dem Kapitän die überraschende Meldung durch Kurschus zukommen zu lassen. Sind doch Krankheiten eigentlich selten bei Seeleuten, die sich ständig in frischer, ozonreicher Meeresluft bewegen. Wenn nicht durch Tropenklima hervor gerufene Seuchen dem Fahrzeuge einen unwillkommenen Besuch abstatten, hat der Schiffsarzt bei gleichzeitiger Abwesenheit von Passagieren fast gar nichts zu tun. Aus diesem Grunde war der Medizinmann für diese Reise abkommandiert worden. Des Kapitäns erster Gedanke beim Hören der Meldung von der tiefen Ohnmacht seines „Vierten“ war daher zunächst ein wenig freundlicher wegen „dieser Knauserei des Kontors“. Er erinnerte sich aber bald, dass der belgische Arzt, den er gern hatte los sein wollen, eigentlich auf sein, nämlich des Führers eigenes Treiben, versetzt war. „Ick kann den Kerl nich rüken“, war Kapitän Rohdes stetes Urteil gewesen, obwohl sich Dr. van Deyken eigentlich allezeit mehr, als den Kabinennachbarn angenehm sein konnte, ruchbar machte. Denn mangels menschlicher Patienten beschäftigte er sich in Westindien tagein tagaus mit dem Abbalgen der von ihm erlegten Vögel und Vierfüßer. Er präparierte alles, was da kreucht und fleucht und roch daher stets nach dem zum Aufbewahren benutzten Spiritus, sein Arbeitsraum nicht minder. Es sollte mitunter sogar jedes Riechorgan beleidigen, wenn größere animalische Studienobjekte da gelegen hatten. Die seiner Kunstfertigkeit entsprossenen Gegenstände wanderten nach der Heimkehr des Dampfers in die Hände williger Abnehmer, die den Verkauf an Kleinhändler, Schulen und wohl auch Museen vermittelten. Da auf dieser Reise nur Güter und, wegen der Unruhen drüben, gar keine Passagiere befördert werden sollten, hatte Dr. van Deyken mit seinem anatomischen Kabinette ein andres Fahrzeug beglücken müssen. „Un grod nu, dat is doch to dumm. So ohne Dokter is man nich mehr gewöhnt. Die Geschichte muss schlimm sein, denn er kommt gar nicht wieder zu sich“, überlegte der um seinen Adjutanten bemühte und besorgte Schiffsführer. „Was mag ihm nur passiert sein? Eine Verwundung ist nirgends zu finden; trinken tut er gar nichts, Fieber kommt hier auch nicht vor und zum Sonnenstich ist erstens nicht Hitze genug gewesen und dann tritt der auch nicht spät nachmittags ein, sondern im heißesten Sonnenbrand; aber knapp auf der kühlen Scheide zwischen Holland und Belgien.“
Endlich regte sich der mittlerweile von den Kameraden Entkleidete und in die bequeme Koje Gepackte. Stöhnend fasste er nach der rechten Seite, fiel aber sofort wieder in die frühere Bewusstlosigkeit zurück. Nach langer Geduldsprobe überwand der Erkrankte schließlich den Zustand der Erschlaffung, die ihm die Herrschaft über die Sinne geraubt hatte. „Wasser!“ und lechzend sog er matt das rasch herbeigeschaffte kühlende Nass mit Behagen ein, um ebenso unvermutet, wie er zuletzt sich erholt, mit neuen Äußerungen des Schmerzes die Augen zu schließen. Wiederum zuckte die Hand nach der rechten Seite und neues Ächzen kündete einen frischen, heftigen Anfall. Da der Kranke keine Auskunft geben konnte, und niemand imstande war, die Natur des Leidens zu erraten, jeder aber vom Ernst der Lage überzeugt sein musste, stieg Kapitän Rohde eilends hinauf zur Funkenbude, wie man den Raum für die drahtlose Telegrapheneinrichtung auf Schiffen zu nennen beliebt. Er hieß den Beamten, der Agentur zu telegraphieren, man möge bei Ankunft der „Düsternwald“, die voraussichtlich in zwei Stunden erfolgen könne, alles fertigmachen, um einen Schwerkranken sofort ins Hospital zu bringen. — Umsichtigerweise war denn auch bei der Ankunft gut vorgesorgt. Als sich der Dampfer seiner Anlegestelle näherte, schor schon ein kleines Motorboot längseit, um den Hilfsbedürftigen der kundigen Hand des Arztes zu überweisen, noch bevor der große Dampfer sich fest an den Kai gelegt haben konnte. Man packte den Leidenden auf eine Zwischendeckermatratze, hüllte ihn noch in warme Decken, legte ihn auf einen Lukendeckel und heißte die leichte Last mit Hilfe der Dampfwinde empor. Sobald die Höhe der Reling erreicht war, fierte man allmählich ins längseit gelegte kleine Motorfahrzeug. Bald nahm dessen enge Kajüte den neuen Passagier auf. „Erst mal los mit ihm, die Sachen senden wir später nach“, wurde noch von oben gerufen. Während „Düsternwald“ nun langsam schwojete, um gleich wieder den Bug stromab zu legen, seine Stahltrossen den Koloss Zoll für Zoll an den Kai heranzogen, die Dampfwinden an Deck ihre Trommeln langsam drehten, da schoss das kleine Boot mit seinem stillen Patienten schon dem stadtseitigen Scheldeufer zu, sich weiter stromaufwärts beim malerischen Fort Stehen einen bequemen Landungsplatz zu suchen. Es schlüpfte zwischen dem Kai Plantin und dem Quai de la Station hinein in eine Einfahrt bis zum Walloner Bollwerk, wo eine breite Steintreppe und ein weniger lebhafter Verkehr mühelosere Landung des Kranken ermöglichten. Eine zweirädrige Krankenkarre nahm den Patienten hier auf. Die beiden Kompaniehafenarbeiter, die zur Eile ermahnt waren, begannen nun, ihre kostbare Last dem Krankenhause im Galopp zuzuführen. — Die rue Kronenburg hinauf und dann durch die rue Gerard eilend, gelangten sie, trotz der Schmerzensschreie des Erkrankten, den das Stückeln auf dem Pflaster und die Nachtkühle bald aus seiner Bewusstlosigkeit ins Leben zurückgerufen, nach verhältnismäßig kurzem Transporte zum Portal des Hospital St. Elisabeth. Hier war man schon telefonisch in Kenntnis gesetzt, so dass der neue Ankömmling bald umgebettet und untersucht werden konnte.
Irgendeine an Bord zu hastig eingenommene Speise oder ein zu kalter Trunk, vielleicht auch ein nicht mehr gutes Stückchen einer Fischkonserve, möglicherweise schon ein kurz vor dem Verlassen des Heimathafens genossenes Gasthausessen hatten, wie sich später ergab, eine ernsthafte „Magenverstimmung“, auf gut Deutsch also eine Art Vergiftung, verursacht.
Das Laden der zwei letzten Nächte vor dem in See-Gehen hatten wenig Schlaf, der ausgiebige Regen dabei aber ein gänzliches Durchweichen mit sich gebracht, so dass sich noch Erkältung und ein Anfall von Rheumatismus dazugesellten.
Das „Fräulein Milchmann“ hatte also nicht etwa sein Herz zurückgelassen bei den beiden schönen Kreolinnen, die die „Düsternwald“ auf der letzten Reise mit nach Deutschland gebracht.
Es war nicht der Trennungsschmerz gewesen — der Seemann macht ihn ja zu oft durch. — Die auffallende Gereiztheit und Schweigsamkeit des sonst immer muntern und beliebten Offiziers waren lediglich schon die Vorboten dieser nunmehr ausgebrochenen, schweren Erkrankung gewesen. Das erkannte der junge Arzt des Krankenhauses auch rechtzeitig und richtig und gab infolge seiner die Wahrheit treffenden Diagnose zuerst scharfe Brech-Pulver und andere Mittel, den rebellischen Magen wieder gründlich zu reinigen.
Große körperliche Schwäche verhinderte den Patienten die erste Zeit nach seiner Einlieferung, den Dingen um sich herum die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Nur wie durch einen Schleier sah er die mit seiner Pflege betraute Nonne und verwechselte die Lebende in wirren Fieberträumen der ersten Nächte mit einem in seiner Bordkajüte hängenden Bilde. Dies war ihm aus der letzten Hausreise von der jüngeren der beiden erwähnten Senoritas, die sich in Dresden zur Malerin ausbilden wollte, als Andenken zum Geschenke gemacht, nachdem der junge Seemann der Vollendung dieser Skizze während der Überfahrt von Westindien stets großes Interesse entgegengebracht. Es stellte ebenfalls eine Nonne dar, so dass dem Fiebernden bald Dolores selber, bald die ihn im Krankenhause pflegende Schwester dem Rahmen entstiegen. Bunt hatten die Gedanken ein unentwirrbares Netz gesponnen. Als der sonst kräftige, jetzt durch langes Fasten geschwächte Körper endlich Herr wurde über die Krankheit, da merkte Erich Sarnekow bald den Unterschied der beiden Gestalten. Die ferne Künstlerin wäre die weniger hübsche, aber lebensvollere aus Fleisch und Blut gewesen. Hier die Schwester war kalter Marmor. Der junge Seemann taufte sie bald in seinem Innern „das Bild ohne Gnade.“ Gemessen und kalt tat sie zwar ihre Pflicht, aber bald merkte der Patient, dass es nur aus Zwang, fast mit Widerwillen geschah, was der von den Frauen sonst gern Gesehene sich nicht erklären konnte. Als ihm aber der junge Arzt am sechsten Tage seines Hospitalaufenthaltes erzählte, wie sich indessen die Dinge in der Welt zugespitzt, wie das aus Serbien drohende schwere Gewölk am politischen Himmel höher und höher gestiegen sei, da begriff er manches. Der Mediziner hatte sich in Leipzig und Berlin einen Teil seiner Kenntnisse geholt und an diesen Universitäten mit deutschem Wissen auch Achtung deutschen Wesens und Zuneigung zu den Bewohnern dieses Landes angeeignet. Er teilte seinem jungen Patienten mit, Deutschland und Österreich ständen als treue Bundesgenossen in einem Heerlager, vielleicht bald mächtigen Feinden gegenüber, gegen Russland und Frankreich. Die Sympathie seiner, der belgischen Landsleute aber sei naturgemäß auf gallischer Seite. Man fürchte, Preußen würde vielleicht sein Vaterland zwingen, den Durchmarsch der Armeen zu dulden. Dies werde man doch nicht gestatten dürfen, wolle man nicht allen nationalen Stolz zertreten lassen. So sei es immerhin möglich, dass Belgien, von den politischen Verwickelungen in der einen oder andern Weise gezwungen, sich würde am Kriege beteiligen, und zwar auf Seiten Frankreichs treten müssen. Diese Aussichten hätten naturgemäß nicht gerade dazu beigetragen, die Beliebtheit der Deutschen an der Scheide zu mehren. Fanatische Franzosenfreunde dürften bereits zwanglos ihren Abscheu vor den von Berlin aus Regierten offen an den Tag legen. Da Krieg und Frieden schon auf des Messers Schneide lägen, so rate er, wenn der Gesundheitszustand die Reise nur irgend erlaube, nach Deutschland heimzukehren. Erich solle dies dem Hauptarzte bei dessen Besuch vorstellen. Letzterer, sowie die pflegende Nonne wären ausgesprochene Franzosenfreunde und zeigten auch offen, auf wessen Seite ihre Sympathien zu finden seien. Erich war nun vollkommen auf dem Laufenden und überlegte, auf welche Weise er seine Entlassung am besten vorbereiten könne. Da der Oberarzt an diesem Tage nicht erschien, die kaltäugige Schwester Josefa sich aber in ein Gespräch überhaupt nicht einlassen wollte, hieß es vorerst noch abwarten. Vielleicht hatten morgen die Kräfte schon wieder so weit zugenommen, dass man wagen konnte, die Entlassung auch gegen den ärztlichen Willen zu erzwingen. Willkommen kam dem Kranken an diesem Tage nun ein Gruß von außerhalb des Hauses. Als er, noch vor seiner Steuermannsprüfung, die letzten Vorbereitungsmonate der praktischen Seedienstzeit nach den Schulschiffsjahren als Steurer bei der Atlantiklinie abfuhr, die ihn heute als Offizier angestellt, hatte er einen älteren Seemann aus der Nähe Lübecks zum Kollegen, mit dem er abwechselnd auf seiner Wache das Steuer zu bedienen hatte. Dieser, Kuhlo mit Namen, war vor dreiviertel Jahren in Antwerpen geblieben, um dort bei der Reederei einen Vertrauensposten zu übernehmen, und hatte sich mit einer schwarzhaarigen Tochter des Landes, aber deutscher Nationalität, verheiratet. — Seeleute halten auch nach vollendeter Reise oft noch lange Zeit treue Kameradschaft, obwohl sie mitunter ganz verschiedener Bildungsstufe sind. Sie haben immer wieder einmal Gelegenheit, voneinander zu hören, ganz einerlei, ob Hansen in San Franzisko hängengeblieben, Müller in Honolulu ein Bahntje gefunden und Berg Liverpool als Heimatshafen erwählt hat. Solange sie in der Seefahrt verwandten Berufen bleiben und hin und wieder noch mit der Wasserkante in Berührung kommen, sieht dieser sie, hört jener von ihnen und berichtet daheim oder von dort weiter zum fremden Hafen, zur entlegensten Küste. So hatte Kuhlo gelegentlich vernommen, dass Erich Sarnekow als vierter Offizier bei der Linie diene und auf der „Düsternwald“ fahre. — Eine Nachfrage an Bord hatte ihn die Erkrankung seines ehemaligen Kameraden erfahren lassen, was Kuhlo veranlasste, zum St. Elisabeth-Hospital zu wandern. Da Besuche des Patienten in den ersten Tagen vollkommen ausgeschlossen waren, musste sich der treue Schiffsmaat mit einem schriftlichen Gruß begnügen, dem er die neuesten Nummern deutscher Zeitungen beifügte. Trotz Einspruches der Pflegerin, des „Bildes ohne Gnade“, verschlang der Kranke sofort den Inhalt der beunruhigenden politischen Nachrichten und war sich nun vollkommen klar, dass er auf jeden Fall versuchen müsse, die deutsche Grenze zu erreichen, sobald ihm die Kräfte die Reise nur irgend erlauben würden. — Endlich am nächsten Tage ließ sich der Herr Oberarzt mit der stets glimmenden Zigarette wieder sehen. Er pflegte sie eigentlich nur dann aus dem Munde zu nehmen, wenn er einen Patienten näher untersuchen wollte. Schon mehrmals hatte sich der recht eigene Erich unwillig abgewandt, wenn die nikotinduftenden, braunen ärztlichen Fingerspitzen in zu unappetitlicher Nähe seines Mundes herumgefuchtelt hatten.
Auf Bitten des jungen Offiziers, ihn zu entlassen, da er nach Hause wolle, hatte der Gestrenge nur ein Lachen, in das die sonst so schweigsame Schwester Josefa herzhaft einstimmte. „De vent will na huis to en kan noch niet mal loope“, meinte sie dann und kehrte auch auf Bitten und Klingeln des Patienten, ihm einige Handreichungen zu tun, fürs erste nicht ins Krankenzimmer zurück. Als die nächsten Zeitungen immer bedrohlichere Nachrichten enthielten, ließ Erich Sarnekow nach seinem wahrscheinlich in den Schuppen oder Kellern der Reederei lagernden Zeug fragen, um wenigstens einen Teil davon zu sich ins Krankenhaus bringen zu lassen. Da man ihn direkt aus seiner Schiffskoje auf die Matratze und aus dem Motorboote in die Karre, aus dieser ins Hospitalbett gepackt hatte, besaß er augenblicklich an Kleidungsstücken nichts bei sich. Er hätte demnach auch nicht heimlich entweichen können. Der treue Kuhlo, der Lieferer der Zeitungen, übernahm nun auch die Besorgung eines Zettels an das Kontor der Reederei mit der Bitte um den nötigen Anzug und um genügende Wäsche. Beides wurde am nächsten Tage, im Handkoffer wohlverpackt, im Pförtnerzimmer des Hospitals für ihn abgegeben. Als dann der Oberarzt seinen Rundgang wieder machte, eröffnete ihm Erich, er fühle sich nun wohl genug, die Heimreise anzutreten und wünsche, das Krankenhaus zu verlassen. Die prompte Antwort des edlen Äskulaps war: „Für Gesunde hat dies Haus keinen Platz! Wenn Sie also nicht mehr krank sind — bitte!“
Damit war der Patient ohne Untersuchung, ohne Sang und Klang entlassen und gezwungen, gänzlich ohne Hilfe des immer unfreundlicher gewordenen Personals aufzustehn und sich allein anzukleiden. Nach unsäglicher Mühe gelang dies dem Schwachen endlich; niemand zeigte sich, der ihm behilflich gewesen wäre, und klappend schloss sich das schwere Gittertor hinter dem ausgewiesenen Pflegling, dem sich alle wie einem Verfemten bei seinem Abschiede ferngehalten!
Auf der Straße heftig gestikulierende, aufeinander einredende Menschen, die zum Glück nicht auf den Ahnungslosen achteten, der nicht wusste, wie scharf sich inzwischen in den letzten Stunden die Lage zugespitzt hatte. Schräg gegenüber fuhr gerade ein Auto vor dem Grand Hotel in der rue Gerard vor, das er mit wenigen Schritten erreichen konnte. Ein Fahrgast entstieg dem Fuhrwerk, kurz entschlossen nahm Erich von diesem Besitz und rief dem Führer die Adresse seiner Reederei-Agentur am Kai Van Deyck zu. Als der Chauffeur nur langsam über den belebten Place Verte fuhr, tauchte aus der hin- und herflutenden Menge dicht vor dem Fuhrwerk das Gesicht des Inspektors der Atlantiklinie auf, der nach der Kathedrale zusteuerte. „Hallo! Sie Geist aus Mitternacht. Wie sehn Sie aus, junger Mann? Augenblicklich mal volle Kraft rückwärts und wieder hinein ins Hospital. Dass Sie gesund sind, glaubt Ihnen doch keen Deubel! Wat soll so ‘n Unsinn?“ war seine erste Begrüßung. „In das Hospital kriegen mich aber keine zehn Pferde, nicht mal zehn Autos wieder hinein, Herr Inspektor! Wenn das zum Klappen kommt, da ließen sie mich nicht wieder lebendig raus. Das Gefühl habe ich; das ist eine unchristliche Gesellschaft.“ „Wat ‘n Unsinn,“ brummte der alte Herr nochmals, stieg aber kurz entschlossen mit hinein ins Auto und setzte unterwegs seine Empfehlung, ins Krankenhaus zurückzukehren, nochmals fort. Als er aber auf ganz entschiedenen Widerstand der Gegenseite stieß, meinte er schließlich selber, vorläufig sei zwar noch keine Gefahr vorhanden, man könne jedoch nicht voraus sehen, wie die weitere Entwicklung der nächsten Stunden sein werde. Am besten würde Sarnekow demnach tun, vorläufig im deutschen Seemannsheim zu bleiben, um dort das Weitere abzuwarten. Jedenfalls müsse er sich wohl darauf gefasst machen, dem Rufe des Vaterlandes schnell zu folgen, denn der Kaiser habe die Mobilmachung bereits ausgesprochen. Da schon durchzuckte den jungen Seemann der Gedanke: wo sind deine übrigen Sachen und wo mag zwischen ihnen der Militärpass stecken? Die Kameraden würden ihm an Bord zwar alles sorgsam verpackt haben; in welchem der drei Koffer würden sich aber die benötigten Stücke befinden? Doch die Fahrt sowie die ganze Übersiedelung aus dem ungastlichen Hospital hatten den noch immer bedenklich Kranken so angegriffen, dass er sofort nach Ankunft im freundlichen Seemannshause das Bett aufsuchen musste, das er auch den ganzen folgenden Tag nicht zu verlassen vermochte. Als die Sonne wieder leuchtete, fühlte er sich schon besser, aber sehr unruhig. Was wohl inzwischen passiert sein mochte? Denn unten auf der Straße herrschte reges Leben; vom Kai herüber summte es wie die Propeller eines Zeppelins. Hohe und tiefe Brummtöne der Dampferpfeifen verrieten dem Kranken, wie lebhaft sich der Verkehr auf der Scheide noch abwickelte. Im Hause selbst schien aber Grabes schweigen zu herrschen. Als auf sein wiederholtes Klingeln niemand erschien, entschloss sich Erich trotz großer Mattigkeit, das Zimmer zu verlassen, um sich über den Straßentumult und die Totenstille des Hauses näher zu unterrichten. Doch seiner harrte eine Überraschung, an die er selbst in wildesten Fieberphantasien nicht gedacht hatte. Er sah unter den Bäumen auf der andern Straßenseite, gegenüber dem Seemannshause, eine lebhaft sich unterhaltende, wilde Drohungen ausstoßende Menge, die von Minute zu Minute anschwoll. Den größten Zuzug empfing der dichtgedrängte Haufe von links, vom Kai her. Überhaupt schienen sich hier alle Angehörigen des Janhagels der Wasserkante ein Stelldichein gegeben zu haben. Viele hatten aus Säcken hergestellte Schürzen umgebunden, aus denen durch Hochhalten der beiden Zipfel Beutel gebildet waren, deren Inhalt Erich gleich kennen lernen sollte. Als nämlich wieder ein halbes Dutzend wahrer Apachengestalten mit gefülltem Schürzenbeutel angerückt war, wurden die Ankömmlinge johlend empfangen. Sie schienen von irgendwelchen Heldentaten an der Wasserkante zu berichten. Gelächter und neues Gejohle belohnte die Überbringer jeder Botschaft. Ein eigentümliches Geräusch in der Luft, ein Klirren und Sausen, fast an die Ankunftszene der Vertriebenen in den Quitzows erinnernd, klang von der nahen Hafenstraße herüber. Neues Gelächter, Pfeifen und Heulen; und dann kommt plötzlich Bewegung in die Menge, die Gutes nicht im Schilde führen konnte. Dem jungen Beobachter, der inzwischen zu seiner Bestürzung herausgefunden, dass er der alleinige Insasse des ganzen Seemannshauses sei, war nunmehr klar: Der anrückende Haufe will plündern. Erst ganz klein, die Figuren genau wie auf einem Kinofilm, dann immer größer werdend, die Front breiter und breiter sich ausdehnend. Aus dem Johlen und Pfeifen heben sich schon einzelne Stimmen deutlich ab. Vernehmlich hört man jetzt auch vom Kai Van Deyck das Klirren eingeschlagener Fenster- und Ladenscheiben, das Krachen und Bersten von Türen und Läden. Angstschreie, rohes Gelächter und neue Boten, die dem jetzt schneller vorgehenden Haufen Beruhigung wegen etwaiger Behinderungsversuche von Seiten der Polizei einzuflößen schienen. Wut und Verzweiflung packte den Verlassenen. Denn elend und schwach wäre er der vorstürmenden Rotte auf Gnade oder Ungnade preisgegeben gewesen. Ganz ohne Waffe und knapp imstande, den sonst so kräftigen Arm zu heben, musste er gewärtig sein, wie eine wehrlose Ratte zertreten, totgequetscht zu werden.
Jetzt macht drunten der Haufe halt. Sarnekow schmiegt sich in die schmale Zimmerecke am letzten Fenster und lugt vorsichtig aus diesem Unterstand durch die Scheiben. Die Vordersten stehen weit über der Straßenmitte still; erst drängeln noch die folgenden Reihen, dann staut sich die ganze Flut und steht wie eine feste Mauer in viertel Straßenbreite dem Seemannsheim, das deutscher Gemeinsinn geschaffen, gegenüber. Dann schlüpfen einige Schürzenmänner ins erste Glied. Der Hörer im oberen Stock vernimmt wohl einige flämische Worte, kann aber deren Sinn noch nicht ausfinden. Nur zu klar wurde ihm gleich darauf die Bedeutung der Ansprache, die eine ganz besonders polizeiwidrige Gestalt hielt, schon in der nächsten Sekunde. Der Rädelsführer hatte seine Weisungen gegeben; die Männer schaffen sich erst Ellenbogenfreiheit, und dann prasseln faustgroße Steine, Ziegelbrocken, Eisenstücke wie ein Hagelwetter in die großen Scheiben des Erdgeschosses, wo der Schenkraum und das Kontor liegen. Auch seitwärts in die Zimmer der Seemannsmission sausen die Geschosse. Pfeifen, Gelächter und Gröhlen übertönen fast den Lärm der klirrenden Splitter. Über dem Höllenspektakel aber schwebt trotz ihrer Schnapsrauheit immer vernehmbar die anfeuernde und leitende Stimme des Führers dieser Horde. „Een, twee, drie — warp!“ und sausend krachen die Geschosse in neue Scheiben. »La troisiéme« klingt’s dann zur Abwechslung mal französisch aus der heiseren Kehle eines Zweiten, dessen Galgenphysiognomie hier recht an Ort und Stelle ist. Dichte Salven von halben Mauersteinen donnern schon gegen die feste Haustür, und einzelne wohlgezielte Würfe zerschmettern gelegentlich die Glasflächen im ersten Stock, wo der einzige Zuschauer dieses Zerstörungswerkes bald Projektile des Bombardements in seine Waschschüssel fliegen sieht. Hoch auf spritzt der Inhalt und bedeckt mit den Scherben der Schale und ins Zimmer fallenden weiteren Steinen den sonst so blitzblanken Fußboden. Das Bett füllt sich mit den Trümmern der Geschosse. Es sieht bald aus, als habe jemand den Kachelofen umgerissen und hier auf der Ruhestatt vorläufig abgelagert. — Von unten herauf hört man das Krachen der gegen die Wand geschleuderten Flaschen und Gläser im Speisesaal, den die Plünderer schon anfüllen. In Splittern fliegen Tische und Stühle, Schenke und Bilder durch die leeren Fensterhöhlen aufs Pflaster, die Straße bald mit dicker Trümmerschicht bedeckend. — Doch nach und nach wird der Lärm geringer, die Banditen scheinen ermüdet abzuziehen; sie wollen auch wohl den Inhalt der geraubten Flaschen in einem stillen Winkel in Ruhe leeren. Schließlich liegt das Haus wieder in Grabesstille, man würde fast hören können, wie die Mäuse die Treppen hinauf und hinunter huschen. — Sind die Frevler gestört? Hat ihrer bessere Arbeit gewartet, noch lohnendere Plünderung ihnen in Aussicht gestanden? Es ist niemals aufgeklärt, warum sie abzogen, ohne dem Oberstock eine Visite abzustatten. Der einsame Gast des sonst so rege besuchten Heims horcht noch angestrengt auf die sich immer mehr entfernenden Tritte und gewinnt nach und nach die Überzeugung, dass er vorläufig gerettet, dass er augenblicklich in Sicherheit ist.
Jetzt bringt sich aber die Krankheit wieder in Erinnerung, auch der Hunger meldet sich, nachdem die Aufregung der letzten beiden Stunden alles andere zurückgedrängt hatte. Da das Bett als Lager nicht zu brauchen ist; große Schwäche ihm das Wegräumen des Schuttes nicht mehr gestatten will, versucht Erich sich auf dem Sofa einzurichten. Trotz nagenden Hungers und ungeachtet der Schmerzen, ist er bald in festen, traumlosen Schlaf gefallen.
Als er die Augen wieder öffnet, ist schon das Dunkel der Sommernacht um ihn her. Er hat also einige Stunden geschlummert und währenddessen Plünderung und Krieg vergessen gehabt. Jetzt ist es ihm aber, als habe die eine Stufe der Treppe geknackt, die jedes Mal einen Alarmton gab, so oft man gerade darüber wegschritt. Dies hatte früher oft zu Scherzen der Hausinsassen Veranlassung gegeben. Gespannt horcht der Einsame und vernimmt nun deutlich, dass jemand sich tastend und vorsichtig nähert. Jetzt hebt sich auch im Türrahmen deutlich die Gestalt eines Mannes ab, dessen Augen sich wohl schon an die Dunkelheit des Zimmers gewöhnt haben mochten. Denn er flüstert den Namen des Schiffsoffiziers. „Sarnekow, sind Sie hier? Leben Sie und sind Sie unverwundet? Ich bin’s, Kuhlo, Ihr alter Schiffskamerad. Ich fragte schon früher nach Ihnen im Hospital. — Können Sie hochkommen und fort von hier? „Der Inspektor schickt mich, Sie zu holen. Er will die Nacht noch fort, um seinen Kompaniedampfer in Sicherheit zu bringen. Denken Sie, die verdammten Belgier haben den ganzen Hafen geplündert, d. h. natürlich bei den Deutschen. Unsere Truppen sind drauf und dran, in Belgien einzumarschieren, um Frankreich schnell angreifen zu können. Das hat die Leute hier natürlich furchtbar erbost und wahnwitzig gemacht. Nun haben sie zugelangt und alles kurz und klein geschlagen, wo sie deutsches Eigentum zu finden vermuteten. Die Hunde! Mien Fru ehr neie Neihmaschien hebb se ook. Nich etwa twei mookt? Ne, de hebbt se eenfach heel un ganz metnohin! Un mien Fru, de mutt dat so met ankieken, dat so ‘n dicke Ohlsch ehr de recht vor de Näs’ wegsleep’n deit! So ‘n Bande!“ — Nach einer Weile fuhr die treue Seele fort: „Wir müssen alle raus aus Belgien, hüt nacht noch. Da is en grooten Flüchtlingszug tosam’stellt, da mutt wie all met. Sonst weiß ich den Deubel nich, wat da noch von ward!“ —
Begierig hatte Erich dem lebhaften Berichte seines ehemaligen Schiffskameraden gelauscht und sich, wenn auch stöhnend und noch mit Mühe, von dem unbequemen Lager erhoben. „Ihre übrigen Sachen sind weiß Gott wo“, fuhr er fort, auf Erichs paar Habseligkeiten deutend, „die können Sie man Adjüs sagen auf Nimmerwiedersehen! Da sin die Schubbejacks natürlich ook gliek up los wesen hier unten in’n Keller; alles Seemannszeug, das Janmaat hier zur Aufbewahrung gelassen hat, is allens futsch! Na lat man, uns’ Lud salln hier erst mal kom’, dann sollt se woll scheun betohln, de Antwerpner Röders!“ Sarnekow hatte sich inzwischen, so gut das in dem Halbdunkel ging, angezogen und war nun fest entschlossen, die erlangte Gelegenheit zur Heimfahrt zu benutzen, ob krank oder genesen.
Durch den Seiteneingang der Mission verließen beide das öde Haus und schwenkten, rasch in die trotz der Nachtstunden noch auf- und niederflutende Menge tauchend, links ab nach dem Hause der Agentur der Linie, um hier zu den bereits Versammelten zu stoßen. Angestellte der Kompanie, Frauen und Kinder, Seeleute, Bootsführer, wohl an zwanzig Personen saßen in einem großen dunkeln Packraume hinter dem Kontor, dessen Fenstern dasselbe Schicksal bereitet war wie im Seemannshause. Es war beschlossen, Frauen, Kinder und ältere Leute sollten das unerleuchtete Haus möglichst unauffällig und in kleinen Gruppen verlassen und durch Nebenstraßen den Bahnhof zu erreichen suchen. Unterwegs sollte, um die Aufmerksamkeit des Antwerpener Pöbels nicht unnötig zu erregen, gar nicht oder nur das Allernotwendigste gesprochen werden. Der Vertreter der Linie war der Ansicht, die schlimmsten Jagdszenen würden sich unten an der Wasserkante abspielen. Der Pöbel hätte, so meinte der erfahrene Mann, dann auch vor allem die Hauptstraßen für seine Promenaden gewählt. Als die letzten der für den Bahnhof Bestimmten das Kontor der Reederei verlassen hatten, ohne dass ihr Fortgehen bemerkt worden wäre, machte sich auch der Inspektor fertig, mit den noch übrigen sechs Männern den ungemütlichen Raum zu verlassen. Erich hörte nun den Plan, dass man denke, an Bord des Dampfers zu gelangen und mit dem kleinen Fahrzeug vorsichtig die Schelde hinabzufahren, um Holland zu erreichen. Kuhlo hatte sich noch nach Einbruch der Dunkelheit unbemerkt an Bord gestohlen, den Namen „Libelle“ an der Seite überpinselt, so dass die bisher dort angebrachten großen weißen Buchstaben nicht mehr zum Verräter werden konnten und ferner, um das Fahrzeug noch mehr unkenntlich zu machen, dem gelbgestrichenen Schornstein ein schwarzes Kleid gegeben. Der kleine Dampfer sah durch dieses Umfrisieren den Schleppern der Société Anonyme de Remorquage á Hélice täuschend ähnlich. Selbst wenn nun die Scheinwerfer der Festungswerke ihr Millionen-Kerzenlicht grad auf ihn richten würden, oder auf dem Revier kreuzende Wachtboote ihn bemerkt hätten, so wäre er nach dieser Umwandlung doch nur dann wieder zu erkennen gewesen, wenn die Blockadebeamten mit ihren eigenen Fahrzeugen unmittelbar längseit gekommen wären. Der sonst die Maschine bedienende Belgier war schon nachmittags von Bord und in die Stadt gegangen und zum Glück nicht zurückgekehrt. Der deutsche Heizer hatte das Feuer unter dem Kessel langsam unterhalten und die Glut rasch wieder entfacht, als alle sieben Passagiere an Bord waren. Der am ganzen Hafen bekannte Inspektor hatte sich den Bart gestutzt und eine Arbeiterjacke übergeworfen, während ihm eine breite weiche Mütze ganz das Aussehen eines an der Antwerpener Wasserkante Heimatsberechtigten gab. Er und ein ihm bekannter deutscher Maschineningenieur, der bis heute in einer belgischen Fabrik angestellt gewesen war, hatten sich jeder mit einem großen Ballen beladen, in den man die wichtigsten Papiere und Bücher der Reederei eingeschlagen, um sie für das Stammhaus in Deutschland zu retten. Alle gelangten dank der Vermummung als Hafenarbeiter in ruhigem Schritt mit ihrer Last ungefährdet an Bord. Begegnende hielten das Getragene wohl für gemachte Beute und riefen ihnen dann und wann Scherzworte über dies vermeintliche Glück zu.
Im letzten Augenblick hatte sich ein noch allen unbekannter, achter Mann eingefunden, den man erst beim Verlassen des Speichers gewahr geworden war. Der Inspektor kannte ihn augenscheinlich näher, schien aber bestrebt zu sein, das Inkognito des Fremdlings zu wahren, der einen sehr vornehmen Eindruck machte. Nach später, während der Fahrt aufgefangenen Brocken der Unterhaltung kam er aus Ostende, hatte die rechtzeitige Rückkehrzeit verpasst und betonte, auf jeden Fall nach Deutschland zurück zu müssen. Namentlich schien ihm sehr daran gelegen, sein Handgepäck gut zu verbergen. Er zog auch Erich ins Gespräch, von dessen Erkrankung und Aufenthalt im Hospital er zuvor durch Inspektor Jürgens gehört hatte. Er sollte sich nur nicht zu viel zutrauen, meinte der neue Ankömmling im Laufe der Unterhaltung. So lobenswert es wäre, sich dem Vaterlande sofort zur Verfügung zu stellen, so verkehrt sei es aber, einem noch nicht wieder gesundeten Körper Kriegsstrapazen zuzumuten. Denn an Bord von S. M. Schiffen sei keiner überflüssig. Jeder müsse dort seinen Platz ganz und voll ausfüllen! Erkranke aber jemand gleich in den ersten Tagen, so störe er die Ausbildung der Kameraden, für deren Vollzähligkeit wieder frischer Ersatz nötig sei. Diesen müsse man dann neu einexerzieren, damit er sich dem Zusammenwirken der schon weiter Fortgeschrittenen auch anzupassen vermöge. — Kuhlo warf die beiden Taue, die die kleine „Libelle“, den Kompaniedampfer, an der Steintreppe dicht beim Lotsenamte hielten, nunmehr ganz leise los, setzte mit seinem starken Bootshaken den Bug geräuschlos ab und drückte so den Kopf des Fahrzeuges allmählich herum, dass er nach außen zeigte. Der dem Inspektor befreundete Ingenieur hatte den Rock beim Betreten des Bootes abgeworfen, die Hemdärmel hochgestreift und war in die Maschine hinuntergestiegen, um ihre Steuerung zu bedienen, während der alte Jürgens das Rad ergriff, um die sieben Deutschen auf dem rechten Kurse die Scheide hinunter in die Freiheit und sicher heimzubringen. Ein schläfriger Polizist erhob sich beim Passieren des Fahrzeugs von einem am Ufer lagernden Ballen jenseits der Einfahrt in das Petit Bassin und fragte etwas in flämischer Mundart herüber. Kuhlo, dessen Organ das ausgiebigste zu sein schien, rief ihm ein „Ja well“ zu und lachte laut auf, als ob er über einen köstlichen Witz des andern außerordentlich erfreut sei. Der Wächter der heiligen Hermandad in seinem schläfrigen Dusel dachte sicher:
„Wo man lacht, da lass dich ruhig nieder.
Die bösen Deutschen kommen niemals wieder“
und warf sich beruhigt von neuem auf seine weiche Unterlage. — Nun ließ der Inspektor seine „Libelle“ quer über den Strom schießen und dann die Maschine stoppen, damit das Geräusch der arbeitenden Schraube und das Bub-Bub der Zirkulationspumpe nicht zum Verräter würden. Dicht am linken Scheldeufer, fast unter den Wällen des Forts trieb das kleine Fahrzeug, von der ablaufenden Ebbe getragen, dann leise stromabwärts. Einmal huschte der Lichtkegel eines Scheinwerfers vom Ufer über das Schifflein hinweg. Die Aufmerksamkeit des Ausgucks war jedoch wahrscheinlich mehr auf die Mitte des Reviers und das rechte Ufer gerichtet. Nach einigen angstvollen Sekunden war man wieder frei von diesem Strahlenbündel und sackte weiter und weiter stromab, nunmehr mit nur langsam angehender Maschine, um nicht die unerwünschte Aufmerksamkeit etwaiger Posten in der Nordzitadelle zu erregen. Dann hieß es rechtzeitig wieder stoppen, um nur die günstige Richtung des Tidenstromes zum Weiterkommen zu benutzen. Diesmal zog es der erfahrene Seemann am Steuer vor, recht in der Mitte des Fahrwassers zu bleiben. Man schien aber nirgends Verdacht zu schöpfen, denn niemand hinderte die Flüchtlinge, obwohl an Backbord und Steuerbord zuweilen kleinere Dampfer passierten und auch mitunter nach der „Libelle“ etwas hinüberriefen. Kuhlo antwortete dann mit seiner Stentorstimme entweder die internationale Formel „All right“, was so viel wie „Alles in Ordnung“ bedeutet oder das von den Seeleuten ebenso häufig gebrauchte „Ay Ay“, „schon gut“, eine Redewendung, die fast immer passt und zu nichts verpflichtet. Der fremde Gast machte sich jedes Mal beim Passieren der Forts kurze Notizen und schien namentlich für die Scheinwerferbeleuchtung großes Interesse zu haben, ließ sich aber unterwegs mit niemand mehr in ein Gespräch ein. Nur einmal ersuchte er den auf dem Einfalllicht der Maschine halbliegenden Erich freundlich, doch an eine Handtasche und ferner an eine meterlange Rolle die größten Steinkohlenbrocken, deren er habhaft werden könne, mit guten Seemannsknoten festzubinden und dann beide Gepäckstücke neben sich im Auge zu behalten. Nötigenfalls würde er weitere Weisungen empfangen. — Beinahe bei Sonnenaufgang hatte man das letzte belgische Fort am linken Ufer, Liefkenshuk, passiert, ebenfalls ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Auch bei Lillo rührte sich nichts. Dann steuerte der kundige Inspektor Jürgens wieder quer über den Strom und war nach einer letzten angstvollen Viertelstunde, nachdem man auch vom Fort Frederik Henrik nicht belästigt war, aufatmend in holländischem Gebiet. „Nun lassen Sie ihn laufen, was die Maschine hergibt“, pustete er erleichtert dem vornehmen Maschinisten durch das Sprachrohr nach unten, und bald wurde die Bemannung der „Libelle“ gewahr, dass das Kommando auch sofort ausgeführt worden sei. Denn wie ein Pfeil flog das kleine Fahrzeug jetzt flussabwärts und lag bald geborgen in der Nähe der zur Oberschelds führenden Schleuse des Süd-Bevelandschen Kanals beim Dorfe Schore sicher vertäut. Der Heizer und Kuhlo blieben vorläufig als Wache an Bord, während die übrigen Fahrgäste sich zu dem östlich liegenden Bahnhofe aufmachten. Der Inspektor mit dem fremden Herrn, den er jetzt, wie Erich zu hören vermeinte, mit „Herr Kapitän“ anredete, verabschiedeten sich, da sie in Holland noch durch verschiedene wichtige Besorgungen würden aufgehalten werden. Jedenfalls sei es nicht unmöglich, sich in Hamburg — oder — das meinte der Begleiter des Inspektors zu Erich gewendet — auch in Kiel wieder einmal in Sicht zu laufen. — Nachdem hilfreiche Holländer, dix sich schon beim Anlegen der „Libelle“ eingefunden, die Führung der einen Gruppe zum Dorfe, des Nestes zur „spoorweg statie“, zum Bahnhofe, übernommen, marschierten die den Belgiern glücklich Entronnenen ihrem Ziele zu. In Rozendaal, wo die von Antwerpen kommende Bahn Anschluss an das niederländische Netz gewinnt, erfuhr man, ein langer von Antwerpen abgelassener Flüchtlingszug wäre schon voraus, und die Möglichkeit, dass noch einer folge, sei nicht ausgeschlossen. Man kam deshalb überein, die gleich nach der deutschen Grenze gebotene Fahrgelegenheit zu benutzen. Man werde bis Goch entweder den vorausbefindlichen Zug einholen oder doch erfahren, ob die Bekannten darin wären oder noch folgten. — Wie vermutet, konnte der in Trilburg liegende Flüchtlingszug die Angehörigen unserer „Libelle“-Leute noch nicht bergen, da er Antwerpen schon am Spätnachmittage verlassen hatte; während unsere Bekannten ja erst in der Nacht aus der Agentur aufgebrochen waren. Man beschloss, trotz der gastlichen Aufnahme durch die stammverwandten Holländer, lieber bis Goch durchzufahren und auf deutschem Boden das Eintreffen der Freunde abzuwarten. Erich fand dort bereitwillige Hilfe in der bereits in voller Arbeit befindlichen Baracke des Roten Kreuzes und durfte, da er sich nicht erst Unterkunft im Gasthause suchen wollte — um die Freunde ja nicht zu verfehlen — in der Bahnhofsstation verweilen und sich dort auf einem Feldbette ausstrecken. Seine Kräfte waren am Ende, und er bedurfte dringend einiger Stunden der Ruhe. Gestärkt erwachte er, als die junge Schwester eintrat, um mitzuteilen, der erwartete Zug sei nunmehr gemeldet und würde in einer Viertelstunde fällig sein. Leichter als man gedacht, waren die in Antwerpen Getrennten wieder vereinigt. Trotz der überfüllten Wagen machten die Insassen gerne Platz, wenn man bei der drangvoll fürchterlichen Enge überhaupt von einem solchen noch reden darf. Erich konnte dem bald gefundenen Vertreter von der glücklichen Ankunft der „Libelle“ berichten, und fuhr mit den andern vereinigt weiter.
Mit welcher Dankbarkeit hatten die Flüchtlinge die ersten Erquickungen angenommen, nachdem man die holländische Grenze erreicht. Mit welchem Jubel aber sah man schließlich wieder die deutsche Flur, trotzdem mancher im Zuge wohl nur mit trübem Blick der Zukunft entgegenschauen konnte, nachdem all sein, vielleicht in Jahrzehnten, erworbenes Hab und Gut dem Antwerpener Pöbel zum Opfer gefallen! Langsam rollten die vollgepfropften Wagen durch die mit stets neuer Freude begrüßten Gaue unseres Vaterlandes. Die Kunde von ihrer Vertreibung war ihnen bereits vorausgeeilt; schon waren durch das rastlose Arbeiten des elektrischen Funkens die Gräuelszenen bekannt, die sich in der Scheldestadt abgespielt hatten. Aber beruhigend war allen, den unzähligen Zügen zu begegnen, die bereits Soldaten und Kriegsmaterial gen Westen schleppten. „Die Schmach von Antwerpen werden wir rächen, Landsleute! Lasst uns nur erst mal da sein! Denen soll schon eingeheizt werden. Man ruhig Blut! Ihr sollt schon wieder zu Eurem Eigentum kommen“, so schallte es den Flüchtlingen vielfach aus den Soldatenwagen entgegen.