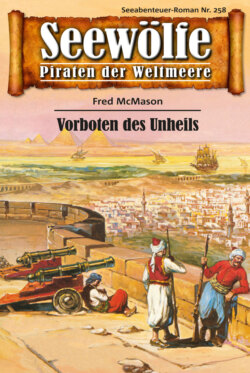Читать книгу Seewölfe - Piraten der Weltmeere 258 - Fred McMason - Страница 4
1.
ОглавлениеDer Gambianeger Batuti schien die Hitze kaum zu spüren, die in langen Wellen über der Wüste flimmerte. Seine Haut war trocken, lediglich auf seiner dunklen Stirn standen ein paar winzige, kaum sichtbare Schweißperlen.
Kein Wunder, dachte Dan O’Flynn, der neben ihm herritt, Batuti stammte ja auch aus Gambia, aus dem Sudan, und war ein echter Mandingo, ein unverwüstlicher Naturbursche, der in dem tropischen heißen, flachhügeligen Savannenland aufgewachsen war.
Ja, ein Mandingo, überlegte Dan, und diese Kerle warf nichts um, die haute nichts aus dem Sattel. Ebenso selbstverständlich wie Batuti seit langen Jahren zur See fuhr, hockte er jetzt auf einem übelriechenden Wüstenschiff und ritt durch die sengende Hitze, als sei das ganz selbstverständlich.
Sie ritten dicht nebeneinander auf den schaukelnden Kamelen, und Dan O’Flynn begann vor sich hinzudösen. Diese sengende Glut, die über der Wüste stand, trocknete ihm noch den Verstand aus.
Sie hatten ihre Aufgabe erfüllt und befanden sich auf dem Rückweg zum Nil, wo die „Isabella“ querab von Kuft lag. Sie hatten das Rote Meer gefunden und waren damit der Gewißheit ein Stück näher gerückt, daß es auch einen Wasserweg dorthin gab, eben jenen Kanal der Pharaonen, wie er auf der geheimnisvollen Karte eingezeichnet war.
Der Seewolf würde sich über diese Entdeckung freuen, das war sicher, denn diese Entdeckung – der Seeweg nach Indien – war wirklich eine Sensation. Im Roten Meer hatten Batuti und er ein erfrischendes Bad genommen, und in eineinhalb Tagen konnten sie wieder an Bord sein.
Vor, hinter und neben ihnen dehnte sich trostlos, heiß und verlassen eine Wüste, die scheinbar keinen Anfang und kein Ende hatte. Nirgendwo war eine Menschenseele zu sehen. Nur himmelhohe Sanddünen, weite gelbliche Täler, dann wieder Dünen, wellenförmig, wie glattpoliert mitunter, andere von yardtiefen Furchen bis zum Horizont durchzogen.
Irgendwie erinnerte es Dan an das Meer, an lange rollende Dünung, die plötzlich erstarrt war. Die Zeit war stehengeblieben und hatte alles angehalten, jede Bewegung, jeden Hauch, und so waren auch diese Wellen erstarrt.
Er blickte nach links, zu Batuti, dem knochenharten Kerl, den das alles nicht zu berühren schien. Verdammt, Batuti hatte noch keinen einzigen Tropfen Wasser getrunken. Er blickte voraus, warf auch hin und wieder einen Blick auf Dan und grinste leicht, daß man seine starken weißen Zähne in der Sonne blitzen sah.
Dan O’Flynn war zwar auch ein harter Knochen, wie alle aus der Familie O’Flynn. Er war ein Draufgänger, der Tod und Teufel nicht fürchtete, der sich im Leben hart durchgeschlagen hatte und heute zur Schiffsführung der „Isabella“ gehörte. Er hatte die Navigation erlernt, sich behauptet mit der ihm eigenen O’Flynn-Zähigkeit und immer wieder durchgebissen, aber dieser Ritt auf dem stinkenden, schaukelnden Kamel durch eine gottverlassene Landschaft, unter glühender Hitze, bei ständigem Durst und knirschendem Sand zwischen den Zähnen, das schaffte selbst ihn bald.
Schweiß verklebte ihm die Augen, Sand hing ihm in den Mundwinkeln, und der Durst plagte ihn in einer Weise, daß er am liebsten ständig gallonenweise Wasser in sich hineingesoffen hätte. Vor seinen Augen flimmerte der Glast, die Wüste schien mal in der Luft zu hängen, dann drehte sie sich leicht zur Seite, und feurige Wellen liefen nach allen Richtungen davon.
Scheißwüste, dachte er träge. Hier mußte der liebe Gott mal vor Jahren und im allergrößten Zorn ein paar Hände voll Sand hingeworfen haben, für alle jene, die so vermessen waren, immer und ewig nach Neuem zu suchen und den Hals nicht voll genug kriegen konnten.
Trotzdem hausten selbst hier noch Tiere. Überaus lästige Sandfliegen, Sandflöhe, kleine Spinnen, Springmäuse und die giftigen Skorpione. Der Teufel mochte wissen, was die Biester hier hielt, und wovon sie sich ernährten.
Und dann diese Kamele oder Dromedare. Die rannten mit hochmütig und arrogant vorgestreckten Schnauzen von morgens bis abends durch den glühendheißen Sand. Fanden sie mal einen dornigen Busch oder ein paar Disteln, dann blieben sie stehen und fraßen das Zeug. Fanden sie nichts, schien es sie auch nicht zu stören.
Und Durst hatten diese plattfüßigen Ungeheuer anscheinend nie oder nur sehr selten.
Ein Kamel müßte man sein, dachte Dan, aber war er nicht ohnehin eins, daß er hier quer durch die Hölle ritt? Na klar, er war ein Kamel, aber eins, das keine Disteln fraß und ständig Wasser brauchte.
Er griff zu dem Ziegenlederschlauch am Sattel – zum wievielten Male eigentlich schon? – und trank ein paar Schlucke.
Das Wasser schmeckte brühwarm und fad, und es erfrischte auch nicht, denn nach ein paar Schlucken hatte man meist schon wieder Durst.
Batuti warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu, aber Dan O’Flynn ignorierte den Blick, starrte einmal auf den kleinen Kompaß, den sie dabeihatten und tat so, als wolle er feststellen, ob die Richtung noch stimme.
Batuti kannte jedoch seinen Freund und blieb hartnäckig. Er zeigte seine weißen Zähne und wurde leicht ironisch. Dan O’Flynn zu belehren, war völlig witzlos, darauf reagierte er nicht. Man mußte ihn schon nachdenklich stimmen.
„Mensch dümmer als Kamel, heißen ein Sprichwort. Mensch saufen immer viel, Kamel wissen, warum selbst nicht soviel saufen.“
„Na und?“ brummte Dan.
Batuti ließ sich nicht beirren.
„Viel saufen, viel schwitzen“, sagte er lächelnd, „noch mehr saufen, noch mehr schwitzen. Wenig saufen, nur ganz wenig schwitzen.“
„Ein Kamel kann ja auch nicht schwitzen“, sagte Dan. „Das hat ein wasserdichtes Fell.“
„Du immer wissen besser“, sagte Batuti. „Aber trotzdem nicht immer gleich trinken, wenn nur ein bißchen Durst. Warten, warten, verschieben auf später.“
„Später bin ich so ausgetrocknet wie die Mumienmänner, wenn ich nichts trinke.“
„Wenn dein Trinkwasser alle, ich dir geben meins.“
„Schon gut, hast ja recht“, meinte Dan. „Ich werde versuchen, vorerst nichts mehr zu trinken.“
„Oder nur machen Lippen feucht“, schlug Batuti vor.
Danach nickte Dan, dann schwiegen sie eine Weile.
Über ihnen hing der Glutball der Sonne, ein riesengroßes, heimtükkisch leuchtendes Auge, das sie bösartig anstierte. Dieser Riesenofen schleuderte Unmengen Glut herab. Der Sand fing diese Höllenglut auf, erwärmte sich an ihr und strahlte sie wieder zurück. Das ging den ganzen Tag so, und nachts wurde es so lausig kalt; daß einem die Zähne klapperten.
Mit gesenktem Kopf ritt Dan weiter. Hin und wieder warf er einen Blick auf den Kompaß, auf das lebenswichtige Utensil, das ihnen zwar nicht die Rückkehr, aber wenigstens die Richtung garantierte.
Immer weiter ritten sie, in ekelhaft schaukelnder Bewegung, mal an den Seiten hochgehievt, dann wieder von vorn und achtern, immer dem Trott der Wüstentiere angepaßt, die so schaukelten wie ein angeschlagenes Schiff bei hart rollender Dünung.
Dan O’Flynn wußte nicht, wieviel Zeit vergangen war. Zeit? Die spielte hier ohnehin keine Rolle. Es schien keine Zeit zu geben, nur sengende Sonne, brüllende Hitze und knisternden Sand.
Dan bemerkte jedoch, daß sich irgend etwas geändert hatte. Er vermochte nur nicht zu sagen, was das war. Etwas irritiert sah er sich nach allen Seiten um.
Nein, nichts hatte sich verändert. Oder doch? Da waren die langgestreckten berghohen Dünen, da war …
Ja, die Sonne war es, die sich verändert hatte. Sie stand immer noch am Himmel, als wollte sie sich jeden Augenblick mit ihrem kochendem Atem auf die Erde stürzen und alles verbrennen. Aber um die Sonne hatte sich ein kaum sichtbarer Schleier gelegt, der sie leicht dunstig erscheinen ließ.
„Mächtig viel warm“, sagte Batuti in die tödliche Stille hinein.
Dan bemerkte, daß sich auch der Gambiamann immer wieder nach allen Seiten umdrehte, als erwarte er eine Gefahr.
„Fast so warm wie in England“, sagte Dan anzüglich und grinste den titanenhaft wirkenden Herkules aus rissigen Lippen an.
Sein Gaumen war schon wieder ausgetrocknet, die Zunge hing ihm wie ein trockener Schwamm im Hals, und von seinem Körper troff das Wasser, als hätte er ein Bad genommen.
Der schwarze Riese aus Gambia ging auf Dans Worte nicht ein. Der Blick seiner dunklen Augen wanderte unruhig hin und her. Zwischen seinen Augen bildete sich eine senkrechte Falte.
„Ist was?“ fragte Dan. „Vielleicht gibt es Regen, was?“
„Hier nicht regnen, Dan. Viele Jahre kein Regen“, sagte Batuti ernst. „Aber Allah machen viel warm und Sonne dunkel.“
„Fängst du jetzt auch schon mit Allah an?“ fragte Dan gallig. „Der lacht sich doch halbtot über uns.“
Batuti hob die Hand und deutete auf den glosenden, jetzt von einem feinen Schleier umgebenen Sonnenball. Das rosige Innere seiner Handflächen hob sich stark von der dunklen Haut ab.
„Batuti nicht gefallen. Nix gut, wenn Sonne dunkel.“
Dan zuckte mit den Schultern. Er kannte sich zwar mit dem Wetter gut aus, doch das galt für das Meer, nicht aber hier in der lausigen heißen Wüste, wo andere Gesetze herrschten. Andererseits konnte er sich darauf verlassen, daß Batuti Bescheid wußte. Der Mann aus Gambia spürte sogar schon ein Erdbeben lange im voraus. Seine Instinkte waren immer hellwach, und er reagierte auf jede noch so kleine Veränderung in der Natur.
„Was, glaubst du, hat das zu bedeuten?“ fragte Dan nach einer Weile.
„Kamele schon unruhig“, sagte Batuti.
„Davon habe ich noch nichts bemerkt.“
„Batuti schon lange merken.“
„Du hast meine Frage nicht beantwortet“, erinnerte Dan.
Der muskelbepackte Herkules deutete stumm nach oben.
Dan kniff die Augen zusammen, musterte den immer milchiger werdenden Feuerball und stellte fest, daß sich da etwas entwickelte, das nach Regen aussah. Die Sonne zog Wasser, so schien es jedenfalls, und so hätte man auf See auch dazu gesagt. Schleier wirbelten in der Atmosphäre, und über den Sonnenrand legte sich ein etwas dunklerer Punkt. Minutenlang hatte es den Anschein, als stünde eine partielle Sonnenfinsternis bevor. So etwas hatte Dan schon einmal im Land des Großen Chan erlebt.
„Ah, du meinst eine Sonnenfinsternis?“ fragte Dan.
„Batuti meinen Sandsturm. Schlimmes Sandsturm.“
Dan sah seinen langjährigen Freund und Bordkameraden ungläubig von der Seite an und verzog das Gesicht.
„Ein Sandsturm? Verdammt, das fehlt uns noch.“
Für Augenblicke flackerte es in Dans Augen auf, dann hatte er sich wieder in der Gewalt. Er hatte zwar noch keinen Sandsturm in der Wüste erlebt, aber er konnte ihn sich ungefähr vorstellen. Und wenn er Batutis besorgtes Gesicht sah, dann konnte er sich einen Sandsturm schon wesentlich besser vorstellen, denn er sah, wie der Neger die Farbe wechselte. Sein Gesicht wirkte älter und wurde leicht grau.
Jetzt spürte auch Dan die innere Unruhe der beiden Kamele. Sie schnaubten laut und gaben ein paar merkwürdige Schreie von sich wie Tiere, die man zur Schlachtung führt, und die das Blut ihrer getöteten Artgenossen schon riechen.
Sie liefen schneller, sie rannten und trampelten über den heißen Sand, und sie wollten nach links ausbrechen. Dort aber gab es nur noch mehr Wüste. Doch voraus lag der Nil.
Dan riß sein Tier herum und zwang es in die alte Richtung.
Gleich darauf hüllte sich der Sonnenball in noch dichtere Schleier, und aus dem Sand erklang ein leises Fauchen. Ein glühend heißer Luftzug wehte in ihre Rücken, und am Horizont tauchte weit achteraus ein feiner Schleier auf, der spielerisch über die Dünen tanzte.
Er trieb auf sie zu, legte sich dann aber wieder, und Dan wollte schon befreit aufatmen.
Ein leises Winseln erklang, wieder ein Gluthauch, der sie diesmal frösteln ließ und sogar den Schweiß von Dans Körper fast schlagartig vertrieb.
Die ersten Vorboten des nahenden Unheils waren da, aber mit ihrer Entfaltung ließen sie sich noch reichlich Zeit. Wie die sieben Schleier der Tänzerinnen sah dieses Spiel aus, fast neckisch und herausfordernd. Mal ein Winseln, ein sanftes Klingen, dann wieder ein klagendes Seufzen.
Glühend heißer Wind blies vom Roten Meer herüber, der die scheinbar tote Wüste zu unheimlichen Leben erweckte.