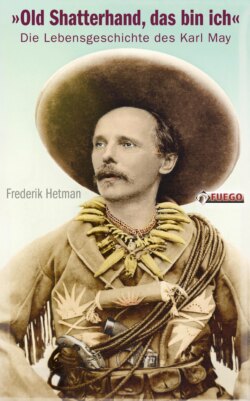Читать книгу Old Shatterhand, das bin ich - Frederik Hetmann - Страница 9
II. Einer soll Lehrer werden
Оглавление»Warum gibt es so viele Verlorene?
Sie müssen verloren gehen, weil man ihnen schon den ersten, kleinen Fehltritt nicht verzeiht.«
Karl May, Im Reiche des Silbernen Löwen IV
Im September 1856 besteht Karl May die Aufnahmeprüfung zum Lehrerseminar. Er ist an seiner neuen Ausbildungsstätte alles andere als zufrieden. Die Atmosphäre an der Lehrerbildungsanstalt ist pedantisch nüchtern und reaktionär. In der Demokratiebewegung des Jahres 1848 waren viele Lehrer engagierte Demokraten. Dem versucht man entgegenzusteuern. Eine bessere Bildung der unteren Volksschichten soll verhindert, demokratische Umtriebe und liberale Ideen schon im Ansatz unterbunden werden. Derlei Grundsätze gelten nicht nur für Preußen, sondern auch im Königreich Sachsen. »Restaurative Einstellung, systemtreue Frömmigkeit und staatserhaltende Anpassung wurden folglich goutiert und gefördert«, schreibt Wohlgschaft.13
Mays Kritik ist unpolitisch, er murrt vor allem über die Art und Weise, in der religiöse Fragen am Seminar behandelt werden, und Theologie und Religionsunterricht nehmen im Lehrplan einen breiten Raum ein. In der Haus- und Lebensordnung für das Schullehrer-Seminar in Waldenburg heißt es dazu: »Der Seminarzögling soll, eingedenk des von ihm gewählten Berufes, wie zu allen Zeiten, so auch während der Dauer seines Aufenthalts im Seminar, eines christlichen frommen Sinns sich befleißigen. Dieser Sinn wird sich kundgeben in andächtiger Theilnahme an den täglichen Hausandachten und am öffentlichen Gottesdienste, in würdiger Begehung der Abendmahlsfeier, in Vermeidung alles Sittlich-Unlauteren, in Gedanken, Worten und Handlungen, in Gehorsam gegen die Lehrer, in pünktlicher Befolgung der Anstaltsordnungen, in einem verträglichen, milden und gefälligen Verhalten gegen die Mitschüler, in einem bescheidenen, anspruchslosen und aufmerksamen Betragen gegen die übrigen Hausbewohner und gegen Fremde.«
Der Tageslauf scheint frei nach dem englischen Sprichwort »Early to bed and early to rise, make a man healthy, wealthy and wise« festgelegt worden zu sein. Man stelle sich die Reaktion eines heutigen Schülers oder Studenten vor, dem man Folgendes vorschreiben würde:
»§ 9 [...] Im Seminar wird an den Wochentagen um früh ½ 5, im Winter um 5, sonntags im Sommer um 5, im Winter um 6 Uhr aufgestanden. Nach der Abendandacht hat sich jeder Zögling bis ¾ 10 Uhr zu Bett zu begeben.
§ 10. Der Seminarist hat nach dem Aufstehen sein Bett zu machen, sich zu waschen, die Zähne zu reinigen, die Haare zu kämmen und sich vollständig anzukleiden. In den Früh- und Abendstunden des Winters dürfen warme Schuhe und ein schlafrockähnliches Oberkleid getragen werden; zu jeder anderen Zeit muss der Zögling mit Stiefeln oder Lederschuhen und mit Rock und Jacke, bei der Frühandacht am Sonntag mit Sonntagskleidern angethan sein.
§ 11. Das Schuhwerk und die Alltagskleider werden gleich nach dem ersten Frühstück, die Kleider und Stiefel für den Sonntag während der frühen Nachmittagsstunden des Sonnabends gereinigt. Reinigungsort ist im Sommer der Hof, im Winter der untere Hausflur.
§ 12. Im Sommer wird einige Mal in der Woche an einem sicheren Orte des Muldeflusses gebadet. Der die Tagesinspection führende Seminarleiter oder ein Hülfslehrer begleitet die Zöglinge. Im Winter wird von Zeit zu Zeit eine Hauptreinigung des Körpers in einem dafür eingerichteten Zimmer vorgenommen. Die hierfür zu beobachtende Ordnung wird vom Director näher bestimmt.«
Insbesondere der »hölzern pedantische« Ton, in dem diese Bestimmungen abgefasst sind, gibt einen Eindruck davon, wie autoritär der Alltag im Lehrerseminar reglementiert war. Mir fallen dazu Heinrich Heines Verse aus Deutschland, ein Wintermärchen ein, die da lauten:
»Noch immer das hölzern pedantische Volk,
Noch immer der rechte Winkel,
In jeder Bewegung im Gesicht
Der eingefrorene Dünkel.
Sie stelzen noch immer so steif herum,
So kerzengerade geschniegelt,
Als hätten sie verschluckt den Stock,
Womit man sie einst geprügelt ...«14
Dies ist eine Beschreibung von Soldaten des preußischen Militärs 1844. Das Seminar muss eine gute Vorschule für den Militärdienst gewesen sein:
»§ 39. Des Sonntags darf der Seminarist außer der Stadt befindliche anständige Wirtschaften besuchen und sich hier Bier und Milch zu seiner Erquickung reichen lassen. Der Genuss spirituöser Getränke ist, sowie Kartenspiel und Kegelspiel um Geld, verboten. An den Wochentagen darf keine Wirthschaft besucht werden.«15
Karl May selbst erlebte den Alltag im Seminar so: »Es gab täglich Morgen- und Abendandachten, an denen jeder Schüler unweigerlich teilnehmen mußte. Das war ganz wichtig. Wir wurden sonn- und feiertäglich in corpore in die Kirche geführt. Das war ebenso richtig. Es gab außerdem bestimmte Feierlichkeiten für Missions- und ähnliche Zwecke. Auch das war gut und zweckentsprechend. Und es gab für sämtliche Seminarklassen einen wohldurchdachten, sehr reichlich ausfallenden Unterricht in Religions-, Bibel- und Gesangbuchlehre. Das war selbstverständlich. Aber es gab bei alledem Eines nicht, nämlich gerade das, was in allen religiösen Fragen die Hauptsache ist, nämlich es gab keine Liebe, keine Milde, keine Demut, keine Versöhnlichkeit. [...] Es fehlte ihm [dem Unterricht] jede Spur von Poesie. Anstatt zu beglücken, zu begeistern, stieß er ab. Die Religionsstunden waren diejenigen Stunden, für welche man sich am allerwenigsten zu erwärmen vermochte.« (Leben und Streben, S. 94
Bezeichnend für die Atmosphäre im Seminar sind die Umstände, unter welchen 1858 zwei Seminaristen ausgeschlossen werden. Sie sollen angeblich ein rüdes Wesen an den Tag gelegt haben, wozu unter anderem gehört hat, dass sich der eine einigen Schulmädchen »unsittlich genähert« habe, was immer darunter verstanden worden sein mag. Bei diesem Delikt bleibt nach hochpeinlicher Untersuchung fraglich, ob es überhaupt stattgefunden hat. Das ändert nichts an der Einschätzung, der Seminarist eigne sich nicht für den Lehrerberuf. Es bleibt bei dem Ausschluss aus dem Seminar.
In ebendiesem Jahr 1858 erlebt May eine schwere Enttäuschung. Er hat sich in die gleichaltrige Anna Preßler, ein Mädchen aus der Nachbarschaft, verliebt. Für sie hat er schwärmerische Gedichte geschrieben und noch Jahre später wird ihn die literarische Verarbeitung dieses Ereignisses beschäftigen.16 Anna, die ihm offenbar zunächst Hoffnungen gemacht hat, gibt dann jedoch dem Schnittwarenkrämer Carl Hermann ihr Jawort. Der ist die bessere Partie.
Bei seinen Mitschülern ist Karl May offenbar nicht sehr beliebt. Sie belächeln ihn und nehmen ihn nicht für voll. Er hat keine Freunde.
Schon in den Jahren auf dem Lehrerseminar scheint May geschrieben, aber auch komponiert zu haben. »Die paar Pfennige, die ich erübrigte«, heißt es in seinem Lebensbericht, »wurden in Schreibpapier angelegt.« (Leben und Streben, S. 99)
Als May sich in der vorletzten Klasse des Hauptseminars befindet, kommt es zu einem Zwischenfall. Als so genannter »Lichtwochner« hat er sich um die Reinigung der Leuchter und das Aufstecken neuer Lichter zu kümmern. Dabei bringt er sechs Kerzen auf die Seite und versteckt sie in seinem unverschlossenen Koffer in der Rumpelkammer. Er will sie in den Ferien mit nach Hause nehmen, um seiner Familie eine Freude zu machen. Was dann geschieht, verzeichnet ein Protokoll des Seminarleiters wie folgt:
»Dem Hohen Gesamtconsistorium habe ich Folgendes gehorsamst zu berichten. Kurz vor Beginn der diesjährigen Weihnachtsferien wurde von dem Proseminaristen Schäffler angebracht, dass ihm aus einer kleinen Lade zwei Thaler abhanden gekommen seien. Da hier eine Entwendung vorzuliegen schien, so wurde sofort eine Untersuchung angestellt, bei der sich jedoch keine genügenden Verdachtsgründe gegen irgendeinen Zögling ergaben.
Auf die Nachfrage, ob auch ändern Zöglingen Geld abhanden gekommen sei, wurde von dem Seminaristen Haupt mitgetheilt, dass ihm aus seiner Beinkleidertasche während der Nacht das Portemonnaie samt dem darin befindlichen Gelde von circa 15 ngr. abhanden gekommen. Der Umstand, dass Haupt die Beinkleider in den Schlafrock sorgfältig eingewickelt hat, sie aber früh auf dem Fußboden liegend gefunden, musste der Vermuthung Raum geben, dass auch hier eine Entwendung stattgefunden habe.
Der Director versammelte nun, nach gängiger Berathung mit den Seminarlehrern, den Seminarcötus und machte es jedem Zögling zur Ehren- und Gewissenssache, zur Ausmittlung des Hausdiebes auf alle Weise mitzuwirken.
Infolge dieser Aufforderung kamen zwei Schüler der ersten Seminarklasse, Ilisch und Illing, zum Director und theilten mit, dass der Seminarist May in der Zeit seines Lichtamtes sechs ganze Lichter behalten und in seinem Koffer über 14 Tage verborgen ge- halten habe. Hier hätten sie sie, weil der betreffende Koffer unverschlossen gewesen sei, zufällig gefunden. Sie hätten diese Lichte weggenommen und dem fungierenden Lichtwochner übergeben. Unter den Mitschülern sei der Fall besprochen worden; eine Anzeige bei dem Lehrer, der die Anstaltslichte unter Verschluss hat und ausgibt, oder beim Director hätten sie aber um deswillen nicht zu thun vermocht, weil sie die traurigen Folgen für May und dessen arme Eltern gefürchtet hätten. Es versteht sich von selbst, dass bei den Schülern wegen Verheimlichung dieses Falles ein Verweis gegeben wurde.
Die Seminarlehrer traten nun sofort wieder in Conferenz. May konnte hier das Factum nicht ableugnen, gestand aber die böse Absicht nicht zu, behauptete vielmehr, er habe die Rückgabe der Lichter nur vergessen. Hiergegen wurde ihm bemerkt, dass er bei Ausrichtung seines Lichtwochneramtes gar keine Veranlassung gehabt habe, mit so vielen Lichtern in die entlegene Rumpelkammer oder auch nur in deren Nähe zu kommen, wenn er in jener Kammer gleichwohl sechs Lichter abgelegt, eingewickelt und wochenlang verheimlicht habe, so zeuge das alles nicht für, sondern wider ihn.«17
Über den Vorfall wird dem Ministerium Meldung gemacht. Dieses verfügt Mays Entfernung aus dem Seminar und begründet diese Maßnahme mit seiner »sittlichen Unwürdigkeit für den Beruf«. Ausschlaggebend für diese Entscheidung dürfte, neben der Kerzenaffäre, noch ein anderer Vorfall gewesen sein, bei dem der Seminarist May auffällig geworden war:
»Bei der Beurtheilung dieses Falles«, heißt es in den Schulakten, »kommt auch die seitherige Aufführung Mays in Betracht. Die Lehrer haben bei diesem Schüler hie und da über arge Lügenhaftigkeit und über rüdes Wesen Klage geführt. Wie schwach sein religiöses Gefühl sein müsse, geht unter andrem aus folgendem Falle hervor.
Als die Anstalt in der Fastenzeit dieses Jahres zum heiligen Abendmahl gewesen, hatte sich May von dem angeordneten Besuch des Nachmittagsgottesdienstes absentirt. Dem die Tagesinspection führenden Lehrer hatte er seine heimliche Entfernung anfänglich abgeleugnet und sogar Mitschüler genannt, neben denen er in der Kirche gesessen haben wollte. Dem Director gestand er sein Unrecht und bat sehr um Verzeihung, die ihm dann auch vor dem Lehrercollegio für diesmal zu Theil ward. Der Fall war aber ganz dazu angethan, dass man dem May die Verdorbenheit seines Gemüthes und Herzens gleichsam offen darlegen konnte. Der Ernst, mit dem das geschah, schien auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben.
Weiterhin ist zu bemerken, dass in der ersten und zweiten Seminarclasse, die beide von der Conferenz abgehört wurden, die moralische Überzeugung sich offen und allgemein aussprach, dass May nicht bloß in Betracht des vorliegenden Falles, sondern auch noch sonst im Verdacht der Unehrlichkeit bei ihnen stehe, obwohl sie ihn im Einzelnen nicht überführen konnten.«18
Zu vermuten ist, dass sich Karl May gegen den sehr strikt und engherzig auf Disziplinierung der Zöglinge ausgerichteten Seminarbetrieb hin und wieder aufgelehnt hat. Wahrscheinlich hat er auch die recht formalen Vorstellungen der Seminarleitung von religiöser Unterweisung kritisiert.
Doch »arge Lügenhaftigkeit«? Trifft das zu? Hierzu ist zu sagen, dass bei Karl May die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Einbildung, zwischen Einbildung und Lügenhaftigkeit sehr fließend sind. Und dies wird ihn immer wieder in Schwierigkeiten bringen.
Das nicht nur für Karl, sondern für die ganze Familie katastrophale Ereignis des Hinauswurfs hat auch gravierende Auswirkungen auf Mays Weltanschauung: »Ich lernte zwischen dem Christentum und seinen Bekennern zu unterscheiden. Ich hatte Christen kennengelernt, die unchristlicher gegen mich verfahren waren, als Juden, Türken und Heiden verfahren konnten.« (Leben und Streben, S. 102)
Mays religiöse Überzeugung verändert sich. Was in den frommen Traktätchen für naive Kirchgänger gepredigt wird, überzeugt ihn nicht mehr. Er beginnt an einem auf das kirchliche Dogma festgelegten Glauben zu zweifeln und entwickelt selbständige religiöse Vorstellungen. Sie tun sich beispielsweise 1870 in dem höchst eigenartigen Fragment »Ange et Diable« kund.
In »Ange et Diable«, das in einem ziemlich unvollkommenen Französisch gehalten ist19, tritt uns ein gegen kirchliche Autoritäten und Dogmatismus rebellierender Karl May entgegen. Er plant sogar zu diesem Thema einen sechs Bände umfassenden »socialen Roman«.
Die Reaktionen seiner Umwelt bei der Affäre um die entwendeten Kerzen hat May nie ganz verwunden und seine grüblerischen Erinnerungen schließlich 1897 in dem Roman Weihnacht umgesetzt.
Der Roman beginnt damit, dass der Gymnasiast May ein Weihnachtsgedicht von 32 Strophen schreibt. Aus dem Schüler-Dichter wird in der Handlung des Buches nach einem Zeitsprung von einigen Jahren Old Shatterhand, der im Missourigebiet und im Felsengebirge eine Verfolgungs- und Rettungsreise unternimmt. Der Direktor des Seminars in Waldenburg tritt dort als »Prayerman«, als Traktätchenhändler auf, der sich im Laufe der Handlung als getarnter Bandit entpuppen wird. Von biographischer Bedeutung ist im Roman die Gestalt des mit dem Erzähler befreundeten Schulkameraden Carpio. Zu einem mühselig-harten Lebensweg gezwungen, flüchtet Carpio in ans Krankhafte grenzende Illusionen. Carpios Scheitern und Tod kann der Ich-Erzähler, Old Shatterhand, zwar nicht verhindern, doch gelingt es ihm, Carpios Elend dadurch zu mildern, dass er diesem das Gefühl gibt, wenigstens von einem Freund verstanden zu werden. Gewiss ist dies eine Wunschvorstellung von Karl May selbst, die er hier auf eine seiner Gestalten überträgt, und sie gibt Aufschluss über seine Situation im Seminar.
Wieder auf den »einzigen Fehler«, nämlich die in Waldenburg beiseite geschafften Kerzen anspielend, schreibt May da erstaunlich aufsässig: »Ich finde zwischen Gott und Teufel keinen Unterschied. Wer ist wohl schlimmer - ein Gott, welcher wegen EINES EINZIGEN Fehlers EINES EINZIGEN Menschenpaares, an dessen Fehlerhaftigkeit er noch dazu als Schöpfer die Schuld trug, Millionen und aber Millionen unschuldiger Menschen ins Unglück stürzt [...] oder ein Teufel, welcher dann und wann eine ungehorsame Menschenseele als Fricassee verspeist?«20
Schon an diesen beiden Beispielen lässt sich ersehen, wie eng bei Karl May Leben und Werk verbunden sind, wie er gravierende Ereignisse seines Lebens mit seiner Phantasie bearbeitet und in die Handlung seiner Bücher einfließen lässt. Ein ganzes Heer von Karl-May-Interpreten ist vor allem in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts tätig gewesen und hat diese Zusammenhänge aufgedeckt.