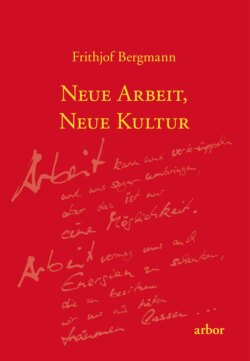Читать книгу Neue Arbeit, neue Kultur - Frithjof Bergmann - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel I
Der Zustand nach dem Kalten Krieg
Stellen Sie sich eine Szene in einem möglichen Hitchcock-Film vor: Ein Zug fährt immer tiefer in eine trockene Berglandschaft hinein. Die Fahrgäste werden zunehmend unruhig. Vor einer Weile war es noch ein Gefühl des Unbehagens, dann wurde es Nervosität, jetzt ist es die nackte Panik. Eine Reihe schnell aufeinander folgender Ereignisse legt die Vermutung nahe, dass der Zug ohne Lokomotivführer fährt und niemand die Fahrt kontrolliert; außerdem haben die Fahrgäste entdeckt, dass die Notbremse nicht funktioniert. Der Zug fährt bergab, und inzwischen ist er viel zu schnell, als dass jemand abspringen könnte. Doch selbst wenn jemand abspringen wollte: Es scheint, dass sämtliche Türen und Fenster des Zuges fest verriegelt sind und es keine Möglichkeit gibt, sie zu öffnen.
Das Bild des Zuges ist eine Metapher für einen Glauben und eine emotionale Situation, die viele Menschen in unserer Kultur erfahren. Wir fühlen uns ohnmächtig, im Lauf der Dinge gefangen, wir sehen eine Geschichte sich entfalten, der wir nicht entrinnen können. Die Situation ist unheilschwanger und wird immer erschreckender. Und was alles noch furchtbarer macht: Wir haben nicht die allerleiseste Ahnung, wie diese Fahrt anzuhalten oder umzukehren wäre. Natürlich laufen Leute gestikulierend und laut rufend durch die Waggons, aber jeder weiß mit schreckensstarrer Überzeugung, dass das nur ein Ablenkungsmanöver ist. Was früher oder später unausweichlich geschehen wird, geschehen muss, ist inzwischen allen klar geworden: Der Zug wird entgleisen, gegen eine Felswand prallen oder auf einer Brücke kippen und in die Tiefe stürzen.
Es ist ganz erstaunlich, wie viele unterschiedlichste Gruppen von Menschen sich in diesem Zug befinden. Die Millionen, die das Nahen der apokalyptischen Katastrophe in ökologischen Begriffen beschreiben, haben lebhaftere und eindrucksvollere Bilder dafür als viele andere. Nach ihrer Vorstellung rattert der Zug bergab auf die Erschöpfung natürlicher Ressourcen wie Kohle oder Öl zu, oder er fährt hin zu noch unheimlicheren Bildern von einer Welt zunehmend versalzender Böden, von fruchtbarem Land, das sich in Wüste und Staub verwandelt, von Städten in Küstennähe, die dem steigenden Wasserpegel der Ozeane zum Opfer fallen, und von immer größeren einst fruchtbaren Landstrichen, die von Schichten von Asphalt, Zement und Beton versiegelt werden.
Andere, inzwischen ebenso umfangreiche und weit verbreitete Gruppen sehen die größte und am schnellsten sich nähernde Bedrohung in der sich ständig vertiefenden und verbreiternden Kluft zwischen den Reichen und den Armen. Viele von ihnen schauen erst seit kurzem der erschütternden Tatsache ins Auge, dass die 80 Prozent der Welt, die wir bisher, uns selbst belügend, die „Entwicklungsländer“ genannt haben, in Wirklichkeit in eine Spirale der Rückentwicklung geraten sind, und das bereits seit etwa 15 Jahren. Der Anblick dessen, was dort geschieht, wird bald die satte Selbstgefälligkeit der Phantasie, dass diese Länder „aufholen“, auslöschen. Angesichts der Zustände, in die sie abstürzen, werden wir vielleicht neue Begriffe erfinden müssen, weil Wörter wie Anarchie oder Chaos noch viel zu friedlich, zu glatt und zu konventionell sind. Nur in sehr seltenen Momenten sehen wir ein Foto wie das von den drei Kindersoldaten kürzlich auf der Titelseite der New York Times oder lesen wir in einem Nachrichtenmagazin eine Geschichte wie die von den drei indischen Schwestern, die sich am selben Tag vor Verzweiflung darüber, dass sie keine Arbeit gefunden hatten, aufhängten, und erhaschen dadurch einen Blick in diese mögliche Zukunft.
Die große Anzahl Menschen, die sich verstärkt mit dem Thema Armut beschäftigt haben, sehen schon seit langem den Alptraum eines letzten und endgültigen Krieges auf uns zukommen, auf dessen Schlachtfeld die Reichen den Armen gegenüberstehen. Was zum gegenwärtigen Zeitpunkt (2004) in den unterschiedlichsten Köpfen aufdämmert, ist die Erkenntnis, dass das, was wir heute und in diesem Stadium noch „Terrorismus“ nennen, in zehn Jahren vielleicht ganz anders verstanden und benannt werden wird. Es mag sein, dass bis zum Jahr 2014 völlig offensichtlich geworden ist, dass wir heute durch die Anfangsstadien eben dieses Krieges gehen – eines Krieges, der völlig anders aussieht als alle Kriege, die wir bisher kannten. Aber es mag noch Jahre dauern, bis wir bereit sind, das zuzugeben.
Wiederum andere Gruppen bringen ihr Gefühl, in einem bergab rasenden, verriegelten Zug zu sitzen, mit dem Niedergang, dem Untergang, der fortschreitenden Austrocknung und dem Zerbröckeln dessen in Verbindung, was einmal unsere Kultur war. Es geht hier aber nicht darum, dass auch wir leiden und uns deshalb nicht nur in der Betrachtung der Horrorszenarien der Dritten Welt verlieren sollten. Es geht darum, dass wir zumindest ein allgemeines, grundlegendes, intuitives Verständnis für das entwickeln sollten, was in der Zeit, in der wir leben, in dieser Welt im Ganzen geschieht. In diesem Sinne ist es überaus notwendig, deutlich darauf hinzuweisen, dass es, einmal ganz abgesehen von der Umweltproblematik und der sich eklatant vertiefenden sozialen Kluft, auch mit dem Leben der Privilegierten, oder zumindest der Mehrheit von ihnen, steil und rapide abwärts geht. Diese Menschen reagieren auf den Zusammenbruch ihrer früheren Lebensqualität. Dazu gehören die wachsenden Aufwendungen für ihre Gesundheitsfürsorge und ihre Rente, ja im Grunde für das gesamte soziale Sicherheitsnetz. Dazu gehört auch die Geldknappheit von Bibliotheken und Museen, die ihre Öffnungszeiten einschränken müssen, von Orchestern und Theatern, bei denen sich die Budgetkürzungen ebenfalls immer stärker bemerkbar machen, und nicht zuletzt die Tatsache, dass man für praktisch alle Universitäten ein Requiem schreiben könnte (mit Ausnahme einiger weniger Universitäten in den Vereinigten Staaten). Dazu gehört auch die Verdummung durch das Fernsehen, die erbärmliche Erosion dessen, was einmal Journalismus hieß, oder auch die zunehmende Prostitution der Politiker gegenüber dem Business, ganz zu schweigen von der Vulgarisierung persönlicher Beziehungen und den um sich greifenden Konsequenzen eines allgegenwärtigen Zeitmangels, der zu einem gnadenlosen Crescendo des täglichen Stresses, der Hast, der Erschöpfung führt.
Es ist sehr bedeutsam für die hinter uns liegende Geschichte, aber auch für die künftigen Aussichten der Neuen Arbeit und ganz besonders im Hinblick auf das zentrale Thema „Macht“, dass eine beträchtliche Anzahl Manager aus den oberen Etagen angesehener Großunternehmen heute so redet, als seien auch sie in diesem Zug gefangen. Allerdings gibt es hier einen Unterschied. Bei den Weltklasse-Managern herrscht nicht das Bild vor, dass der Zug von einer Brücke stürzen oder gegen eine Felswand prallen wird. Bei ihnen ist die vorherrschende Befürchtung, dass das Terrain immer flacher, aber auch härter und unwegsamer und das Klima immer trockener und unfruchtbarer wird. Sie fürchten, dass der Zug immer mehr an Fahrt verlieren und schließlich quietschend zum Stehen kommen wird. Unter den oberen Zehntausend grassiert die große und nur noch teilweise unter den Teppich gekehrte Furcht vor einer chronischen Verlangsamung der Wirtschaft, einem sich lange hinziehenden Niedergang, einer nicht nur zyklischen, sondern permanenten Lähmung, die schließlich zu einem totalen Stillstand führen wird.
Wir haben wohl alle schon davon sprechen hören, dass die Topmanager unter Druck stehen, dass sie gehetzt, frustriert, überarbeitet und erschöpft sind. Doch Bilder wie das des „Gefangenen im goldenen Käfig“ oder des „Hamsters im Laufrad“ müssen korrigiert werden. Das Bild des Hamsters im Laufrad ist sogar völlig irreführend, denn das Laufrad dreht sich, wenn der Hamster läuft; hält der Hamster an, bleibt auch das Rad stehen – und genau das entspricht nicht der Erfahrung unserer erfolgreichen Wirtschaftsbosse.
In den vergangenen 20 Jahren habe ich eine ganze Reihe von Führungspersönlichkeiten gut kennen gelernt und etliche von ihnen persönlich beraten, Männer, die stolz waren auf ihre Büros mit der phantastischen Aussicht und den dicken Teppichen. Ausnahmslos klagten sie darüber, dass es für sie kein Innehalten gäbe, kein Ausruhen, keine Stabilität, keine Dauer. Ganz im Gegenteil: Sich zurückzunehmen und innezuhalten war für sie gleichbedeutend mit einem Abrutschen ins Bodenlose, dem freien Fall. Das zutreffende Bild ist deshalb nicht das eines Käfigs, sondern einer sehr glatten, rutschigen, schiefen Ebene, die so steil ist, dass man nur mit äußerster Anstrengung an seinem Platz bleiben kann. Und das Erschreckendste daran ist, dass diese schiefe Ebene sehr kurz ist und zum Rande eines Abgrunds führt. Hält man inne, so wird man zuerst beruflich zurückversetzt und bald danach gefeuert. Der Abgrund ist also nicht nur tief, sondern gleicht auch einem Schlangennest.
Es ist vielleicht noch bedeutsamer, dass das Sichanklammern auf der geölten, schiefen Ebene über dem Abgrund keineswegs nur das individuelle, persönliche Leben jener Menschen beschreibt, die (zeitweise) an der Spitze stehen – und damit meine ich natürlich nicht nur Manager, sondern auch Ärzte, Ingenieure, Professoren und Rechtsanwälte. Es beschreibt treffend auch die Situation vieler der erfolgreichsten Geschäftsleute, Financiers und Unternehmer, die unsere Gesellschaft, unser Wirtschaftssystem und sogar unsere Kultur als Ganzes definieren. In den letzten 20 Jahren habe ich viele Male beobachtet, dass nicht nur Führungspersönlichkeiten in der Automobilindustrie, sondern auch Topmanager in der Computerindustrie und besonders im legendären Silicon Valley angesichts der derzeitigen ökonomischen Gesamtstruktur in Verzweiflung und Ausweglosigkeit verfallen, was in scharfem Kontrast zu dem oberflächlichen Optimismus steht, den sie beruflich zur Schau stellen müssen.
So wie viele Individuen sich verzweifelt festklammern und mit Armen und Beinen rudern müssen, um nicht in den leeren Raum zu stürzen, so müssen sich die Räder unserer Wirtschaft buchstäblich bis zur Weißglut immer schneller drehen, nur damit unsere Gesellschaft sich über Wasser halten kann. Neue Produkte, neue Erfindungen, neue Technologien, neue Industrien und neue Märkte müssen ständig in diesen großen Schlund geworfen werden. Und die Frage, wie lange das, was bereits in die große Maschinerie Eingang gefunden hat, noch ausreichen wird, um uns vor dem Absturz zu bewahren, sitzt in den meisten Aufsichtsräten in einem eigenen Sessel mit am Tisch. Ständig herrscht da das Gefühl, dass wir eine neue Idee, einen neuen Dreh, vielleicht eine ganz neue Produktlinie brauchen, das nächste „große Ding“, sonst … Ja, genau, dieses „sonst“ ist der springende Punkt. Wenn nichts kommt, um uns zu retten, dann werden der Niedergang und der Verfall beginnen und die Stagnation wird allgegenwärtig sein. Es ist ganz wichtig, dass wir auch diesen Teil des Bildes sehen: In unseren Tagen meinen nicht nur die im Elend Lebenden, dass wir auf dem Weg in den Abgrund sind; viele Menschen aus den verwöhnten, privilegierten Eliten sind derselben Ansicht. Das ist eine Tatsache von entscheidender Bedeutung, denn sie zeigt, dass wir davon ausgehen können, dass nicht nur die Machtlosen auf eine große Veränderung hoffen, sondern dass auch viele derer, die nicht weit von den Hebeln der Macht entfernt sind, dieselbe Hoffnung hegen.
Es wäre ein Leichtes, weitere große Gesellschaftskreise aufzuführen und zu beschreiben, die sich ebenfalls in einem dem Abgrund entgegenrasenden Zug gefangen glauben. Einige sehen den kommenden Zusammenbruch vor allem im Bereich Gesundheit (eine Pandemie von Aids, exponentiell steigende Kosten), andere sprechen von einer „Ankunft des Anarchismus“ und verweisen auf den Brudermord auf dem Balkan, auf die Stammesfehden in Afrika oder auf die beherrschende Rolle, die das organisierte Verbrechen, die Mafia, in sehr vielen Ländern spielt. Wir alle könnten diese Liste fortführen, aber die für uns zentrale und entscheidende Frage ist eine andere, nämlich: Was ist passiert? Was war die Ursache oder welche waren die einzelnen, teils parallell laufenden Entwicklungen, die uns in diese Hilflosigkeit, Passivität, fassungslose Ratlosigkeit hineinmanövriert haben?
Unterstreicht nicht schon die längst nicht vollständige Aufzählung der angeführten Tatsachen, wie außerordentlich und beängstigend diese Lähmung ist? Macht nicht schon allein die schiere Menge der Menschen, die alle zusammen das Gefühl haben, in einer gigantischen Maschinerie gefangen zu sein, die Situation besonders dringlich? Wenn die Zahl all dieser Menschen zusammengenommen wirklich so immens ist, warum bringen wir dann nicht genügend Energie auf, um die Richtung zu ändern? Ist die riesige Zahl Menschen, die heute nicht nur in einer schweigenden, sondern in einer somnambulen, einer komatösen Opposition leben, nicht eine Beleidigung für den letzten Rest des uns verbliebenen gesunden Menschenverstands?
Diese Masse von Menschen eine „Mehrheit“ zu nennen wäre eine krasse Untertreibung. Um zu einer zutreffenden Einschätzung der Proportionen zu gelangen, müsste man die Fragestellung umkehren. Nicht: Wer teilt die Ansicht, dass unsere Kultur sich auf einem unheilvollen Kurs befindet? Sondern: Wo sind die Ausnahmen? Wer glaubt noch daran, dass wir als Gesamtzivilisation, dass dieses ganze moderne, weiße, industrielle Superunternehmen auf einem soliden und vielversprechenden Weg ist? Die Antwort lautet natürlich: Diese Zahl ist verschwindend gering. Damit wird die Dringlichkeit unserer Frage noch größer. Wenn man sich diese Situation, dieses enorme Missverhältnis vor Augen führt – warum verhält sich die große Masse der Menschen so, als stünden sie unter einem Bann, der sie in diesem gespenstischen Zug gefangen hält? Und das, obwohl wir wenigstens in einem nominellen Sinne noch daran glauben, in einer Demokratie zu leben? Warum fühlen wir uns so hilflos, so machtlos, so unentrinnbar gefangen, so gänzlich ausgeliefert? Was für eine Kette von Ereignissen hat uns in diese jämmerliche Situation gebracht? Was waren die Gründe für diese beängstigende Lähmung, diese seltsame und spezielle Impotenz?
Es gibt gute Gründe dafür, Gründe mit sehr tief reichenden und überaus starken Wurzeln. Ein Großteil dieser Gründe hat damit zu tun, dass wir in einem wirtschaftlichen System leben, das eine Dynamik besitzt, die uns mit unglaublicher Kraft in diese Richtung zieht. Und wir sind hilflos, weil es keine Alternative zu diesem ökonomischen Moloch zu geben scheint. Ja, wir sind so zutiefst davon überzeugt, dass es keine Alternative gibt, dass es unmöglich geworden ist, sich eine solche auch nur bildlich vorzustellen. Sosehr wir uns auch bemühen mögen, uns ein alternatives ökonomisches System wenigstens als Phantasie vor Augen zu führen, ein ökonomisches System, das mächtiger oder produktiver sein könnte als das, unter dem wir gegenwärtig leiden, es liegt außerhalb der Grenzen unserer Vorstellungskraft. Und deshalb sind wir vollkommen verwirrt und wie betäubt.
Es war einmal vor langer Zeit, da gab es eine ökonomische Alternative. Wir wissen von dem System, das die Hälfte unseres Globus umspannte. Aber wir wissen auch um das Schicksal dieser Alternative.
Der Tod des Sozialismus
Wie oft bei Todesfällen musste wohl auch nach dem Tod des Sozialismus eine gewisse Zeit verstreichen, bis wir die volle Realität dieses Vorgangs zu fassen vermögen. Fünfzehn Jahre waren nicht genug, denn er war einer der seltsamsten und unerhörtesten Todesfälle überhaupt und er ereignete sich absolut unerwartet und abrupt. Für Generationen war der Sozialismus die Hoffnung für die Menschheit gewesen! Die Hälfte der Menschheit hatte an ihn geglaubt, und Generationen hatten dafür gekämpft, gelitten und sich in Gefängnissen und Straflagern um seinetwillen foltern lassen. Und dann war er über Nacht einfach verschwunden. Er starb so „gründlich“, dass nicht einmal ein Leichnam zurückblieb, den man hätte beweinen können.
Der Sozialismus war eine detaillierte und kohärente Alternative gewesen. Er war nicht nur eine Säule hier, ein Torbogen dort; er war ein in sich stimmiges ausgefeiltes Bauwerk, das in gewissem Sinne vollständig war. Er hatte sich zu einer voll ausgestatteten Gegenwelt entwickelt, die in krassem Gegensatz zu der Welt stand, in der wir jetzt leben. Es gab in beiden Systemen kaum einen Strebebalken, einen Träger oder eine Säule, die man nicht hätte miteinander vergleichen können und zu denen man nicht sagen konnte: So und so vollzieht sich diese Transaktion in der Wirtschaft, die wir jetzt haben, und so und so sollte sie sich stattdessen vollziehen – in jener perfekteren Welt, um deren Verwirklichung wir ringen.
Dass etwas, das so detailliert und so umfassend war, etwas, das die Hälfte der Welt regiert hatte, sich praktisch über Nacht in Rauch auflösen könnte, wäre uns zuvor als gespenstischer, verrückter, völlig unwahrscheinlicher Alptraum vorgekommen. Und eigentlich hätte die halbe Welt danach jahrelang in Trauerkleidung gehen und Klagelieder singen müssen. Aber nichts dergleichen geschah. Zahllose Menschen zuckten die Schultern, klopften sich den Staub von den Kleidern und machten weiter, als sei nichts Besonderes geschehen.
Wir haben nie innegehalten. Wir haben nie hinterhergeschaut. Wir haben nie tief darüber nachgedacht, was der Tod dieses Kolosses für uns für Konsequenzen haben könnte. Nicht einmal die offensichtlichste und nächstliegende dieser Konsequenzen haben wir uns klar gemacht. Hätten wir nicht vom ersten Tag an vorhersehen müssen, dass unser eigenes System, das plötzlich ohne Gegengewicht dastand, ohne jene Kraft, die es bisher in Zaum gehalten hatte, unausweichlich zum Extremen, zum Unausgeglichenen, zur Schieflage, zum Brutalen, zum Gefährlichen, zum Schrillen hin tendieren würde? Die Wirkung in den Rängen der Macht war offensichtlich enorm, aber das war nicht alles. Dieser Tod führte auch zu enormen Veränderungen in unserer politischen, intellektuellen und sogar spirituellen Welt. Man spricht oft von Verschiebungen im intellektuellen Spektrum, einer Bewegung von einigen Zentimetern. Aber dies war keine bloße Verschiebung – ein riesiger Teil unseres intellektuellen Bodens brach einfach weg, wie bei einem Erdbeben. Die fundamentale Polarität war verschwunden, sie war auf etwas unvergleichlich Kleineres zusammengeschrumpft: Wo es früher echte Streitpunkte und Debatten gegeben hatte, gab es jetzt nur noch kleinkariertes Gezänk und Haarspaltereien, ein müßiges Tauziehen um Schattierungen, um Nuancen.
Ist es nicht wahrhaft erstaunlich, dass wir überhaupt nicht reagiert haben, dass der Schock uns nicht schwindlig gemacht hat? Vielleicht hätte es ja geholfen, wenn es tatsächlich den Leichnam irgendeines Märchenriesen gegeben hätte, so groß, dass er die Hälfte der Ebenen der Ukraine bedeckt hätte. Doch alles, wozu es tatsächlich kam, war ein kaum hörbares unterdrücktes Schluchzen, und das trotz der Millionen echter menschlicher Leichen, trotz der zahllosen Leben, die in aufopferungsvoller Hoffnung lichterloh gebrannt und eine Energie abgestrahlt hatten, die der eines kleinen Sterns gleichkam. Dass wir uns einfach umgedreht haben und weitergegangen sind, ist ein denkwürdiges und in der Geschichte bisher nie da gewesenes Ereignis. Nero soll Kithara gespielt und gesungen haben, als Rom brannte. Wir haben nur sorgfältig die Haut von einer Salami abgezogen und uns dünne Scheiben aufs Brot gelegt.
Die andere Kultur
Dass wir uns ohne Alternative wiederfinden, ist einer der Hauptgründe für unser Gefühl, gefangen und wie gelähmt zu sein. Wir werden von einer gigantischen Maschinerie mitgerissen, die eine so unbeschreibliche Macht besitzt, dass es völlig aussichtslos erscheint, ihren Kurs ändern zu wollen. Das Gefühl der Machtlosigkeit, das Gefühl, wie im Mittelalter an einen Pranger gekettet zu sein, ist jedoch verwunderlich, ja geradezu bizarr. Schließlich leben wir nicht in einer uniformen, homogenen, im Gleichschritt marschierenden Welt. Davon sind wir weit entfernt und können es also auch nicht als Entschuldigung anführen. Aber auch wenn es ganz offensichtlich keine ökonomische, keine systemische Alternative gibt, existieren seltsamerweise doch zwei ganz unterschiedliche, in vieler Hinsicht sogar gegensätzliche Kulturen.
Auf oberflächliche Weise ist sich natürlich fast jeder dessen bewusst, und die meisten Menschen könnten auch sehr verallgemeinert diese beiden Kulturen beschreiben. Zu den Klischees, die mit der Kultur der Angepassten, der Biedermänner, der Spießbürger verbunden werden, gehören der Nadelstreifenanzug der Männer und das klassische dunkelblaue Kostüm der Frauen mitsamt den dazu passenden Accessoires. Als Nächstes würde wahrscheinlich angeführt, dass diese „offizielle“ Kultur den global arbeitenden Großkonzernen Vorrang einräumt, diesen geradezu hörig ist und deshalb Wachstum nicht nur wünscht, sondern für eine absolute Notwendigkeit hält. Das wiederum bedeutet, dass sie sich für eine freie Marktwirtschaft mit einem guten Investitions- und Geschäftsklima stark macht, die wiederum niedrige Löhne verlangt und die Gewerkschaften am liebsten abgeschafft sähe. Dazu gehören natürlich eine bestimmte Sozialpolitik und gute Beziehungen zum militärisch-industriellen Komplex und zum Netzwerk internationaler Machtpolitik. Niemandem würde es schwerfallen, einige typische Vertreter dieser Kultur aufzuzählen. Bill Gates könnte ein Beispiel sein, George W. Bush ein anderes. Bush verkörpert diesen Typ mit einer solchen Perfektion, dass man ihm dafür beinahe dankbar sein müsste. Mit ihm als Maskottchen ist es bedeutend leichter geworden, diese offizielle Kultur auf einen Begriff zu bringen. Er ist schon beinahe so überzeichnet wie eine Karikatur: Es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, wie er mit seinem beschränkten Wortschatz und dem einfältigen Gesicht auf dem Schoß eines Bauchredners sitzt – eines der großen multinationalen Konzerne.
Viele Menschen bringen die andere Kultur, ebenso in Klischees denkend, mit einer bestimmten Musik und gewissen Bands in Verbindung, mit einer völlig anderen Art, sich zu kleiden und zu ernähren, und sehr oft mit dem Gedankengut des spirituellen Aufbruchs und vielleicht auch des Buddhismus, ganz gewiss aber mit einer ungezwungeneren Einstellung zu Sex, mit einer starken Abneigung gegen Hierarchien und Autorität sowie einer Nähe zur legendären, oft missverstandenen 68er-Generation. Zu den Unterschieden zwischen beiden Kulturen gehören auch sehr gegensätzliche Einstellungen zur öffentlichen Ordnung, zu Disziplin, Monotonie und Langeweile sowie in großem Ausmaß auch zum sehr viel ernsteren Thema Krieg und Frieden.
Fast jeder würde wohl zugestehen, dass die zweite Kultur enorm viele verschiedene Gesichter hat. Dies wirft wiederum Licht auf eines ihrer interessantesten Charakteristika: Obwohl sie ganz außerordentlich bunt und vielfältig ist und keine gemeinsamen und verbindenden Insignien, Strukturen und Institutionen kennt, und obwohl es in ihr zahllose Formationen gibt, die sich um ganz unterschiedliche Themen scharen, erkennt man ihre Mitglieder doch auf den ersten Blick. Es spielt keine Rolle, ob man ihnen auf den Straßen von Peking oder Tokio, ob man ihnen in Nord- oder Südafrika, in Zentralasien oder in der Ukraine begegnet. Ganz gleich wo, die paradoxe Qualität, die augenblicklich identifizierbare Präsenz dieser anderen Kultur tritt überall klar zutage, auch wenn sie sich in ein Panoptikum verschiedener Gewänder kleidet und völlig unterschiedliche Sprachen spricht. Oft genügt eine einzige Reaktion, ein kurzer Blick, ein kleines Lächeln, und man weiß, auf welcher Seite der Wasserscheide zwischen den beiden Kulturen man sich gerade befindet.
Unnötig zu sagen, dass diese zweite Kultur eine immense Zahl von Mitgliedern hat. Es gibt wahrscheinlich kein einziges Land auf dieser Welt, in dem man nicht ihre Cafés und Kneipen findet, selbst auf dem Lande, und natürlich die Läden und Boutiquen, welche die Klientel dieser anderen Kultur ansprechen. Diese liefern sogar einen gewissen Maßstab. Und doch gibt es eine unbestreitbare Schwierigkeit. Wollte man heute versuchen, ihre Vertreter zu zählen, wäre das nicht nur äußerst schwierig, man müsste daran scheitern. Es sind zu viele geworden. Halb im Scherz könnte man behaupten, dass es eine angemessenere und praktikablere Prozedur wäre, wenn man fragte: Wer fühlt sich eigentlich in der offiziellen Kultur noch wirklich wohl? Wer fühlt sich darin zu Hause, wer identifiziert sich mit ihr, wer glaubt an sie und wer ist froh und glücklich in ihr? Wie schon im Falle unseres Hitchcock-Zuges sind es wohl eher wenige.
Ein Hinweis darauf, wie tief und breit der Graben zwischen diesen beiden Kulturen ist, ist die Häufigkeit, mit der die Kommunikation zwischen ihnen zusammenbricht. Dieses Unvermögen geht bis zur Sprachlosigkeit. Frustration und schließlich Kapitulation sind weit verbreitet, und der Satz, der Männern von Feministinnen gern entgegengebracht wird: „Du begreifst es einfach nicht“, trifft ebenso auf die Kommunikation zwischen diesen beiden Kulturen zu. Dass beide Seiten es einfach aufgeben, ist keineswegs nur eine Frage der Sprache. Nein, Worte werden sinnlos, weil man auf Grund gelaufen ist. Es gibt natürlich zahllose Meinungsverschiedenheiten über Tausende von oberflächlichen Themen und über Werte, aber am Schluss läuft alles auf zwei grundverschiedene Vorstellungen darüber, wie man leben soll und was der Sinn des Lebens ist, hinaus – und da gibt es dann nichts mehr zu sagen.
An der Oberfläche erscheint die andere Kultur ziemlich heterogen. Und in ihr gibt es wiederum Subkulturen, die oft um ein einziges Thema kreisen und einander nicht selten sogar befehden. Dennoch haben große Teile dieser anderen, zweiten Kultur Wurzeln, die sehr viel tiefer hinabreichen und die letztlich fest im Boden der Aufklärung wurzeln. Das bedeutet, dass nicht nur die „offizielle“ und öffentliche Kultur auf diesen Grundlagen fußt, sondern dass es tatsächlich zwei diametrale Sätze von Prämissen, zwei total unterschiedliche Weltanschauungen gibt, die beide in der Zeit der Aufklärung entwickelt wurden. Anders ausgedrückt, die Aufklärung hat einen Januskopf. (Diesen Gedanken habe ich in meinem Buch über die Freiheit, Die Freiheit leben, im Detail entwickelt.)
Da gab es einerseits die Tradition, auf der die uns vertrauten klassischen Dokumente der Demokratie beruhen und die wir alle aus dem Schulunterricht und dem täglichen Leben kennen. Das ist die Grundansicht, dass menschliche Wesen unentrinnbar von ihrem Eigeninteresse, ihrem Egoismus geleitet, ja kontrolliert werden und immer darauf schauen, was ihnen persönlich zum größten Vorteil gereichen könnte. Diese Aussage ist durch allzu häufigen Gebrauch glatt poliert worden, und so muss man sich erneut vor Augen führen, was sie ursprünglich besagen sollte. Wenn man sich an das berühmte Diktum von Thomas Hobbes erinnert, dass das Leben in seinem ursprünglichen Zustand „widerlich, brutal und kurz“ war, dann ist die sanfte Mittelklasse-Sprachregelung, die von „Eigeninteresse“ spricht, offensichtlich viel zu harmlos.
Die Grundidee war eher, dass der Mensch im Grunde blutrünstig und wild ist – so, wie man sich die Tiere zu dieser Zeit vorstellte – und dass er zuallererst sozialisiert werden muss, indem man ihm die Krallen beschneidet und ihn zähmt. Mit diesem Argument rechtfertigten die bekanntesten Philosophen dieses Zweiges der Aufklärung die Moral, den Staatsvertrag und den Staat. (Kant, der in vieler Hinsicht das andere, Hobbes entgegengesetzte Ende des Spektrums dieser Philosophen vertrat, bestand nichtsdestoweniger darauf, es sei der Zweck der Moralität, das „Eigeninteresse“ auszulöschen.) Bliebe der Mensch unkontrolliert, ungezähmt, seinen eigenen Impulsen überlassen, so der Standpunkt dieser Philosophen, dann könnten wir nicht sicher in einem Bus fahren. Der Fahrgast neben uns könnte uns ja eine Hand abbeißen.
In dieser offiziellen, die Zähmung betonenden Tradition der Sozialisierung wird die zentrale politische Idee der Freiheit sofort von Vorsichtsmaßnahmen und Bedenken eingeschränkt; sie ist ein „Ja … aber auf keinen Fall zu viel!“. Es soll Freiheit geben, aber mit Verantwortung und allen möglichen anderen Einschränkungen. Mit anderen Worten: Freiheit ja, aber nur wenn das Halsband umgelegt und die Leine stark ist. Die meisten von uns sind so sehr an diese Vorstellung gewöhnt, dass sie ihnen ganz unvermeidlich und fraglos wahr erscheint. Der bloße Gedanke, dass es grundlegende Axiome geben könnte, die diesem Verständnis entgegengesetzt sind, erscheint deshalb bereits seltsam und irreal. Doch ist das völlig gegenteilige Verständnis der menschlichen Natur nicht im Geringsten exotisch, sondern ganz einfach. Es geht von der Überzeugung aus, dass das menschliche Wesen an sich zuerst einmal schwach und zerbrechlich ist. Die Menschen sind schnell entmutigt, niedergeschlagen und zahm. Es ist in der Tat allzu leicht, die Menschen einzuschüchtern und zu dressieren, und sehr viele sind scheu und in sich zurückgezogen.
Das Problem ist also nicht, dass Menschen aufbegehren und sich nicht anpassen wollten. Ganz im Gegenteil. Eigentlich sollte der Faschismus uns davon überzeugt haben, dass es nicht schwer ist, Menschen dazu zu bringen, zu kuschen und stillzuhalten. Sie leisten nur wenig Widerstand, und die Gesellschaft vermag sie zu formen wie Wachs. Wirklich schwer ist es also nicht, den Menschen zu zähmen, sondern ihn so weit zu stärken, dass er sich erheben und Widerstand leisten wird.
In der offiziellen Strömung des Denkens, in der wir aufgewachsen sind, ist die große Gefahr zu viel Wille, zu viel Wildheit und zu viel Aufbegehren. Deshalb geht es darum, zurechtzustutzen, zurückzuschneiden und zu sozialisieren. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, wie emanzipatorisch, wie wirklich befreiend in diesem Geiste ausgeführte Dinge sein können. Kann etwas, das auf den Prämissen der Tradition beruht, in der wir erzogen wurden, wirklich zu einer ernst zu nehmenden „Revolution“ werden, oder werden die so genannten Revolutionen nur darin bestehen, dass man das Kostüm wechselt oder neue Knöpfe an alte Uniformen näht? Natürlich kann es eine neue Regierung geben, eine neue Autorität, die Ordnung und Disziplin zusichert. Anstelle eines Königs kann man ein Parlament oder einen Kongress installieren, und man kann auch den Menschen erlauben, alle paar Jahre zu wählen. Doch Ziel und Absicht bleiben im Grunde noch immer dieselben. Die einzige Frage wird lediglich sein, unter genau welchen Umständen man das Recht hat, einen König zu enthaupten oder sich seiner anderweitig zu entledigen. Aber die neuen, nur anders gekleideten Regierenden werden die Kontrolle der Menschen noch immer als ihren Auftrag ansehen. Deshalb werden sie die ganze Bandbreite der sozialen Institutionen und Strukturen, von den Gerichten über moralische Instanzen und die Polizei und die Schulen bis hin zum Militär dazu benutzen, sicherzustellen, dass die Menschen nicht aus ihrem Käfig ausbrechen, sondern ruhige und zahme Bewohner des Zoos bleiben.
Die andere Tradition, der zweite Zweig der Aufklärung, geht von der Erkenntnis aus, dass menschliche Wesen bei ihrer Geburt noch sehr unvollständig und sehr abhängig sind. Dies steht in krassem Gegensatz zu dem berühmten Satz von Rousseau: „Der Mensch ist frei geboren.“ Der Mensch muss vielmehr genährt und gestärkt werden. Seine Individualität muss gefördert und ermutigt und zum Vorschein gebracht werden. Das Letzte, was ein Mensch braucht, ist, dass man seine Individualität abschleift, dass man sie poliert, bis sie verschwunden ist, dass man ihm Beruhigungspillen verabreicht und ihn in den Schlaf singt. Was Not tut, ist, dass man ihn aufweckt!
Nichts könnte irriger sein als die Annahme, die konventionelle und zähmende Tradition sei irgendwie vernünftiger oder glaubwürdiger als die anstachelnde und belebende Strömung. Der Stammbaum dieser letzteren Tradition kann sich durchaus sehen lassen, denn zu ihren Vorvätern gehören viele angesehene, überragende Persönlichkeiten. Man könnte Goethe, Melville und Whitman anführen, aber auch Hölderlin, Rilke, Hesse, Lawrence und Gide, und natürlich Philosophen wie Emerson und Thoreau und sicherlich nicht zuletzt, sondern an einem Ehrenplatz, Hegel und Nietzsche. Suchte man einen einzigen Satz als ein Emblem, als Motto für diese breite Strömung, dann könnte man William Blakes „Energie ist Ewiges Entzücken“ nehmen oder auch Jack Londons „Lieber will ich zu Asche verbrennen, als zu Staub zerfallen“.
Es steht außer Frage, dass die Geschichte dieser anderen, das Individuum stärkenden und fördernden Tradition lang und beeindruckend ist. Sehr allgemein gesagt, könnte man feststellen, dass sie ihre Anfänge vor allem in der Literatur, der Philosophie und der Kunst hatte. (Viele meiner Freunde haben mich darauf hingewiesen, dass die lebensbejahende Tradition der Aufklärung vielfältige Ähnlichkeiten mit den Philosophien und auch Religionen des Ostens hat. Die Rezeption von östlicher Philosophie, Psychologie, Religion und von Methoden zur Transformation von Körper und Bewusstsein begann nach ihrer Auskunft im Abendland bereits mit Schopenhauer, dessen Denken entscheidend von den Upanischaden beeinflußt war, hat sich seit Mitte des letzten Jahrhunderts [C. G. Jung, D. T. Suzuki, Erich Fromm] ständig beschleunigt und hat inzwischen viele Bereiche der abendländischen Natur- und Geisteswissenschaften erfasst sowie nicht zuletzt Bereiche der Medizin [Psychoneuroimmunologie] und große Bereiche der körper- und psychotherapeutischen Methoden. Einen guten Überblick über die Entwicklung dieser Integration der lebensbejahenden Strömungen von östlichem und westlichem Denken gibt das Werk von Ken Wilber, insbesondere sein Hauptwerk Eros, Kosmos, Logos.)
Nun, inzwischen hat diese Tradition einen alles durchdringenden und auf alles abfärbenden Einfluss darauf, wie zahllose Menschen, ja in der Tat die überwiegende Mehrheit in unserer gegenwärtigen Kultur über Moral und Werte denken sowie darüber, wie man sein Leben leben sollte. Die große Geistesverwandtschaft zwischen dieser anderen, belebenden Strömung und dem Feminismus ist bezeichnend und bedeutsam. Alle möglichen Gemeinsamkeiten springen sofort ins Auge. Eine der fundamentalsten ist der Standpunkt, dass die Fähigkeit, sich selbst zu behaupten, nicht geschwächt, sondern im Gegenteil gestärkt und trainiert werden muss wie die Muskeln eines Athleten.
Die Kultur, die anstacheln und aufwecken will, hat auch in einigen Bereichen der Erziehung ihre Zelte aufgeschlagen. Sie hat zwar bisher keineswegs einen entscheidenden Sieg davongetragen, doch in der Diskussion darüber, wie man mit jungen Menschen und ganz besonders mit Kindern umgehen sollte, spielt die bekräftigende Seite des Projekts der Modernität eine zunehmend wichtige Rolle. Immer mehr Eltern kommen zu dem Schluss, dass sie sich nicht an der Schwächung und Verunstaltung ihrer Kinder beteiligen wollen oder daran, wie man zu sagen pflegte, ihren Willen zu brechen.
Auch in vielen Bereichen der Beratung und der Therapie ist es zu einer vergleichbaren Transformation gekommen. Ganz allgemein kann man gewiss sagen, das viele sich von rigiden Standardvorgehensweisen und präzise definierten, oft pseudomedizinischen Techniken abgewandt haben. In vielen Fällen geht man heute davon aus, dass wir es in unserer Gesellschaft mit einem durchgängigen Gefühl der Depression zu tun haben. Diese manifestiert sich letztlich als eine Schwächung der Fähigkeit des Einzelnen, auf der Höhe seiner Energie zu funktionieren, und in vielen therapeutischen Situationen ist das oberste Ziel, das Wohlbefinden des Klienten und sein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wiederherzustellen.
Dieselbe allmähliche Verschiebung von den traditionellen und älteren Ideen hin zu einer neueren, die Lebendigkeit fördernden Einstellung ist noch deutlicher bei den Ansätzen zu erkennen, den tief im Elend Versunkenen Hilfe zu leisten. Wer sich über längere Zeit und intensiv mit dieser großen und ständig wachsenden Bevölkerungsgruppe beschäftigt hat, versteht immer klarer, dass das entsetzliche Gefühl der totalen Entmutigung, der schieren Verzweiflung, der verhärteten Überzeugung, alles sei vergeblich und nichts wert, das alles andere überschattende Hindernis für erfolgreiche Hilfe und Unterstützung ist. Das führt natürlich zu ganz anderen Vorstellungen darüber, wie man diesen Menschen beistehen könnte. Wenn eine monströse, eisige Gleichgültigkeit jeden Zugang zu diesen Menschen verbaut, dann muss die erste Hilfe darin bestehen, dass man versucht, diese Rüstung aus Eis aufzutauen – und das gehört wiederum zur Domäne der anfeuernden und belebenden Kultur.
Trotz des ehrfurchtgebietenden Stammbaums und der vielfältigen Errungenschaften der lebensbejahenden Kultur fehlt doch etwas ganz Entscheidendes, und das gleicht einem schockierenden, sprachlos machenden Geburtsfehler: sie hat nur einen halben Kopf. So beeindruckend diese andere Kultur auch in vieler Hinsicht sein mag, sie hat es doch nie geschafft, sich in ein Gefüge von sozialen Institutionen zu übersetzen. Es gibt hier keinerlei ernst zu nehmendes, ausgearbeitetes politisches Programm. Man sucht vergeblich nach einem fest umrissenen, klar definierten Konzept eines Ziels, einer Vorstellung davon, wie eine Gesellschaft strukturiert und reguliert werden müsste, damit sie den grundlegenden Impuls zu verkörpern vermag, der darauf abzielt, Individuen zu stärken, zu fördern und zu entwickeln.
Dieser erstaunliche Mangel ist so krass, dass wir bis auf den heutigen Tag der Meinung sind, dass Strukturen, Regeln und Institutionen sozusagen per definitionem die Individualität beschneiden müssen. Doch das ist nichts weiter als eine programmierte intellektuelle Beschränktheit, auch wenn sie in vielen Bereichen, insbesondere in der amerikanischen Politik, eine große Rolle spielt. In den Vereinigten Staaten schwenkt man noch immer den Slogan „Weniger Staat bedeutet mehr Freiheit“ wie eine Fahne im Wind, ganz besonders auf Parteitreffen der die Wirtschaft beherrschenden Konservativen. Es als Entschuldigung herzunehmen, noch immer an diese Einfaltsformel zu glauben, ist heutzutage nicht mehr zu aktzeptieren. Wir brauchen uns nur die verschiedenen Regionen anzusehen, in denen der Staat tatsächlich an Blutarmut gestorben oder einfach vertrocknet ist. Bei einem Besuch auf dem Balkan, im Kongo oder in Zentralasien dürften wir bald die elementare Lektion lernen, dass die Abwesenheit des Staates sehr schnell zu einer Abwesenheit aller Freiheit und ins Chaos führt. Es sollte also nicht nötig sein zu betonen, dass Strukturen und Institutionen die Individualität durchaus stützen und fördern können.
Wie gesagt hat es also schon die ganze Zeit eine alternative, das Leben fördernde Plattform gegeben, eine Konfiguration aller nötigen grundlegenden Begriffe und Metaphern. Und von ihren ersten Anfängen an hatte diese emanzipatorische Plattform beachtliche Stärken im Bereich der Philosophie und der Kunst und unzweifelhaft hat die 68er-Bewegung in ihrer Geschichte eine Rolle gespielt. Bis dahin hatte sie eher im Verborgenen geblüht. Sie lebte zwar im Theater (denken Sie an Strindberg, O’Neill oder Büchner), in Bibliotheken, Universitäten, Studios, Gelehrtenstuben und Museen, aber eben nicht in gesetzgebenden Versammlungen, bei Gewerkschaftskongressen und anderen Foren, die wir den „öffentlichen Bereich“ nennen.
Das hat sich in den berühmt-berüchtigten Jahren nach 1968 völlig geändert. Die andere Kultur stieg von ihren Elfenbeintürmen herab und wurde überraschend schnell zu einem Massenphänomen. Sie hatte nicht nur eine Affäre mit den Medien, nein, sie ging eine Ehe mit ihnen ein. Sie bemächtigte sich der Pop-Kultur, wurde zu so etwas wie dem kulturellen Äquivalent von Fast Food, usurpierte gleichzeitig aber auch die Galerien der „hohen Kunst“. Die Strebungen in der gesamten modernen Kunst glichen sich weitgehend denen dieser anderen Kultur an. Ob Film, Skulptur oder Happening, das Wichtigste war, dass das Kunstwerk „lebendig“ war. Es musste Kraft haben und authentisch sein. Und das beinahe um jeden Preis, auch was seine Wirkung auf das Publikum anging: Ein sehr großer Teil der Kunst strebte auf Biegen oder Brechen an, die Leute aus ihrem Schlaf aufzuschrecken, sie aufzuwecken – und die Methoden dazu konnten gar nicht schockierend genug sein.
Doch ihr „Geburtsfehler“ führte letztlich auch zum traurigen und kläglichen Scheitern der Achtundsechziger. Heute wissen nur noch wenige, dass diese Epoche, zumindest in den Vereinigten Staaten, einen wirklich glorreichen Anfang hatte. Man braucht sich nur einmal anzusehen, welche Sprache Menschen wie Robert Moses und Stokley Carmichael bei den frühen Friedensbusfahrten nach Mississippi sprachen. Im Vergleich dazu war bereits Martin Luther King an Farbe und Kraft geschwächt. Sie trugen wirklich das „Feuer auf den Berg“ und waren, wie viele zu ihrer Zeit auch erkannten, echte „Evangelisten“– und das nicht zuletzt, weil sie Whitman, Melville, Thoreau und Blake gelesen hatten.
Das Unglück geschah, als die kleine und zutiefst idealistische Bürgerrechtsbewegung zu einer Massenbewegung gegen den Krieg in Vietnam wurde. Plötzlich wurde sie ins Rampenlicht sämtlicher Fernsehstationen gerückt und Stimmen wurden laut, die ein politisches Programm über die Beendigung des Vietnamkrieges hinaus forderten. Darauf war man bedauerlicherweise ganz und gar nicht vorbereitet. Und das wurde zum entscheidenden Punkt: Die andere, das Leben fördernde Strömung innerhalb unserer Kultur hatte sich nicht mit den programmatischen Fragen von Politik und Gesellschaft auseinander gesetzt. Doch plötzlich waren die Straßen und Plätze voll von Menschen, die Antworten verlangten. Sie wollten wissen, in welche Richtung sie nun marschieren sollten und was sie mit den inzwischen entfesselten himmelstürmenden Energien aufbauen sollten. Nicht nur, was man „beenden“, „zerschlagen“ oder „übernehmen“ sollte, sondern welche Dinge man aufbauen und in neue Formen gießen sollte. Und da wussten die Achtundsechziger plötzlich nichts mehr zu sagen. Was dann kam, ist uns allen nur allzu gut bekannt. Bittere sektiererische Fehden brachen an allen Ecken und Enden aus. Splittergruppen packten ihre Koffer und fuhren ab in jede erdenkliche Richtung.
Aber das Schlimmste waren zwei Verirrungen, die im Rückblick gar nicht so schwer zu verstehen sind. Die eine war der Abstieg in sich verpuffende Gewalt (z. B. die Weathermen in den USA, Baader-Meinhof in Deutschland), die andere das Abrutschen in wahre Schlammschlachten der Rhetorik und der Vulgarität. Zu diesen beiden Formen kam es, weil Briefe an den Abgeordneten des eigenen Wahlkreises, Boykotts und Protestmärsche und die anderen sanfteren Formen des Protests offensichtlich nicht ausreichten. Es waren letztlich vergebliche Zeichen und Gesten – ein wirkungsloses Posieren und Drohen. Aber man wusste nicht, was man sonst tun sollte. Es gab keine Alternative! Also bewarf man die Polizei mit Pflastersteinen oder zog sich – wie bei dem viel kommentierten Woodstock-Festival – nackt aus und badete im Schlamm.
Wie zu erwarten, schwang das Pendel zurück. Die Friedensbewegung erzeugte eine Reaktion, deren Name in den Vereinigten Staaten „Reagan“ war. Und bis in unsere Zeit hat man den Eindruck, dass sie sich von dieser Reaktion noch nicht wieder erholt hat. Die Achtundsechziger waren kläglich, beschämend und erbärmlich gescheitert, und eine sich ständig vertiefende Desillusionierung über die Politik als Ganzes griff um sich. Gleichgültigkeit, Apathie, Zynismus sowie reine Clownerie nahmen zu und breiteten sich aus wie ein Sumpf, in dem immer mehr Menschen Zentimeter um Zentimeter versanken.
Alle Beobachter sind sich einig, dass diese Stimmung noch dadurch verstärkt wurde, dass man sich ab da der Arbeitsplätze nicht mehr sicher sein konnte. Dies bedeutete, dass man sich stärker auf das eigene Überleben und das Durchbringen seiner Familie konzentrieren musste und sich nicht mehr die Ablenkung und den Luxus erlauben durfte, über den Tellerrand hinauszuschauen. Dies bedeutete auch, dass man sich stärker auf materielle Güter konzentrierte, was dann zur Konsumgesellschaft führte. Es gibt allerdings einen ziemlich weit gehenden Konsens darüber, dass das Abrutschen in immer tiefere Abstumpfung, in immer tieferes Koma auch durch die immer deutlichere Spaltung in zwei völlig verschiedene Welten zustande kam: die Welt der im Elend Lebenden und die Welt der Reichen.
Diese Version der Geschichte der vergangenen Dekaden ist sicher in vieler Hinsicht wahr. Man sollte ihr jedoch noch eine Perspektive hinzufügen, die eine in einigen Bereichen zwar deckungsgleiche, in anderen jedoch verschiedene Gestalt erkennen lässt. Die Abwendung von der Politik und die Stimmung der Apathie und der Lähmung, die damit einhergehen, haben wahrscheinlich noch eine ganz andere und viel faszinierendere Ursache.
Die Ära der Achtundsechziger war weitgehend ein Strohfeuer, weil sie ein Durchbruch, ein Coming-out einer völlig anderen Kultur war, die schon seit langem parallel zur offiziellen disziplinierenden Kultur existiert hatte. Die Nemesis dieser traurigen kleinen Episode war, dass sich keine Form ergab, die diesem Geist hätte Gestalt, Fleisch und Substanz geben können. Und so löschte dieses kurze Aufflackern sich selbst aus, noch bevor die Bewegung aus ihren Kinderschuhen herausgewachsen war. Aber der dahinter stehende Impuls überlebte dieses vielversprechende und dennoch groteske Debakel. Dieser Impuls war etwas viel Ernsthafteres, eine viel wagemutigere Vorstellung von Freiheit als das bloße Ersetzen eines Königs durch ein großes Komitee. Die Sehnsucht und die Hoffnung, die in dieser Idee bereits vage angelegt waren, nahmen an Kraft zu, und die Zahl der Menschen, die sich dadurch inspiriert und entflammt fühlten, wuchs ganz enorm. Während der Zeit des Vietnamkrieges bestand die andere Kultur aus einer kümmerlichen und unansehnlichen Schar Studenten, verlorener Intellektueller und Künstler. Doch inzwischen ist die andere Kultur um die Welt gewandert, und man kann sie in den entlegensten Dörfern Chinas und Mexikos finden. Und nicht nur das. Außer den bereits erwähnten Bereichen Erziehung, Therapie und Kunst sollte man sich den Bereich der neuen Industrien näher anschauen, vor allem den Bereich jener, die Computer herstellen, sowie derer, die auf irgendeine Weise mit Computern arbeiten. Man erkennt schon an ihrer Frisur und ihrer Kleidung, aber auch an dem, was sie essen, und an dem Kaffee, den sie trinken, zu welcher Kultur sie gehören.
Die Computerleute sind nur eines von vielen möglichen Beispielen, ein Querschnitt an einer bestimmten Stelle. Ich habe sie herausgegriffen, weil sie während des vergangenen Jahrzehnts die Lokomotive gewesen sind, die die Wirtschaft gezogen hat, und wenn wir sie, oder sehr viele von ihnen, als Teil der anderen Kultur ausmachen, gibt uns das einen Eindruck von der Macht, den die stärkende Kultur in der Zukunft haben könnte. Ein sehr großer Teil der jungen Leute sowie eine überraschend große Zahl von Managern und Ingenieuren, vor allem solche, die in kleinen und mittelgroßen Unternehmen (also nicht in der Großindustrie) arbeiten, stehen ebenfalls auf dieser Seite der tiefen Kluft.
Die politische Gleichgültigkeit hat deshalb vielleicht einen ganz anderen Grund. Vielleicht kommt sie nicht aus Apathie oder Verzweiflung, sondern hat gänzlich andere Wurzeln. Vielleicht ist es eher eine Haltung des Abwartens: Man liegt auf der Lauer und spart seine Kräfte für einen späteren Zeitpunkt auf. Die Themen, die von den Parteien gegenwärtig diskutiert werden, etwa die Gesundheitsreform oder noch größere Steuervorteile für die Superreichen, haben nichts mit den grundlegenden Unterschieden zwischen den beiden Kulturen zu tun. Das sind Streitigkeiten zwischen nahen Verwandten, die zum selben Lager gehören: dem der „Angepassten“, der braven Bürger, der ordnenden und disziplinierenden Kultur. Und dabei geht es nur um die Größe der zu verteilenden Kuchenstücke: ein bitte nicht mehr ganz so kleines für die Armen und ein natürlich sehr viel größeres für die Reichen. Weder die Republikaner noch die Demokraten, weder die Sozialdemokraten noch die Christliche Union, weder die Labour Party noch die Tories haben die geringste Vorstellung davon, welche Art von „Programm“, welche Veränderungen in der Wirtschaft und im sozialen Bereich stärkere und lebendigere Individuen hervorbringen würde, Menschen, die in sich ruhen, die lebhafter, authentischer und selbstbewusster sein würden. Und das ist der Punkt, an dem wir vor einer Betonmauer stehen. Niemand weiß, wie das Ziel zu erreichen wäre.
Aber genau das ist des Pudels Kern! Die überwiegende Mehrzahl der Menschen, die heute auf diesem Erdball leben, interessiert sich nicht mehr für das Gezänk zwischen den Fraktionen der jetzt sterbenden Kultur, von der sie sich selbst vielleicht schon vor Jahren losgesagt haben. Sie halten still und scheinen merkwürdig ruhig zu sein, aber nicht, weil sie betäubt oder apathisch wären. Sie halten still, weil sie warten. Man kann sogar mit dem Finger in die ungefähre Richtung zeigen, in der das liegt, worauf sie warten. Und das könnten erste Fingerzeige darauf sein, dass die bisher noch unvollständige andere Kultur, in der sie jetzt noch sehr beengt und unbehaglich leben, vielleicht doch noch verwirklicht werden könnte, Anzeichen dafür, dass diese Kultur nicht länger ein bloßer Impuls bleiben muss, nicht länger ein Kind mit einem halben Kopf. Irgendetwas müsste diesen Wartenden das Gefühl geben, dass es einen Plan gibt, dass konkrete Schritte möglich sind, dass es eine gangbare Leiter gibt, die Sprosse für Sprosse hinaufführt zu der Kultur, die sie sich wünschen. Wenn ein Zeichen davon am Horizont erschiene, dann würden sie ihre Apathie ausziehen wie Regenmäntel. Dann würden sie die Ärmel hochkrempeln und würden anfangen, an einer mehr Leben gebenden und das Leben stärkenden Welt zu arbeiten.
Die Kopplung von Business und Arbeitsplätzen
In optimistischen Momenten geben die Existenz der anderen Kultur und insbesondere ihre phänomenale Größe uns Hoffnung. Wir wachsen mit gewaltigen Sprüngen, und die konventionelle, unterdrückende, zähmende und sozialisierende Kultur ist im Schrumpfen begriffen und vertrocknet langsam. In fünf Jahren könnte die Welt völlig anders aussehen als heute … wenn da nicht diese monströsen Kräfte wären, die uns umklammert halten wie ein Schraubstock und die unbeugsam entschlossen scheinen, uns alle in einen gähnenden Abgrund fahren zu lassen. Dass wir dermaßen in dieser kolossalen Dynamik gefangen sind, liegt nicht in erster Linie daran, dass es keine gangbare Alternative gäbe, sei es nun der verstorbene Sozialismus oder eine andere Kultur, die sich vielleicht zu einer Alternative entwickeln könnte, die aber bis jetzt noch keine Macht, keine Agenda und noch nicht einmal eine Vorstellung von ihrem Ziel hat.
Wir sind vielmehr in einem Mechanismus gefangen, der über solch immense Kräfte verfügt, dass alles Reden von einer Hoffnung und von künftigem Wandel verlorene Träumerei ist, solange wir diesen Mechanismus nicht klar und deutlich verstanden und darüber hinaus entmachtet und entwaffnet haben. Vier Zahnräder greifen ineinander wie die Gänge in einem Getriebe. Wir müssen uns jeden dieser vier Faktoren vornehmen und ihn leidenschaftslos untersuchen.
1. Der erste Faktor ist, dass Arbeitsplätze zu unserem alles andere überragenden Omni-Wert geworden sind. Es gab einmal einige Indianerstämme, für die der Büffel keineswegs nur Fleisch bedeutete. Natürlich aßen sie die Beute, die sie jagten. Aber aus den Häuten machten sie auch ihre Zelte und Kleidungsstücke und selbst ihre Mokassins, und aus den Sehnen des Büffels machten sie ihre Bogensehnen. Es gab keinen Teil des Büffels, den sie nicht verwendeten, und der Büffel lieferte ihnen alles, was sie brauchten. Das meine ich mit Omni-Wert.
Heutzutage sind Arbeitsplätze das, was diesen Indianern ihre Büffel waren. Arbeitsplätze versorgen uns natürlich mit unserem Einkommen, aber sie leisten noch sehr viel mehr. Unser Job ist die Quelle unseres sozialen Status. Und er ist unsere Verbindung zu anderen Menschen: „Das Telefon klingelt nicht mehr“ ist eine der häufigsten Klagen, die man von Arbeitslosen hört. Darüber hinaus ist er die Stütze unserer Selbstachtung. In dem Moment, in dem wir arbeitslos werden, fällt das Gefühl für unseren eigenen Wert in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Viele der Arbeitslosen, mit denen ich gearbeitet habe, verheimlichten die Tatsache, dass sie ihren Job verloren hatten, selbst vor ihrer Frau und ihren eigenen Kindern. Sie packten am Morgen ihre Brote ein, zogen los und kamen erst am Abend – aus der öffentlichen Bibliothek – wieder zurück. Ohne Arbeitsplatz ist man ein von anderen „Abhängiger“, also kein ganzer Mensch. Man ist überflüssig, störend, eine Last. Man hat auf nichts wirklich ein Recht, nicht einmal auf sein Essen.
Dies ist eine Situation, die sich sehr von der vieler, wenn nicht der meisten anderen Kulturen unterscheidet, und das ist noch nicht das Ende. Jedes Jahr laden wir noch etwas mehr von dem, was einmal unser Leben ausgemacht hat, auf einen Karren und verbrennen es auf dem großen Scheiterhaufen unserer Arbeitsplätze. In dem Dorf in den Alpen, in dem ich aufgewachsen bin, wurde Weihnachten sechs Wochen lang gefeiert, mit vielen Liedern, Kerzen, Festmählern und allen möglichen, durchaus nicht nur kirchlichen Zusammenkünften; und wenn jemand gestorben war, dann ging das ganze Dorf zum Begräbnis und für die nächsten zwei Tage blieb niemand nüchtern.
Fast alles davon ist verschwunden. Wir haben keine Zeit mehr für unsere Freunde und nicht mehr viel Zeit für unsere Kinder. Unsere früheren zwischenmenschlichen Beziehungen sind dahin, aber sie hinterließen keinen leeren Raum. Unsere Arbeit hat, wie Wasser, jede Ecke und jeden Winkel ausgefüllt.
2. Das zweite Zahnrad in der großen Maschinerie ist die Automatisierung. Viele Jahre lang haben selbst die am großzügigsten orakelnden Experten auf dem Gebiet der „Zukunft der Arbeit“ die erdrutschartigen Auswirkungen, die die Automatisierung mit sich bringen kann, vollkommen unterschätzt. In unzähligen angeblich gelehrten Aufsätzen wurde in den frühen achtziger Jahren nachzuweisen versucht, dass durch die Einführung von Computern nur die Qualität der Arbeit zu einem gewissen Grade aufpoliert werden wird, die Quantität aber unverändert bleiben würde.
Daran glaubt heute niemand mehr, aber die meisten Menschen sträuben sich gegen den Hinweis, dass wir uns noch immer erst in einem Vorzustand der Automation befinden, dass alles, was wir bisher gehört haben, erst das Stimmen der Instrumente eines Orchesters ist und das Konzert noch gar nicht angefangen hat. Der Dirigent hat noch nicht mit dem Taktstock gegen sein Pult geklopft. Was Automatisierung erreichen kann, wie sich diese Musik anhören wird, wenn erst einmal die bisher durcheinander spielenden Instrumente unter einer Führung harmonisch zusammenspielen – davon haben wir bisher noch keinen Begriff.
Es gibt einige Beispiele, die uns bereits jetzt einen ersten Eindruck geben von dem, was sich da entwickeln könnte. Beispielsweise in Mexiko in Grenznähe zu den USA. Dort sind bereits ein oder zwei ultramoderne Fabriken in Betrieb, die ihren Kunden anbieten, das Gewünschte auf Anforderung zu produzieren. Eine Woche lang stellen sie Kühlschränke her, in der nächsten Woche Fernsehempfänger, eine Woche danach DVD-Player und einige Tage später X-Boxen für Microsoft (von Jeffrey M. O’Brien in der Zeitschrift Wired, November 2001). Es ist sehr nützlich, diese Fabriken als Symbole zu verstehen, als Metapher dafür, wie flexibel und wie anpassungsfähig Fabriken werden können.
Noch vor wenigen Jahren wurde ein bizarrer Glaube häufig diskutiert, den wir bald nur noch im Wachsfigurenkabinett antreffen werden. Ich meine den verzweifelten Glauben, dass Wachstum im Bereich der Dienstleistungen durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze die Verluste in der Industrie wettmachen werde. Inzwischen ist allgemein bekannt, dass eine genau gegenteilige Entwicklung eingesetzt hat. Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich lassen sich viel leichter automatisieren als dort, wo „Dinge hergestellt“ werden. So wird auf die Automatisierung der Banken und Versicherungsgesellschaften und natürlich an Tankstellen, am Fahrkartenschalter und am Schalter zum Einchecken auf Flughäfen bald eine große Entlassungswelle im Bereich der privatwirtschaftlichen und öffentlichen Verwaltungen folgen. Das wird sicherlich einer der am meisten begrüßten Fortschritte auf diesem Gebiet sein. Das lästige Ausfüllen endloser Formulare für alle möglichen Anträge, Lizenzen, Führerscheine, Visa, Kredite und Kreditkarten und die Zahlung an Versicherungen, Krankenkassen und Rentenanstalten wird endlich vorbei sein, und ein großer Seufzer der Erleichterung wird zum Himmel aufsteigen, wenn all dies zu Grabe getragen und das Grab mit Software zugeschüttet wird.
Die absurde Komik dieser ganzen Entwicklung ist natürlich schwer zu übersehen: Zuerst haben wir Arbeitsplätze mit allen Werten ausgestattet, die wir nur finden konnten. Wir haben sie nicht nur herausgeputzt, sie sexy und verführerisch aussehen lassen, wir haben sie auch unerlässlich gemacht. Ohne sie wurde das Leben unmöglich. Wir haben alles getan, um sicherzugehen, dass es keinen Ersatz für sie gibt. Bildlich gesprochen, wir haben ihnen alle nur möglichen Medaillen und Orden angeheftet und sie auf ein sehr hohes Podest gehoben. Aber dann haben wir uns auf einmal um 180 Grad gewendet und 550 Methoden erfunden, um sie abzuschaffen und zu Grabe zu tragen, auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen oder im Ozean zu ersäufen. Mit Hilfe zahlloser Maschinen wurden Arbeitsplätze auf einmal zu einer gesuchten Rarität.
Jedermann hätte vorhersagen können, dass es einen wahnsinnigen Wettlauf geben würde, dass die Menschen sich mit Faustschlägen und Fußtritten um sie reißen würden. Das war zu erwarten, aber wir haben noch eine weitere Wendung hinzugefügt, die jene betraf, die in dem großen Gerangel den Kürzeren gezogen hatten und zur Seite gedrängt worden waren. Man sollte meinen, es wäre Bestrafung genug, wenn aus dem Füllhorn des Arbeitsmarktes nichts für sie abfiel. Aber nein. Gerüchte wurden über diese Menschen verbreitet, Gerüchte, die ihnen nachsagten, dass sie aus schierer Bewegungslosigkeit keinen Arbeitsplatz gefunden hatten, ja dass sich eine Fäulnis unter ihnen ausbreite, die ihre anscheinend nutzlosen Gliedmaßen in brandige, übel riechende Stümpfe verwandle.
So haben wir jetzt eine überaus paradoxe Situation: Erst haben wir Arbeitsplätze in den Himmel gehoben, und dann haben wir alle Kraft und Intelligenz darauf verwendet, sie massenweise abzuschaffen.
Und als sei das noch nicht genug, wurde noch ein drittes wichtiges Element in die verfahrene Situation eingebracht. Es war nicht beabsichtigt, und es wurde auch nicht vorhergesehen. Es war ein völlig überraschendes Nebenprodukt anderer Entwicklungen: Wir perfektionierten bestimmte Technologien. Diese waren nicht so umstritten oder esoterisch wie die genetische Manipulation von Nahrungsmitteln oder die Herstellung von Maschinen aus einzelnen Molekülen. Sie gehörten zu einem eher banalen Bereich. Sie hatten im Wesentlichen alle mit dem Transportwesen und dem Zurücklegen großer Entfernungen in einem Minimum an Zeit zu tun. Genauer gesagt: Entscheidend war die Entwicklung großer Langstreckenflugzeuge, sehr schneller und sehr billiger Frachtschiffe, von Lastwagen und Eisenbahnen und natürlich von einer der elementarsten Möglichkeiten von Computern, nämlich der, E-Mails zu empfangen und zu versenden. Selbstverständlich gab es noch eine Menge anderer Faktoren, aber diese Technologien trugen wesentlich dazu bei, das dritte Zahnrad in unserem Getriebe zu erzeugen.
3. Dieses dritte Zahnrad ist die Globalisierung. Der erstaunliche Überraschungseffekt war der Wandel der Größenordnungen, in denen wir nun denken mussten. Mit einem Sprung verließ beinahe alles die lokale und regionale, ja selbst die nationale Ebene, und in erstaunlich kurzer Zeit waren wir in eine neue Ära eingetreten, die des Globalen.
Einer der reichlich seltsamen Aspekte dieser plötzlichen Transformation ist, dass Geschäftsleute sie im Allgemeinen nur aus der engstmöglichen Perspektive sehen und diskutieren. Aus ihrer Sicht bedeutet das Wort „global“ vor allem einen globalen Markt, und zu allem Überfluss ist ihre Vorstellungskraft auch noch allein auf das Produkt beschränkt, das sie selbst zufälligerweise herstellen.
So sieht die Autoindustrie zum Beispiel China als Glücksfall an: als ein einziger riesiger Marktplatz, auf dem sich Millionen von Chevrolets verkaufen lassen. Das Vermögen, auf diese Art und Weise zu denken, ist geradezu akrobatisch: Es stellt eine Ausnahmeleistung in der Meisterung des Einseitigen und Asymmetrischen dar. Schon fast so wie die berühmte Fähigkeit, mit einer Hand zu klatschen. Wie ist es nur möglich, die andere Seite dieser Medaille zu übersehen? Nämlich dass die Chinesen nicht nur kaufen, sondern selbst herstellen werden – und vielleicht billiger und mit höherer Qualität. Die Japaner machen uns das schon seit vielen Jahren vor, weshalb es noch erstaunlicher ist, dass dieselben Manager der Automobilindustrie, die mit den Zähnen knirschen, wenn die Sprache auf Japan kommt, nun voller Überschwang von China sprechen.
Doch das Thema des Handels sollte unsere Diskussion hier nicht monopolisieren. Unglücklicherweise ist dies das bereits bekannte Muster, nach dem das Für und Wider der Globalisierung im Allgemeinen diskutiert wird. Vernachlässigt wird die Seite, die mit der Arbeit zu tun hat. Stellen Sie sich eine Kombination dieser drei Aspekte vor: Erst hebt man Arbeitsplätze auf ein Podest, dann macht man sie durch Automatisierung rar, was schließlich nicht zu mehr Produkten führt, sondern zu immer mehr Menschen, die Arbeit suchen.
Was wäre, wenn es ein Wunderheilmittel (sagen wir gegen Aids) gäbe, das Angebot an diesem Mittel aber äußerst eingeschränkt wäre. Denken Sie an die Masse Menschen, die bereits unruhig in der heißen Sonne stehen und warten. Und dann bringt man an diesen Ort mit Zügen, Schiffen, Bussen und Autos noch Tausende zusätzlicher Patienten. Aber machen wir uns nichts vor: So wahnwitzig dies wäre, es ist immer noch kein zutreffendes Bild für das, was wirklich geschehen ist. Die Wahrheit ist noch um einiges grausamer.
Bis in sehr viel jüngere Zeit, als man gemeinhin glaubt, lebte die überwiegende Mehrheit der Menschen auf dem gesamten Globus in Dörfern und erzeugte ihren Lebensunterhalt, indem sie Land bestellten, ihr eigenes oder das anderer. Selbst in den Vereinigten Staaten und in Europa lag die Zahl der Menschen, die auf dem Land lebten, bis vor etwa 150 Jahren bei 80 Prozent. Jedermann weiß, dass die Bauern in diesen Ländern heute enorme Subventionen erhalten und dennoch „in Schwierigkeiten“ sind. Deshalb sind ganze Dörfer auch in Europa und den USA beinahe wie ausgestorben. Im Vergleich zu praktisch dem gesamten Rest der Welt ist diese Landflucht aber noch geringfügig. In jedem Land in Afrika, Asien und Südamerika sind riesige Wanderungsbewegungen im Gange. Die ehemaligen Bauern verlassen ihre Dörfer aus den verschiedensten Gründen, zum Teil aber einfach deshalb, weil sie keine andere Wahl haben. Und sie haben keine Wahl, weil es zwei gewaltige Veränderungen gegeben hat: große Agrarindustrieunternehmen haben ihr Land aufgekauft, und Nahrungsmittel sind auf der ganzen Welt zu billig geworden. Ein kleines Stück Land reicht nicht mehr aus, um auch nur das lebensnotwendige Minimum an Mais oder Reis zu erzeugen.
Das wahre Bild ist also, dass diese Menschen nicht einfach so in Bussen, Zügen und Schiffen angefahren kommen – sie sind gezwungen zu kommen. Die Lebensform, in der sie länger, als irgendjemand zurückdenken kann, gelebt haben, ist ihnen wie ein Teppich unter den Füßen weggezogen worden, und so wandern sie wie Flüchtlinge zu Millionen und Abermillionen auf der Suche nach Arbeitsplätzen in Richtung der Städte (um nur ein Beispiel zu nennen: Simbabwe hat zurzeit „offiziell“ 70 Prozent Arbeitslose.). Die Zahl der Menschen, welche diese Migrationsbewegung umfasst, ist so riesig, dass die Zahlen, die in unserer noch so freundlichen westlichen Welt die Arbeitslosigkeit messen, im Vergleich dazu geradezu lächerlich ist. Wenn man die faktische Auslöschung des größten Teils der traditionellen Landwirtschaft nicht in das Bild einbezieht, dann ist man außerstande, die wahre Größenordnung des Mangels an Arbeitsplätzen, mit der wir konfrontiert sind, einzuschätzen.
4. Das vierte und letzte Zahnrad der angesprochenen Maschinerie wird ein weiteres Schlaglicht auf unsere gegenwärtige Situation werfen: das Arbeitsplätzemonopol. Seine Auswirkung ist so einfach wie krass: Stellen Sie sie sich schlicht als eine ungeheure, überwältigende Zunahme an Macht vor. Wessen Macht? Der Macht der Wirtschaft natürlich, denn die Wirtschaft baut neue Fabriken und schafft damit Arbeitsplätze, aber die Wirtschaft schließt auch Fabriken und schickt die Leute nach Hause.
Die drei gigantischen Kräfte, die wir zuvor beschrieben haben, sind alle relativ neu, und alle sind seit 1989 wie ein Feuersturm angewachsen. Vor 15 Jahren nahm die Arbeit noch nicht so viel Platz in unserem Leben ein und hatte nicht denselben Status wie heute. Die Automatisierung war noch ein Kätzchen im Vergleich zu dem Menschen fressenden Tiger, der sie heute ist, und Millionen, die heute in Slums leben, lebten damals noch auf ihren Bauernhöfen. Der Druck war also längst nicht so groß; inzwischen hat er enorm zugenommen, und die Macht der Wirtschaft ist proportional dazu gewachsen.
„Wir, das Volk“, um diesen großen, klangvollen Ausdruck zu benutzen, sind in die Position von Bittstellern und Bettlern geraten. Das ist nun die Essenz. Oft ist die Rede davon, dass Städte, Regionen oder sogar Staaten sich bemühen, Großunternehmen durch Anreize dazu zu „verführen“, sich auf ihrem Territorium niederzulassen. Aber dieses Bild ist nicht ganz zutreffend: Eine Verführerin, die sich mit nicht mehr als schwarzer Unterwäsche bekleidet auf einem roten Sofa räkelt, braucht beträchtliches Selbstvertrauen. Dazu muss man sich begehrenswert und attraktiv vorkommen. Gegenüber den Großunternehmen ist heute der Großteil der Städte und Länder jedoch mitnichten in einer solchen Position. Sie schmeicheln und bieten „Geschenke“ und große Summen in Form von Subventionen und Steuerersparnissen an, aber darüber hinaus bleibt ihnen oft schlichtweg nichts anderes übrig als zu betteln. In der Beziehung zu den Wirtschaftsfürsten sind „wir, das Volk“ also keineswegs mit einer verführerischen Frau zu vergleichen. Wir ähneln mehr den „Bürgern von Calais“, Rodins berühmter Skulpturengruppe. Wir kommen barfuß und in Lumpen. Wir warten in Vorzimmern und haben den Schlüssel zu unserer Stadt um den Hals hängen. Diese Haltung und diese Art von Beziehung waren der Grundstein und das archetypische Modul, aus dem die Wirtschaft und das politische Leben in der Ära nach dem Kalten Krieg gebaut wurde.
Es mag beklagenswert sein und wütend machen, aber es ist nichtsdestoweniger wahr, dass ein einziger roher und brutaler Ringergriff einer ständig kleiner werdenden Gruppe von Menschen so viel Macht verliehen hat. Aber halten Sie diesen primitiven Knebelmechanismus nur einmal gegen – beispielsweise – den Erfolg von Reagans Wahlkampf oder, was das angeht, gegen die Karriere von Clinton, Blair, Schröder oder Bush, oder halten Sie ihn gegen das, was in den Vereinigten Staaten aus den Gewerkschaften oder allgemeiner aus dem Liberalismus oder speziell aus der demokratischen Partei geworden ist. Ist es dann nicht ein Leichtes, zu sehen, welch beherrschende Macht die Kopplung von Business und Arbeitsplätzen ausgeübt hat?
Es ist von entscheidender Bedeutung, klar zu erkennen, wie ein Würgegriff es geschafft hat, uns lahmzulegen. Wie er unseren Verstand und vor allem unsere politische Vorstellungskraft wie an einen mittelalterlichen Pranger gekettet hat. Es hätte kaum einfacher, kaum banaler sein können: Arbeitsplätze sind unser Omni-Wert, und die kombinierten Kräfte von Automatisierung und Globalisierung konnten sicherstellen, dass wir ständig und zunehmend an einem Mangel an Arbeitsplätzen leiden. Auf die drohende Hungersnot kannten wir nur eine Antwort: die Wirtschaft aufs Podest zu heben und ihr gegenüber immer noch ergebener und noch unterwürfiger zu werden. Wir glaubten, dass es keine andere Möglichkeit gäbe. Wir glaubten, wir säßen in einem Zug, dessen Türen und Fenster fest verriegelt seien.
Das Ableben der Linken
Es war keineswegs nur der wahre Kern des Sozialismus, der abgetötet wurde. Es fiel nicht nur seine Festung, auch alle sie umgebenden Ländereien wurden besetzt. So sind seit 1989 auch die milderen, verdünnten, verwässerten Formen des Sozialismus, von denen viele auf dieser Seite des Eisernen Vorhangs aufgeblüht waren, schal und lahm geworden. Selbst die bloßen Schattenformen des Sozialismus, die kaum noch „links“ zu nennen und allenfalls noch blassrosa waren, die „respektablen“ sozialdemokratischen, liberalen, vornehmen, bürgerlichen Parteien mit „sozialem“ Anspruch, wurden schwach und müde und verloren ihre Zielsetzung und ihre Identität.
Warum kam es dazu? Ein wichtiger Faktor war, dass sie befleckt waren! Befleckt durch bloße Assoziation. Sie hatten eine gewisse Ähnlichkeit, eine ferne Verwandtschaft mit einem System, das kläglich gescheitert war. Deshalb haftete ihnen der Geruch des Versagens und der Niederlage an. Das machte sie noch unsicherer und viel bereiter, auf Kompromisse einzugehen und sich immer mehr von ihren ursprünglichen Absichten und Ideen zu distanzieren.
Ein weiterer bedeutsamer Faktor war, dass sie entwurzelt, ja von ihren Wurzeln abgeschnitten worden waren. Wir hatten uns nicht die Mühe gemacht, die tiefen und ernsten Ursachen für den Tod des Sozialismus klar zu erkennen. Es wurde viel geredet über Inkompetenz, Korruption, Parteibosse und Bürokratie, und das Resultat war absehbar. Da der Sozialismus tot und nirgends ein Leichnam zu finden war, durchstöberten die Leute die verbliebenen Andenken und Mementi. Was zuvor eine kohärente Weltanschauung und weltverändernde Politik gewesen war (irregeleitet, zweifellos, aber dennoch kohärent), war jetzt zerschlagen, und aus den Überresten des Inventars ließen sich nur noch jämmerliche Barrikaden errichten.
Dies wurde das Markenzeichen der Linken in der Politik, und die wirkungslosen Rückzugsgefechte wurden sogar charakteristisch für die Gewerkschaften. „Begrenzung“ wurde zu ihrem Schlagwort: Begrenzung der Geschwindigkeit der Fließbänder, Begrenzung der Zahl der Arbeitsstunden, Begrenzung des Maßes, zu dem wir uns ausbeuten lassen. Der gleiche Geist machte sich im Rest dessen breit, was zuvor die linke Kultur gewesen war. Ganz gleich, welche Gruppe oder welche Enklave oder welches Lager man besuchte, es ging um die Verteidigung von Arbeitsplätzen oder Löhnen, die Beschränkung der Ölförderung in einer bestimmten Region, den Schutz vor einer Technologie oder einer bestimmten (biologischen) Forschung, den Schutz von dieser Spezies oder jenem Regenwald. Das waren die Slogans und Schlachtrufe. All dies war, traurig genug, reaktiv und defensiv – und deshalb immer nahe an einer Stimmung des Rückzugs. So könnte man zusammenfassend sagen: Die Geschichte der Linken seit 1989 ist die Geschichte einer langen Reihe von Rückzugsgefechten.
Mit Blick auf das größere Bild überschattet ein anderer, noch bedeutenderer Faktor die beiden bereits genannten: die schon erwähnte Kopplung von Business und Arbeitsplätzen. Kurz gesagt: Die Macht der Wirtschaft nahm dergestalt exponentiell zu, dass die Linke hoffnungslos überflügelt wurde. So wurde die Politik der Linken hauptsächlich zu einem Bemühen, die wachsende Macht der Wirtschaft zu kontrollieren, und daran musste sie scheitern, weil diese Kopplung inzwischen so ungeheuer an Macht gewonnen hatte, dass die Linke dem eigentlich nichts mehr entgegen zu setzen hat.
Früher, in günstigeren Zeiten, waren die politischen Ideen der liberaleren, linksorientierten Parteien wie ein Bündel miteinander verschlungener Seile. Nach dem Kalten Krieg nun wurden einzelne Fäden und kleinere Stränge aus diesem einen großen Seil herausgezogen und auf eine abgeschwächte, angepasste Weise auf die unterschiedlichsten Situationen angewendet. Jede dieser Aktionen war in Wahrheit ein mehr oder weniger schwächlicher Versuch, die Willkür der Wirtschaft einzuschränken. Aber eben darin lag das prinzipielle Scheitern, denn jeder dieser Schachzüge wurde von der Furcht begleitet, damit Arbeitsplätze zu gefährden.
Worum auch immer es ging, ob es ein Versuch war, die Mindestlöhne anzuheben, die Gesundheitsfürsorge zu verbessern oder den Kündigungsschutz zu verschärfen, ob es um diverse Steuern ging oder natürlich zuerst einmal um die Bemühungen, die Arbeiter in einer Fabrik zu organisieren – gegen all diese Bestrebungen konnte man ins Feld führen: Das wird zu einer Verringerung der Arbeitsplätze führen. Das wird dem Unternehmen einen Grund liefern, seine Koffer zu packen und seine Zelte anderswo aufzuschlagen. Dies wird die Expansion dieses oder jenes Unternehmens behindern, und damit werden weniger neue Arbeitsplätze geschaffen.
Oder nehmen wir einen anderen Bereich: Oft fanden sich Gruppen im Namen der Friedensförderung zusammen und wuchsen sogar zu einer beträchtlichen Größe an. Auf vielen Türen waren Aufkleber angebracht, und es kreisten sogar weiße Tauben um die Dächer. Aber dann verbreitete wie zufällig der lokale Militärstützpunkt oder die Munitionsfabrik am anderen Ende der Stadt das Gerücht, sie werde ihre Tore schließen müssen, und damit würden natürlich die Arbeitsplätze, von denen die Stadt abhängig war, verschwinden. Und bezeichnenderweise malten viele der Friedensbewegten nach kurzer Zeit ganz andere Schilder als jene, die sie zuvor durch die Straßen getragen hatten. Nun forderten sie den Stützpunkt oder die Fabrik dazu auf, zu bleiben. Und natürlich gab es nur einen Weg, das zu erreichen: Die Stadt musste sich noch attraktiver zeigen. Sie musste den Geschäftsinteressen noch verführerischere Konditionen anbieten. Womit? Mit Steuersenkungen. Mit größeren Subventionen. Mit Arbeitsverträgen, die für die Unternehmerseite noch attraktiver waren.
Sobald wir einmal die Logik und die Dynamik dieser Kopplung von Business und Arbeitsplätzen durchschaut haben, gewinnen wir ein klareres Verständnis für den fortschreitenden Niedergang unserer Kultur. Was heute geschieht, ist weit von einem bloßen „Abbröckeln“ entfernt, von einem Wegbrechen ermüdeter oder altersschwacher Teile. Es ist viel eher ein „Abriss“, eine absichtliche und gewollte Zerstörung, an der wir alle aktiv teilnehmen. Von allen Seiten ertönt der Ruf, mehr Arbeitsplätze zu schaffen, und diese Forderung ist absolut und nicht verhandelbar.
Und bislang kennen wir nur eine Antwort auf diesen Ruf: die Gewinne, die der Wirtschaft zufließen, noch mehr zu vergrößern. Also nehmen wir es von den sozialen und kulturellen Institutionen und geben es en masse der Wirtschaft. Der Bereich der Wirtschaft nimmt einen immer größeren Platz ein, während die sozialen und kulturellen Institutionen sich aufgrund ihrer Budgetkürzungen in immer kleiner werdenden Nischen zusammenkauern. Die Unsummen, die den pharmazeutischen Unternehmen und den großen Versicherungsgesellschaften in den Vereinigten Staaten als Teil der Finanzierung des neuen Home Security Department zugesprochen wurden, sind nur eines der jüngsten und schamlosesten Beispiele für diese massiven Umverteilungen.
Aber wir nehmen es nicht nur von der „Kultur“ im engeren, ätherischen und affektierten bürgerlichen Sinne. Die Wirtschaft ist inzwischen einer Rube-Goldberg-Maschinerie vergleichbar, die mit maximalem Aufwand ein minimales Ergebnis produziert, in unserem Falle das, Arbeitsplätze „herzustellen“. Da aber ständig Arbeitsplätze abgebaut werden (wenn durch sonst nichts, dann durch die Automatisierung), müssen dauernd neue Arbeitsplätze aus der großen Schütte dieser Maschinerie purzeln. Aber die Antriebsmaschine ist gefräßig. Um den Dampfdruck so hoch wie möglich zu halten, greifen wir nach allem, was uns in die Hände fällt, und befeuern damit den Kessel. Und das ist der Skandal: Metaphorisch gesprochen, verbrennen wir alte Familiengemälde, wertvolle Möbel und sogar unsere Geigen. Dieses frenetische Verbrennen hat inzwischen einen Punkt erreicht, an dem immer mehr gehetzte Menschen nur noch lapidar sagen können: „Wir haben kein Leben mehr.“
Der von den gigantischen vereinten Kräften der sich ausbreitenden Automatisierung und Globalisierung erzeugte Druck senkt aber nicht nur das Niveau des Lebensstandards der „Arbeiterklasse“. Nein, die Kraft dieses Drucks hat auch, zum Beispiel, das Leben der Ärzteschaft völlig verändert – denken Sie daran, dass Krankenhäuser und viele andere Bereiche der Medizin zu Unternehmen umgewandelt wurden, die Gewinne erwirtschaften müssen –, und das trifft auch auf viele andere „angesehene“ Berufsgruppen zu. Dies ist in der Tat eine der deutlichen Konsequenzen der zunehmenden Dominanz der Wirtschaft: Bereiche, die früher nicht nach rein finanziellen Gesichtspunkten gehandhabt wurden, sind von der Wirtschaft erobert und ihrem Herrschaftsbereich einverleibt worden.
Der gleiche Druck hatte auch im Bereich der Dienstleistungen niederschmetternde Wirkungen. Sozialarbeiter, um nur ein Beispiel zu nehmen, leiden unter einer total altmodischen „Beschleunigung“– mehr Fälle in weniger Zeit – und werden zudem immer stärker reglementiert. Das Resultat? Der einzigartige Wert, den diese Arbeit früher besaß und der untrennbar mit persönlicher Zuwendung und persönlichem Engagement verbunden war, wurde weitgehend ausgehöhlt. Der Druck hat das Menschliche aus der Arbeit der Sozialarbeiter herausgepresst, hat sie trocken, bürokratisch und nahezu sinnlos gemacht.
Die jüngsten Rückschläge der ökologischen Bewegung kann man natürlich auch als Konsequenz ebendieser Dynamik verstehen. Die Beziehung zwischen der Vielfalt der ökologischen Belange und der Kopplung Business-Arbeitsplätze wird bereits umrissen, wenn man nur die Begriffe „Nötigung“, „Erpressung“, „Ultimatum“ und „Daumenschraube“ hintereinander stellt. Das ist in unserer Welt eines der erprobtesten und wohlfeilsten Handlungsmuster. Um welche Sache es dabei auch geht, sei es die Qualität der Luft oder des Wassers, die Bewahrung der Schönheit eines Tales oder Strandes – früher oder später kollidieren all diese Kampagnen mit irgendeinem Aspekt des Wirtschaftssystems, und dann wird uns schnell und kalt das Entweder-oder serviert: „Beharrt nur auf eurem Wasser oder eurer Luft. Dann lagern wir unsere Produktion einfach in Gebiete aus, wo die Lohnkosten niedriger sind, in die Ukraine oder nach Brasilien.“ Weil das brennende Verlangen nach Arbeitsplätzen immer dringender wird, wächst die Macht dieses Instruments. Das ist einer der Gründe für die lange Reihe der Niederlagen und Rückschläge, die die ökologische Bewegung in den letzten Jahren erleiden musste.
Dies ist ganz offensichtlich dieselbe monotone Wiederholung ein und desselben Musters. In der Tat wurde dieses Muster so durchgängig wiederholt, dass die Qualität der Politik sich im Laufe der Jahre grundlegend verändert hat. Politiker machen Versprechungen, das liegt nun einmal in der Natur ihres Berufsstandes: Sie werden das Los der großen Mehrheit, die ins Hintertreffen geraten ist, verbessern; sie werden die allgemein bekannten Trends hin zu größerer Ungleichheit, hin zu mehr Arbeit für weniger Lohn, hin zu was auch immer umkehren. Und natürlich wecken diese Versprechungen Hoffnungen und mobilisieren eine Wählerschaft. Aber wieder und wieder erweisen sich diese Versprechungen als reine Show, als bloßes Lippenbekenntnis. Sobald es zum Konflikt kommt, sobald der Kampf Form annimmt und man über das Stadium der Gesten und der Rhetorik hinaus ist, setzt sich der altbekannte Mechanismus durch. Es wird klar, dass die Einhaltung des Versprechens, alles Mögliche zu ändern, die künftige Schaffung von Arbeitsplätzen gefährden würde.
An diesem Punkt geschehen nun zwei Dinge gleichzeitig: Einerseits werden die Politiker kleinlauter, sie rudern zurück, ihr Standpunkt wird um einiges kompromissbereiter, sanfter, zahnloser. Aber auch wir selbst werden unsicher, wir kommen ins Schwanken, und zumeist schwören wir dann unseren früheren Zielen ab und ändern den Kurs.
Das hat zur Folge, dass man es gar nicht mehr zu einem echten Kon-flikt kommen lässt. Es gibt keine echten Verhandlungen mehr, kein echtes Entgegenkommen, keine echten Kompromisse, bei denen verschiedene Parteien angemessen berücksichtigt werden. Nichts dergleichen. Stattdessen werden für kurze Zeit die wachsenden Ängste besänftigt, ein bisschen Ruhe breitet sich aus, es gibt vage Zeichen der Hoffnung, eine etwas bessere Stimmung.
Um zu unserem Bild des Zuges zurückzukehren: Inzwischen haben wir unter Schmerzen gelernt, dass unsere Politiker, ganz gleich, was sie uns versprechen, niemals den Kurs des Zuges ändern werden. Wir haben in der Tat schon längst ein fortgeschritteneres und noch beängstigenderes Stadium erreicht. Und die Politiker sprechen längst nicht mehr über den Zug oder darüber, wohin er steuert, oder was irgendjemand tun könnte, um ihn anzuhalten oder wenigstens abzubremsen. Sie sprechen die drohende Situation überhaupt nicht mehr an. Sie erwähnen mit keinem Wort eine fundamentale Tatsache: nämlich dass es früher Alternativen gegeben hat und dass diese verschwunden sind. Die Politiker sind genauso hilflos wie wir. Deshalb haben wir begonnen, sie anders zu sehen. Sie erfüllen ihre frühere Funktion nicht mehr, und so haben wir ihnen eine andere Rolle zugeteilt. Sie wurden degradiert und zu Schlafwagenschaffnern gemacht: Sie klopfen an die Türen der Abteile und bieten uns Kopfkissen an, einige sind rot, andere sind schwarz, wieder andere sind grün. Ein wenig Bequemlichkeit, damit wir ein Nickerchen machen können, ein sanftes Liedchen für diese oder jene Gruppe, die sich auf die Zehen getreten fühlt, ein paar einlullende Worte, damit jedermann im Zug einigermaßen ruhig bleibt. Das ist alles, was von der Politik übrig geblieben ist.
In vielen der Kasperletheaterstücke, die ich als Kind gesehen habe, lauerte das große Krokodil mit seinen Reißzähnen direkt hinter Kasperles Rücken. Alle Kinder sahen das große Krokodil natürlich ganz deutlich, aber aus irgendeinem seltsamen Grund bemerkte Kasperle es einfach nicht. Ganz gleich, wie laut die Kinder schrieen, ganz gleich, wie oft sie ihn warnten, dass es mit weit aufgerissenem Maul direkt hinter im lauere, Kasperle schaute einfach verwundert drein und war ständig abgelenkt durch alle möglichen zufälligen Ereignisse. Dass unsere Politiker wie Kasperle sind und wir wie die kleinen Kinder, kann wohl leicht erraten werden.
Aber im Ende steckt die Lektion: Die Kinder blieben immer bis zum Schluss der Vorstellung. Doch viele von uns haben dieses Kasperletheater schon vor langer Zeit verlassen; es war ermüdend und langweilig geworden. (Wenn Sie wissen wollen, wie langweilig, dann brauchen Sie sich nur die Prozentzahlen der Wahlbeteiligung in den Vereinigten Staaten anzusehen.)
Die Selbstverstümmelung geht weiter
Der Film City of God zeigt das Leben junger Straßenkinder in einer der Favelas von Brasilien. In einer Szene verlangt der 14-jährige Führer einer Gang von einem Achtjährigen, der in die Gang aufgenommen werden will, er müsse erst beweisen, „aus welchem Holz er geschnitzt sei“. Die dem Jungen zugewiesene Probe ist, dass er aus nächster Nähe eines der beiden ebenfalls wartenden Kinder erschießen soll. Nachdem er einige Augenblicke gezögert hat, hört man den Schuss widerhallen.
Wie funktioniert die Kopplung von Business und Arbeitsplätzen in der Dritten Welt? Was sind die Auswirkungen, die der enorme Zuwachs der Macht im Wirtschaftssektor auf diese zwei Drittel des Erdballs hat? Der Vergleich ist nicht nur so düster wie die beschriebene Filmszene, er ist auch sehr lehrreich. Es ist schwierig, die wahre Natur der Kräfte, die in diesem Jahrzehnt die Welt gestalten und umgestalten, zu verstehen, wenn man sie nur vom geschützten Standpunkt unserer eigenen Welt aus betrachtet. Vieles von dem, was wir hier nur durch einen Nebel sehen, als Schatten und Andeutungen, wird in einem dieser völlig anderen Länder unmissverständlich klar.
Dort ist alles noch unvergleichlich viel schlechter. Und die Gründe dafür springen geradezu ins Auge. Einmal, weil die Arbeitslosigkeit fünf-, acht- oder zehnmal größer ist als bei uns. Wenn wir schon in Lumpen gehen und den Schlüssel zu unserer Stadt um den Hals hängen haben, weil wir so verzweifelt nach Arbeitsplätzen suchen, was sollen dann erst die Völker Afrikas oder Indiens oder von irgendeinem anderen von 50 nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Ländern der Dritten Welt tun? Sollen sie nackt kommen und auf den Knien rutschen?
Sie stehen natürlich im Wettbewerb mit uns, und das sollte man zu den Schlaglichtern hinzufügen, die deutlich machen, wie sich die neue und immer größere Macht der Wirtschaft manifestiert. Auch ohne ausgeprägtes Talent für theatralische Inszenierungen kann man sich doch leicht eine Szene ausmalen, in der zwei Vertreter der verschiedenen Bevölkerungsgruppen – vielleicht einer aus einem netten Städtchen irgendwo in den östlichen Bundesländern und der andere aus einem Slum, in dem ein Achtjähriger bereit ist zu töten, um in eine Gang aufgenommen zu werden – ihren Fall vor einem nur halb hinhörenden Geschäftsmann vertreten: Welche Infrastruktur haben Sie zu bieten? Wie fähig und wie gut ausgebildet sind die Leute, die auf Zeitungspapier auf der Straße schlafen? Wie viele Jahre haben die meisten von ihnen eine Schule besucht? Wie vertraut sind sie mit der neuesten Version von Word oder Windows? Und dann noch eine und keineswegs die unwichtigste Frage an den da, den Mann aus Ghana: Wie viel werden Sie uns zahlen, wenn wir uns entschließen, in Ihr Land zu kommen?
Und doch versuchen alle Regierungen aus jedem dieser Länder genau das zu tun – zu zahlen. Es ist erschütternd! Sie haben Massen von Menschen, die arbeitslos sind und in Slums leben, und sie bitten und betteln vor den Toren der Wirtschaft, sie möge doch kommen und sich auf ihrem Territorium ansiedeln, genauso wie wir das zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern tun oder eben zwischen Niedersachsen und Michigan. Ich selbst kenne eine ganze Menge Politiker in den Regierungen einiger Dritte-Welt-Länder, und ich weiß, dass viele von ihnen korrupt sind. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass auch nur ein einziger von ihnen nicht im Innersten seines Herzens weiß, dass dieser spezielle Wettbewerb der helle Wahnsinn ist, eine grauenvolle Monstrosität. Aber der springende Punkt ist natürlich, dass sie es nichtsdestoweniger tun, und natürlich aus dem einen allerbesten und zwingendsten Grund: Weil es keine Alternative gibt. Weil man sich gar nichts anderes vorstellen kann. Weil Entwicklung bedeutet, Arbeitsplätze zu schaffen, und das ist ja nun einmal ohne jeden Zweifel klar: Arbeitsplätze kommen vom Business und sonst von nirgendwoher.
Wenn ich von einer Fahrt in einem Zug mit verriegelten Türen spreche – ich vermute, diese Regierungen wissen genau, was ich damit meine.
Nehmen wir Südafrika als Beispiel. Über viele Jahre hat das südafrikanische Volk eine Revolution vorangetrieben, die der größte Teil der Welt mit atemloser Spannung verfolgt hat. Es war eine außerordentlich linke Revolution, auch wenn viele Menschen in den Vereinigten Staaten und in Europa lieber nicht wissen wollen, wie eng die Bande zwischen Nelson Mandela und dem Kommunismus in diesen Jahren waren. Es war auch ganz und gar eine schwarze Revolution. Und sie war vor allem siegreich! Und trotz all dem – welchen Kurs hat die schwarze Regierung seit 1994 verfolgt? Jedermann weiß es: Nach einigem anfänglichen Widerstand war es bis ins Detail derselbe Pfad, immer wieder wurde dem Business schöngetan, um es, hoffentlich, ins Land zu holen.
Es ist bittere Ironie, dass sich gerade die Situation der schwarzen Bevölkerung seit dem Sieg der Revolution und der Wahl einer vorwiegend schwarzen Regierung in vieler Hinsicht verschlechtert hat. Die Arbeitslosigkeit hat rasant zugenommen und damit natürlich Gewalt und Kriminalität. Die Versorgung mit Wasser und Strom ist teurer geworden und die sozialen Einrichtungen wurden reduziert. Es ist heute durchaus nichts Ungewöhnliches, wenn einem ein schwarzer Taxifahrer sagt, dass er lieber wieder in der Zeit der Apartheid leben würde. In diesem Sinne teilt Südafrika sein Los ganz und gar mit der großen Mehrzahl der Länder der Dritten Welt. Es mag sich für unsere Ohren schockierend anhören, aber viele Menschen, die auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion leben, sprechen von der Ära Breschnews als der „guten alten Zeit“. Warum? „Weil die Fleischer damals noch Würste im Fenster hatten und jeder Arbeit hatte.“ An dieser Stelle möchte ich einfügen, dass der Begriff „Dritte Welt“, klassisch als die Summe aller wirtschaftlich und sozial unterentwickelten Länder definiert, heute weiter gefasst werden muss: inzwischen sind unter dem Aspekt der Verelendung auch ehemalige Sowjetstaaten, aber ebenso die Armenviertel amerikanischer Metropolen, etwa in Detroit oder in Los Angeles, als Dritte Welt aufzufassen.
Der erschreckende Abstieg, zu dem es während der vergangenen 15 Jahre in zwei Dritteln der Welt gekommen ist, lehrt uns etwas ganz Wesentliches. Natürlich war die Politik, die diese Länder übernommen haben, falsch. In jedem einzelnen dieser Länder hat sie den Graben zwischen Arm und Reich nur noch weiter vertieft. Und da die Armen bereits zahlreich und sehr arm waren, bevor dieser Niedergang begann, ist ihre Situation heute katastrophal. Und auch in dieser Entwicklung liegt eine Ironie verborgen. Viele machen die Weltbank und den Weltwährungsfonds (IWF) für Aspekte dieses Niedergangs verantwortlich. Und zweifellos hat der IWF in vielen Situationen herrisch reagiert und Regierungen eine Wirtschaftspolitik aufgezwungen, die nach dem Geschmack Washingtons war. Und auch die Weltbank hat sich oft wie ein skrupelloser Kredithai verhalten. Wenn schmierige Pfandleiher in den Armenvierteln der amerikanischen Großstädte praktiziert hätten, was die Weltbank ihnen viele Male vorgemacht hat, wären sie ins Gefängnis gewandert.
Trotz allem: Es wäre falsch, sich einzubilden, dass die Weltbank und der IWF für das Desaster, das inzwischen herrscht, verantwortlich wären. Es ist sinnlos, ihnen dafür die Schuld zu geben, außer natürlich für ihr Timing und den starren Dogmatismus, mit dem sie einigen Ländern die „Privatisierung“ aufgezwungen haben – die frühere Sowjetunion ist vielleicht das beste Beispiel hierfür. Die wahre Verantwortung und die wahre Schuld liegen anderswo. Nämlich im Fehlen irgendeiner denkbaren Alternative. Mit oder ohne IWF und Weltbank wären all diese Länder schließlich doch in der Kopplung Business-Arbeitsplätze gefangen gewesen. Mit oder ohne das zusätzliche Drängen des IWF und der Weltbank hätten sie doch alle verzweifelt versucht, den Dünger zu finden, der ihnen eine Rekordernte an Arbeitsplätzen versprochen hätte. Dieses Ziel war der zwingende Grund für die Politik, die sie gemacht haben. Deshalb sind sie vor dem Big Business zu Kreuze gekrochen, auch wenn das die Mittel verschlungen hat, die sie gebraucht hätten, um den im Elend Lebenden zu helfen.
Ich habe nun auf verschiedene Weise betont, dass das massivste und alles andere überschattende Charakteristikum unseres Systems die Tatsache ist, dass es uns immer tiefer in eine Polarisierung hineinzieht: die Polarisierung zwischen den immer weniger werdenden Menschen, die ständig reicher werden, und den unvermindert anwachsenden Massen, die in immer schlimmerem Elend leben. Die Gesamtzahl der Menschen, die bereits in Slums leben, sowie derer, die aus fast allen ländlichen Gegenden der Dritten Welt in die Slums abwandern, ist unüberschaubar geworden. Wahrscheinlich hat nur eine ganz kleine Minderheit von uns eine in etwa zutreffende Vorstellung von der Größenordnung, in der sich die Zahl aller Slumbewohner auf unserem Globus bewegt. Aber die unglaublich große Zahl wäre für uns wahrscheinlich nicht mehr als eine dieser vielen leeren Zahlen, die in den Abendnachrichten an uns vorüberziehen.
Vielleicht werden wir schon etwas mehr von der Tatsache berührt, dass praktisch jede Stadt in der Dritten Welt – ob es nun Kiew oder Moskau ist, Kalkutta oder Bombay, Johannesburg oder Kairo – sowohl eine Stadt als auch ein Slum ist. Und der Slum-Teil dieser Städte wächst ständig; er bedeckt viele Quadratkilometer, auf denen die Menschen leben wie Flüchtlinge, beengt, zusammengekauert, mit einem Stück Plastikplane als Dach und oft nur mit einem Minimum an Wasser und mit hygienischen Verhältnissen, die ich gar nicht erst beschreiben will.
Dass diese Zustände zu einem Charakteristikum unserer Jetztzeit geworden sind – vielleicht weckt uns das ein wenig auf. Wie es dort wirklich zugeht, das kann uns wahrscheinlich kein Bericht und kein Film vermitteln. Es gibt wohl keinen anderen Weg, das zu begreifen, als einmal eine längere Zeit in einem Slum zu leben, und zwar nicht nur für drei Tage mit einem Fremdenführer, sondern in jeder Hinsicht genauso zu leben wie ein Slumbewohner.
Eine einzige, ausgewählte Statistik möchte ich hier heranziehen. Experten haben grob geschätzt, dass zurzeit etwa zwei Milliarden Menschen in einem städtischen Raum leben und etwa zwei Drittel dieser Menschen bitterarm sind. Schätzungen dieser Art sind bekanntermaßen sehr problematisch, aber das spielt für das, was ich hier bezwecke, keine Rolle: Ob diese Zahl nun der Wahrheit sehr oder nur in etwa nahe kommt, angesichts dieser Größenordnung glaubt praktisch niemand mehr daran, dass diese Zustände mit der einen und einzigen Tunnelstrategie, die wir bisher verfolgt haben, beseitigt werden können. Ganz gleich, wie willfährig unsere Verbeugungen vor den Wirtschaftsbossen auch werden, ganz gleich, wie viele Opfergaben wir auf die Altäre ihrer Vorstandstische häufen, das Wachstum der Wirtschaft und die dadurch erreichbare Zunahme von Arbeitsplätzen kann kein Gegenmittel für ein Problem dieses Ausmaßes sein.
Wenn wir dieses Ausmaß, diese Größenordnung wenigstens ansatzweise zu erfassen vermögen, dann können wir uns die nächsten Entwicklungsschritte dessen vorstellen, was bis jetzt noch „Terrorismus“ genannt wird. Die Frage, die jetzt zu stellen ist, lautet folgendermaßen: Wenn die Existenz des Terrorismus, wie wohl kaum noch zu leugnen ist, zu unserer Zeit eine Tatsache ist, was wird dann die Wechselwirkung zwischen den beiden weltumspannenden Phänomenen Elend und Terrorismus sein? Deutlicher gesagt: Wie wird der Terrorismus die weitere Entwicklung des Elends und der Slums beeinflussen? Und umgekehrt: Auf welche Weise werden die brodelnden und sich ausbreitenden Slums die nächste Phase der Entwicklung des Terrorismus beeinflussen? Jeder, der das Leben in den Slums der Dritten Welt kennt, kann nur staunen darüber, wie friedlich, wie geduldig und wie leidensfähig die große Masse von Menschenwesen bisher gewesen ist.
Für alle, die die Slums aus eigener Erfahrung kennen, ist kaum zu übersehen, dass der Terrorismus vielleicht der erste, längst fällige Aufschrei ist – ein lange hinausgezögertes wütendes, ja rasendes Umsich-Schlagen, das keinen Regeln gehorcht und natürlich auch nicht den „Regeln des Krieges“. Die Armut aber wird immer noch größere Bevölkerungsschichten erfassen – nicht, weil es unvermeidlich oder vom Schicksal so beschieden wäre, sondern weil all dies in der Gewalt der alles niederwalzenden Maschinerie der Kopplung von Business und Arbeitsplätzen liegt.
Die Ausbreitung des Terrorismus ist im Grunde eine Frage des Inkubationsraums – der räumlichen Nähe, der Geographie. Wenn die Häufigkeit, Heftigkeit und Allgegenwärtigkeit terroristischer Angriffe zunimmt, werden viele von ihnen höchstwahrscheinlich in der Nähe von Slums stattfinden. Das wird unweigerlich eine Reihe von Schutz- und Verteidigungsmaßnahmen nach sich ziehen, und es wird Repressionen gegen die Slumbewohner geben, und zwar gegen die Schuldigen wie gegen die Unschuldigen. Seit September 2001 haben wir dieses Muster nur allzu häufig in Aktion gesehen.
Früher oder später wird dies die Zahl der potentiellen Terroristen vergrößern. Die schreckliche Geschichte des Kampfes zwischen Israelis und Palästinensern ist eine didaktische Demonstration wie aus dem Lehrbuch für die Logik dieser Eskalation, die wir noch an vielen anderen Orten beobachten werden. Ein Teil davon ist schlicht und einfach eine verständliche „Auge um Auge“-Reaktion.
Die erstaunliche, tief deprimierte, ja beinahe katatonische Passivität typischer Slumbewohner hat aber zweifellos Grenzen. Genug Gewalt und eine unnachgiebige Unterdrückung werden diese Menschen irgendwann so tief hinabgestoßen haben, dass es zu einer Gegenreaktion kommt. Für diese Reaktion gibt es inzwischen wohlerprobte Modelle. Sie wurde in Zeitungen und Fernsehsendungen unzählige Male analysiert und erklärt. Jeder weiß heute bis ins Detail, was zu tun wäre, und mit genügend Provokation wird er es schließlich auch tun.
Ein anderes Element ist so alt wie die Psychologie der Sünde: Wenn ich behandelt werde, als hätte ich das Verbrechen bereits begangen, obwohl ich doch tatsächlich noch unschuldig bin, dann wäre ich doch hirnverbrannt, wenn ich nicht zuschlagen würde. Ich muss ja bereits büßen, also könnte ich genauso gut in vollen Zügen sündigen. Warum also nicht Terrorist werden, wenn die Reichen bereits begonnen haben, uns so zu behandeln, als wären wir welche?
Sollte der Terrorismus sich tatsächlich auf diese Weise ausbreiten, sollten allmählich immer mehr kriegerische Handlungen ihren Ursprung in den Slums haben (und zu einem großen Ausmaß ist das ja bereits der Fall), dann werden Al-Kaida und andere klar umrissene terroristische Vereinigungen verblassen und in den Hintergrund treten. In den Vereinigten Staaten wird dies eine immer noch sehr weit verbreitete Ansicht unterminieren. Aus vielerlei Gründen herrscht hier noch immer die emotional begründete Meinung vor, dass einige „saubere“, „chirurgische“ Militärschläge ausreichen werden, um dieses Problem in den Griff zu bekommen – dass dieser Konflikt im Wesentlichen auf Distanz gehalten werden kann und für die Amerikaner, ähnlich wie die letzten Kriege, die sie geführt haben, ein „fernes“ Ereignis darstellen wird.
In Amerika wird man auf diese atemberaubende Überheblichkeit in wenigen Jahren als auf einen Pegelhöchststand zurückblicken, als sprechendes Beispiel dafür, wie katastrophal verblendet man war. Diese Arroganz wird sich nur schrittweise verringern und abschleifen. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass es an vielen verschiedenen Orten viele terroristische Anschläge geben wird, und allmählich werden sie so allgegenwärtig werden, dass wir endlich erkennen müssen, dass es keine wirksame Verteidigung gegen sie gibt. Unser Leben wird allmählich dem in Israel gleichen; niemand wird sich mehr sicher fühlen können, wenn er einkaufen geht. Eltern wird die Angst ins Gesicht geschrieben sein, wenn sie ihre Kinder in die Schule schicken. Man wird auf die Straße treten, um einen Platz zu überqueren, und auf der anderen Seite nicht ankommen.
Nach und nach werden wir begreifen, dass der Irakkrieg nur ein Scharmützel war, und widerwillig werden wir schließlich eingestehen müssen, wer in diesen Kampf wirklich unser Feind ist und wie groß die Zahl derer ist, die uns inzwischen „hassen“. Stück für Stück wird unser Bild der gesamten Gestalt sich verändern, bis wir endlich der Tatsache ins Gesicht sehen, dass wir uns in der ersten Phase eines längst überfälligen großen Krieges befinden, des ersten wirklichen „Weltkrieges“, in dem die elenden Massen, die vier Fünftel der Weltbevölkerung ausmachen, den sinnlos und absurd Reichen gegenüberstehen.
Wir wollen diesem Bild noch einige Pinselstriche hinzufügen: Die meisten von uns haben Filme gesehen oder Bücher gelesen, in denen jene Gefilde, in die der verriegelte Zug hineinfährt, detailliert beschrieben werden. Gehen wir weiter in die Richtung, in die wir uns heute bewegen, dann wird der Abgrund, der die Armen von den Reichen trennt, noch sehr viel tiefer und breiter werden. Es ist gut möglich, dass die meisten Reichen in zehn oder 15 Jahren in „Schutzzonen“ leben werden – in einigen Ländern und US-Bundesstaaten existieren solche Gemeinschaften ja bereits. Diese Schutzzonen werden aussehen wie Festungen. Sie werden umgeben sein von hohen Betonmauern, die von Spiralen elektrisch geladenen Stacheldrahts gekrönt sind. Überwachungskameras werden an allen möglichen Orten, wo man sie nicht erwartet, die Umgebung abtasten. Die Kinder werden in gepanzerten Bussen in die Schule fahren und ihren Eltern durch schussfeste Fenster zuwinken. Das Alltagsleben der Reichen wird gezwungenermaßen sehr diszipliniert und eingeschränkt sein – in vieler Hinsicht wie das Leben von Militärs. Es wird ein Leben sein wie in Kasernen – nur dass diese Kasernen Swimmingpools haben.
Auch die andere Seite ist vorhersehbar: Auch dafür existieren heute bereits Modelle. Die Armut wird noch schlimmer sein, und die Zahl der im Elend Lebenden wird sehr viel größer sein als heute. Wird die Abwärtsentwicklung aller sozialen Einrichtungen und Sicherheitsnetze weitergehen, dann werden die Slums, Lager, Barrios und Favelas der Armen immer mehr anwachsen. Sie werden sich über viele Quadratkilometer erstrecken. Nur noch wenige Menschen werden in einer ländlichen Umgebung leben, und die Reichen werden sich in von den Armen abgetrennte Lebensräume zurückgezogen haben. Viele von uns haben sicher schon Berichte gesehen, wie das Leben in den Slums aussieht; es fällt also nicht schwer, sich noch weitere Bilder vorzustellen. Einige Bereiche mögen stark den Leprakolonien des Mittelalters ähneln, andere sehen vielleicht eher aus wie die Lager von Guerillakriegern, wie wir sie aus Vietnam, dem Irak, aus Osttimor, Afghanistan oder Palästina kennen.
Die Trennung, die zweigleisige Kultur, die wir heute nur als einen moralischen Skandal betrachten, wird ein anderes Gesicht haben: kleine befestigte Enklaven, von einem endlosen Meer elender und hoffnungsloser Kämpfer umgeben, die bereit sind, bis zum letzten Blutstropfen, nein, bis zum Selbstmord zu kämpfen. Das Leben wird zu einem hysterischen Kampf ums Überleben, auch für die Reichen, und sowohl die Armen wie die Reichen werden in einer Umgebung leben, die einem großen Schlachthaus gleicht.
Ja, der Zug fährt in Richtung Jerusalem. Nicht in das Jerusalem, das es einmal gab, sondern in die Stadt, zu der Jerusalem während der letzten 20 Jahre geworden ist. Im Rückblick werden wir erkennen, dass Jerusalem eine prophetische Rolle gespielt hat: Das Leben, wie es damals dort aussah – mit Bomben, die in Diskotheken und Restaurants explodierten –, war ein Vorbote dessen, was uns allen bevorstand. Der verriegelte Zug, in dem wir alle zu sitzen scheinen, prallt vielleicht nicht gegen eine Felswand oder stürzt nicht von einer Brücke. Der Zug hält vielleicht einfach an und die Schaffner rufen: „Endstation! Dieser Zug endet hier! Jerusalem!“
Natürlich stellt sich uns nun die Frage: Muss es dazu kommen? Werden wir unweigerlich in die Richtung weitergehen, die wir bisher eingeschlagen haben? Oder gibt es eine Alternative, eine andere Möglichkeit?
Wir sind von der Metapher ausgegangen, dass viele Menschen den Zustand unserer Kultur wie einen Zug mit verriegelten Türen und Fenstern erfahren. Es gibt nur eine Bahn, eine Richtung, ein Ziel. Im Folgenden werde ich den Versuch unternehmen, eine andere Möglichkeit zu entwickeln. In dieser anderen Metapher sind wir dabei, eine sehr lange und breite Verzweigung zu durchlaufen, etwas wie das Mississippidelta. Es gibt nicht nur einen entscheidenden Moment, ein rasches und endgültiges Entweder-oder. Stattdessen sucht unsere Kultur sich ihren Weg in der Spannung zwischen zwei Polen, zwei Alternativen. Sie tut dies schon seit einiger Zeit, und so wird es auch noch einige Jahre weitergehen. Zwischen den beiden Wegen besteht ein Kraftfeld. Wir durchqueren Strömungen, die uns bald in die eine, bald in die andere Richtung ziehen und treiben. Welchen dieser beiden Wege unsere Kultur schließlich einschlagen wird, ist noch offen. Beide sind möglich. Viel hängt davon ab, welche Entscheidungen wir selbst treffen und wie wir uns verhalten werden.
Wir wissen, dass es uns nichts nützt, für die Wirtschaftsbosse immer breitere rote Teppiche auszurollen, sie hektisch herumrennend zu hätscheln und zu verwöhnen. Wir haben das mühsam gelernt. Wir wissen auch, dass das im Grunde sogar eine destruktive Strategie ist. Warum küssen wir ihnen dann weiter die Füße? Letztlich aus einem einzigen, alles überragenden und entscheidenden Grund: Es gibt keine Alternative! Wir haben nicht die leiseste Ahnung, was wir sonst tun könnten! Wir sind wie paralysiert. So ist der Zustand nach dem Kalten Krieg. Diesen Zustand zu beenden, das ist das Ziel der NEUEN ARBEIT – zu zeigen, dass es tatsächlich eine Alternative gibt, und diesen Weg so sichtbar zu machen wie ein Rollfeld aus Licht.