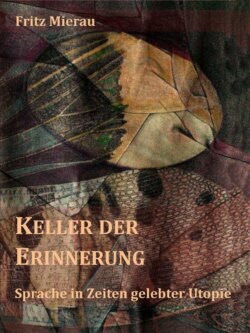Читать книгу Keller der Erinnerung - Fritz Mierau - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„Ja, blutrotes Traumpferd, erscheine!“
ОглавлениеSergej Jessenin war und blieb eine russische Kultfigur
Dieser sanfte Jüngling mit dem strohblonden Haar, der aus einem unbekannten mittelrussischen Dorf aufgebrochen war, um in Petersburg Karriere zu machen und der beste Dichter des modernen Rußlands zu werden, der russische Bauernjunge, der eine weltberühmte amerikanische Tänzerin eroberte und mit ihr Europa und die USA bereiste, und sich, zurückgekehrt, in der Stadt seines spektakulären Beginns mit 30 das Leben nahm, bot den Stoff zum Kult.
Ein Dorfrüpel, der im Ton der mystisch-orgiastischen Hymnenpoesie der russischen Sekten sang, ein naiver Naturmensch mit tragischem Größenwahn, der Mann aus dem Märchen und aus der Skandalchronik, Verkörperung eines Mythos in der Banalität.
Die sowjetische Kulturpolitik hat dagegen anzugehen versucht, indem sie von Jesseninstschina sprach und damit die Nachahmung seines Lebens auf der untersten Stufe von Suff und Rowdytum brandmarkte. 1935 hatte Stalin Majakowski zum besten Dichter erheben wollen. Alles umsonst. Es gibt heute in Rußland Dutzende von größeren und kleineren Jessenin-Museen und Sammlerklubs. Es gab Jessenin-Bräute und Jessenin-Witwenkreise. Aber Jessenin wurde schon in den Kanon der sowjetischen Literaturgeschichte aufgenommen, als von Anna Achmatowa, Ossip Mandelstam kaum geredet werden durfte, geschweige denn von Nikolai Gumiljow oder Maximilian Woloschin.
Für mich war Sergej Jessenin von vornherein weniger eine Erscheinung der russischen Literaturgeschichte als vielmehr meines Existenzbezugs. Das erste, was ich über ihn erfuhr, stammt von Ilja Ehrenburg. Etwa 1955 las ich in der damals bedeutendsten europäischen Kulturzeitung Die literarische Welt den Nachruf Ehrenburgs auf Sergej Jessenin und darin den Satz: „Wo, wenn nicht in Rußland, mußte dieses Todeslied der unermeßlichen Äcker und Wiesen ertönen?“ Nicht, daß ich je Bauer gewesen wäre, aber die sächsischen Äcker und Wiesen sind mein Ausgang gewesen.
Und so hat es über die 55 Jahre viele Versuche gegeben, mich diesem Menschen zu nähern.
‒ Reise 1965 Jessenins Geburtsort Konstantinowo verpaßt – nur bis Rjasan gekommen.
‒ Leningrad 1966 Alexander Lohmann schenkt mir eine Jessenin-Ausgabe von 1916.
‒ In Moskau im Hotel gewohnt, wo auch Jessenin einst logierte.
‒ In Baku die Stelle aufgesucht, wo „Ersatz-Persien“ für Jessenin eingerichtet war.
‒ 1973 „Pugatschow“-Inszenierung in Moskau erlebt.
‒ Brief an Höpcke zu Gunsten des Sängers Biermann.
‒ Jessenin-Dissertation abgebrochen, dafür Aufsätze, Biographie 1992
Ja, blutrotes Traumpferd, erscheine!
Ja, blutrotes Traumpferd, erscheine!
In die Gabeldeichsel der Welt
eingespannt!
Streu über pazifische Ferne
dein Wiehern.
Greif als Kummet den Regenbogen,
den Polarkreis als Sattelschnur.
Dann los! die Erde gezogen
auf eine andere Tour!
Deutsch von Adolf Endler
Ihr Moskauer Café nannten Jessenin und seine Freunde Pegasus-Stall – Stojlo Pegasa. Das Café befand sich mitten in Moskau auf der Twerskaja, der alten nordwestlichen Magistrale, die ein paar Jahrzehnte Gorki-Straße hieß. Damals Haus 37, nach dem klassizistischen Neubau in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts etwa Haus 7 in der Nähe des Hotels Zentral, zu Jessenins Zeiten das Hotel Lux der Parteielite und der Gäste der Kommunistischen Internationale.
Der Name Pegasus-Stall war Programm. Die russischen Künstlercafés hießen Domino, Pittoresque, Streunender Hund, Komödiantenstadel, Zerrspiegel oder Blauer Vogel und höchstens (so in Charkow) CHLAM – Gerümpel, was aber eine Abkürzung der russischen Wörter für Maler, Literaten, Schauspieler, Musiker war.
Auch der Pegasus-Stall, ein nach dem letzten Schrei russischer Vorkriegsmode prächtig eingerichtetes winziges Etablissement, hatte nach dem bisherigen Betreiber, einem Exzentriker, dem berühmten Musikalclown Bim-Bom, Bom geheißen. Pegasus-Stall war nun zugleich anspruchsvoller und exzentrischer. Anspruchsvoller, weil mit dem geflügelten Pferd das alte göttliche Sinnbild der Dichtkunst ins Spiel kam und auf einem Eingangstableau in den Himmel auffuhr.
Exzentrischer, weil die avantgardistischen Musensöhne nicht nur ausschweifend der Pferdesymbolik huldigten, sondern sich selber in den verschiedenen Pferderassen erkannt fanden, und mit Stall ein Sesshaft-Leiblich-Ländliches in die Stadt versetzt war.
Einer war ein eleganter Traber, einer ein Hunter, Typ englisches Jagdpferd. Jessenin galt als eine Wjatka, zärtlich Wjatotschka, eines von jener schönen ausdauernden Rasse vom Wjatkafluß nördlich des mittleren Wolgagebiets. Ironisch beschrieben Zeitgenossen die Dichtersitten des Pegasus-Stalls: Nüstern gebläht, Ohren nervös gedreht, mit dem Schweif gewedelt. Eigentlich, meinte ein Kritiker, sei Pegasus aber viel zu langsam für die anbrechende Epoche: „Das Pferd der Dichter von heute ist nicht Pegasus, sondern die Zeit, geschmiedet in den Panzer Al-Baraks, des Pferds, auf dem Mohammed seine Himmelfahrt vollbrachte.“ Gemeint war das Silberpferd des Erzengels Gabriel, auf welchem Mohammed in einer Nacht von Mekka nach Jerusalem, von dort durch alle sieben Himmel zurück nach Mekka ritt – so schnell, daß ein Wasserkrug, den er bei der Abreise umgestoßen hatte, noch nicht ausgelaufen war, als er zurückkehrte.
Für Jessenin war das Pferd nicht zuerst das dressierte Reit-, Renn- oder Kutschpferd. Reiterpoesie wie bei Hofmannsthal, Kafka oder Rilke entfiel völlig, auch die Hoheit des Reitens kam nicht in Betracht: Odin auf Sleipnir, Mohammed auf Al-Barak, Alexander der Große auf Bukephalos, der reitende Papst, Recke, Ritter oder Iwanuschka-Dummkopf auf Siwka-Burka.
Stattdessen:
Mit ihren Nüstern blasen sie im Schreiten
Vom Gras hinweg den goldenen Staub der Zeiten.
Über den Hügel hin zur blauen Bucht
Geht flatternd ihrer schwarzen Mähnen Flucht.
Ihr Antlitz schwankt im stillen Wasserspiegel,
Vom Mond gehascht mit silberblankem Zügel.
Und:
Im Wacholderdickicht, das vom Ufer schaut,
Herbst, der stille Rotfuchs, seine Mähne kraut.
Und:
Mond, das Füllen, Mond der Fuchs,
Spannte sich vor unsern Schlitten.
Und:
Felder, Ebnen, ruft ihr? Wen?
SolIts ein Traum sein, hell und heiter?
Trabt da, blaue Reiterei,
Korn vorbei an Wald und Weiler?
Nichts da, Korn! Frost kommt geritten.
Aufgebrochen Tür und Tor.
Und:
Und trifft er Droschkenkutscher auf dem Platz,
wenn dann Erinnerung ihm den Mistgeruch der
heimatlichen Felder braut,
ist er bereit, jeglichen Pferdes Schwanz
zu tragen wie die Schleppe einer Braut.
Bis zu:
Ja, blutrotes Traumpferd, erscheine!
Statt Reiterpoesie und Hoheit des Reitens also in ihrer Feinheit und ihrem Verderben die Kreatürlichkeit der Pferde: Geruch, Atem, Schnauben, die schäumenden Mäuler, Mähne, Beben, Blick und Ohrenspiel. Das Pferd als Windsbraut, Elementarkraft, Schicksal.
Die russischen Dichter der Moderne des 20. Jahrhunderts ritten – Alexander Blok, Michail Kusmin, Maximilian Woloschin, Sergej Tretjakow, Isaak Babel. Marina Zwetajewa träumte sich immerhin als Amazone. Aber Jessenin war auf Pferden großgeworden und Majakowski hatte ihn einmal bissig einen Pferdenarren, ja stutenphil genannt. In einer von Jessenins Autobiographien lesen wir: „Als ich dreieinhalb Jahre alt war, hoben sie mich auf ein ungesatteltes Pferd und setzten es unvermittelt in Galopp. Ich erinnere mich, ich war halb von Sinnen und klammerte mich an der Mähne fest.“
Pawel Florenski, der Philosoph der russischen Moderne, der selber ritt, hat die überwältigende, die nach Vereinigung verlangende Empfindung für das Leiblich-Geschmeidige der kreatürlichen Formen, für ihre elastische Gestrecktheit in seinen Kindheitserinnerungen beschrieben: „Ach, warum bin ich nicht diese Form … Wenn ich die Oberfläche, die einen Körper begrenzt, als die natürliche Oberfläche des Gleichgewichts der elastischen Kräfte des gesamten Organismus empfand, wenn ich mit meinem inneren Blick sah, wie diese elastische Oberfläche von den inneren Kräften herausgewölbt wird und sie, mit meinen heutigen Worten gesagt, ihre Aufgabe mit einem Minimum an Aufwand löst, dann schwoll dem in mir so etwas wie eine Erwiderung entgegen und ich empfand sie als meine Oberfläche und mich als ihren Inhalt.“
Das Pferd wird es gewesen sein, über das Jessenin mit Isaak Babel, dem großen Pferdeschilderer, der nach seiner „Reiterarmee“ einen Pferderoman erträumte, des längeren sprach, als die beiden das Reich der Literatur untereinander aufteilten: „Nimm du die Krone der Prosa“, so Jessenin zu Babel, „mir gehört die der Poesie.“ Und noch Paul Celan muß des Jesseninschen Pferde-Mythos gedacht haben, als er vom russischen Fluß Oka sprechend, an dem Jessenins Heimat – Rjasan – liegt, sein Übersetzen als Reiten beschrieb:
(Kyrillisches, Freunde, auch das
ritt ich über die Seine,
ritts übern Rhein.)
Ganz zu schweigen von Lothar Sells Titelbild mit dem Traumpferd zum Poesiealbum 60 „Sergej Jessenin“ von 1972.
Im Spiel mit den Pferdenamen wie in der Universalisierung des Bildes vom Pferd war bei allem Übermut zweifellos ein Echo uralten Wissens zu vernehmen. In seinem Poetik-Essay „Marienschlüssel“ spricht Jessenin von den drei Stufen seiner Bildauffassung:
Auf der ersten Stufe der Vergleich oder die Taufe des Entfernten auf Namen des Vertrauten: Die Sonne – Rad, Kalb, Pferd, Hase. Die Wolken – Tannen, Schiffe, Schwalben. Der Regen – Pfeile, Saat, Perlen, Fäden.
Auf der zweiten Stufe werde das Bild in Bewegung gesetzt. Jessenin verweist, um das zu erklären, auf die Liebesdichtung des Hohenliedes, Kapitel 4, Vers 2: „Deine Zähne sind wie die Herde mit beschnittener Wolle…“
Von dieser zweiten Stufe gelange man zu einer dritten, wenn die Zähne der Geliebten als Ziegen von den Bergen Gileads sprängen. Auf Bildern dieser Art seien fast alle Mythen aufgebaut. Beispiele fänden sich in den großen Dichtungen der Völker – in der Ilias, der Edda, in den Veden, im Igor-Lied.
So heißt es im Pferde-Kapitel der altindischen Veden: „Der Kopf jenes Pferdes ist der frühe Morgen, sein Auge ist die Sonne, sein Athem ist der Wind, sein geöffneter Mund ist das Feuer, d. i. die Naturwärme, welche in der ganzen Welt ist; sein Körper ist das volle Jahr, sein Rücken das Paradies, sein Leib ist die Atmosphäre, sein Huf diese Erde, seine Seiten der Raum, die Knochen der Seiten (die Rippen) sind die Winkel des Raumes, die übrigen Glieder die Jahreszeiten ... seine Adern sind die Meere, Leber und Nieren die Gebirge, seine Haare die Pflanzen, seine Mähne die Bäume... sein Gähnen ist das Zucken des Blitzes, sein Schäumen ist das Krachen des Donners, sein Harn ist der Regen, sein Wiehern die Sprache...“
Das Verderben dieser lebendigen Verbindung von Vertrautem und Entferntem, von Mikrokosmos und Makrokosmos hat Jessenin schon ein Jahr nach der Anrufung des Traumpferdes im „Pantokrator“ 1919 zu Tode getroffen.
Im August 1920 schreibt Jessenin von einer Kaukasus-Reise an eine Bekannte in Charkow: „Verdammt unbehaglich und öde auf dem Planeten. Freilich, das Lebendige kann noch Sprünge machen, vom Pferd auf den Zug etwa, aber das ist nur Beschleunigung oder Anmaßung. Andeutungsweise ist das seit langem und weit genauer bekannt. Mich faßt Trauer um das vergehende Sanfte, Häusliche, Kreatürliche und um die unerschütterliche Macht des Toten, Mechanischen. Ein anschauliches Beispiel. Wir fahren von Tichorezk nach Pjatigorsk, plötzlich Schreie, wir sehen aus dem Fenster, was war los? Neben der Lokomotive her galoppiert aus Leibeskräften ein kleines Fohlen. Galoppiert so wild, daß klar war, es hat sich in den Kopf gesetzt, sie zu überholen. Es galoppierte lange neben uns her, bis es schließlich ermattet auf einer Station eingefangen wurde. Bedeutungslos die Episode für manchen, mir sagt sie viel. Die Reiterei aus Stahl hat das lebendige Pferd besiegt ... Verzeihen Sie nochmals, meine Liebe, daß ich Sie damit belästige. Es bedrückt mich sehr jetzt, daß die Geschichte eine schwere Epoche erlebt, in der die Persönlichkeit als das Lebendige abgetötet wird, denn der Sozialismus ist gar nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe, sondern etwas Abgegrenztes und Zweckhaftes, wie die Insel Helena, ohne Ruhm und ohne Träume. Zu eng für die Lebendigen, zu eng für den, der die Brücke baut in die unsichtbare Welt... immer wird es traurig stimmen, in einem neu erbauten Haus niemanden wohnen, in einem neugezimmerten Kahn keinen fahren zu sehen.“
Lokomotiven gilts!, für Tonnen Pferdefleischs zu kaufen;
eine einzige für Tausende von Pud der Haut!
hieß es kurz darauf im Gedicht.
Der Dichter hat sich von diesem Schock nie wieder erholt. Ein langer Abschied beginnt. Er wird noch zweimal heiraten, eine weltberühmte Tänzerin und die Enkelin Lew Tolstois. Mit der Tänzerin Isadora Duncan reist er in die Welt – nach Deutschland, Italien, Frankreich und in die USA. Zurückgekehrt, wird er die Welt im Moskau der Kneipen finden. Er wird von den Bolschewiki umworben werden, Lew Trotzki für den idealen, vollendeten Typ Mensch halten. Und wie er sich als Prophet, Apokalyptiker und Rowdy verstand, wird er sich nun verstehen als Segel am Schiff der Zeit, als Bohrturmenthusiast, als Student von Marx, Passagier auf Lenins Schiff, endlich, gespiegelt, als Mann in Schwarz. Doch dem „Abgegrenzten und Zweckhaften“, dem Angriff auf den Traum, ist nicht zu entgehen. Im Dezember 1925 gibt Jessenin auf.
Ilja Ehrenburg hat diesen Abschied eine Ekstase des Verlustes jenseits von Geschichte und Ethnographie genannt.
Es gibt eine kaum beachtete Schilderung des von Jessenin beklagten Zustands aus schwedischer Hand, die „Wirklichkeit zum Sterben“ heißt, verfaßt von Harry Martinson, dem Schiffsheizer und späteren Nobelpreisträger. Als junger Mann war er Ende der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts auf Jessenins Gedichte in der schwedischen Anthologie „Gesänge in Rot und Schwarz“ gestoßen und hatte sich – ein Foto Jessenins entdeckend – mit Betroffenheit in ihm erkannt: „Ich erinnere mich, daß ich erschrocken sein Bildnis in einer Zeitschrift sah – das war mein Porträt.“ Da mochte zunächst Physiognomie und Statur gemeint sein, aber da war mehr: Gemüt und Vision. Freunde haben ihn Jessenins Gedichte sprechen hören. Keine zehn Jahre nach Jessenins Tod erlebte Harry Martinson in Moskau gleichsam die Exekution des Jesseninschen Traumpferds: 1934 anläßlich des ersten Sowjetischen Schriftstellerkongresses, auf dem seine Favoriten – neben Sergej Jessenin Wladimir Majakowski – fehlten. Er nennt das Erlebnis den „Terror des Konkreten“, eine „Wirklichkeit zum Sterben“ – einen „ultramaterialistischen Weihnachtsabend“.
„Der Kongreß war zu einer Riesenflugparade eingeladen... Der Verkehr zwischen Stadt und Flugfeld hatte so gewaltige Ausmaße, daß er aus der Luft dirigiert werden mußte, von einem Fesselballon aus. An diesem in 200 Meter Höhe befindlichen Ballon hing in einem riesigen Rahmen Stalins Porträt ... Mengen von unglaublich geschickten Fliegern kamen mit ihren Flugzeugen aus dem Steppenraum herangedonnert, vollführten ihre Rollen, ihre Loopings, ihre ohren-betäubenden Anläufe ... Hoch über ihnen schwebte das Riesenpropagandaflugzeug ‚Maxim Gorki‘ am Himmel, eine Zeitungsdruckerei an Bord ... Die ‚Maxim Gorki’ spie 50 Fallschirmjäger aus ... Hier war man nun dabei, wie es moderne, von der Ultratechnik frisch erlöste russische Bauern vom Himmel regnete. Es regnete lange und es regnete große Mengen. Man begnügte sich nicht damit, Menschen herabzuschleudern. Man schleuderte Kälber herab und Schafe, schreckerfüllte Hunde und Katzen, alle an Fallschirmen hängend und in die begeisterte Million am Boden hineinschießend. Durch die den Luftraum füllenden herabschwebenden Tiere und Menschen ließ man einen Käfig mit Hühnern herunter und gleich danach eine Jazzkapelle, deren Mitglieder, nahe beieinander schwebend und fallend, jaulten, ihre Trommeln bearbeiteten und die Becken aneinanderschlugen. Die Luft war wahrhaft erobert ... Mehrere von Ballons getragene Stalinporträts hingen zwischen der Jazzkapelle und den Hühnern und starrten allergnädigst herab auf die konkret selige Million unten. Weh dem, der träumt und meditiert, wenn die Produktionsraserei über die Erde hingeht.“
Eine schwere Epoche hatte Jessenin die anbrechende Zeit im Brief von 1920 genannt – unsicher, ob sie je vorübergehen würde. Noch im gleichen Jahr schrieb er eine dramatische Dichtung, die den russischen Bauernrebellen Jemeljan Pugatschow zum Helden hatte. Im Untergang dieses kühnen Gegners der Zarin Katharina II. sah der Dichter sich selber untergehen: „Wo denn? Wo bist du, einstige Macht?“, so die Schlußverse des „Pugatschow“:
Aufstehn willst du, und bewegst nicht die Hand.
Jugend, Jugend! Wie eine Mainacht
verklungen bist du wie der Faulbaum am Steppenrand.
Da schwimmt, schwimmt übern Don das nächtliche Blau,
weich zieht Brandgeruch aus den dürren Gehölzen davon.
Goldenen Kalk überm niedrigen Haus
sprüht der weite und warme Mond.
Irgendwo eines Hahns unwilliges heiseres Krähen,
in die zerrissenen Nüstern niest staubig der Weg.
Und weiter, weiter, die verschlafene Wiese schreckend
läuft das Glöckchen, bis es zerspringt hinterm Berg.
Gott, mein Gott!
Ist es wirklich schon Zeit?
Kann, wie unter einer Last, man unter der Seele fallen?
Dabei schien es ... schien es noch gestern ... weit...
Ihr meine lieben ... guten ... alle...
Deutsch von Rainer Kirsch
Jessenin hat die Dichtung viele Male mit großem Einsatz vorgetragen. Eine Aufführung unter Wsewolod Meyerhold kam nicht zustande. Erst am Taganka-Theater unter Juri Ljubimow mit Wladimir Wyssozki, dem großen Moskauer Schauspieler und Sänger, war Anfang der 1970er Jahre eine hinreißende Inszenierung zu sehen.
Beobachter im Osten wie im Westen haben das schaudernde Entzücken beschrieben, das Jessenins Vortrag seines „Pugatschow“ hervorrief. Im Westen etwa Franz Hellens, der Jessenin als einer der ersten ins Französische übersetzte. 1927 schilderte er die Verwandlung des eleganten, schlanken, rassigen, ja aristokratisch wirkenden Jünglings in seinen „Pugatschow“.
Hellens hatte eines Abends in Paris aus seiner Nachdichtung „Pugatschows“ gelesen, als Isadora Duncan sich an Jessenin wandte und ihn bat, die Dichtung russisch vorzutragen: „Schamrot“, so Hellens, „wurde ich, als ich hörte und sah, wie er liest! Und ich hatte gewagt, seine Poesie zu berühren! Bald tobte das wie ein Sturm, bald säuselte es wie junges Laub am Morgen. Es war die Offenbarung der tiefsten Gründe seines poetischen Vermögens. Nie zuvor hatte ich eine so vollkommene Vereinigung der Dichtung mit ihrem Schöpfer erlebt. Diese Deklamation gab seinen Stil in der ganzen Fülle wieder: er sang seine Verse, er verkündigte sie, er spie sie aus, er brüllte und er schnurrte mit der Kraft und der Grazie eines Tieres, und der Zuhörer war betroffen und verzaubert.“
Einer dieser Jesseninschen Vorträge ist seinerzeit aufgenommen worden und zwar die Verse, die ein Ankömmling im Lager Pugatschows spricht, der – ein Sträfling – von den Regierungstruppen freigelassen wurde, um Pugatschows Stellungen auszuspionieren, sich aber dem geheimnisvollen Rebellen nun anschließen will.
Führt mich! Führt mich hin vor ihn!
Sehn will ich, sehn will ich diesen Menschen.
Heute klingt es wie ein Appell, vielleicht weniger Pugatschow als vielmehr, Jessenin zu sehen.